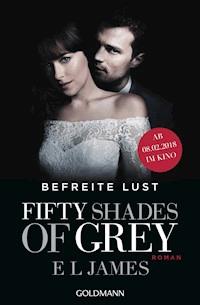Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LUST
- Kategorie: Erotik
- Serie: Intim-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Luft in der Kneipe ist von Tabakqualm und Biergeruch dick, ein Lied lässt ein Mann an seinen ersten sexuellen Erlebnissen zurückdenken. Er erzählt in aller Details von seinen leidenschaftlichen Erfahrungen. Nach fast vierzig Jahren, sieht er noch die zierliche, nackte Gestalt deutlich vor Augen und erinnere sich an den unreifen Schoß des kleinen Mädchens mit seinen vollen Wülsten. Zur gleichen Zeit entdeckt er die Selbstbefriedigung und zwar einen Nachmittag in der Badewanne wo er sich warmes Wasser auf den Bauch plätschern ließ. Sofort durchströmten nie erlebte Wonnen seinen Körper-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Hochweiler
Silberne Zeit
Saga
Silberne ZeitCopyright © 1990, 2019 Peter HochweilerAll rights reservedISBN: 9788711717592
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit dem Verlag gestattet.
All meine Sehnsucht
Mündet nun in diese Nacht.
Aber der Morgen spült schon heran,
Zu umsäumen das Wunder der Liebe
Mit silberner Zeit
You are always in my mind
Die Luft in der Kneipe ist geschwängert von Tabakqualm und Biergeruch zum Zerschneiden. Dazu dringt ohrenbetäubender Krach aus der Lautsprecherbox. Über dem Tresen, an dem ich sitze, kämpfen ein paar gelbe und rote Lampen gegen den Dunst an und versuchen vergebens, so etwas wie Atmosphäre zu schaffen. Um mich stehen und sitzen junge Leute, so um die zwanzig. Sie gestikulieren laut, lachen, reißen Witze, mich aber würdigen sie keines Blickes, sie nehmen mich überhaupt nicht wahr, obwohl ich fast jeden Abend um die gleiche Zeit hier erscheine, zwei, drei Biere austrinke und verschwinde. Der Schlummertrunk in der Kneipe ist für mich schon fast zum Ritual geworden. Midlife-crisis heißt das wohl, wenn man älter geworden ist, erkennt, daß die Sonne des Lebens bereits in den Rücken zu scheinen beginnt, die Jugend der anderen einem das eigene Alter bewußt macht. Doch fühle ich mich keineswegs in einer Krise begriffen. Im Gegenteil, eigentlich liebe ich diese Stimmung, die Einsamkeit in der Menge, ich bin nicht allein, und doch für mich.
„You are always in my mind“, schreit diese schrille, junge Frauenstimme aus dem Lautsprecher. Mindestens ein dutzendmal wiederholt sie den Satz, unermüdlich, wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Doch er wird dadurch nicht geistreicher. Sprachlosigkeit kompensiert durch Lautstärke. „You are always in my mind.“
Wen habe ich eigentlich im Sinn? Nicht eine, viele! Wie auf einem Laufsteg ziehen sie in meinen Gedanken einzeln vor mir auf, halten einen Augenblick inne, eine Momentaufnahme, grell wie von einem Blitzlicht angestrahlt, das den Schatten, in dem sie gleich wieder verschwinden, nur um so dunkler wirken läßt. Mädchen und Frauen, die ich geliebt habe, von denen ich geliebt wurde, die ich enttäuscht habe, von denen ich enttäuscht wurde. Inge, die mich die Liebe gelehrt hat, und Noriko, die mich in Japan sitzenließ, Marion, die meine Eifersucht anstachelte, und Yuri, deren Eifersucht mich verfolgte, Elke, die mir die kalte Schulter zeigte, und Mari, deren Zuneigung ich nur halb erwiderte, Bärbel, die mich mit Haut und Haaren besitzen wollte, und Sabine, die keine Gegenforderung stellte. Erinnerungen werden wach, versinken wieder, Ereignisse werden lebendig und purzeln durcheinander.
„Bring Ordnung in deine Frauengeschichten“, hatte einmal Sabine gelacht, als ich sie versehentlich mit dem verkehrten Vornamen ansprach. Ich will es im folgenden versuchen.
Der kleine Unterschied
Acht Jahre war ich, als mir „der kleine Unterschied“ allmählich bewußt wurde. Den Gassenhauer der Spielkameraden „Angelina ist modern, sie hat ’ne Pflaume ohne Kern“, hatte ich bis dahin kräftig mitgegröhlt, ohne den Hintersinn zu verstehen. Durch Zufall war mir aufgegangen, daß Mädchen zum Pinkeln eine Spalte besaßen, wogegen Jungens – viel praktischer – durch ein Röhrchen „zielen“ konnten. Was eine „Pflaume ohne Kern“ bedeutet, ist mir erst viel später klar geworden.
Das Wort Penis erfuhr ich erst mit vierzehn Jahren. Es ging mir ähnlich, wie wohl den meisten Kindern. Den kleinen Unterschied hatte ich schon bemerkt, ihn aber hingenommen, ohne mir Gedanken darüber zu machen. Auch daß Frauen Brüste hatten, Männer nicht, ist mir erst später aufgefallen. Besitzen kleine Mädchen auch Brüste? Wieso hatte ich das noch nicht bemerkt? Fragen, die mich eines Tages beschäftigten.
Es war Sommer, viele Kinder, Jungen wie Mädchen, liefen mit bloßem Oberkörper herum, schon weil Kleidung in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg knapp war. Ich wollte es genau wissen, und eines Tages beobachtete ich aus den Augenwinkeln heraus Doris, eine Klassenkameradin, die im Konsum neben mir vor dem Ladentisch stand. Ich sah, daß ihre Brust genauso eben war wie die meine. Also, zog ich messerscharf den Schluß, Brüste wachsen den Mädchen erst später.
Kein sichtbarer Unterschied also, wenigstens was die Brust bei gleichaltrigen Mädchen betraf. Trotzdem spürte ich, daß sie irgendwie anders waren. Puppenwagen statt Flitzbogen genügten mir nicht als Erklärung.
Ich hatte mit sechs Jahren den Torso einer Puppe gefunden, dem auf mein inständiges Bitten hin neue Arme und Beine angenäht worden waren. Ich liebte diese Puppe und konnte nicht verstehen, daß man mich auslachte, als ich damit spielen wollte. Die Erklärung Katharinas, meiner älteren Schwester, ein Junge tue sowas nicht, befriedigte mich nicht. Nur um dem Spott der anderen Kinder – und auch der Erwachsenen – zu entgehen, verzichtete ich schließlich aufs Puppenspielen.
Unterdessen war es Herbst geworden, Apfelernte. Seit drei Jahren bewohnten wir die notdürftige Kellerwohnung unter der Bühne eines Tanzsaales. Wer wollte schon eine alleinstehende Frau mit fünf Kindern aufnehmen, die aus Schlesien hatte fliehen müssen? Der Vater war im Krieg geblieben. Ich begann, mich für Eva, die Tochter unseres Hauswirts, zu interessieren, die damals gerade sechs gewesen sein muß. Wir spielten häufig miteinander. Eines Nachmittags geschah es. Wir hatten uns hinter der Musikantentribüne versteckt, die den geräumigen Hof der Gastwirtschaft abschloß. Unvermittelt stellte Eva sich vor mich, zog ihren Schlüpfer bis zu den Knöcheln herab und hob ihr Kleidchen bis unters Kinn. Noch heute, nach fast vierzig Jahren, sehe ich die zierliche, nackte Gestalt deutlich vor Augen, erinnere mich an den unreifen Schoß des kleinen Mädchens mit seinen vollen Wülsten. Ich machte es ihr nach, ließ meine Hose fallen und zog die Unterhose ebenfalls bis zum Boden herab. Ich nahm mein Glied in die Hand, dessen Vorhaut nicht nur die Eichel gänzlich bedeckte, sondern sogar darüber hinaus ragte. Wir sprachen kein Wort und wußten auch wohl beide nicht, warum wir das taten. Eva streckte mir den Bauch entgegen, und kreisend fuhr ich mit meinem kleinen Glied darüber, drückte es an ihren Nabel und stupste damit ihre Spalte. Dabei lächelte Eva glücklich und sah mich mit großen, leuchtenden Augen an.
Dieses Spiel haben wir öfters wiederholt. Eines Tages, während wir uns wieder mal gegenüberstanden und ich mit meinem Glied über ihren Bauch strich, fühlte Eva plötzlich, wie es in ihr zu rumoren begann. Sie hatte sich durch Obst den Magen verdorben. Kurzerhand hockte sie sich hin und verrichtete vor meinen Augen ein großes Geschäft. Fasziniert schaute ich zu, wie aus ihrer Spalte anschließend ein heller Strahl hervorsprudelte und glitzernde Tropfen an den Grashalmen hängenblieben.
Lange erfreuten wir uns der geheimen Zusammenkünfte nicht. Meine Mutter war stutzig geworden, weil wir so häufig hinter der Tribüne verschwanden, um nach einiger Zeit einträchtig händchenhaltend wieder hervorzukommen. Eva und ich standen uns eines Tages wieder gegenüber, und mein Glied berührte ihren Bauch, als plötzlich, wütend mit der Rute fuchtelnd, meine Mutter herbeigerannt kam. Es ging sehr schnell, sie packte mich am Arm, zerrte mich von dem Mädchen weg und versetzte mir ein paar Streiche auf den bloßen Hintern.
Die Hiebe spürte ich kaum, weit schmerzhafter war die Scham, ertappt worden zu sein. Ich lief weg, verkroch mich, und es kostete große Überwindung, abends bei Tisch zu erscheinen. Um so mehr war ich erstaunt, daß während des Abendessens und auch später kein Wort über das Ereignis vom Nachmittag fiel. Eva und ich aber wagten kein Stelldichein mehr hinter der Musikantentribüne.
Zwei Jahre später zogen wir um, und ich verlor Eva aus den Augen. Ich besuchte in Westdeutschland eine katholische Missionsschule. Damit waren Mädchen für sechs lange Jahre absolutes Tabu. Alles, was irgendwie an Sexualität erinnerte, wurde von Seiten der geistlichen Lehrer rigoros unterdrückt. Wer beispielsweise im Besitz einer Illustrierten mit Bildern nackter Mädchen ertappt wurde, riskierte entlassen zu werden.
In den Ferien fand ich in einer Illustrierten beim Friseur eine alberne Geschichte, die monatelang meine Phantasie beschäftigte: „Wer zieht zuerst die Braut aus?“ Beim Spiel in einem Nachtlokal ging es darum, als erster eine junge Frau aus den Brautkleidern zu schälen, bis sie in Slip und Büstenhalter dastand. Ich sehe noch die Pose vor mir, wie das Mädchen auf dem Foto lächelnd geschehen ließ, daß ein Mann vor ihr kniete und sie aus den Kleidern pellte. Nach den Ferien ins Internat zurückgekehrt, überkam mich jedesmal ein eigentümlich sehnsuchtsvolles Gefühl, wenn dieses Bild mir im Bett vor dem Einschlafen unwillkürlich vor Augen stand.
Drei Jahre lang machten die politischen Verhältnisse es mir unmöglich, auch nur einmal nach Hause zurückzukehren. Die Schulferien verbrachte ich zuerst bei einer Tante, die in der Nähe wohnte und später in einem Heim der Missionsschule. Der Eiserne Vorhang schottete Ostdeutschland von der Bundesrepublik ab. Interzonenpässe waren praktisch nicht zu bekommen. Doch nach dem Aufstand am 17. Juni 1953 wurde die Grenze durchlässig. Von da ab konnte ich zweimal jährlich in den Ferien nach Hause fahren, bis meine Mutter nach Westdeutschland ziehen durfte.
Mit vierzehn erlebte ich in den großen Ferien daheim zum ersten Mal den bittersüßen Schmerz heimlicher Liebe. Karin, so hieß das Mädchen, wurde für zwei Jahre mein Idol. Ich träumte, wir seien verheiratet, hätten Kinder und führten ein glückliches Leben. Dabei hat sie nie gemerkt, was ich für sie empfand, ich war zu schüchtern, es ihr zu sagen.
Zur gleichen Zeit entdeckte ich die Selbstbefriedigung. Eines Nachmittags lag ich in der Badewanne und ließ mir warmes Wasser auf den Bauch plätschern. Unwillkürlich versteifte sich mein Glied, der Strahl traf die Eichel. Ich zog die Vorhaut zurück und hielt sie in den prickelnden Wasserstrahl. Sofort durchströmten nie erlebte Wonnen meinen Körper, nahmen zu an Intensität, bis plötzlich ein milchigweißer Strahl hervorschoß, am Penisschaft herablief und im Wasser ausflockte.
Seitdem onanierte ich fast jeden Abend im Schlafsaal, wenn die Mitschüler bereits schliefen. Dabei gaukelte die Phantasie mir Karin vor, wie sie vor mir stand und mich umfangen hielt.
Welche Liebesstellungen es gibt, wußte ich damals noch nicht. Ich hatte nur ganz verschwommene Vorstellungen davon, etwa daß die Liebenden sich gegenüberstehen und das Glied im Stehen in die Scheide einführen, bis ich – mittlerweile achtzehn – erotische Bilder mit Koitusdarstellungen zu Gesicht bekam. Nach dem Erguß suchten mich regelmäßig die gleichen Schuldgefühle heim. Ich hatte mich in einem Netz verfangen, aus dem ich mich nicht zu befreien vermochte, es sei denn, ich zerriß es.
Nach der Untersekunda verließ ich die Schule. Ich konnte es vor mir selber nicht mehr rechtfertigen, tagsüber den braven, keuschen Missionsschüler zu spielen, während ich mich spätabends vor dem Einschlafen regelmäßig meinen einsamen Phantasien hingab, voller Sehnsucht nach Ergänzung durch ein Mädchen.
Die Oberstufe absolvierte ich in einem weltlichen Gymnasium.
Liebe aus der Ferne
Die Jahre, die ich in der Missionsschule verbrachte, hatten mein Verhalten tief geprägt. In die Freiheit entlassen, wußte ich zunächst nichts damit anzufangen. Wie beneidete ich Mitschüler, die Freundinnen hatten!
In der Unterprima meinte ich, ein Mädchen gefunden zu haben, das meine Freundin werden könnte. Fast zwei Jahre lang liebte und verehrte ich sie, allerdings zunehmend aus der Ferne. Sie war meine Tanzstundendame gewesen und hieß Elke. Wie ich, wohnte auch sie nicht am Schulort, und so wartete ich häufig vor dem Lyzeum, um sie zum Bahnhof zu begleiten. Anfangs schien ihr das zu gefallen, jedenfalls ließ sie mich nicht spüren, daß mein Werben ihr unangenehm war. Aber nach und nach zeigte sie mir immer deutlicher die kalte Schulter. Ich traute mich nicht mehr, sie an der Schule abzuholen, ich wartete lieber an dem langen Bahnsteiggitter, ob sie vielleicht die Stufen der Eingangshalle heraufkäme. Ich wußte ja, wann ihr Zug abfuhr. Doch selten gelang es mir, sie zu treffen und wenigstens auf den Bahnsteig zu begleiten, denn genauso wie ich, sparte sie häufig das Fahrgeld und fuhr per Autostop nach Hause. Zum letzten Mal begegneten wir uns im Juni, drei Vierteljahre nach dem Abschlußball der Tanzstunde. Darüber hat sich ein Tagebucheintrag erhalten, den ich kurz danach aus der frischen Erinnerung niederschrieb.
„Als ich heute abend die Confessiones des Augustinus aufschlug, fand ich als Lesezeichen das Bild von unserem letzten Klassenabend. Auch Elke ist auf dem Foto zu sehen. Seltsam, daß ich noch immer an sie denken muß. Erst heute mittag sah ich sie aus der Ferne am Zug. Beide taten wir, als bemerkten wir uns nicht.
An das letzte Treffen mit ihr im Juni erinnere ich mich noch genau. Ich ging zu ihr auf den Bahnsteig. Am Gleis zwei wartete sie mit ihrer Freundin auf den gleichen Eilzug wie heute. Ich grüßte, sie nickte kaum. So stand ich da und wußte nicht, worüber ich sprechen sollte. Es war nur allgemeines Zeug, wie es in der Schule gehe und dergleichen. Elke schien mir gar nicht zuzuhören. Starr und uninteressiert blickte sie nur aufs Nachbargleis, wo der Eilzug für die Gegenrichtung wartete. Fast fühlte ich mich erleichtert, als endlich ihr Zug einfuhr. Ich kann mich noch erinnern, sie sagte nicht einmal auf Wiedersehen. Seitdem habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen.
Nach dem Abschlußball im November des vergangenen Jahres, als ich die ganze Nacht in der Stadt herumlief, weil ich Elke draußen am Auto verabschieden wollte und dabei den Freund verfehlte, bei dem ich übernachten sollte, meinte ihre Mutter noch, Elke und ich träfen sich ja noch oft. Nein, häufig ist es nicht gewesen. Als der Zug abfuhr, wußte ich bestimmt, daß ich mit Elke nie mehr sprechen würde. Es wäre unmöglich gewesen, aber ich muß immerzu an sie denken.“
Elke war die Tochter eines Dozenten. Für welches Fach, habe ich nie herausbekommen, sie spielte Geige und liebte die Kunst. Ich sah in ihr die Verkörperung des Kallos, des Schönheitsideals der Antike. Daß ich Elke verfallen war, mag zumeist an ihrer äußeren Erscheinung gelegen haben. Sie schien mir von jener grazilen Zerbrechlichkeit, die mein Schönheitsideal, Botticellis Venus, ebenfalls besaß. In Elke glaubte ich das Modell der Göttin, eine zweite Simonetta, zu erkennen. Boticellis Bild haftete als Frontispiz in meinem Tagebuch, lange bevor ich Elke kennenlernte.
Noch bis zum Abitur wartete ich weiter geduldig am Gitter des Kopfbahnhofes, um vielleicht zwanzig Meter weiter im Gewimmel heimlich und verstohlen Elkes Anblick zu erhaschen. Ich gab mir den Anschein, hier zufällig auf meinen Zug zu warten. Bei rechtem Licht betrachtet, hatte ich sogar Angst, sie zu sehen. Ihr Bild hatte ich ständig vor Augen, gleichgültig wo ich mich befand. Auf Elke war ich so fixiert, daß für mich kein anderes Mädchen existierte. Ich sehnte mich nach einer fruendlichen Geste von ihr, nach einem Wort, nach ihrer Zärtlichkeit. Wenn ich mich abends vor dem Einschlafen einsam mit der Hand befriedigte, gaukelte mir die Phantasie ihr Bild vor. Dabei hatte ich gar nicht den Wunsch, sie möge sich mir öffnen. Ich wollte nicht in sie eindringen. Wenn ich mir sie manchmal nackt vorstellte, dann in der Pose Simonettas, die glatte Scham und ihre Äpfelchen züchtig mit der Hand bedeckend.
In aller Regel hatte ich nur ihr Gesicht vor Augen, ein unendlich zartes, liebliches, beseeltes Gesicht das mich vor purpurnem Hintergrund mit freundlichen, mitleidsvollen Augen ansah. Wenn ich mich nach dem Erguß voller Schuldkomplexe müde zur Seite drehte, stellte ich mir vor, Elke läge nackt neben mir und hielte mich eng umschlungen. Mein Arm umfing dann ihren Nacken, und eine Hand umspannte eine ihrer Brüste. Im Grunde hatte ich Angst vor der Umwelt, die mich zu bedrohen schien, Angst vor der Schule, Angst auch vor meiner Mutter, die recht herb und streng war. Was ich ersehnte, waren Sicherheit, Geborgenheit und Liebe. Wie herrlich wäre es gewesen, wenn Elke mir etwas davon geschenkt hätte. Sie hat mich enttäuscht.
Angst vor der Frau
„... und hiermit entlasse ich euch ins Leben. Geht glücklich euren Weg und vergeßt euer altes Gymnasium nicht.“
Seine Stimme zitterte vor Rührung, während der Direktor die letzten Sätze der Abiturrede sprach. Ins Leben entlassen, was bedeutete das? Als Hilfsarbeiter in einer Fabrik arbeiten? Geld verdienen fürs erste Semester? Schönes Leben!
Zwei Tage später stand ich in einem zerschlissenen, grauen Arbeitsmantel hinter einer Sägemaschine. Meine Aufgabe bestand darin, Holzklötzchen, welche die Maschine unablässig in einen flachen Kasten spie, gleichmäßig zu verteilen. „Praxen“ nannte man das. Welcher etymologischen Wurzel das Wort entstammt, habe ich nie ergründen können. Aber was es bedeutete, blieb mir nicht lange verborgen. Schon bald hatten die ständig herabfallenden Holzstücke den Handrücken aufgerissen, die Haut rauh wie ein Reibeisen werden lassen. Wenn der Kasten bis zum Rand gefüllt war, hatte ich ihn in die Trockenkammer zu bringen. Dazu kam das ohrenbetäubende Kreischen von vierzig Kreissägen, auf denen die Bretter roh zugeschnitten wurden, sowie der feine Staub des Sägemehls, der die Luft erfüllte, auf der schwitzenden Haut festklebte und juckte.
Einen Lichtblick brachten die Betriebsferien. In diesen zwei Wochen ruhte die Produktion, und ich wurde zu Putz- und Aufräumarbeiten eingeteilt. Während ich auf einer Leiter stehend versuchte, ein blindes Fabrikfenster mit Wasser, Seife und Schwamm wieder durchsichtig zu machen, kam ein Mädchen aus der Verwaltung quer über den Hof. Unter meiner Leiter blieb sie stehen.
„Sie sollen zur Geschäftsleitung kommen.“
„Was ich? Was soll ich da?“
„Weiß ich nicht, aber die Griechen sind gekommen.“
In dem getäfelten Zimmer residierte hinter einem respekteinflößenden, wuchtigen Schreibtisch Herr Preuss. Ein Mann Mitte fünfzig, tadellos gekleidet mit graumeliertem Haar. Er brauchte nicht körperlich zu arbeiten. Wie beneidete ich ihn in meinem abgerissenen Zustand!
„Sie können doch Griechisch?“
Woher hatte er erfahren, daß ich ein humanistisches Gymnasium besucht hatte?
„Heute sind die ersten griechischen Arbeiter eingetroffen, und Sie sollen in Zukunft übersetzen.“
Wußte der Mann, wovon er sprach? Genauso gut hätte ich Italiener auf Latein begrüßen können.
Aber ich lernte Neugriechisch. Bereits nach kurzer Zeit konnte ich mich mit den neuen Arbeitskollegen aus Saloniki, Athen und Korinth leidlich verständigen. Besonders mit einem schloß ich Freundschaft: Argyrios. Er stand neben mir an der zweiten Maschine, war etwa so alt wie ich, hatte braunes Haar und sah so gar nicht wie ein Grieche aus.
„Avrion den epergaziti“, morgen wird nicht gearbeitet, dozierte ich bereits zum x-ten Male, es war der Vortag von Mariahimmelfahrt, Argyrios nickte.
„Ich habe schon eine Freundin gefunden, eine Friseuse. Gestern abend habe ich mit ihr geschlafen.“
Wie um die Aussage zu bekräftigen, steckte Argyrios den Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger.
Ich sah ihn neidisch an.
„Hast du keine Freundin?“
„Nein.“
„Willst du auch einmal mit einer Frau schlafen?“
Ich nickte.
„Dann komm morgen mittag zu uns. Marita ist bereit.“ Argyrios zeichnete die Konturen des riesigen Busens und der breiten Hüften die mich erwarteten, in der Luft nach.
So einfach war das also. Der Gedanke, so schnell und unerwartet das erste Mal mit einer Frau zu schlafen, ließ mich den ganzen Tag nicht los. Während ich mechanisch die Holzklötzchen verteilte, den gefüllten Kasten wegtrug und einen neuen hinstellte, ließ ich die erotischen Bilder aus der antiken Literatur vor meinen Augen passieren, Longos, Apuleius und Ovid. Wie die lüsterne Lykainion sich geschickt unter den unschuldigen Daphnis geschoben hatte, so daß er von selber den lange gesuchten Pfad der Liebe fand; wie Photis als Venus pendulans mit Lucius gerungen hatte, indem sie rittlings auf ihm sitzend, ihren Rükken spielen ließ; wie Corinna endlich während der Mittagsschwüle Ovid im Dämmerlicht seines Gemachs erschienen war und er voller Lust die nackte Gestalt an sich preßte.
Trotzdem, je konkreter ich mir das morgige Erlebnis ausmalte, desto größere Angst ergriff mich. Angst vor der Frau, Angst vor ihrem Geschlecht, Angst vor der Vereinigung.
Am Abend nach der Arbeit lief ich unruhig und ziellos durch die Wiesen vor der Stadt. Zufällig begegnete ich Dagmar, der Freundin eines meiner Brüder. Sie war weit älter als ich, um die fünfundzwanzig. Instiktiv bemerkte sie meine Qualen und forschte nach der Ursache.
„Irgendwas stimmt nicht mit dir, hast du Probleme?“ Ich gab eine ausweichende Antwort. Daß eine Frau im Spiel war, schien sie zu ahnen, schließlich wurde ich in wenigen Monaten zwanzig. Um was es sich konkret handelte, wußte sie nicht, und ich konnte es ihr nicht sagen. Beiläufig brachte sie das Gespräch auf uneheliche Kinder.
„Abtreibung käme für mich nie in Frage“, sagte sie.
„Dann würde ich lieber den Krach mit den Eltern durchstehen, später findet sich immer ein Weg.“
Meinte Dagmar etwa, dies sei mein Problem?
Am nächsten Morgen, es versprach ein strahlend sonniger Tag zu werden, Kirchgang. „... et, virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Jesum Christum, Dominum nostrum ...“ sang der Pfarrer in der Präfation. „Und sie hat im ungeschwächten Glanz der Jungfräulichkeit das ewige Licht der Welt geboren, Jesus Christus, unseren Herrn ...“
Maria, die reine, die vollkommene, die unbefleckte, die makellose Jungfrau. Diese Gestalt hatte ich seit meiner Kindheit verehrt, und nie war mir bewußt geworden, wie fatal mich dieses Ideal geprägt hatte. Wenn sie rein gewesen ist, mußte Sexualität schmutzig sein; wenn sie vollkommen war, mußte die geschlechtliche Liebe etwas Unvollkommenes sein; wenn sie unbefleckt war, mußte die Vereinigung die Frau besudeln; wenn sie makellos war, mußte der sexuellen Handlung ein Makel anhaften. Entsagung war Tugend, Verlangen war Sünde. Ich fühlte mich als Sünder.
Trotz aller Skrupel ging ich nach dem Mittagessen zu den Griechen. Bei ihrer Unterkunft handelte es sich um eine stillgelegte Ziegelei in unmittelbarer Nachbarschaft der Fabrik. Hier waren im Erdgeschoß einige Räume provisorisch für sie eingerichtet worden. Auf Gartenstühlen und Kisten sitzend, aßen, lachten und gestikulierten die Männer. Schüchtern nahm ich auf einem klapprigen Stuhl Platz. Argyrios begrüßte mich und zeigte auf eine Gruppe von Frauen vor ihm, unter denen eine stämmige, kräftige Gestalt auffiel. Argyrios zeigte mit dem Finger auf sie: „Marita.“
Ein rundes, gutmütiges Gesicht strahlte mich an, ein Gesicht, das ihren Körperformen entsprach. Argyrios hatte nicht übertrieben, als er ihre Formen mit den Händen beschrieben hatte. Diese Frau schien gewohnt zuzupacken, gleichgültig, ob sie tagsüber die Abfälle aus der Fabrik oder nachts den sexuellen Notstand unter den Griechen zu beseitigen hatte. Nachdenken schien nicht ihre Stärke zu sein, eher schon Vorsicht.
Die Griechen steckten ihre Köpfe zusammen, tuschelten und lachten. Ich verstand kein einziges Wort. Dann eröffnete mir Argyrios, daß „Kapota“, Kondome fehlten und auch nicht zu beschaffen seien, da ja Feiertag war. Aus der Sache mit Marita würde es heute nichts, es wurde nie etwas daraus.
Ich muß zugeben, daß mir ein Stein vom Herzen fiel, als ich das hörte. Nicht allein wegen der Skrupel, die mich gepeinigt hatten, sondern auch wegen der äußeren Erscheinung dieser Arbeiterin.
Ein solches „erstes Mal“ hatte ich nicht gewollt.
Seit dem Erlebnis mit der Griechin wurde mir immer deutlicher bewußt, daß Elke für mich keine Person mehr war. Sie war zum Synonym für das liebende Mädchen schlechthin geworden. Ich meinte die weibliche Ergänzung, wenn ich mich allein und unbeobachtet fühlte, halblaut den Namen „Elke“ aussprach. Diese Gewohnheit steigerte sich fast zum Zwang, und ich erntete manch befremdeten Blick, wenn ich in Anwesenheit anderer die erste Silbe des Namens vor mich hinmurmelte, die zweite aber unterdrückte.
Elke war in weite Ferne gerückt, unnahbar, unerreichbar! Ich versuchte, mich mit Poesie zu trösten, lernte Gedichte auswendig. Besonders die Ballade vom Brennesselbusch des Börries von Münchhausen hatte es mir angetan, spiegelte sie doch meine innere Not. Vermittelt hatte mir dieses Gedicht Inge.
Das erste Mal
Wie alt mag Inge damals gewesen sein? Schwierig zu schätzen, aber anfangs dreißig war sie gewiß. Seit geraumer Zeit besuchte ich sie fast täglich in ihrer kleinen, gemütlichen Dachwohnung, wo sie allein lebte, um ein Glas Wein mit ihr zu trinken und mich mit ihr zu unterhalten. Bei Inge konnte ich mein Herz ausschütten, über meinen Ärger in der Fabrik sprechen, wo ich seit dem Abitur „Zeit arbeitete“. Sie hatte ein offenes Ohr für die Probleme des anstehenden Studiums und was einen neunzehnjährigen Jungen sonst noch bewegte. Ich hatte ihr auch von Elke und meiner unglücklichen, unerwiderten Liebe erzählt.
Eines Abends im Herbst war ich wieder bei Inge zu Gast. Die Kerze auf dem Tisch verbreitete ein warmes, anheimelndes Licht und ließ den Wein im Glas rubinrot funkeln. Aus dem Radio erklang dezente Musik. Inge saß mir gegenüber auf dem Sofa und zog nachdenklich an einer Zigarette.
„Was du brauchst, ist eine Freundin. – Ich wüßte eine für dich.“