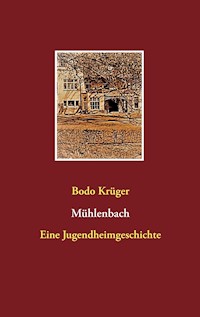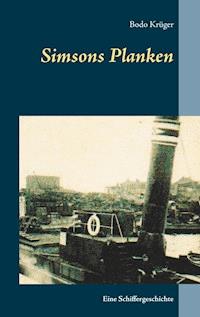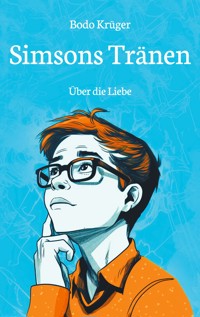
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Beim fünften Buch des Autors geht es um einen Generationenroman. Es sind Ergriffene, von denen er schreibt: Von der Liebe, der Musik, vom Wahn einer Sekte und schließlich von der Hoffnung auf Erlösung. Alles beginnt mit dem Tod Pastor Breslauers, dessen Hausstand vom Sohn aufgelöst werden soll. Und mit einem geheimnisvollen Koffer...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe ist stark wie der Tod (Altes Testament)
Inhalt
1.Teil Präludium
Das Haus Sartorius
Die Frau des Senators
Arnos Vermächtnis
Pastor Breslauers Bild von Anna
Die Besetzung der Kantorenstelle
Der Pastor und Anna
Ein entscheidender Brief
Der „große Knall“
Das Hin und Her der Gefühle
Anna und das Leben im Grünen
Wieder in Freiburg
Und nochmal ein Brief
Mutter und Tochter
Der Unfall
2.Teil Intermezzo
Gero und Ulrike
Zwei Herzen im Mai
Im Kurort
Die Ernüchterung
Ulrike und Frederik
Frederiks Darstellung der Geschichte von Anna und Arno
Der Weg am See entlang
Der Brief an Gero
Die Wohngemeinschaft
3.Teil Postludium
Geros Enttäuschung
Ulrikes Entscheidung
Das Ende hier, der Anfang dort
1.Teil
Präludium
Das Haus Sartorius
Der untersetzte Mann stand gedankenverloren am Fenster und blickte in den Garten, dessen Areal von uralten Eichen- und Buchenbäumen begrenzt wurde. Gero Breslauer-Cramer öffnete einen der gewaltigen Fensterflügel, was ein leichtes Geräusch verursachte und atmete die Luft in tiefen Zügen ein, die ihm durch den Nieselregen gereinigt und kostbar vorkam. So verweilte er einige Zeit. Dann machte er ein paar Schritte durch das, mit Teppichbrücken bedeckte Zimmer. Glasfensterbemalung und Deckenstuck verrieten hier die Tendenz zum Jugendstil. Der jüngere Mann ließ den Blick wohlwollend über die Bücherwand seines Vaters gleiten. Nahm lächelnd wahr, dass viele Druckerzeugnisse kaum sortiert, sondern wohl eher schnell abgelegt worden waren, wenn sie dem Hausherrn als Lesestoff ausgedient hatten. Auf der anderen Seite des Raumes, der unter den orientalischen Läufern einen gut in Schuss gehaltenen Holzfußboden sichtbar werden ließ, stand eine gewaltige dunkelbraune Schrankwand. Ihr gegenüber beanspruchte ein längeres Sideboard den Platz für sich. Dort stand eine Reihe von Fotos. Ein junges Paar in der Mode der 1970er-Jahre schien den Mittelpunkt dieser Erinnerungsgalerie zu bilden. Auf einigen Bildern tauchte immer wieder ein Kind auf. Erst als Baby auf dem Arm der Mutter. Mehr im Hintergrund stand der etwas reifer aussehende Mann vom Hochzeitsfoto. Dann erschien wieder das einstige Kind in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, bis da schließlich ein junger, etwas schüchtern wirkender Mann in die Kamera lächelte.
Gero Breslauer-Cramer schenkte dem letzten Foto einige Sekunden größere Beachtung. Dabei verzog er die Mundwinkel zu einem Grinsen. „Wie ich mich doch im Laufe der Jahre verändert habe.“ Vorsichtig strich er mit den Fingerspitzen beider Hände sein dünnes Haar zurück.
Über dem Sideboard hing ein fast gemäldeartiges großformatiges Foto im gediegen wirkenden Holzrahmen. Eine jüngere Frau mit dunklen hochgesteckten Haaren schaute den Betrachter mit einfühlsamen, aber schwermütigen Augen an. Eine stilvolle Brille verriet den modischen Geschmack der Dame, ebenso wie das Perlencollier. Sie trug eine dunkelblaue Robe, wohl zu einem festlichen Anlass. Geros Gesicht wurde beim Anblick seiner Mutter entspannter. Seine Augen suchten ihre gepflegten, kräftigen Hände, die er immer geliebt hatte. Die rechte Hand hatte Frieda Breslauer, geborene von Treuenfels, etwas angespannt. Die linke schien leicht über das Kleid zu streifen. „Sie war eine stattliche Frau, meine Mutter“, dachte Gero.
Nach dieser ihm guttuenden Begegnung mit der Mutter in ihren besten Jahren wandte er sich seinem Vater zu. Der war etwas kleiner als seine Frau. Auch er hatte in diesen Jahren noch die Ausstrahlung, die man brauchte, um von anderen als interessant und bei der Begegnung lohnend eingestuft zu werden. Dunkelblonde, etwas längere Haare, die gerade die Ohren bedeckten und im Kontrast dazu einen schwarzen Schnurr- und Backenbart. Lebendige und freundliche Augen. „Man kann sich gut vorstellen, dass Vater Menschen für sich einnehmen konnte.“ Gero lächelte in sich hinein. Der Pastor Arno Breslauer trug einen schwarzen, gut geschnittenen Anzug und hatte seine kleinen, aber kräftigen Hände in den Taschen seines Jacketts vergraben. Bis auf die Daumen, die er lässig herausschauen ließ. Der Sohn fand, dass er leider mehr die kleinen unauffälligen Hände seines Vaters geerbt hatte als die großen ausdrucksstarken der Mutter. „Aber die Natur verteilt eben, wie sie es möchte“, tröstete er sich.
Gegenüber dem Gartenfenster im ersten Stock gab ein ebenfalls nicht kleines Fenster zur Straße, das von außen her durch seinen kunstvoll geschweiften Rahmen dem Betrachtenden einen erbaulichen Blickfang bot, die Sicht auf andere ältere Gebäude der Nachbarschaft frei. Die alte Villa lag an einer halb ringförmigen Straße mit geschützten Baumbeständen im höher gelegenen Teil von Hamburg-Blankenese. Die alten, villenartigen Häuser befanden sich kaum noch im Besitz der früheren Eigentümer. Junge erfolgreiche Leute hatten sie entweder komplett gekauft oder wenigstens eine schmucke renovierte Wohneinheit.
Gero war vor einigen Tagen aus Freiburg zur Beerdigung seines alten Vaters angereist. Nun war alles vorüber. Es war nur eine kleine Trauerfeier. Verwandte und Freunde gab es kaum und die paar, die noch übrig waren, hatte Pastor Breslauer oftmals vor den Kopf gestoßen. Was sie ihm nicht vergessen hatten.
Sein einziger Sohn Gero hatte Urlaub genommen, um sich um die Hausstandauflösung des dem Vater überlassenen Hauses zu kümmern. Pastor Breslauer hatte hier seit seinem Ruhestand gelebt. Erst mit seiner Frau, dann noch einige Jahre allein. Der Sohn war nur schwer in der Lage, sich zeitlich länger als zwei Wochenenden freizunehmen. Seine Kantoren- und Organistenstelle in Freiburg ließ ihm kaum Zeit für private Angelegenheiten, obwohl es nur eine mittelgroße evangelische Kirche am Stadtrand war. Das lässt erstaunen, aber es ist verständlich, wenn man bedenkt, dass Gero sich oft an den Stars seines Berufsstandes maß und auch wie sie in der Woche mindestens ein oder mehrmals künstlerisch hochstehende Orgelkonzerte gab. Wer das nicht hinbekam, so befürchtete Gero Breslauer-Cramer, würde bald von den Kolleginnen und Kollegen, und natürlich früher oder später auch vom Publikum geschnitten werden. Und in solche Situation wollte sich der baldige Kirchenmusikdirektor auf keinen Fall bringen lassen.
Er hatte schon in früheren Jahren die Hausverwaltung immer wieder um eine Verlängerung des Nießbrauchrechts gebeten, das seinem Vater und natürlich auch seiner Mutter nur für fünf Jahre von der Frau Sartorius eingeräumt worden war. Dem wurde großzügiger Weise schon dreimal stattgegeben, weil der Pastor an einer schweren chronischen Krankheit litt und ein Umzug ihm unter solchen Umständen nicht zuzumuten war.
Auch wenn es für die Gebäudeverwaltung unwirtschaftlich war, so fühlten sie sich doch gegenüber der Frau Senatorin Sartorius verpflichtet. Die sich wiederum seinem Vater von ganzem Herzen zugetan und in der Schuld fühlte.
Der Grund dafür lag einige Zeit zurück. Senator Henning Sartorius litt viele Jahre an einer heimtückischen Erkrankung, die ihn immer mehr schwächte und hinfällig werden ließ. Am Ende würde unweigerlich der totale körperliche und geistige Verfall stehen. Dem langen Leiden würde unweigerlich der Tod ein Ende setzen. Wobei es außer Frage stehen würde, ob in der Regel die Angehörigen und vielleicht auch der Erkrankte selbst, wenn er noch über einen ausreichenden Teil seiner Kräfte verfügte, ihn schließlich als Erlösung begrüßen würden.
Die Frau des Senators
Aber wieso gebührt in dieser Angelegenheit dem Pastor Breslauer Dank, könnte man fragen? Wieso gerade ihm? Das hat was mit dem Ruf oder, wenn man so will, Nimbus dieses Geistlichen zu tun. Der sich während seiner Dienstjahre langsam, aber stetig über seine kleine Vorstadtgemeinde hinaus verbreitet hatte. Er war nämlich ein Spezialist für alles, was mit dem seelischen Umfeld des Todes zu tun hatte. So waren seine Sterbemeditationen weit bekannt. Und oft schon Wochen, ja Monate vorher ausgebucht. Sie liefen immer nach einem festen Ritual, der Vorstellung des eigenen Todes ab. Was sicher für die unvoreingenommenen Teilnehmenden fremd, vielleicht sogar frivol und verschreckend gewirkt haben musste. Doch die einfühlsame Persönlichkeit des Pastors und seine überdurchschnittliche Begabung, Menschen für eine Sache, die ihm am Herzen lag, zu öffnen und zu begeistern, ließen diese Meditationen fast zu einer unabdingbaren Voraussetzung für pflegende Angehörige und irgendwann einmal selbst vom Ableben Betroffene werden.
So hatte auch die Frau Sartorius vor Jahren, als die Krankheit mit ihren zunehmenden Verfallserscheinungen von ihrem Mann Besitz ergriff, von dieser Veranstaltung erfahren. Weil sie immer mehr darunter zu leiden begann, dass ihr Mann, der noch seiner Tätigkeit als Finanzsenator im Rathaus nachging, zusehends ernster und zugeknöpfter ihr gegenüber wurde. Sie machte sich ehefrauliche Sorgen um ihren Gatten, der ihr ja schon in jungen Jahren als Ehemann und Fleisch von ihrem Fleisch von Pastor Stahlmann aus Blankenese anvertraut worden war. Die Braut hatte dem jungen Sartorius, der aus einer alteingesessenen Hamburger Reederfamilie stammte, gern ihr Ja-Wort gegeben und ihm den wunderbar glänzenden goldenen Ehering über den schon etwas dicklich erscheinenden Ringfinger gestreift. Sie fand das jedenfalls besser, wie eventuell als alte Jungfer irgendwo auf der Couch bei ihrem hochkonservativen Bruder zu enden. Denn sie war als junge Frau politisch links und schätzte die außerparlamentarische Opposition. Das alles passte sehr zu dem flippigen aufgekratzten Mädchen, das sehr beliebt bei den Männern war. Dagegen war ihr Mann eher ruhig und in allem sehr besonnen, fast zu sehr, wenn man an manche nervigen Auseinandersetzungen dachte, die sie mit ihm in über fünfzig Ehejahren ausgefochten hatte. Denn er brauchte, um zu einer Entscheidung zu gelangen nach der Meinung seiner Frau mehr als ein Menschenleben. So musste er schon als junger Mann bei der Partnerinnenwahl immer wieder einen deftigen elterlichen Stupser einstecken, besonders von seiner Mutter, die ihn darauf hinwies, dass er mit Eva Mollendorf richtig liegen würde. Denn die wäre das lebendig machende Elixier für den etwas phlegmatischen und oft an Frauen uninteressierten Henning.
Das war damals, wo man sich gemeinsam als Paar um eine gute Zukunft mühte. Als nun der Verfall ihres Mannes einsetzte, lag die Goldene Hochzeit schon einige Jahre zurück. Und auch für Henning Sartorius ging es, wenn auch nur krankheitsbedingt, vorwärts in eine Zukunft, die eher an die Vergangenheit erinnerte, wo der Senator noch ein unmündiges Kind war. Und das war für die gestandene, willensstarke ältere Dame mehr als schmerzlich. Denn sie stand noch mitten im Leben und konnte sich nur bedingt vorstellen, dass es wohl Erkrankungen gibt, gegen die man mit Zusammenreißen und eisernen Willen nichts tun konnte. So suchte sie in dieser Zeit nach Beratung und Austausch und sicher auch nach Hilfe, wobei sie mit diesem Begriff ihre Schwierigkeiten hatte und lieber von Coaching sprach.
Deshalb suchte sie nach Wegen, sich in dieser Hinsicht fortzubilden. Damit sie innerlich gewappnet sein würde, wenn eines Tages die Wogen der Erkrankung ihres Mannes das eigene seelische Bollwerk mit seinen Brechern überfluten würde. Sie dachte gern in diesen norddeutschen Bildern vom Meer und von den Wellen. Mit einem Wort, sie kam schnell auf die Teilnehmerliste für das nächste Sterbeseminar in jener Vorstadt-Kirchengemeinde, in der Pastor Breslauer in diesen Jahren als Seelsorger tätig war. Aber die Voraussetzung für einen der begehrten Teilnehmerplätze war ein ausführliches Gespräch, in dem der Pastor ausloten wollte, ob der angemeldete, auf der Liste stehende Teilnehmende auch wirklich psychisch stabil genug und bereit war, die schließlich hilfreiche, aber zu Beginn noch zusätzliche Belastung der Vorstellung des eigenen Erkrankens und Sterbens auf sich zu nehmen. Auch über die Motivation und die eigenen Beweggründe sollte der Teilnehmende sich im Klaren sein, damit es nicht im Unterrichtsverlauf zu Enttäuschungen kommen würde. Frau Sartorius hatte alles, was sie in letzter Zeit mit ihrem Mann und dem Fortschreiten seiner Erkrankung bedrückte, vor dem Pastor ausgebreitet und danach ein sehr befreiendes Gefühl gespürt. Diese Erleichterung war so gewaltig, dass sie das Seminar, von dem sie sich zunächst nur so etwas wie eine neue Sicht auf das Leben versprochen hatte, plötzlich wie den Ort einer Erleuchtung empfand. Leider widerfuhr es ihr, dass sich die Krankheit ihres Mannes von den Erleuchtungs- und Glücksgefühlen nicht beeindrucken ließ, sondern bis zum Beginn der Veranstaltung sich so verschlechterte, dass die Frau Senator eigentlich gar nicht mehr daran teilnehmen konnte. Obwohl man Geld genug gehabt hätte, eine spezielle Pflegekraft für den Senator einzustellen, war seine Ehefrau nicht dazu in der Lage, die Pflege und Begleitung ihres Ehegefährten anderen Händen zu überlassen. Da nun der Sterbespezialist Pastor Breslauer in dieser Angelegenheit sich allein schon durch die Anmeldung der Frau Senatorin, wie manche Bekannten noch aus alter Gewohnheit sagten, involviert fühlte, erklärte er sich bereit, bei diesen Leuten zu Hause in überschaubarer Dreierrunde den stark komprimierten und persönlich auf die Eheleute zugeschnittenen Lernstoff seines wertvollen und begehrten Sterbeseminars zu vermitteln.
So kam der Pastor in der schweren, anfechtungsreichen Zeit dieser beiden zweimal die Woche in die Senatorenvilla und hielt im oberen Stockwerk, gerade in dem Raum, der dem Senator als Schlafzimmer diente und in dem Gero Breslauer-Cramer seinen Trolley abgestellt hatte, sein komprimiertes Sterbeseminar ab. Und zwar am Mittwoch und Sonnabend. Wobei die Frau Senatorin die anderen Wochentage zur freien Verfügung hatte, sich praktisch an ihrem moribunden Gefährten zu erproben. Was sie dann auch sehr gewissenhaft tat.
Hinzuzufügen ist noch, dass diese Veranstaltung am Bett des Sterbenskranken sich nur auf körperliche Nähe und Wärme und Zuwendung vermittelnde Gesten beschränken musste. Der verbale Teil, den man in dieser Zweierrunde nur als Gespräch bezeichnen kann, fand im Zimmer nebenan statt, wobei wegen des kritischen Zustands des Senators nur ein Flügel der stattlichen weißen Zimmertür geschlossen wurde. Aus dem Grunde der kritischen Verfassung des ab und zu stöhnenden Patienten sprach der Pastor leise gedämpft, fast summend. Wobei die Senatorin aus diesem rücksichtsvollen Verhalten des Seelsorgers wieder einmal viel Kraft und Beruhigung erfuhr.
Zwischendurch gönnten sich die beiden eine kleine Stärkung. Es war auf dem Biedermeier-Beistelltisch für Kaffee und englischen Tee gesorgt. Auch selbstgebackenes Gebäck stand einladend bereit. Eine stilvolle und freundliche Geste der Hausherrin, die beim Pastor gut ankam. Wenn das Stöhnen von nebenan überhandnahm, ging die im Laufe der Zeit mehr und mehr mit Moribunden bewanderte Senatorin in das Nebenzimmer, wo ihr Mann die Arme nach ihr ausstreckte, und setzte sich einige Zeit an sein Bett. Bis schließlich der alte Mann durch Streicheln seiner unruhigen Hände zur Ruhe gekommen war. Breslauer blieb zwar in der Zwischenzeit im anderen Zimmer sitzen und ließ sich Kaffee und Gebäck weiter schmecken, verfolgte aber mit allen angespannten Sinnen das Geschehen nebenan. Als die Senatorin nach einiger Zeit wieder zu Breslauer zurückkehrte, nachdem sie sich von ihrem klagenden und sie festhaltenden Gatten durch das Abschütteln seiner Hände ziemlich abrupt abgegrenzt hatte, gab es genug zu besprechenden Stoff, der sich noch der Kritik unterziehen musste.
Der alte Senator erholte sich immer wieder, trotz der Anzeichen seiner Hinfälligkeit und Schwäche und nahm einige Tage später sogar als beredter Dritter an dieser Veranstaltung in seinem Hause teil. Er hatte sich aber gern als Erprobungsobjekt seiner Frau zur Verfügung gestellt und ging auf die Erläuterungen und Erörterungen des Pastors, sogar mit einer gewissen Sachlichkeit ein. Es gefiel ihm gut, mal wieder im Mittelpunkt zu stehen. Er kam sich vor, als würde er im Senat des ehrwürdigen Rathauses der Bürgerschaft den Haushaltsplan erläutern. Argumentierte hin und her und her und hin über seine Schmerzen und körperlichen Unzulänglichkeiten, wobei er von seiner Ehefrau und dem Pastor im Wechsel nur ein gemurmeltes Hm, Hm oder ein verstehendes Ja, Ja zur Antwort erhielt.
Als es dann doch geschah, dass ihr Mann eines Morgens nicht mehr aufstand und auch die Wiederbelebung, Weinen und Schütteln seinem entschlafenen Zustand kein Ende mehr setzen konnte, besuchte die Senatorin Sartorius noch einige Male den Pastor Breslauer in seiner Kirchengemeinde. Wie ein Wunder waren ziemlich rasch ihre Lebens- und Überlebenskräfte zurückgekehrt, was sie alles dem Seminar zugute rechnete. Sie besuchte Seniorentanzveranstaltungen, machte die eine oder andere Seereise in die Gewässer des Nordens und kehrte um einige Jahre verjüngt und entspannter zurück. Wobei sie sich bald darauf entschloss, ihr Haus in Hamburg-Blankenese zu verlassen und nach Argentinien auszuwandern. Dort hatte ihre Großmutter eine Kaffeeplantage mit Herrenhaus besessen, von dem sie wunderbare Fotos besaß und wo sie ihren Lebensabend zubringen wollte.
Die Villa in Blankenese wurde einer Hausverwaltung übertragen. Senatorin Sartorius verkaufte nicht gern etwas, was ihr einmal gehört hatte. „So weit ist es mit mir noch nicht gekommen“, sagte sie gern in ihrer forschen, direkten Art, wenn sich jemand mit seiner Frage zu weit vorgewagt hatte. „Nein, da muss es den anderen erst einmal schlecht gegangen sein, und sie müssen sich wieder hochgearbeitet haben. Dann können wir vielleicht mal geschäftlich ins Gespräch kommen. Aber in der Regel verkaufe ich nicht, wenn ich es nicht will. Denn ich bin eine Mollendorf, Im- und Export und habe gelernt, mich nicht unterkriegen zu lassen. Außerdem war mein Mann ja viele Jahre Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Er war in seinem Beruf erfolgreich. Ich war es ja auch, die ihn beraten hat, wenn er selbst mit den Aufgaben nicht zurechtkam. Mir kann man nichts in Geldsachen vormachen.“ So sprach die Frau Senatorin Sartorius. Und sie hatte recht.
Doch, bevor die Senatorin nach Südamerika zog, um sich um ihre Kaffeeplantage zu kümmern, wollte sie sich gegenüber Pastor Arno Breslauer erkenntlich zeigen. Da sie ihre Villa nicht verkaufen wollte, suchte sie nach einer vertrauenswürdigen Person, der sie in ihrer Abwesenheit ein zeitlich begrenztes Wohnrecht in ihrem Haus einräumen konnte. Sie hatte gehört, dass der Pastor nach Beginn seines Ruhestands aus der Dienstwohnung ausziehen musste. So rief sie ihn also an und besprach mit ihm alles. Er war begeistert. Die Senatorin verzichtete sogar auf die Miete, im Gegensatz zu ihrer sonstigen Knauserigkeit, weil sie eine große, fast an Liebe grenzende Sympathie für diesen, nach ihrer Meinung mit guten seelischen Kräften ausgestatteten Geistlichen empfand.
So wurde dem Ehepaar Breslauer ein fünfjähriges Nießbrauchrecht eingeräumt, das man bis zum Tod des letzten Hinterbliebenen verlängern konnte. Das war schließlich der Pastor selbst. Seine Frau starb schon einige Jahre vor ihm an einem Hautkarzinom, was ihn fast aus der Bahn geworfen hätte, wie es der Sohn gern anderen gegenüber formulierte.
Die Wirklichkeit zwischen den beiden sah allerdings anders aus, seit dem „großen Knall“. Denn irgendwann, als der Pastor noch ein jüngerer Mann war, herrschte Funkstille im Bereich größerer Gefühle zwischen den beiden. Frieda hatte es ihrem Mann nicht verziehen, dass er sich in einer ziemlich delikaten Sache so disziplinlos gehen lassen konnte. Sie war sogar für längere Zeit, ja einen ganzen Lebensabschnitt, mit dem kleinen Gero aus dem Pastorat ausgezogen, weil die Kirchengemeinde schlecht über ihn redete und hatte am anderen Ende des Stadtteils eine billige Wohnung bezogen. Was ihr nicht leichtgefallen war. Erst in ihren letzten Lebensjahren war sie wieder mit ihrem Mann zusammengezogen, nämlich als er die Blankeneser Villa hatte. „Das bist du mir, nach all dem, was du mir angetan hast, schuldig“, hatte sie damals gereizt gesagt. Worauf der Pastor nur antwortete: „Warum wirfst du mir vor, dass ich der guten Verheißung des Lebens gefolgt bin, deren Weg mir die Liebe gewiesen hat?“ Daraufhin schaute sie ihn giftig an und ließ die wunderschöne Biedermeiertür im oberen Stockwerk der Villa knallen. Die beiden hatten bis zuletzt getrennte Schlafzimmer. Was sein Vater immer wieder damit begründete, dass er ein Nachtmensch sei und die besten Regungen seines Lebens hatte, wenn er in der Nacht allein über alles nachdenken konnte.
„Ja“, dachte der Sohn. „Vater war schon ziemlich eigenwillig. Mutter hat es nicht leicht mit ihm gehabt.“ Aber viele haben ihn auch geschätzt, und wen er mochte, für den setzte er sich ein, mit allem, was er an Gaben zur Verfügung hatte.
Das Haus war mit wertvollen, alten Möbeln ausgestattet. Sohn Gero kam als junger Organist immer mal wieder nach Blankenese, um auf dem alten Flügel zu spielen, der im Erdgeschoss im Musikzimmer stand. Das Instrument bildete dort den Mittelpunkt. Daneben standen braune Holznotenständer und ein winziger Beistelltisch mit zwei Korbsesseln. An der Wand wenige Regale mit Partituren und losen Notenblättern. Auch der Raum oben mit dem großen Fenster zur Straße war möbliert belassen worden. Wenn man ihn vom Treppenhaus betrat, fiel der Blick sofort auf einen größeren runden Tisch, der mit einer schneeweißen gehäkelten Tischdecke bedeckt war. Sie berührte fast den Parkettfußboden. Drei unterschiedlich bezogene Holzstühle aus dem vergangenen Jahrhundert standen locker um ihn herum. Abends erhellten den Tisch zwei silberne Leuchter mit weißen Kerzen. An den leicht bräunlich schimmernden einfarbigen Tapeten hingen Stiche mit Blankeneser Elbmotiven. Man konnte sich so setzen, dass man auf die mit alten Eichenbäumen umsäumte Straße sah, was guttat und die Gedanken kommen ließ.
Gero Breslauer-Cramer war bei einem nahen einfachen Italiener schnell eine Kleinigkeit essen gewesen. Hatte dazu ein Gläschen Chianti getrunken und kehrte schnell wieder in die Villa zurück. Als Ästhet freute er sich auf einen längeren Abend bei Kerzenschein und unterstützende indirekte Beleuchtung von der stilvollen Stehlampe, die ihm schon früher manches Mal die Noten und Partituren beleuchtet hatte, wenn er unten am Flügel übte. Häufig hatte er auch einfach nur verschiedene Töne angerissen, kleine melodische Fragmente entworfen und vor sich hingeträumt. Bevor er heute Abend nach oben ging, öffnete er die Tür zum Musikzimmer. Dort war es dunkel. Es war ihm, als müsste er den Geistern der Erinnerung eine Chance geben, sich im ganzen Haus auszubreiten. Durch das kleine Fenster, deren Tüllgardinen nicht zugezogen waren, sah er das Lichterspiel von langsam durch die Baumstraße fahrenden Autos. Oft hatte er als junger Mann hier die Abende verbracht und auf den Nachklang der Musik gelauscht, ohne die er nicht leben konnte.
Arnos Vermächtnis
Oben am Eingang des Wohnzimmers seines Vaters, etwas hinter der Tür verborgen, stand der alte Lederkoffer. Der Sohn setzte sich auf einen der Stühle, machte es sich kleidungsmäßig bequem und schaute eine Weile unverwandt auf dieses alte Ding, das nur von zwei breiten Lederriemen zusammengehalten wurde. Ein etwas beklemmendes Gefühl überfiel ihn. „Was würde sich ihm nach dem Öffnen offenbaren?“, dachte er. Ihm fiel Aladin mit der Wunderlampe ein, der sich mit diesem Gegenstand auch nicht ganz anfreunden konnte. Dann raffte er sich aber auf. Er war es gewohnt, sich der Situation zu stellen, auch wenn sie unangenehm werden konnte. Das hatte er von seiner Mutter. Sein Vater lief oft vor dem Leben davon.
Er ergriff den Koffer und stellte ihn auf die beiden Stühle, die ihm als Stütze für dieses unhandliche alte Ding willkommen waren. Dann löste er die Riemen, die jeweils von einer Schnalle gehalten wurden. Durch leichten Druck seiner Finger am Schloss sprang der schon wacklige Deckel auf. Es waren Papiere darin. Wohl wichtige Papiere. Einige, mit festem Bindfaden zusammengeschnürte Pakete. Sie waren mit römischen Zahlen und Überschriften versehen. „Ja, Vater, versuchte in allen Bereichen seines Lebens eine grundsätzliche Ordnung zu halten. Aber es gelang ihm nicht lange. Schon bald gab er sich damit zufrieden, wenn er nur irgendwie etwas von dem wiederfand, was ihm einstmals unbedingt wichtig erschien.“ Beim Sichten des Inhalts, der zum großen Teil aus alten Notizheften mit Tagebucheintragungen, lange verjährten Bankbelegen, Rechnungen und Steuerunterlagen bestand, fiel ein etwas größerer brauner Umschlag aus dem Rahmen. Mit schwarzem Filzstift stand da A.L. Darunter, ebenfalls in Schwarz, fiel ein blitzartiger Strich auf, der unter den beiden Buchstaben begann und nach unten verlief. „Aha, die Anfangsbuchstaben des besagten Namens, den keiner in den Mund nehmen durfte, als ich Kind war. Trotzdem geisterte er immer herum.“ Auch wenn sich sein Vater bald abgewöhnt hatte, von dieser Person zu sprechen.
Gero holte umständlich eine Schere aus der Küche, um den etwas dickeren Briefumschlag aufzumachen. Einfach so die Briefe aufzureißen, entsprach nicht seinem Ordnungssinn. Eine DVD-Kassette lag darin. Und noch eine Notiz, die von seinem Vater stammte. Gero kannte die kleine, saubere Handschrift, um die er ihn als Kind oft beneidete.
Endlich weiß ich, wo Anna geblieben ist. Ich dachte schon, sie lebt nicht mehr.
Hier brach die Notiz ab. Gero bekam nun die Bestätigung, dass es sich bei dem Monogramm A.L. um Anna Lerchenfeld handelte, die sein Vater einmal in schwachen Momenten erwähnt hatte, als er bei ihm zu Besuch war. Damals wunderte sich das Kind nur, dass sein Arno – er redete den Vater mit dem Vornamen an – so traurig war. Natürlich erzählte er seiner Mutter davon, wie komisch sich sein Arno verhalten hatte. Sie sagte dann etwas, dass der Kleine nicht verstand. „Ach, der trauert, weil er seine Anna nicht mehr hat. Die hat ihn doch in der Tinte sitzenlassen.“ Daraufhin war der Junge still. Aber über die Tinte, in der man einen sitzenlassen konnte, dachte er lange nach.
Im Wohnzimmer stand der Fernseher mit dem DVD-Player. Gero legte die Scheibe ein. Es begann auf dem Bildschirm zu flimmern. Dann sah man den Innenraum einer Kirche. Sie war voller Menschen. Sie schauten zum Altar, vor dem ein üppig geschmückter Weihnachtsbaum aufgestellt war. Es war die Aufnahme eines Fernseh-Gottesdienstes, der vor einigen Jahren ausgestrahlt worden war. Die Sendung nannte sich „Heiligabend in einer norddeutschen Dorfkirche“. Verantwortlich für die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes war die berüchtigte Verursacherin des familiären „großen Knalls“ Anna Lerchenfeld.
Gero schaute sich die einstündige Aufzeichnung interessiert an. Er war von der Musik und den Chorälen recht angetan. Die Kirchenmusikerin, die sein Vater auch privat zu sehr geschätzt hatte, machte ihren Job gut. Sie war immer nur sehr kurz auf den Einstellungen zu sehen; wahrscheinlich war sie zu bescheiden, um sich länger der Kamera zu präsentieren. „Ein guter Zug“, fand Gero. „Nicht jeder in diesem Amt nimmt sich so zurück.“ Die überdurchschnittlich große Frau war mindestens schon über fünfzig. Sie trug ihre blonden Haare lang und offen. „Sicher waren sie gefärbt“, dachte Gero. Einige etwas längere Einstellungen zeigten sie am Klavier beim Begleiten des kleinen Orchesters. Ein feines, konzentriertes Gesicht. „Ja, sie gehört hinter das Klavier und auf die Orgelbank, da gibt es keinen Zweifel“, stellte der Berufskollege fest. Der in seinem süddeutschen Kirchenbezirk schon manchen Kantor und Organisten beurteilen musste. Nicht alle hatten starke Nerven, gar keine oder nur wenige Fehler zu machen. „Wie sie wohl damals als junge Frau aussah, als sie Vater kennenlernte?“, ging es Gero durch den Kopf. „Wohl kaum anders als jetzt“, war sein Fazit. „Manche Frauen bleiben in ihrer Seele ein Leben lang das kleine Mädchen“, dachte der Kantor und schämte sich für das dumme Vorurteil.
Da lag noch was anderes im Koffer, das hier erwähnt werden muss. Es war die zusammengerollte Kopie eines Gemäldes mit dem Titel „Simson und Delila“ vom flämischen Maler Peter Paul Rubens. Diesem bedeutenden Kunstwerk liegt folgende biblische Geschichte zugrunde (Richter 16, 15-21).
Delila, in die sich der Held Simson verliebt hatte, fragte ihn bei einem Schäferstündchen nach der Ursache seiner übermenschlichen Kraft. Er foppte sie mehrmals, in dem er irgendwelche Geschichten darüber erzählte. Doch Delila ließ nicht locker, ihm sein Geheimnis zu entlocken. Simson war so sehr verliebt, dass er die Situation total verkannte, in der er sich befand. Denn seine geliebte „Gefährtin“ wünschte immer wieder die Clique ihrer Landsleute herbei, um ihm Böses zuzufügen. Trotz dieser ziemlich offensichtlichen Gefahr verrät er ihr zu guter Letzt doch noch das Geheimnis seiner Kraft. Es ist das Haar, was er wachsen lassen musste, um ein Gott Geweihter zu bleiben. Doch das wurde ihm nun von seinen Feinden abgeschnitten, die die Vertrauten seiner Geliebten waren. Nachdem ihm auf diese Weise seine Kräfte verlassen hatten, stachen sie ihm die Augen aus und machten einen Blinden aus ihm. Jetzt fand er sich nicht mehr zurecht, sodass man mit ihm machen konnte, was man wollte. So verlor er durch die blinde Liebe zu einer Frau, die diese Liebe ihm nur vorspielte, seine Freiheit und wurde zu einem angeketteten Sklaven, der wie ein Ochse tagaus tagein ein Mahlwerk drehen musste.
„Ja, Liebe macht blind“, dachte Gero. „Diese Frau spielte ein falsches Spiel. Da können einem schon die Tränen kommen. Warum liegt dieses Bild hier im Koffer? Wollte Vater damit einen Zusammenhang zwischen Delila und Anna aufzeigen.“ Gero rollte die Rubenskopie wieder zusammen und ließ sie im Koffer verschwinden.
Dem Organisten und Kantor, der sich vor dem alten Lederkoffer neigte, wie König David vor der heiligen Lade, fiel ein, dass die Geschichte von Simson in seiner Familie eine besondere Tradition hatte. Sein Vater erzählte einmal, dass es ein Foto von einem Familienkahn gab, der „Simson“ hieß. Auf dieses Schiff war sein Großvater Heinrich Breslauer, der Binnenschiffer, sehr stolz, weil es kraftvoller war als die anderen Frachter.
So war Kraft und Stärke ein verbindendes Element mit dem Motiv dieses Gemäldes. Ein anderes aber war in der Unaufrichtigkeit der Delila zu suchen. Auch mit dieser Empfindung, von einer geliebten Frau gelinkt worden zu sein, hatte der Großvater seine eigene Erfahrung gemacht. Seine Frau ließ ihn nämlich mit seinem besten Freund sitzen. Man nannte sie – ob zu Recht oder Unrecht – in der Familie nur „das Aas“, was so viel wie ein schlechter Mensch bedeutet.
Gero ertappte sich dabei, dass er plötzlich begann „O, wie so trügerisch sind Weiberherzen“ zu schmettern. Und er schämte sich wieder einmal dafür, dass er diesen abgedroschenen Ohrwurm aus der Opernwelt hier mit ins Spiel brachte.