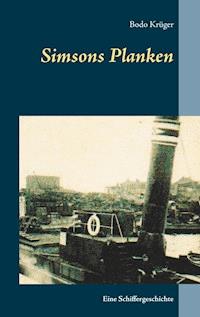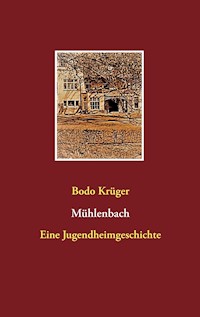
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bodo Krüger (Jahrgang 1945) stammt aus einer Schifferfamilie und kommt erst mit 13 Jahren in die Schule. Bis dahin lebt er auf dem Schiff seiner Eltern mit wenig Kontakten zu anderen Kindern. Er erzählt vom Nachholen seiner Schulzeit in einem Jugendheim Ende der 1950er-Jahre. In einer Reihe von Episoden beschreibt er seinen Alltag in dieser neuen und fremd bleibenden Umgebung. Erzieher, Lehrer, Mitschüler und andere für ihn wichtige Menschen werden in der Erinnerung des Heim- und Schulalltags wieder lebendig. Es geht um Kränkung, Überforderung und Enttäuschung. Aber auch um Begegnungen mit ambivalenten "Mutter- und Vaterfiguren", Vorbildern und erste Lieben. Man erfährt etwas über einen jungen, kaum gebildeten Menschen, der seinen Weg an "Land" erst finden muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Hanne
Inhalt
Ankunft und Heimerfahrungen
Die Lehrer
Das Geburtstagsfest
Die Singstunde
Ein ganz normaler Abend
Dienstwechsel
Urlaubsvertretungen
Weihnachtseinladung
Mein Problem mit dem Sport
Die Heimkonfirmation
Die Schulentlassung
Was soll ich werden?
In der Lehre
Die Pastorenfamilie
Das kleine Zimmer und Abschied
Die Mühle am Mühlenbach
Eine Art Nachwort
Ankunft und Heimerfahrung
Der schwarze VW-Käfer biegt an der Kreuzung ab. Das Auto ist voll besetzt. Vorn sitzen zwei wortkarge Beamte. Sie befördern mit den Zöglingen gleichzeitig die interne Post zu den Heimen. Hinten hocken kleinlaut vier Gestalten, wie Hühner auf der Stange. Sie sollen auf amtlichen Beschluss aus einer nicht funktionierenden Familie in eine förderliche Heimgemeinschaft verpflanzt werden.
„Mühlenbach“ steht auf dem Ortsschild. Die beiden grauen Begleiter, denen nur noch die Zylinder fehlen, um für Mitarbeiter einer Beerdigungsfirma durchzugehen, fahren mit uns an dem Namensgeber dieses Dorfes vorbei. „Da, der Mühlenbach“, knurrt der am Lenkrad. Wir passieren einen Gebäuderest, der zur Ruine einer Wassermühle gehört. „Der Mühlenbach hatte früher mehr Wasser. Um ihn ranken sich Geschichten. Davon werdet ihr was hören, wenn ihr Heimatkunde habt“, sagt der etwas jünger als sein Kollege aussehende Beifahrer. Auf einmal wird sein Tonfall feierlich:
„Am Mühlenbach, am Mühlenbach,
da raunen Stimmen in der Nacht.
Sie können nun nicht schweigen mehr,
das Leben war doch arg zu schwer.“
„Seltsam“, denke ich, „will der uns Angst machen?“ Doch dann blickt er sich freundlich zu uns um und sagt ganz normal: „Das Mühlenbacher Heim ist das beste, das es im Umkreis der großen Stadt gibt. Es liegt am Rande eines Waldes und hat einen, wie verwunschen aussehenden Dornröschen-Park, wo ihr gut spielen könnt.“
Gemächlich fahren wir auf das Schloss zu. Den Mittelpunkt des Marktplatzes, der an der anderen Seite vor einem teilweise verfallenen Torbogen sein Ende findet. Die ganze Anlage ist wohl früher einmal ein Gut gewesen. In einigen der etwas heruntergekommenen Häuser, die den Platz eingrenzen, sind kleine Läden untergebracht. Ein Milchmann, ein Gemüsehändler, ein Schlachter. Außerdem haust im Torbogenrest ein Kolonialwarenhändler. Sein hölzernes Ladenschild erinnert an einen Drugstore im Wildwestfilm. Sogar ein Hotel mit Restaurant wartet wohl schon länger auf Gäste. Die aber, wenn sie sich aus der näheren Umgebung zu diesem dörflichen Flecken hin verirren, sich doch lieber ein paar Schritte weiter vor dem einarmigen Banditen im Dorfkrug einfinden, um dort ihre Groschen für das nächste Bierchen zu vermehren.
Es ist ungefähr neun. Das weiß ich, weil ich die Zeit bald darauf von der großen Uhr im Treppenhaus des Gutshauses ablesen werde. Stolz, dass ich das wenigstens schon kann. In diesem alten Gemäuer, das mit seinem größeren und den zwei kleineren Türmen wirklich wie ein Dornröschen-Schloss aussieht, und damit auch was Anziehendes für uns hat, ist das Jugendheim untergebracht.
Gerda, Erwin, Willy und ich. Wir vier sind die Neuzugänge. Die wohl auch schon erwartet werden. Als Begrüßungskomitee stehen allerdings nur die Putzfrauen vor der Tür und begutachten uns von Weitem, ohne ein Wort zu sagen. Sie beobachten uns aufmerksam, indem sie sich auf ihre Besen und Schrubber stützen, und dabei gleichzeitig ein wenig von der Arbeit ausruhen. Dass überhaupt jemand uns beachtet, nimmt mir etwas die Spannung. Es sind dicke, gutmütig aussehende Frauen aus dem Ort, die sich im Heim mit Saubermachen ein Zubrot verdienen. Wir sind für sie beachtenswert, weil sie uns für bemitleidenswert halten. Kinder, um die sich die Eltern nicht kümmern, und die deshalb auf die schiefe Bahn geraten sind. Bedauernswert und weit entfernt von den eigenen Vorstellungen von richtig und falsch, die in einer überschaubaren Welt mit kleinen Gärten und gradgeschnittenen Hecken sich gebildet haben.
Ich sage: „Guten Morgen!“, mit meiner damals schon ziemlich kräftigen Stimme. Grüße, weil ich möchte, dass jemand mir antwortet. Mich und uns freundlich willkommen heißt. Ich will kein unmündiges Kind sein, das man nicht ernst nimmt. Ich bin doch jemand, der schon seinen Eltern geholfen hat, damit sie im Leben zurechtkommen. Ich habe die Frachtpapiere zum Schleusenmeister gebracht. Unser Schiff festgemacht und seine Maschine gewissenhaft alle vier Stunden geschmiert, damit es gut fahren kann. Trotz meiner dreizehn Jahre. Aber mein Gruß wird nicht erwidert. Man weiß nicht, was für welche wir sind und sagt lieber gar nichts. Setzt sich besser wieder in Bewegung und geht an die Arbeit.
Eine Frau mit weißer Schürze und rotbraunen Haaren empfängt uns als erster redender Mensch. Aber sie hat einen Anstaltston, spricht in Befehlen, herrisch und rau. Das ist die Erzieherin Fräulein Zweigner, später Frau Zweigner. „Erwin, Willy und Bodo…“ (Gerda ist von einer anderen Erzieherin zur Mädchengruppe gebracht worden.) Sie sagt Bo-do. Es klingt übertrieben lang und für mich ungewohnt. Später sagt sie oft „der Bodo“, so wie Vater „der Junge“ gesagt hat. Wie man eben auch „der Schüler“, „der Schornsteinfeger“, „der Handwerker“ sagt. Sie betrachtet Karteikarten mit unseren Namen und Daten wie mitgegebene Lieferscheine. Wirft uns dann wortlos die, aus mehreren Teilen bestehende, Bettwäsche zu. Der Packen ist unhandlich. Ich muss aufpassen, dass ich die einzelnen Stücke nicht auf den Boden fallen lasse. „Bezieht jetzt eure Betten! Wenn ihr Bettnässer seid, sagt es lieber gleich. Also, wer braucht von euch ein Gummilaken? Was ist mit dir, Bodo?“ Ich schaue sie ziemlich lange erstaunt an. Wohl zu lange. „Na, was ist? Bist du Bettnässer, Bo-do?“ Sie deutet mein Zögern als Schämen. Denkt wohl: “Fühlt der sich ertappt? Oder ist der schwer von Begriff?“ „Nein, das bin ich nicht“, antworte ich nach weiterem Zögern erschrocken und etwas vorwurfsvoll. „Das sagen alle. Wir werden es morgen früh genau wissen.“ ich muss schlucken, bin gekränkt. Diese Frau mag ich nicht. Es ist das erste Mal, dass mir Erwachsene nicht wohlwollend begegnen.
Da war die freundliche Friseurin, als ich mit fünf Jahren mit umgehängter Brottasche zum Haareschneiden kam. Ich erzählte ihr, dass ich mich so sehr auf die Einschulung mit sechs freue. Dann wurde ich sechs. Ich kam nicht in die Schule. Ich wurde sieben. Ich kam nicht in die Schule. Es passte meinen Eltern nicht. Ich wurde acht, neun, zehn. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, jemals in die Schule zu kommen. Dann half ich Vater. Erst wie ein Schiffsjunge, später fast schon wie ein Bootsmann. Unterstützte Mutter, die immer mehr ihre eigene Welt errichtete und nicht auf Vater, immer weniger auf mich, aber auf manche Stimmen hörte. Was die rieten, war nicht gut für sie, für Vater und für mich. Dann kam der Sommer, in dem ich dreizehn geworden war. Sicher ein kindlicher Dreizehnjähriger, aber mit einem dünnen schwarzen Flaum über der Oberlippe und mit einer tiefen Stimme. Sie holten mich vom Schiff, das nach mir benannt war. Nahmen mich weg von Mutter, für die ich eine gute Stimme war und von Vater, der nicht da war, als ich ihn brauchte, sondern sich in Ruhrort in Kneipen herumtrieb. Ich ging tapfer mit dem Fürsorger und fuhr mit ihm auf dem Motorroller davon. Mutter sackte am Straßenrand zusammen und schrie: „Mein Kind, sie nehmen mir mein Kind!“ Wir fuhren weiter. Ich benahm mich wie ein Mann. „Männer weinen nicht“, hatte ich gehört. Was sollte ich tun? Was konnte ich tun? Wie ein Erwachsener sein, der weiß´, dass Schule wichtig für das Leben ist, damit man rechnen, schreiben und lesen kann.
Warum unterstellt sie mir, dass ich ins Bett mache? Ich wäre doch ehrlich gewesen, hätte es ihr doch von allein gesagt. Warum sollte ich lügen? Ist ins Bett machen nicht eine Krankheit? Ein Leiden wie Schnupfen, Husten oder Diphtherie? Warum redet sie überhaupt in so einem harten Ton? Was ist das für ein Heim! Was sind das für Menschen! Wie fremd kommen sie mir vor. Da gefiel es mir im Aufnahmeheim viel besser, wo sie mich für die Schulart getestet haben. Da bin ich über einen Monat gewesen. Ich wäre dort Bürobote geworden, wenn ich nicht nach Mühlenbach gekommen wäre. Bürobote, das war dort ein Vertrauensposten. Da hätte ich die Heimakten von einer Abteilung zur anderen gebracht. Das wäre eine schöne Anerkennung gewesen, die mich stolz gemacht hätte. Nun bin ich hier und fühle mich eingeschüchtert, wie ein Angeklagter, der gestehen soll, dass er doch zu den Bettnässern gehört.
In diesem Schloss am Mühlenbach ist es nicht schön. Hier kommt es darauf an, nicht unangenehm aufzufallen, damit die Erwachsenen nicht doch am Ende Recht behalten, dass man eigentlich kriminell und böse ist. Wie lange wird es dauern bis ich hier wieder rauskomme? Drei oder vier Jahre rechne ich mir aus. Solange wie die Schulzeit. Die Bestrafung dafür, dass meine Eltern mich nicht rechtzeitig zur Schule geschickt haben. Aber ich wollte doch zur Schule, wissen die denn das nicht? Nun hat es mir endlich der Staat ermöglicht, wenn auch mit sieben Jahren Verspätung. Aber ich freue mich nicht mehr.
Als kleiner Junge kam ich an einem Schulhof vorbei. Dort war gerade Pause. Viele Kinder hatten Gruppen gebildet und spielten. Ich sah Gestalten in schwarzen Gewändern; sie schienen mir riesengroß. Ihre Umhänge, an denen Stöcke hingen, wurden mit Kordeln zusammengehalten. Diese mönchähnlichen Wesen lasen vertieft in kleinen schwarzen Büchern. Wo sie die Gruppen der Kinder durchschritten, erstarb die Fröhlichkeit zur Totenstille und alle wichen zurück. Als ich Mutter fragte, was das für Leute sind, sagte sie: „Das sind Erzieher. Das dort ist keine Schule, sondern ein Erziehungsheim. Da müssen sie streng sein. Sie passen auf, dass die Kinder nichts tun, was verboten ist.“ Ich schaute unverwandt auf diese Kinder und ihre Aufpasser. Erzieher heißen also solche Leute. Das klingt nach Strenge und Bestrafung. In so ein Heim wollte ich nicht. Auch nicht in ein Schifferkinderheim, wo die Kinder der Schifferfamilien oft hinkommen, wenn sie zur Schule müssen. Ich wollte so lange wie möglich bei meiner Mutter bleiben. Mit ihr zusammen auf dem Schiff. Später in einer Stadtwohnung in Hamburg oder Berlin. Vater könnte ja weiter mit dem Schiff unterwegs sein und sich wieder einen Bootsmann nehmen und uns dann ab und zu mal besuchen. Aber ich ahnte schon, dass daraus nichts werden würde, weil die Eltern nichts auf die Reihe kriegten.
Nun muss ich also hier in Mühlenbach sein. Und wäre am liebsten auch abgehauen, wie meine beiden Kollegen Erwin und Willy. Sie türmen schon nach wenigen Stunden. Aber ich bin dazu zu feige, zu vernünftig und zu brav. Ihre Freiheit ist allerdings nur von kurzer Dauer. Man hat sie schon bald wieder aufgegriffen und bringt sie nach einer Nacht auf der Polizeiwache am nächsten Morgen zurück. Hier erwartet sie dann stundenlanges In-der-Ecke-Stehen und Liebesentzug durch frostiges und kurz angebundenes Verhalten der Erzieher. Aber die beiden Ausreißer stehen nun wenigstens im Mittelpunkt des Interesses. Dazu nehmen sie ihre Strafe gern auf sich. Sie haben sich auf ihre Weise gegen den freudlosen und unwillkommenen Empfang gewährt. Ich dagegen nicht. Ich bin dort geblieben, wo man mich hingesteckt hat. Aus Vernunft, könnte man meinen; aber es ist zum großen Teil einfach Angst vor Strafe und vor dem Anschreien der Erzieherin, die uns damit einschüchtern will.
Im Schlafsaal mit der Holztäfelung an den Wänden warten auf uns eiserne Etagenbetten, die durch schmale Gänge voneinander getrennt sind. Von der Mitte der Zimmerdecke verbreitet eine flache Lampenkuppel mattes gelbliches Licht. Sie erinnert an eine Sonne aus dem Bilderbuch. Von dunklen Sonnenflecken weiß ich noch nichts, aber die Fliegen-, Falter- und Schusterkadaver unter dem Glas hätten mich daran erinnern können. Ich schlafe im oberen Teil des Bettes. Unten liegt ein Günther. Ob wir uns vertragen? Ich möchte hier mit jedem gut auskommen. Vor dem Einschlafen betrachte ich bis zum Lichtausmachen den Beleuchtungskörper über mir. Gehe meinen Gedanken nach und strecke die Finger vor meinen Augen gegen das dürftige Licht. Das Schwarze unter meinen Fingernägeln stört mich. Ich versuche, mit den Nägeln der anderen Hand den Schmutz zu entfernen.
Eine Schiebetür aus dunkelbraunem Holz trennt den Schlafsaal vom Tagesraum. Punkt halb neun verschwindet Fräulein Zweigner dahinter, nachdem sie: “Gute Nacht, allerseits!“ gewünscht hat. Sie sagt „gute Nacht, allerseits“. Nicht mehr. Gibt auch nicht, wie das noch im Aufnahmeheim üblich war, jedem Kind am Bett persönlich die Hand. Sie sagt nur ihren Spruch und verschwindet zurück in den Tagesraum. Wo das Licht nun durch den Spalt der zusammengeschobenen Türflügel noch längere Zeit schimmert. Als Zeichen, dass sie sich dort noch beschäftigt. Sie kennzeichnet die Unterwäsche mit den Anfangsbuchstaben unserer Namen, damit sie uns wieder zugeordnet werden kann, wenn sie von der Großwäscherei kommt. Außerdem bügelt sie die einzelnen Teile noch. Die Erzieherin hat einen langen Arbeitstag, bis sie sich in ihr Privatzimmer im oberen Stockwerk des Gutshauses zurückziehen kann. Dazu kommt sie dieses Mal noch lange nicht.
Schon bald wird es in den Betten unruhig. Ich höre Gerhard, einen großen kräftigen Jungen, rufen: „Wer hat denn da gefurzt? Warst du das, Herbert, du Sau?“ Gerhard schläft unter Herbert und stößt mit den Füßen gegen die Matratze seines über ihm schlafenden Bettgenossen. Der fällt durch den heftigen Stoß samt Bettdecke in die Tiefe. Hält sich spontan am Lattenrost fest und kommt dumpf mit den Füßen auf. Er ist ein zarter, etwas mädchenhaft wirkender Junge, während Gerhard mit seinen fünfzehn schon für achtzehn durchgehen könnte. Herbert steht mit seinem weißen langen Nachthemd noch etwas benommen im Gang zwischen den Betten. Dann scheint ihm einzufallen, dass er auf Gerhard böse ist. Er trommelt auf dessen Decke heftig herum und trifft dabei mehr versehentlich mit seinen Fäusten auch den Körper seines Widersachers, der sich geschickt den Treffern zu entwinden sucht. „Du bist es ja selbst, du fieser Kerl und gibst mir die Schuld.“ Er schlägt den sich mit der Decke Schützenden und Kichernden noch einmal heftig gegen die Brust und schreit in den dämmerigen Saal hinein: „Fräulein Zweigner, Fräulein Zweigner. Der Gerhard hat schlechte Luft gemacht und gibt mir die Schuld. Das finde ich fies!“
Diese Auseinandersetzung wirkt wie ein Signal. Es wird insgesamt unruhiger. Einige beginnen ebenfalls mit ihren Beinen gegen die Matratzen der oben Schlafenden zu treten. Oder mischen sich mit Bemerkungen in den Streit zwischen Gerhard und Herbert ein. Es entsteht erst ein leiser, dann ein immer lauter werdender Geräuschpegel. Im fast finsteren Schlafsaal, der nur von einer schwachen Notbeleuchtung über der Eingangstür in einen dämmrigen Zustand versetzt wird, huschen Gestalten von Bett zu Bett. Raubzüge auf Decken und Kissen werden unternommen. Kopfnüsse und andere Schläge werden verteilt. Immer wieder fallen Matratzen aus den Betten. Das hält eine ganze Weile so an. Da ruft plötzlich einer: „Nun seid doch endlich mal ruhig, wir sollen doch schlafen!“ Ganz ernst gemeint, ist das sicher nicht, denn man hört aus dieser Richtung ein hexenhaftes Kichern. Sicher testet der angeblich für Ruhe Sorgende nur aus, wie lange es dauert, bis Fräulein Zweigner aufkreuzt. Vielleicht hat er auch schon bemerkt, dass sie bereits eine ganze Weile hinter der Schiebetür lauert und durch den schmalen Spalt zwischen den Türflügeln das rege Treiben beobachtet.
Nun ist der geeignete Zeitpunkt für ihren Auftritt gekommen. Mit einem heftigen Ruck reißt sie die beiden schweren Türhälften auseinander, so dass es klingt, wie das Grollen eines Donners. Dann steht sie, wie ein furchtbarer Racheengel da und knipst das Licht an. Der Schreck der plötzlichen Helligkeit lässt mich unter der sonst so trüben Sonnenlampe die Augen zusammenkneifen und mein Herz schneller schlagen. Was wird es jetzt geben an Strafen? Hoffentlich weiß sie, dass ich nicht einer der Störenfriede bin. Sie läuft schnell auf die Betten zu, wo sie den Unruheherd vermutet. Die Stimmen ihrer Pappenheimer hat sie sich eingeprägt und liegt dabei meistens richtig mit ihrer Vermutung, wer angefangen hat. Gerhard und Herbert müssen rasch aufstehen, ihre Bettdecken nehmen und sich beide an die Wand stellen. Es gibt Nächte, da stehen sogar drei oder vier traurige Gestalten wie Gespenster im Dämmerlicht. Sie stehen mit dem Gesicht zur Wand und sollen über ihre Untaten nachdenken. Auch wenn sie vielleicht zu Beginn dieser Prozedur noch etwas herumalbern, gibt sich das im Laufe der Zeit, während die anderen schon wieder schlafen oder vielleicht auch nur so tun. Solange die Bestrafung dauert, muss auch Fräulein Zweigner im Gruppenraum ausharren. Sie sortiert eben Wäsche oder füllt die Zeit mit weiteren Bügelaktivitäten aus. Das kann eine Stunde oder länger dauern. Wenn Sie denkt, dass es genug ist oder es selbst nicht mehr aushält, schickt sie die, nun wie Pferde im Stehen Schlafenden, mit kargen Worten ins Bett. Ihre Stimme ist dabei fast tonlos: „Geht nun schlafen.“ Die Angesprochenen torkeln im Halbschlaf zu ihren Betten. Krabbeln lautlos unter die Decke und schlafen oder dösen bis zum Morgen noch so dahin.
Nach so einem Vorfall ist die Atmosphäre gestört. Es wird weder gelacht, noch leise gekichert, noch sich unbeschwert im Bett umgedreht. Kaum jemand wagt, laut zu atmen. Auch den Nichtbeteiligten fällt es schwer, wieder einzuschlafen. Zu groß ist die Aufregung, die sich auf alle auswirkt. Diese Verunsicherung ist wohl auch beabsichtigt, sozusagen als indirekte pädagogische Maßnahme. Die Gruppe hat heute als Gesamtheit versagt. Das hat sie nun davon. Das Motto, nach dem erzogen wird, heißt: „Einer für alle, alle für einen.“ Aber wie ungerecht ist es doch, wenn alle darunter leiden müssen, dass wenige uneinsichtig sind und vielleicht nur ein Mitglied gegen die Norm verstoßen hat. Man hat sich die Gruppe doch nicht ausgesucht und kann somit auch nicht gleichen Sinnes sein wie die anderen. „Ihr als Gruppe hättet das verhindern müssen“, heißt es oft. Dabei wird vergessen, dass es ja in jeder Gruppe Wortführer und Mächtige gibt, die keine Hemmungen haben, einfach das durchzusetzen, was sie wollen, und dabei nicht so sehr, oder auch gar nicht, an die Gesamtgruppe denken.
Ich werde nie ermahnt; stehe auch nie in der Ecke oder an der Wand. Dafür aber habe ich oft Angst, verdächtigt und durchschaut zu werden. Denn ich finde eigentlich alles furchtbar und fühle mich in Mühlenbach überhaupt nicht wohl. Wenn ich nicht selbst scheu vor dem krassen Ausdruck gehabt hätte, hätte ich gesagt: „Ich finde alles zum Kotzen.“ Doch das möchte ich lieber gut verbergen. So zeige ich also nicht, was ich wirklich empfinde. Mag es mir vielleicht selbst kaum eingestehen, weil ich denke, dass ich dankbar sein muss für all das, was man für mich tut. Aber es gibt Momente, da spüre ich unbändige Wut und Abneigung gegen diese ganze Großraumhaltung von Jugendlichen, die Heim genannt wird. Es herrscht Kasernenatmosphäre, wo der Krieg doch dreizehn Jahre vorbei ist. Während dieser vier Jahre, die mir lange vorkommen, geht es nur ums Durchkommen, ums psychische Überleben. Gelebt, richtig unbeschwert als Jugendlicher gelebt, das habe ich in Mühlenbach nicht. Habe es dort nicht lernen können und habe es eigentlich nie gelernt. Auf dem Schiff nicht, aber dort im Heim ganz gewiss auch nicht.
Einige Wochen später werde ich krank. Die Krankheit kündigt sich langsam an. Krampfartige Bauchschmerzen machen mir in immer kürzeren Abständen das Leben schwer. Sie steigern sich so, dass ich mich beim Sport auf den Boden legen muss und die Beine anwinkeln. Eine ganz normale Essensmahlzeit kann schon der Auslöser sein. Wie mit Messerstichen folgt bald darauf ein Schmerz in der linken Bauchseite. Der Heimarzt, eine Art Landarzt aus dem Ort, fühlt den Bauch ab. Er drückt mal hier und mal da und kann nichts Unnatürliches feststellen. Doch das ist den Schmerzen egal. Sie werden von Tag zu Tag schlimmer. Schließlich beiße ich nur noch die Zähne zusammen. Liege nachmittags, wenn die anderen Sport treiben, mit bis zum Bauch angezogenen Beinen und einer Wärmflasche auf meinem Bett und weiß nicht, was werden soll.
Schließlich komme ich ins Krankenhaus. Zum ersten Mal in meinem Leben. Es ist ein kasernenartiger Komplex aus vielen einzelnen Gebäuden. Die Krankenschwestern sind ebenso ruppig, wie die Erzieherin im Heim bei meiner ersten Begegnung. Bis auf eine Aushilfsschwester, die häufig nachfragt, wie es mir geht. Und wenigstens ein paar Worte mit mir spricht. Sie gefällt mir. Ich finde sie nett, und ich denke nachts an sie, wenn die Schmerzen etwas nachlassen. Ich habe mich wohl in diese junge Frau, mit den kurzen schwarzen Haaren, verliebt.
Wenn ich Mädchen gern mag, vergleiche ich sie in diesen Jahren gern mit der kleinen Wähling. Die Begegnung mit ihr ist schon einige Jahre her, aber sie hat mich damals mit ihren dunklen Locken ebenfalls sehr beeindruckt. Wir lagen mit dem Schiff ein oder zwei Tage am Mittellandkanal an der westdeutschen Grenze. Ich war vielleicht acht und spielte auf dem Treidelpfad. Ganz in der Nähe gab es einen Laden, in dem die Schiffer ihren Proviant einkaufen konnten. Die kleine Wähling war die Tochter des Besitzers und sicher schon zwölf oder dreizehn. Jedenfalls schenkte sie mir eine kleine bunte Wundertüte. Sie blieb neben mir stehen, weil sie sehen wollte, was in der Tüte war. Langsam riss ich sie auf. Einige Teile purzelten heraus. Ich erinnere mich nur noch an zwei Luftballons. Das Mädchen wollte einen davon haben. Sie hatte mir ja auch die Tüte geschenkt. Den anderen blies ich selber auf. Dabei musste ich mich ziemlich anstrengen, weil ich nicht so viel Puste hatte. Meine Partnerin aber hatte ihren mit viel Luft schön voll aufgeblasen. Aber dann kam das Schönste: Sie sprach länger mit mir. Fragte, wie ich heiße, wo ich herkomme, wo ich denn zur Schule gehe, und was ich sonst so auf dem Schiff mache. Ich erzählte, so gut ich konnte, dass ich in Hamburg zu Hause bin. Wir aber keine Wohnung haben, und ich bei meinen Eltern auf dem Schiff lebe, das nach mir Bodo heißt. Im Moment helfe ich ihnen bei der Arbeit, weil wir keinen Bootsmann haben, und meine Mutter nicht alles allein machen kann. Aber zur Schule gehe ich gern. Hier und da mal, wenn wir im Winter nicht fahren können. Und dann irgendwann sicher auch fest. Meine Mutter wird mit mir eines Tages in Hamburg in einer Wohnung leben. Während Vater wieder mit einem Bootsmann allein mit dem Schiff unterwegs sein wird, und wir ihn nur in den Ferien besuchen werden. Aber ganz ohne Eltern in einem Schifferkinderheim leben, will ich nicht. Während ich sprach, hatte sie einen Knoten in den Luftballon gemacht, so dass er seine Luft behielt. Meiner aber war geschrumpft, weil ich während des Erzählens ganz vergessen hatte, ihn mit den Fingern zuzuhalten und zuzuknoten. So hielt ich schließlich nur noch die Gummihülle in der Hand. Doch das kümmerte mich nicht. Ich sah das Haar meiner Gesprächspartnerin, ihre interessierten Augen, die mich anschauten und hörte ihrer Stimme zu, die mir freundlich und vertraut erschien. Dabei habe ich mich selbst vergessen. Dann musste sie in den Laden zurück; ihre Eltern warteten schon. Sie hielt ihren Luftballon am Knoten ganz hoch, als sie fortging. Mit der freien Hand winkte sie mir zum Abschied zu. Dann war sie verschwunden. Am anderen Morgen war alles anders. Wir fuhren früh los. Weiter nach Berlin.
Das Zimmer im Krankenhaus teile ich mit vier Leidensgenossen, ungefähr in meinem Alter. Zwei sind an den Mandeln operiert. Die beiden anderen an ihren abstehenden Ohren. Wenn die Bauchschmerzen schwächer sind, vertreibe ich mir die Zeit mit Schlafen, oder ich schaue mir die Bilderbuchreste an, die auf dem Tisch herumliegen. Meine geliebten Micky-Maus-Hefte musste ich ja auf dem Schiff zurücklassen. Außerdem denke ich an die stark furienartigen Ausbrüche von Fräulein Zweigner, die ich in meiner bisher kurzen Heimzeit auch schon mehrmals erlebt habe, wenn sie unter dem Kopfkissen eines Zöglings ein Comicheft entdeckt hat.