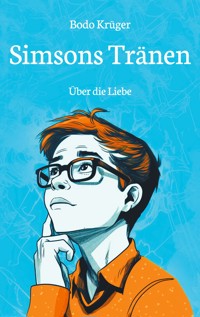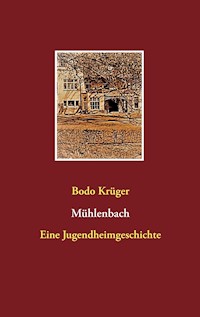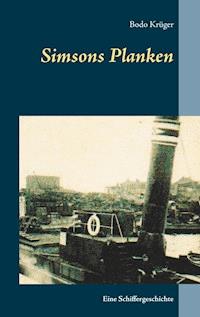
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Verfasser, Jahrgang 1945, stammt aus einer Schifferfamilie und befuhr bis zum 14. Lebensjahr auf dem Schiff seiner Eltern die Wasserstraßen Deutschlands und den Niederlanden. Rückblickend setzt er mit kleinen Geschichten diese vergangene Welt mosaikartig wieder zusammen.Er erinnert sich, wie sehr er vieles vermisste: die Schule, das selbstverständliche Leben an Land, den Umgang mit anderen Kindern. Eigentlich einen großen Teil der unbeschwerten Kindheit. Auch werden die psychischen Veränderungen der Mutter und der Alkoholismus des Vaters für den Jungen immer mehr zum Problem. So muss er sich damit abfinden, dass die tragende Basis seines Lebens auf schwankenden Planken gegründet ist. Bis plötzlich ein Mann der Behörde als Vertreter des Staates auftaucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Tillmann
Inhalt
Die Simson-Geschichte und unsere Schiffe
Erste Erinnerungen
Vater
Oma Krüger
Onkel Erich und Vaters Eifersucht
Russische Soldaten
Der Umbau des Dampfers
Ein Täuschungsmanöver
Eine Flucht
Danziger Goldwasser
Schiffsjunge Alfred
Streit
Und wieder Streit
Das Grandhotel
Die Jugendbande
Licht-Liebe-Leben
Kontaktversuche
Weihnachtsstimmung
Der Schlepperkapitän
Die Freundin
Die Atomkugel
Peinlichkeiten
Mutter kann nicht sprechen
Das Leck
Vater im Kino
Eisenschrott
Der Ausstieg
Von Bord ins Heim
Die Simson – Geschichte und unsere Schiffe
Meine Großeltern sind auch schon Schiffer. Sie befahren mit ihrem Finowmaßkahn die Oder, die Havel und die Spree und natürlich auch die Elbe. Wobei sie, wenn sie in Hamburg sind, an der Peute festmachen. Auch der Vater meines Großvaters, mein Urgroßvater also, besitzt schon einen Kahn. Deshalb gelten die Krügers zu Recht als Schifferfamilie.
Das Bewegen eines Schleppkahns aber ist nicht so einfach wie heute bei einem Motorschiff. Sie können allein nicht fahren und brauchen dazu einen Schlepper, der mit rauchendem Schornstein, zwei, drei, vier oder noch mehr Kähne hinter sich herzieht. Ein Schleppzug ist so ähnlich wie eine Karawane. Er muss auch wie diese zusammengestellt werden. Das besorgt die Schlepperreederei, die den Kähnen mit gleicher oder ähnlicher Richtung einen Schlepper vermittelt. Dafür müssen die Schiffer ganz schöne Summen Schleppgeld bezahlen. So sind die Kapitäne der Schleppkähne ziemlich abhängig. Was nicht gut ist für einen Schiffer, der frei und ungebunden sein will, und das als hohen Lebenswert ansieht.
Deshalb blickt man, als die Motorschifffahrt aufkommt, oft mit Neid auf diese in der ersten Zeit erst einmal nur umgebauten Kähne, die aber an ihren früheren Artgenossen plötzlich mit vielen PS vorbeiziehen. Oft mit einem etwas herablassend blickenden Kapitän hinter dem Steuer. Da kann man sich vorstellen, dass Großvater Krüger auch so ein schmuckes Motorschiff haben will. So nimmt er eines Tages einen Bankkredit auf und lässt seinen Kahn, der bisher Hedwig nach seiner Frau geheißen hat, durch einen Motor und einige andere kosmetische Veränderungen zu Simson umwandeln. Simson, das ist ein starker Held aus der Bibel, der sich mit Kraft und Abenteuer besonders bei Frauen hervorgetan hat. Durch blinde Liebe zu einer Verräterin fällt er eines Tages in die Hände seiner Feinde, die ihn auch ganz zur Erblindung bringen, indem sie ihm die Augen ausstechen. Dagegen denkt Großvater bei Simson sicher mehr an Stärke als an Leiden. Ob er überhaupt die tragische Seite dieser Geschichte kennt, ist fraglich. Es wird sich aber im Laufe der Zeit zeigen, dass gerade dieser Doppelaspekt auf der Sachebene im Dasein dieses Schiffes und auch auf der menschlichen Ebene mit der Familie Krüger als wichtig erweist.
Zunächst einmal steht das Kraftvolle mehr im Vordergrund und das umgebaute Schiff zieht heldenhaft mit seiner 250 PS-Maschine an den langsameren Kollegen vorbei. Es gibt ein Foto, da steht Vater neben Großvater auf der Kommandobrücke. Er hält das Steuer des Simson wie heute jemand das Lenkrad eines teuren Sportwagens. Aus jedem Winkel seines jungen Gesichtes strahlt Freude und Stolz, als würde er rufen: „Fluss frei! Jetzt kommen wir!“
Was aber kommt, ist der Zweite Weltkrieg. Die Nazis planen die Invasion Englands vom Wasser her. Hierzu brauchen sie viele geeignete Binnenschiffe, die einfach beschlagnahmt werden und zu Panzerfähren umgebaut. Den Simson erwischt es auch. Das ist ein schwerer Schlag für die Krügers. Großvater geht aus Kummer in Rente und zieht sich nach Landsberg an der Warthe zurück. Vater ist noch zu jung um aufzugeben. Aber er ist nun ohne Arbeit. Ein für ihn neues unangenehmes Lebensgefühl. Bisher stand er immer bei seinem Vater in Lohn und Brot: erst als Schiffsjunge, dann als Bootsmann und Matrose. Schließlich erwarb er selbst die Patente zum Steuermann und Schiffsführer. Er sollte einmal den Simson übernehmen. Der Krieg machte das alles zunichte. Doch sein Leben ist die Schifffahrt. Hinter dem Steuer findet man seine Seele, wenn es einen Ort außerhalb des Körpers für sie gibt.
Nachdem der Simson nicht mehr da ist, beginnt Vaters eigene Geschichte. Er ist zwar arbeitslos, aber glücklicherweise für den Kriegsdienst untauglich, weil er oft Probleme mit seinem Leistenbruch hat. So fährt er nach Hamburg, mietet sich dort ein möbliertes Zimmer in der Neustadt und will sein Leben wieder in Schwung bringen. Seine erste Ehe ist in die Brüche gegangen und Sohn Karl-Heinz lebt bei den alten Großeltern in Landsberg.
So ist er frei, sich in Hamburg nach einer neuen Existenz umzuschauen. Das kostet ziemliche Nerven, so dass er mit seiner inneren Kraft am Ende ist, als er nach einer durchzechten Nacht die ihn durch ständiges Miauen störende Katze seiner Wirtin ohne Wenn und Aber aus dem Fenster schmeißt. Danach muss er sich eine neue Unterkunft suchen, was er auch verdient hat. Doch zum Glück ist der Schlendrian bald vorbei. Nach längerem Hin und Her und manchem Vorsprechen bei Werften und anderen Schiffern findet er dann schließlich seinen kleinen „Simson“ in Gestalt einer ausgedienten Alsterschute. Die er aber wohl in der richtigen Einschätzung der Realität auf seinen Sohn „Karl-Heinz“ tauft.
Während also auf irgendeiner Hamburger Werft die Schute in ein Motorschiff umgebaut wird, lernt er meine Mutter kennen, die auch froh ist in jenen unsicheren Zeiten wieder festen Boden, und wenn es auch nur Schiffsplanken sind, unter die Füße zu bekommen. Beide überleben die Bombenangriffe auf Hamburg sicher nur, weil der Umbau rechtzeitig abgeschlossen ist und das Karl-Heinz-Schiffchen die Gefahrenzone verlassen kann. Als die Luftangriffe toben, liegt es in Lüneburg und die Eltern sind nicht unmittelbar von der Katastrophe betroffen. Auf dem Weg zum Bunker fällt die schwangere Frau heftig auf den Bauch. Die Sirenen heulen. Sie ist mit ihren Nerven am Ende. Was ist mit dem Kind? Was wird aus ihm? Dann ist der Krieg vorbei und Mutter entbindet in Lüneburg in der Klinik. Es ist für die zarte empfindsame Frau keine leichte Geburt. Ich bin ziemlich schwer und werde durch einen Dammschnitt zur Welt gebracht. Doch sie kehrt überglücklich mit einem Baby auf das Schiff zurück. Nun ist sie Mutter.
Auf diesem kleinen Karl-Heinz-Schiff tun sich für mich die Luken der Welt auf. Ich verbringe dort meine ersten drei Lebensjahre. Alles ist eng und einfach in diesem Raum gleich unter der Ankerwinde, der mehr einem Verschlag gleicht als einer Kajüte. Nicht leicht für meine Mutter unter solchen Umständen einen Säugling zu versorgen. Trotzdem sieht man auf den wenigen vergilbten Fotos aus diesen Jahren Mama und Papa dicht beieinander stehen. Oder auch die junge Mutter in der typischen Nachkriegsfrisur ein gut genährtes freundliches Baby oder schon Kleinkind auf dem Arm halten. Schon nach drei Jahren wird Vater mutig und kauft den Frachtdampfer Havelberg, der dann unter meinem Namen seinen Schornstein rauchen lässt. Bis er nach wiederum drei Jahren auf der Schlichting-Werft in Travemünde zum Motorschiff Bodo umgebaut wird.
Mit diesen Schiffen sind Menschen und Geschichten verbunden, die einen Teil meines Lebensmosaiks ausmachen. Auch wenn es diese schwimmenden Behausungen nicht mehr gibt, so bleiben sie doch Orte, wohin man mit seinen Gedanken zurückkehrt, wenn man älter wird und merkt, dass die geordnete Welt an Land für jemanden, der auf dem Schiff aufgewachsen ist, auch nach Jahren noch, manchmal eng und fremd wird. Die Schiffe werden dann so etwas wie besondere Elternhäuser: Stätten für Geborgenheit und Zugehörigkeit auf der einen Seite und Nichtbehaustsein und Ungebundenheit auf der anderen.
Nach dem Krieg wird versucht, Großvaters altes Simson-Schiff wieder zu bekommen. Doch alle Bemühungen bleiben vergeblich. Irgendwo in den Niederlanden soll es fahren. Aber wer sind die neuen Besitzer? Wollen und müssen sie es überhaupt wieder herausgeben? Nach langem Papierkrieg wird ein Lastenausgleich gezahlt. Er ist kaum der Rede wert und teilt sich auf Großvaters Erben auf. Die große Zeit der Binnenschifffahrt ist vorbei. Wohl auch für die Krügers. Aber Arbeit, viel Arbeit, die gibt es noch lange. Und immer Klagen: „Die Fracht ist zu niedrig, die Bahn macht uns kaputt, der zunehmende LKW-Verkehr. Was bleibt da noch für uns übrig?“
Als Jahre später Vater alt und krank ist und nicht mehr kann, ausgezehrt durch körperliche Arbeit und Alkohol, muss er das Bodo-Schiff mit hohen Schulden belastet an seinen Sohn Karl-Heinz abtreten. Der nennt es in Erinnerung an frühere Zeiten Simson II.
Nun gibt es dieses Schiff nicht mehr. Karl-Heinz stirbt plötzlich mit 75 Jahren. Harte Arbeit und Überforderung, das war auch sein Leben. In den letzten Jahren hatte er kaum noch Fracht. Das Schiff liegt noch lange in Spandau. Unbewohnt, verwaist, unnütz. Irgendwann ist es nicht mehr da. Hat sich nicht verkaufen lassen. Nur noch altes Eisen zum Verschrotten.
Das, worauf man gerade steht, kann wechseln. Aber selten das, worauf man von Jugend auf gegründet ist. Ich stehe früh auf schwankenden Planken. Auf ihnen mache ich erste Schritte; lerne ich gehen. Den Wind muss man bedenken, die Bewegtheit des Wassers und des tragenden Schiffes. Manchmal ist nachzufedern, damit man stehen bleibt. Manchmal ist es gut, eine Kajüte zu haben und anderes Wetter abzuwarten. Simsons Planken. Ich weiß, wie sie sich anfühlen, kenne ihre Musterung. Erinnerung an sie begleitet mich.
Erste Erinnerungen
Helle, Licht! Ein weißes Loch an der Decke. Wie eine grelle Lücke in der Erinnerung. Schritte. Da ist ein Menschengesicht, das im Licht auf mich zukommt. Lachende, neugierige Frauenaugen finden mich. Ich liege in einem winzigen Bett. Eine Kinderwiege. Ist es vielleicht nur ein Bretterkasten, schnell und grob aus der Not gezimmert? Oder sitze ich schon etwas älter auf einer Kommode und lasse die Beine baumeln – von irgendwem hingesetzt – wartend dass man mich wieder herunternimmt. Die Frau beugt sich über mich, lacht und küsst mich. Oder nimmt mich von der Kommode, drückt mich immer wieder an sich. Wie es auch gewesen ist. Sie hat mich in jedem Fall geküsst. Ich glaube ganz fest, dass sie mich geliebt hat. Denn ich habe es getan, oft habe ich es gedacht und meinen Kopf an ihre Wange gelegt. „Ich hab dich so lieb, ich liebe dich über alles, Mama.“
Dann gibt es noch eine andere Erinnerung. Diesmal weiß ich ganz genau, dass ich auf der Kommode sitze. Ich habe eine kurze Hose an, an den Füßen Söckchen. Andere Leute, Angehörige, sind mit im Raum. Oma lehnt nahe an der Kommode. Sie ist eine hoch gewachsene Frau mit einem schwarzen Rock. Dazu trägt sie eine blaue oder dunkle Strickjacke, so dass sie ziemlich finster aussieht. Ihr Haar ist weiß, sie hat eine Omafrisur mit einem Knoten, wie die meisten Frauen, die die Nazizeit hinter sich haben und zu alt für modische Frisuren sind. Dann ist da mein Halbbruder Karl-Heinz. Ein drahtiger, aber etwas kleiner junger Mann, Anfang zwanzig und hat ein schmuddeliges, mal weiß gewesenes Unterhemd an. Hände und Hose sind schmutzig vom abgewischten Öl. Vater ist nicht deutlich. Er ist mit im Raum, sein Gesicht aber hat keine Konturen. Auch Mutter ist da, glaube ich. Vielleicht ist sie aber auch in der Küche oder im Steuerhaus. Da sitzt es sich besser, besonders wenn die Sonne untergeht und der Familienrat mit Oma in der Kajüte Probleme erörtert. Mutter spricht nicht gern über Probleme.
Dieses Arrangement der Familiengestalten ist fest in meinem Gehirn verankert. Es geht um Berlin. Nichts kann nach Berlin rein und raus. Nur die amerikanischen Flugzeuge. Wir liegen mit dem Karl-Heinz-Schiff in Hamburg fest. Alle Grenzen und Zufahrtswege sind gesperrt. Aber Vaters Schwestern leben dort und Oma wohnt da auch, bei Tante Hilde in der Huttenstraße. Es ist ein ernstes Gespräch, was der Junge da auf der Kommode mit anhört. Ich bin angespannt, obwohl ich die Beine baumeln lasse und eigentlich nichts verstehe. Mutter aber zählt nicht. Sie spricht nicht mit und ist nicht da. Oma dagegen spricht viel. Sie ist eine Frau, die in der Familie das Sagen hat. Mutter aber zählt nicht und spricht nicht mit. Was soll sie auch sagen, wenn die Grenzen zu sind. Sie stammt ja nicht aus Berlin, sie ist eine Hamburgerin. Sie stammt ja nicht aus einer Schifferfamilie. Ihr Vater ist Kaufmann. Was soll sie da zur Schifffahrt schon sagen?
Vater
Das erste Mal als ich Vater auf einem Fahrrad sehe, bin ich vielleicht drei. Mutter geht oft mit mir in der Nähe des kleinen Schiffes in den Sträuchern und auf den Wegen an der Ilmenau spazieren. Wir warten auf Vater, Papa. Ich weiß nicht, wie ich zu ihm sage. Ob ich überhaupt schon was sagen kann? Später sage ich Vater. Wenn es um ernste Dinge geht. Doch meistens vermeide ich die Anrede.
An diesem Nachmittag wird er von uns erwartet. An beiden Seiten des Lenkers hängen volle Einkaufsnetze. Er fährt langsam über den holprigen Weg, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Ich werde von Mutter losgelassen und renne, so schnell ich kann auf ihn zu. Er nimmt einen Fuß vom Pedal und behält das Rad zwischen den Beinen. So steht er fest auf dem Boden und kann mich begrüßen. Gleich warnt er, wie es auch später noch seine Art ist: „Junge, pass auf. Tu, dir nichts.“ Er denkt, ich laufe gegen das Rad. „Vater!“ Ob er mich in seine Arme nimmt oder mir einen Kuss gibt, wie Mama es häufig macht? Wahrscheinlich beides nicht. Er ist ein unsicherer Vater.
Ich weiß damals nur, dass es mir gut tut, dass er da ist, wo Mama und ich doch lange auf ihn gewartet haben. Dann geht sie zu ihm. Beide küssen sich. Sie nimmt ihm die Einkaufsnetze ab. Er schiebt sein Rad das kurze Stück bis zum Schiff. Ich laufe hinter beiden her und freue mich, dass ich auf der Welt bin und Vater und Mutter habe.
Oma Krüger
Vater hat mit seiner Mutter äußerlich große Ähnlichkeit. Augenpartie und Wangenfalten hat er von ihr. Ansonsten wirkt der Charakterzug von Willensstärke, der diese Frau auszeichnet, sich kaum in seinem Leben aus. Er ist mehr Blatt im Wind als standhafte knorrige Eiche. Mehr Matrose und Hilfskraft als Steuermann an Bord seines Lebensschiffes.
Oma Krüger hat vier Kinder zur Welt gebracht. Vater ist davon der einzige Junge, und damit so etwas wie ein Hoffnungsträger. Später dann umso mehr auch die große Enttäuschung. Er betritt ohne Hebamme die Bühne des Lebens. Gerade als der Kahn der Krügers in der Nähe der Oranienburger Schleuse an einem Schlepper hängt. Wie ein Heldenmythos wird die Geschichte von Vaters Geburt in der Familie überliefert: Wie die jetzige Oma als junge Frau nur mit ihren Zähnen die Nabelschnur von Baby Heinrich durchtrennt. Während dieser dramatischen Minuten steht ihr Mann hinter dem Ruder mehr dem Kahn zur Seite als seiner Frau. Vater erzählt die Geschichte von der Tatkräftigkeit seiner Mutter gern. Sicher auch aus dem Gefühl heraus, sich selbst ein bisschen mit der Zähigkeit dieser Frau zu schmücken: „Seht, aus solchem Holz sind wir geschnitzt!“ Außer dieser Bewunderung ist von anderen Gefühlen, wie etwa Liebe zur Mutter oder der Mutter zu ihm, nie die Rede. Sie soll ergänzend zu ihrer Zähigkeit auch eine harte Frau gewesen sein.
Nach dem plötzlichen Tod Opa Wilhelms zieht sie von Landsberg zu ihrer besser gestellten Tochter nach Berlin-Moabit. Dort betreiben Tante Hilde und Onkel Willy ein Radiogeschäft. Was zuerst nur als Laden mit einem winzigen Fenster anfängt, wird bald in der Zeit der aufkommenden Musiktruhen, besseren Radios und Fernsehapparaten zu einer mehrere Fenster umfassenden Ausstellungsfläche. Ein übergroßes Firmenschild mit der Aufschrift „Huttenradio“ zieht die Blicke auf sich. Abends steht eine Menschentraube vor den Scheiben, um - wenn auch nur für kurze Zeit- in den Genuss einer Fernsehvorführung zu kommen.
Der Laden ist auch innen ansprechend eingerichtet. An den Wänden hängen Fotos von bekannten Größen der damaligen Musikszene, wie Cornelia Froboess und Peter Alexander. Tante Hilde und Onkel Willy haben mit ihrem Radiogeschäft den richtigen Riecher. Es füllt eine Marktlücke aus in einer Zeit, wo es langsam wieder aufwärts geht und die Menschen das Traurige der Vergangenheit mit Musik und Ratequiz vergessen möchten.
Dieses Geschäft bildet für Mutter und mich in den fünfziger Jahren so etwas wie eine Berliner Anlauf- und Zufluchtsstelle. Wenn wir nicht weiterwissen, heißt es: „Komm, lass uns zu Oma und Tante Hilde gehen.“ Einige Zeit später dann nur noch zu Tante Hilde und Onkel Willy, denn Oma Krüger ist es nur wenige Jahre vergönnt, den Lebensabend bei ihrer Tochter zu feiern. Oma hat für die Angehörigen ihrer Sippe immer ein gutes Herz Sie gibt Mutter und mir häufig ein bisschen Geld, wenn wir durch Berlin stromern und manchmal gar nichts mehr im Portemonnaie haben. Dann ermahnt sie mich: „Sag man Tante Hilde nichts.“ Sie kennt ihre Tochter, die Geschäftsfrau, durch und durch. Die würde Mutter zur Schnecke machen, wenn sie von der Schnorrerei erführe. Oma gibt manchmal einen zwanzig Mark Schein. Doch es kommt auch vor, dass es nur ein Fünfer wird, weil die Rente noch nicht da ist. Die Summe vermindert sich ebenfalls erheblich, wenn wir zu oft bei ihr vorbeischauen und Geld haben möchten. Aber auch, wenn alle Stricke reißen, bekommen wir dann immerhin noch fünfzig Pfennig für den Doppeldeckerbus, mit dem ich so gern fahre, weil man oben vorn so gut Busfahrer spielen kann. Als sie stirbt, sind wir gerade mit dem Schiff unterwegs und erfahren von ihrem Tod erst, nachdem die Beerdigung schon lange stattgefunden hat. Ihr Grab habe ich nie gesehen. Was ich schade finde. Überhaupt ist es in unserer Familie so, dass nach dem Tod eines Menschen nicht mehr viel von ihm gesprochen wird. Er hat eben seine Bedeutung für das praktische Leben eingebüßt. Die Krügers sind da wie viele andere Leute auch.
Tante Hilde hat mit Onkel Willy, der eigentlich Diplomingenieur ist, zwei Söhne, die sieben Jahre auseinander sind: Achim und Fritz. Wobei ersterer nicht mehr zu Hause wohnt, weil er schon seine eigenen Wege geht. Mit dem jüngeren und pfiffigeren Fritz spiele ich öfter, wenn wir zu Besuch sind. Er ist einige Jahre älter und für mich ein Vorbild, dem ich nacheifern möchte. Er sieht gut aus, geht auf das Gymnasium und scheint schier alles zu wissen. Ob es wirklich so ist, weiß ich wiederum nicht. Jedenfalls hat er auf alle meine kindlichen Fragen eine Antwort, die sich stimmig anhört. Wir spielen oft Mensch-ärgere dich nicht und Mühle oder Dame. Natürlich gewinnt er. Irgendwann bemerke ich, dass er es gut versteht, beim Spiel zu schummeln. Darüber bin ich ärgerlich und auch enttäuscht. Behalte aber meinen Frust für mich. Vielleicht, weil ich mich diesem Stadtkind gegenüber unterlegen fühle. Fritz macht Abitur, wird Journalist, schließlich ist er Manager. Dann verliere ich ihn aus den Augen, wie so manchen aus meiner Familie.
Nach über vierzig Jahren sehe ich ihn plötzlich wieder. Er gibt ein Interview im Fernsehen. Ist das eine Überraschung! Er und andere Wirtschaftsleute setzen sich für eine bestimmte Stadt als Austragungsort eines großen Sportereignisses ein. Dabei geht es um Geld und manche Ungereimtheiten. Trotz allem freue ich mich, ihn nach all den Jahren wieder zu sehen – wenn auch nur auf dem Bildschirm. Aus meinem Cousin ist ein älterer Herr mit einem gepflegten Schnurbärtchen geworden. Er erinnert mich an Walt Disney, dem Schöpfer von Micky Maus. Früher behauptete Fritz felsenfest Walt Disney sei eine Frau. Wusste er es wirklich nicht besser oder wollte er mich nur hereinlegen? Zuzutrauen ist es ihm.
Onkel Erich und Vaters Eifersucht
Kinder müssen früh ins Bett. Das gilt damals, und das ist wohl auch noch heute so. Da die Schiffer als fahrendes Volk sich gern den Leuten an Land anpassen, achten sie in den meisten Fällen sehr genau auf die Einhaltung dieser Regel.
So ist es auch beim Feierabend vor der Brandenburger Schleuse. Der Abend ist schön, Mücken tanzen, in der Kajüte ist es stickig, und alles spricht dafür, dass die Eltern noch nicht schlafen gehen wollen.
Im nahen Gartenlokal spielt man Tanzmusik. Meistens verursacht durch eine kleine 3-Mann-Kapelle, die immer mal wieder Pausen einlegt, um ihr spendiertes Pils zu trinken und den Gästen zum Sprechen und auch zum Pinkeln Gelegenheit zu geben. Das alles reizt zum Hingehen bei jungen Eltern, die gerne leben, auch wenn Vater schon Ende vierzig ist. Aber er genießt damals das Leben noch gern. Vater und Mutter sind nicht allein. Sie haben Schwägerin und Schwager im Schlepp. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Bodo-Schiff, damals noch Dampfer, hat ihren Kahn von Berlin auf Spree und Havel bis nach Brandenburg gezogen. Am anderen Morgen soll es weiter nach Hamburg gehen. Tante Erna und Onkel Erich sind ebenfalls nicht mehr ganz so jung. Erna muss schon Ende fünfzig sein. Sie ist von Vaters Geschwistern die Älteste und Onkel Erich sicher auch um den Dreh. Aber tanzen, mal ein paar Gläser über den Durst trinken und lustig sein, das lassen sich beide nicht nehmen. So ist es ausgemacht, dass man heute Abend ausgeht.
Ich soll also ins Bett. Obwohl es draußen noch hell ist. Mache kein Theater, denn ich bin ein ruhiges vernünftiges Kind, das seine Eltern lieb hat. „Wir gehen nur eben auf ein Bier und sind in einer halben Stunde wieder da.“ So sagen sie. „Schlaf mal schön.“ Dann klappt die Kajütentür. Die lauten Stimmen entfernen sich. Ich bin allein. Das Wasser gluckst ab und zu unter dem Schiffsrumpf. Das hat wohl nichts zu bedeuten. Ich schließe die Augen, um einzuschlafen. Die Musik im Gartenlokal spielt lauter. Das Meer von Stimmen wird davon übertönt. „Bumba, bumba, bumba“ dröhnt der Rhythmus. Ich forme meinen Mund, um „bumba“ zu sagen. „Bumba, bumba.“ Das macht Spaß. Warm und stickig ist es in der Kajüte. Es riecht nach Resten vom Mittagessen und Klo. Kein Wunder, der Kloeimer steht vor dem Küchenherd, den Boden nur knapp mit Havelwasser bedeckt. Soll ich einfach aufstehen? Die Petroleumlampe glänzt verführerisch auf dem Tisch. Aber ich trau mich nicht, sie anzuzünden. Da liegen Streichhölzer. Man muss sie stark an der Schachtel reiben, damit eine Flamme entsteht. Die Eltern haben mich immer wieder vor Feuer gewarnt. „Messer, Gabel, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht.“ Also habe ich Angst, dass die Streichhölzer bei einer falschen