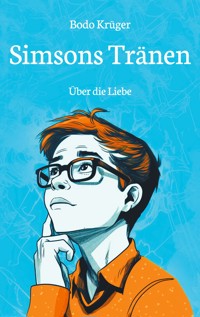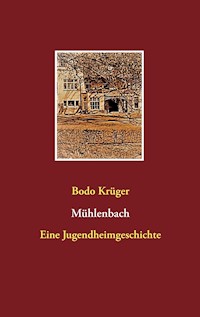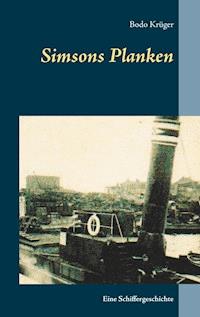5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Autor lebte bis zum 14. Lebensjahr auf einem Binnenschiff. Nach kurzer Schulzeit im Heim machte er eine kaufmännische Lehre und holte anschließend das Abitur nach. Er studierte Theologie und Philosophie und war bis zu seinem Ruhestand evangelischer Pastor. In diesem Roman wird der Pastor und Vormund Arno Breslauer an einen länger geplanten und immer wieder aufgeschobenen Besuch bei seiner psychisch erkrankten Mutter erinnert, die schon seit Jahren in einer Klinik lebt. Der Brief der Stationsärztin kommt gerade in einer für den Pastor schwierigen Arbeitssituation. Nur oberflächlich vernarbte alte Wunden reißen beim Sohn wieder auf. Das wird zum Anlass für eine Reise durch das Leben der Mutter und zu den eigenen Wurzeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für meine Mutter
Was ist schon im Leben eindeutig, machen wir es nicht erst dazu – oft mit viel Kraft und Anstrengung?
Maria Meyer-Schwarzberger
Inhalt
Das Mündel
Der Vormund
Die Ärztin
Der Notdienst ( 1.Teil )
Gedanken und Mutmaßungen über Irmas Bruder
Der Notdienst ( 2.Teil )
Gedanken und Mutmaßungen über Irmas Jugend
Der Notdienst ( 3.Teil )
Gedanken und Mutmaßungen über Irmas weiteres Leben
Die Reise nach Eichenhausen
Epilog
Anhang
Predigttext aus dem Neuen Testament ( Matthäus 25,1-13 )
Predigt zum Totensonntag
Das Mündel
Die Stationsärztin Dr. Meyer-Schwarzberger hatte schon einige Stunden Dienst hinter sich, als sie sich den schmucklosen Flachbauten mit den Frauenstationen näherte. Die Wege im Landeskrankenhaus waren nicht kurz. Was sich besonders bemerkbar machte, wenn man mehrmals am Tag zwischen den Stationen hin und her pendelte. Heute war es wohl das letzte Mal. Aber man wusste ja nie, ob es nicht doch plötzlich in einem dieser unscheinbaren Häuser einen Notfall gab, wo das Eingreifen der diensthabenden Psychiaterin geboten erscheinen würde.
Eichenhausen war ein Langzeitkrankenhaus für psychisch Kranke, die schon eine Reihe der gängigen Therapien hinter sich hatten und kaum noch Chancen, einmal wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn man gemein wäre, könnte man sagen, dass sie hier zum eigenen und zum Schutz der Gesellschaft verwahrt würden. In der Regel waren es Patienten mit Symptomen aus dem schizophrenen Bereich. Menschen, die irgendwann in ihrem Alltag aufgefallen waren, weil sie Absonderlichkeiten in ihrem sozialen Umfeld gezeigt hatten. Vielleicht gleich mit schweren Delikten wie Gewalttätigkeiten bis hin zur Lebensbedrohung anderer oder auch in allmählich sich steigernder Form, an deren Ende schließlich die Verwahrlosung drohte.
Frau Dr. Meyer-Schwarzberger war für längere Zeit von ihrem Dienst beurlaubt gewesen. Nun waren die Kinder aus dem Haus und auch der Ehemann ging zusehends mehr seine eigenen Wege. Für die Ärztin war nun die Zeit gekommen, die Arbeit in ihrem Beruf wieder aufzunehmen. Mediziner, die in einer solchen Klinik arbeiten wollen, sind nicht gerade zahlreich. Vor allem ist es eine gute Voraussetzung, wenn man Berufserfahrung und Gespür für Patienten mit den hier häufig anzutreffenden Symptomen mitbringt. Und wenn man bereit ist, sich in seinem Beruf mehr einzusetzen als man das nach geltendem Arbeitsvertrag eigentlich müsste.
Die Ärztin hatte das Gebäude erreicht. Sie öffnete mit ihrem Universalschlüssel die Haustür und wandte sich nach rechts. Nun stand sie vor der Station 3a, die im Parterre des zweigeschossigen Gebäudes untergebracht war. Hier musste sie ihren Schlüssel erneut benutzen.
Manchmal dachte sie belustigt, dass der Schlüssel zu den wichtigsten Werkzeugen ihrer Arbeit gehörte. Helles Licht, ein langer breiter Flur, an den Seiten Eingänge zu den Patientenzimmern. In jedem waren zwei Frauen untergebracht. Der Flur war breit genug, dass sich hier auch Rollstühle begegnen konnten. An seinem Ende befand sich ein Tagesraum. Dort nahmen die Patientinnen die Mahlzeiten ein und verbrachten den größten Teil ihrer Freizeit. Die Arbeitstherapie hatte ihre Räumlichkeiten in einem anderen Gebäude, sodass dadurch die Patientinnen das Gefühl hatten, richtig zur Arbeit zu gehen. Man traf allerdings dabei unten ihnen eine Auswahl. Auf keinen Fall durften Frauen, die fluchtgefährdet waren, ohne medikamentös eingestellt zu sein, die geschlossene Station verlassen. Es machten sich also nur ruhig gestellte auf den Weg zur Beschäftigungstherapie, die im Wirtschaftstrakt lag. Dazu gehörten eine Großküche, die alle neun Stationen mit Essen versorgte, die Vorratsräume und der Schälraum. Auf dem Flur roch es noch nach Mittagessen. Was vermischt mit Geruchsresten von Reinigungsmitteln eine Krankenhaus- oder Heimatmosphäre erzeugte. Wahrscheinlich gab es noch zusätzlich zum regulären Abendessen Reste vom Mittag. Man hörte Geräusche, die vom Hantieren mit Geschirr herrührten. Hin und wieder mischten sich Stimmen mit hinein. Etwas fiel herunter und dröhnte Sekunden nach, bis es schließlich zur Ruhe kam.
Die letzte Tür auf der linken Seite vor dem Tagesraum war das Stationszimmer. Die Ärztin trat mit Bestimmtheit ein. Sie schloss die Tür schnell, um zu vermeiden, dass sie von Patientinnen in ein Gespräch verwickelt wurde. Wie die meisten Zimmer dieser Art, war der Raum funktionsgerecht eingerichtet. Auffallend war die Trennscheibe, durch die man in den Tagesraum blicken konnte. Sie ließ keine Geräusche hindurch. Man konnte sich also ganz normal unterhalten und auch über Vorfälle auf der Station sprechen, ohne dort gehört zu werden. Da man aber auch von drüben gesehen wurde, kamen die Frauen häufig ganz dicht an die Scheibe heran. Manche drückten einen Kuss auf das Glas oder winkten, um Aufmerksamkeit zu erregen. An einem größeren Tisch fanden sechs Personen Platz. Die Stühle wirkten preisgünstig, aber bequem. Eine grelle Neonbeleuchtung an der Zimmerdecke wurde durch zwei moderat schimmernde Stehlampen domestiziert. Medikamentenschränke und eine fahrbare Patientendatei, die auf einem teewagenähnlichen Gestell stand, ergänzten das Anstaltsambiente.
„Hallo, da bin ich mal wieder. Gibt’s was Neues?“ Die Ärztin. wandte sich an eine Frau mittleren Alters mit einem grauen Bubikopf, der vermuten ließ, dass er mal ein Schwesternhäubchen getragen hatte. Doch diese Zeiten waren vorbei. Jetzt wünschte man, dass das Pflegepersonal möglichst familiär den Patienten begegnete. Die weiblichen Pflegekräfte waren nur noch an einer grauen Schürze und einem Button mit Namen auf der Strickjacke oder Bluse zu erkennen. Schwester Louise saß mit dem Gesicht zur Tür hinter einem Schreibtisch. Vor sich hatte sie eine Patientenakte, die sie von einem hohen Stapel genommen und nach kurzem Hineinschauen auf einen niedrigeren legte. Sie war nicht allein. Am sogenannten Besprechungstisch saß ein junges Mädchen, das damit beschäftigt war, mit gut lesbaren Buchstaben etwas in ein Oktavheft zu schreiben. Auf ihrem Button stand „Sabine“ und mit kleiner Schrift darunter „Stationspraktikantin“. Sie sah nur kurz auf, als die Ärztin hereinkam und wandte sich gleich wieder dem Prokolieren oder Planen ihrer Arbeitstage zu. „Unsere Frau Breslauer hat sich mit ihrer Tischnachbarin angelegt.“ Louise Hartmann holte zum längeren Erzählen aus. Die Ärztin ergriff einen Stuhl und ließ sich ein wenig fläzig darauf nieder. Sie bekam plötzlich Lust auf eine Zigarette. Zwang sich aber zur Beherrschung. Die Frauen im Tagesraum richteten sich sowieso schon ihre Gesundheit mit Kettenrauchen zugrunde. „Man hat doch eine Verantwortung diesen armen Geschöpfen gegenüber“, dachte sie. Doch gleich rief sie ihr Inneres wieder zur Ordnung: „Das sind ganz normale Kranke, keine armen bedauernswerten Geschöpfe, wie man das vor hundert Jahren diskriminierend meinte. Schizophrenie kann jeder kriegen, wie Arthrose oder Krebs.“
„Und was geschah weiter?“ Wandte sie sich nun betont interessiert der Stationsschwester zu. „Ja, die beiden Frauen hatten in letzter Zeit manchmal Streit, obwohl sie früher befreundet waren. Sie waren ja zusammen vor bald zehn Jahren aus dem Landeskrankenhaus in Lg. gekommen. Ein Herz und eine Seele wie Pat und Patachon. Ich musste immer lachen, wenn ich die Breslauer mit Frau Wolf im Garten sah.“ Schwester Louise schmunzelte bei dem Gedanken, dass auch sie schon zum Urgestein von Eichenhausen gehörte. Ja, auch sie hatte in den Jahren hier manche Stationsärzte kommen und auch wieder gehen sehen. Sie würde wohl auch die jetzige noch beruflich überleben. Bereitete ihr das Genugtuung? „Nein“, sagte sie sich. „Aber man merkt eben doch, wie die Zeit vergeht.“ Dann ist sie wieder bei der Schilderung des Zwischenfalls auf der Station. „Irmi, ich meine Frau Breslauer, schrie plötzlich auf und schlug auf ihre Tischnachbarin heftig ein. Ich war erstaunt, was die noch für Kräfte hat. Sie hätte Frau Wolf erwürgt, wenn wir nicht sofort dazwischen gegangen wären.“ „Was war denn eigentlich der Anlass für ihren Wutausbruch“ Um den Jipper auf die Zigarette in den Griff zu bekommen, hatte sich die Ärztin einen Pfefferminzkaugummi in den Mund geschoben. „Die Breslauer meinte, Frau Wolf hätte sich die größere Roulade auf den Teller gelegt. Das brachte sie völlig in Rage. Dabei ist es doch gerade Irmi Breslauer selbst, die sich beim Essen alles hineinstopft. Sie hat ja nun wirklich reichlich Übergewicht.“ Die Ärztin nickte bestätigend. „Nachdem sie immer weiter schrie und um sich schlug, mussten wir ihr eine Beruhigungsspritze geben. Jetzt ist wieder alles im Lot.“ Die Ärztin atmete kaum hörbar auf. „Wo ist die Patientin jetzt? Ist sie auf der Krankenstation?“ „Das war nicht notwendig. Nachdem das Essen abgetragen und die Frau Wolf auf ihr Zimmer gegangen war, klang die Wut der Breslauer schnell ab. Übrigens dort an der Wand sitzt sie und tut lammfromm, als könnte sie kein Wässerchen trüben.“ Louise deutete auf das Glasfenster, das den Blick in den Tagesraum der Patientinnen gestattete.
„Na, das habt ihr ja gut im Griff gehabt“, sagte die Ärztin und war plötzlich in Eile. „Ich nehme mir mal die Akte Breslauer mit. Muss da mal was raussuchen. Der Vormund muss einen Bericht für das Gericht schreiben. Er hat angefragt, wie es seiner Mutter geht.“ Sie klemmte sich eine prall gefüllte grüne Mappe unter den Arm. „Also schönen Abend noch! Hast du heute Nacht frei?“ Sie schaute die Schwester etwas fragend an. „Ja, zum Glück. Gleich muss auch die Nachtschicht kommen, dann bin ich sofort weg.“ Maria Meyer-Schwarzberger hatte die Tür zum Flur schon hinter sich schnell ins Schloss fallen lassen.
Mit wehendem Kittel über Winterrock und Pullover eilte sie über den langen hellen Gang nach draußen. „Man muss, wenn man mehrmals am Tag über das Gelände läuft, aufpassen, dass man sich nichts wegholt, immerhin haben wir schon Ende Oktober.“ Stellte sie fest und fand es in Ordnung, dass sie auch mal wieder an sich selbst denken konnte. Nach etwa zehn Minuten war sie mit dem ziemlich schweren Aktenvorgang unter dem Arm am Haupthaus angekommen. Hier hatte sie ein Büro. Sogar mit Vorzimmer und einer Sekretärin. Die sie sich allerdings mit dem Direktor teilen musste. Der hatte ja noch mehr Verwaltungskram am Hals als sie, die sich schon langsam auf den totalen Ruhestand vorbereitete. Als Haupthaus wurde der alte Klostertrakt bezeichnet, der in früheren Zeiten einmal den Zisterziensern Heimstatt, Gebets- und Arbeitsstätte war. Die dazu gehörigen umfangreichen Ländereien bildeten die Voraussetzung für das heutige Klinikgelände. Hier schlug jetzt das verwaltungsmäßige Herz des Landeskrankenhauses. Mit den Büros für den ärztlichen Direktor, der Pflegedienstleitung und des Verwaltungsleiters, der auch das Personalwesen unter sich hatte. Außerdem gab es einen technischen Leiter, der einer Reihe von Leuten vorstand, die man im Volksmund als Hausmeister bezeichnete. Maria Meyer-Schwarzberger war froh, dass die leitenden Stationsärzte hier etwas abseits von ihren täglichen Aufgabenfeldern ihre Arbeitszimmer hatten. Hier konnten sie ungestört Gespräche führen, Akten studieren, Berichte, Gutachten und Briefe schreiben oder entwerfen.
Die Ärztin nahm in ihrem spärlich eingerichteten Arbeitszimmer an dem braunen Schreibtisch Platz, an dem schon einige Mediziner vor ihr Patientenakten durchgesehen hatten. Innerlich gesammelt legte sie die mitgenommene Akte vor sich auf die Schreibtischplatte. Ja, das konnte sie, ihre gesamte Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken. Konzentration im entscheidenden Moment, das war ihre Stärke. Damit hatte sie schon als Studentin ihre Prüfer beeindruckt. Aber das war lange her. Wenn man älter ist, wird diese Selbstverständlichkeit eben doch zu einer Eigenschaft, für die man immer dankbarer wurde. Wie so oft, bevor sie eine Arbeit begann, streifte ihr Blick das Gemälde von Turner, das den Mittelpunkt der rechten Wand ihres Arbeitszimmers bildete. Eigentlich sah man darauf nur bläuliche Nebel. Die aber je weiter man sie nach oben verfolgte immer durchsichtiger wurden. Waren es nicht Bäume und Äste, die man je länger man hinschaute, wahrzunehmen glaubte? Ihr gefiel dieses Bild. Es hatte einige Jahre in ihrem Zimmer zu Hause in L. gehangen, während ihrer beruflichen Abstinenz. Sie hatte es, nachdem sie die Stelle bekommen hatte, mitgebracht und hier aufhängen lassen. „Was ist schon im Leben eindeutig?“, sinnierte sie. „Machen wir es nicht erst dazu, oft mit viel Kraft und Anstrengung?“
Dann öffnete sie den mitgebrachten Aktenvorgang. „Irma, Emma, Dorothea Breslauer, geborene Horn. Geboren am 12. Januar 1913 in Hamburg.“
Die Ärztin nahm einen Notizzettel vom Stapel auf dem Schreibtisch. Nach kurzem Zögern begann sie mit einer allem Ärzte-Gekritzel widersprechenden gut lesbaren Handschrift zu schreiben:
„Auffällig ist, dass der Vormund (Sohn) von Frau I. Breslauer, die schon seit fast zehn Jahren auf der geschlossenen Frauenstation unseres Landeskrankenhauses lebt, nur sporadisch den Kontakt zu seinem Mündel (Mutter) pflegt. Und eigentlich auch nur, wenn es gar nicht mehr anders geht, mit dem Landeskrankenhaus in Kontakt tritt. Das hat dazu geführt, dass sich auf dem Eigengeldkonto obiger Patientin über einen längeren Zeitraum eine stattliche Summe von 2300,-DM angesammelt hat und dort eigentlich nur lagert, ohne für die Patientin von Nutzen zu sein. Diese Gelder sollen aber zum Wohle der Patienten eingesetzt werden.“
Sie hielt mit dem Schreiben inne und dachte: „Am besten ich teile das dem Vormund mal schriftlich mit. Seltsam, dass der so wenig in Erscheinung tritt. Bin doch nun schon einige Zeit hier, und ich kenne ihn gar nicht.“
Dann dachte sie an das Gespräch vorhin mit Louise auf 3a. An das Fenster zum Tagesraum, an die Patientinnen, die den Rahmen ausfüllten.Die vorwiegend älteren Frauen saßen auf Stühlen oder abgenutzten Möbelstücken an den Seiten. Manche schliefen entspannt, manche starrten angespannt irgendwo hin ins Leere. Andere sprangen immer wieder auf. Wie Unbeholfene bei einer Turnübung. Streckten die Arme noch oben oder schlugen ihre Hände mit Wucht gegen den Kopf. Doch die meisten saßen nur lethargisch da und dösten vor sich hin. Welche von den Frauen hinter der Glasscheibe war noch mal Frau Breslauer? Einen Herrenschnitt hatten ja fast alle. Eine Kittelschürze auch. Dann erinnerte sich die Ärztin wieder. Sie saß in der Nähe des Fernsehers. Von Wut und Aufregung war ihr nichts mehr anzumerken. Sie wirkte nun eher entspannt, wenn sie auf den Bildschirm schaute. Außerdem sah sie für ihr Alter noch ganz passabel aus. Im Gegensatz zu manchen anderen, die durch körperliche Handikaps auffielen. Nur dick war sie, gerade um den Bauch herum. Adipositas. Sie aß zu viel. „Bei den Mahlzeiten stopft die Patientin alles in sich hinein“, stand in mehreren Klinikberichten, die die Ärztin selbst verfasst hatte. Wenn sie nicht gerade mit dem Essen beschäftigt war, paffte sie eine Zigarette nach der anderen. Bei ihr nützten Ermahnungen nichts. Sie war Kettenraucherin. Aber damit stand sie nicht allein. Viele der Patientinnen, die in ihrem Leben Alkoholprobleme hatten, verlegten sich bei striktem Alkoholverbot, wie es auf allen Stationen praktiziert wurde, auf das Rauchen. Damit der Tagesraum von Zigarettenqualm verschont blieb, war man dazu übergegangen die Besucherzimmer zu Raucherräumen umzufunktionieren. Wenn jemand von den Angehörigen, der Nichtraucher war, diese Räume betrat, fragte er bald, ob er mit seiner Verwandten spazieren gehen dürfte. Frau Breslauer war hier also mit ihrer Rauchsucht in guter Gesellschaft. Personal, Ärzte und Psychologen sahen darin das kleinere Übel. Schwerwiegender war der zunehmende Persönlichkeitsverfall, der mit der Krankheit zusammenhing. Wenn man Irma Breslauer nicht dazu anhalten würde, sich regelmäßig zu waschen und auf ihre Kleidung zu achten, würde sie es nicht tun und sich total körperlich vernachlässigen. Aber trotz mancher Hilfestellungen und medizinischer Maßnahmen bekam sie ab und zu aggressive Anwandlungen. Dann sprang sie plötzlich auf und griff Mitpatientinnen an, weil sie sich über irgendwas geärgert hatte, so wie heute Abend. Ebenfalls kam es vor, dass sie plötzlich gellend aufschrie und um sich schlug, als müsste sie sich gegen unsichtbare Bedrohungen wehren. „Das sind die Stimmen“, dachte die Psychiaterin. „Die Stimmen, von denen in zahlreichen Gutachten der Kollegen und auch von ihr selbst immer wieder die Rede war. Schon in den älteren Berichten aus den 60ger Jahren schrieben die von akustischen Halluzinationen, die ihr Befehle erteilten.“
In diesen frühen Phasen ihrer Erkrankung konnte sie aber immer wieder nach Ablauf der klinischen Behandlung zu ihrem Ehemann nach Hause zurückkehren. Wobei sie gar keinen festen Wohnsitz hatte. Sie wohnte auf einem Binnenschiff, auf dem sie mit ihrem Mann Flüsse und Kanäle befuhr. Das ging dann eine Weile gut, bis sich die Erkrankung wieder meldete; meistens heftiger als zuvor. Wenn sich eine neue akute Phase ankündigte, so war das daran zu erkennen, dass die Patientin fluchtartig das Schiff bei der nächsten Gelegenheit verließ. Sie musste dann gesucht werden, oftmals auch mit der Polizei. Nachdem man sie gefunden hatte, stellte sich heraus, dass sie oft Tage und Nächte ziellos herumgeirrt war. Der Ehemann war ein einfacher Mann, der mit der Erkrankung seiner Frau vollkommen überfordert zu sein schien. Er gab damals dem Medizinalrat Dr. W. aus Lg. zu Protokoll, dass es auch noch einen 17-jährigen Sohn gab, der in Hamburg Kaufmann lernte. Wenn der wieder auf das Schiff zurückkommen würde, dann könnte der ja auf seine kranke Mutter aufpassen. Vielleicht würde sie ja auf den hören. Früher hätte sie das immer getan.
Dr. Meyer-Schwarzberger schaute sich den alten ersten Bericht an. Er war datiert vom 2.Juli 1962. Der Ehemann war drei Jahre später verstorben. Bis zu seinem Tod war er der amtliche Vormund seiner Frau. Danach hatte der Sohn nach Erlangung der Volljährigkeit die Aufgaben des Vaters vom Vormundschaftsgericht übertragen bekommen. „Also schreiben wir dem mal, damit er den weiteren Verbleib seiner Mutter in unserer Einrichtung beim Gericht beantragen kann.“ Die Ärztin nahm das Diktiergerät, schaltete es ein und begann mit ruhiger, gleichmäßiger Stimme zu sprechen: „Briefkopf: Westfälisches Landeskrankenhaus Eichenhausen und so weiter. Herrn Arno Breslauer, Adresse und so weiter. Als Datum bitte den 20.Oktober 1982. Betrifft: Patientin Irma Breslauer und so weiter. Ihre Anfrage zum Eigengeldkonto und zum Verbleib in unserer psychiatrischen Einrichtung.
Sehr geehrter Herr Breslauer,
mir ist aufgefallen, dass sich auf dem Eigengeldkonto Ihrer Mutter hier bei uns ein stattlicher Betrag von 2300,-DM angesammelt hat. Das Geld soll den Patienten zugutekommen. Ich würde vorschlagen, Sie kaufen ihrer Mutter eine hochwertige Bettdecke, die in ihren Privatbesitz übergehen kann. Davon hat sie wirklich etwas. Vielleicht kaufen Sie ihr auch das eine oder andere Kleid. Allerdings müssen Sie bedenken, dass Ihre Mutter unter Adipositas leidet und wegen ihres Körperumfanges nur extrem starke Größen tragen kann. Vielleicht setzen Sie sich diesbezüglich einmal mit der Stationsschwester in Verbindung. Oder Sie bitten sie, die Einkäufe für Ihre Mutter an Ort und Stelle vorzunehmen.
Aber am besten wäre es, wenn Sie selbst diese Sachen bei einem Besuch vorbeibringen würden. Diese Patienten leben davon, dass sie Kontakt zu ihren Angehörigen behalten. Auch wenn man sich vielleicht gar nicht so viel zu sagen hat, die Geste zählt.
Hier stellte die Ärztin das Diktiergerät kurz ab. Es war fast schon neun geworden. Aber sie wollte diesen Brief noch zu Ende diktieren. „Die Geste, ja Geste ist gut.“ Dachte sie. Also begann sie den Satz noch einmal.
Es kommt bei diesen Kranken darauf an, da, wo im Leben die Wurzeln zur Tiefe der Persönlichkeit abgestorben sind, wenigstens die Gesten von Liebe und Verbundenheit nicht abreißen zu lassen. Sie glauben gar nicht, sehr geehrter Herr Breslauer, wieviel Sie durch diese Gesten im Wohlbefinden Ihrer Mutter bewirken können.
Ansonsten habe ich den Eindruck, dass sie gern in unserer Einrichtung lebt. Im Verlauf der letzten Monate hat sich an der Erkrankung keine wesentliche Änderung gezeigt. Wie Sie wissen, ist Ihre Mutter an einer seit vielen Jahren bestehenden Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis erkrankt, die mit der Zeit zu einer Persönlichkeitsveränderung geführt hat. Gleichzeitig kommt es bei ihr immer wieder zu depressiven Verstimmungen. Im Laufe der Jahre ist außerdem ein geistiger und körperlicher Abbau bei ihr erkennbar.
Insgesamt bin ich der Meinung, dass bei der vorliegenden Erkrankung Ihrer Mutter, die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wie in unserer Klinik nach wie vor notwendig ist.
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Meyer-Schwarzberger, Landesobermedizinalrätin
Die Psychiaterin schaltete das Gerät nun endgültig aus und legte es zum Abhören und Schreiben des Briefes in den Briefkorb für die Sekretärin. Dann atmete sie stark aus und sprach zu sich selbst: „Das sollen die dann morgen im Büro tippen. Ich habe heute genug getan. Einmal ist auch Schluss.“
Sie legte ihren Arztkittel über den Stuhl, zog den regenfesten Mantel an und eilte über die Flure der ehemaligen Abtei zum Mitarbeiterparkplatz. Dann ließ sie sich in den Autositz fallen und fuhr in die Dunkelheit hinein, die von den Scheinwerfern des Wagens erhellt wurde.
Der Vormund
Er saß am Schreibtisch. Wenn er sich umwandte, blickte er in einen spätherbstlichen Garten. Die meisten Bäume hatten ihr Laub schon abgeworfen. Nur wenige Blätter hielten noch den Herbststürmen stand und hingen an den Zweigen. Der Vormund begann seinen Dienst zwischen acht und neun. Vor einigen Monaten war er Vater geworden und wollte sich als guter Vater erweisen. Deshalb wachte er nachts am Bett seines Sohnes, wenn der nicht einschlafen konnte. Frieda, seine Frau, befand sich in Elternzeit und war deshalb zu Hause. Normalerweise arbeitete sie als Sozialpädagogin in einer Schule für behinderte Kinder. Vielleicht war das der Grund, warum er dachte, dass gesunde Kinder nicht selbstverständlich sind. Und dass wiederum auch der Grund für sein nicht stabiles gutes Gewissen in Bezug auf seine Vaterrolle; wenigstens ein Grund. Ein anderer bestand in der Art, wie er seinen Beruf ausübte. Er befand sich ständig auf dem Sprung und hatte zu Hause oft ein schlechtes Gewissen.
Der Vormund hatte die Stelle in dieser Vorstadt- Kirchengemeinde vor zwei Jahren bekommen. Sein Dienstsitz, das Pastorat, lag relativ weit von Kirche und Gemeindezentrum entfernt. Er musste erst eine Strecke mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß bewältigen, um dort hin zu gelangen. Deshalb hatte er ein persönliches Arbeitszimmer zu Hause. Dort saß er also an diesem Morgen und studierte den Terminkalender. Neugierig darauf, was der Tag wohl alles an Ereignissen für ihn bereithalten würde.
Um neun war die, im wöchentlichen Turnus stattfindende Mitarbeiterbesprechung. Bei der er seinen älteren Kollegen und die anderen Mitarbeitenden treffen würde. Diese Zusammenkunft löste sich meistens nach zwei Stunden auf; was vom Interessantheitsgrad der behandelten Themen abhing. Nach der persönlichen Meinung des Pastors wurden hier zu viele Belanglosigkeiten durchgehechelt. Doch in der Regel war es hilfreich, sich abzustimmen und die Termine miteinander abzugleichen, damit man nicht nebeneinanderher arbeitete. Der Gemeinschaftsgedanke war den Beschäftigten wichtig. Wenn sich viele für ein Projekt begeistern konnten oder wenigstens bereit waren, sich daran zu beteiligen, dann musste die Sache doch besser gelingen, als wenn Einzelkämpfer sich allein an ihren Schreibtischen ihre individuellen Gedanken machten, glaubte man. Pastor Breslauer aber ertappte sich häufiger bei dem Gedanken, dass es auch den Spruch gab: „Viele Köche verderben den Brei.“ Doch das behielt er lieber für sich. Jedenfalls war er froh, wenn die vorgesehene Zeit möglichst genau eingehalten wurde, und er bald wieder an seinem Schreibtisch sitzen konnte.
An diesem Vormittag erwartete er noch einige Anrufe wegen des bevorstehenden Gemeindeseminars. Außerdem würde die Post sicher schon dagewesen sein. Mit der auch noch schriftliche Anmeldungen eintrudeln konnten. Ganz nebenbei freute er sich auf Frieda und den Kleinen. Der war mit Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Seine Frau war durch und durch ängstlich. Breslauer fand, dass sie sich jeden unnötigen Stress und Schmerz bei der Geburt ersparen sollte. Am frühen Nachmittag müsste er schon wieder los. Heute hatte er Konfirmandenunterricht. Auch der Abend war durch eine Sitzung verplant. Doch jetzt wollte er sich Zeit lassen wenigstens in Ruhe die Post zu lesen oder zu überfliegen. Sie war durch den Briefschlitz an der Haustür auf den steinernen Fußboden gefallen.
So sammelte er also, wie an jedem Tag, den Stapel an Zustellungen ein und begab sich in sein privates Reich. Frieda war mit dem Kind noch unterwegs. „Sie kennt Gott und die Welt“, dachte er. „Sie wird sicher erst zurückkommen, wenn ich schon beim Konfirmandenunterricht bin.“ Er schaute auf seine Armbanduhr und dachte: „Wenn das Postangucken nicht zu lange dauert, habe ich vielleicht noch Zeit zum Chinesen zu gehen.“
Die Kirchenverwaltung hatte geschrieben. Den umfangreichen Vorgang legte er in einen Briefkorb für die spätere Bearbeitung. Es waren, wie erwartet, noch schriftliche Anmeldungen für das Seminar dabei. Dafür hatte er einen extra Ordner. Auch Werbung lag zwischen der Post und wurde aussortiert. Zuletzt blieben noch die privaten Briefe, die für Frieda und ihn bestimmt waren – meistens Arztrechnungen.
Dann stutzte der Pastor. Da war ja noch ein Brief. Den hatte er gar nicht bemerkt. Er trug den Absender: Westfälische Klinik für Psychiatrie Eichenhausen