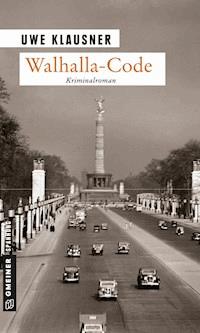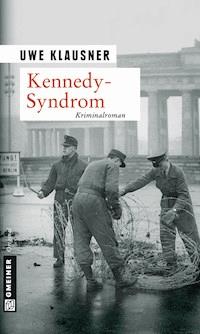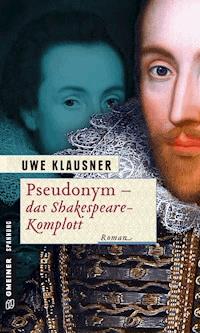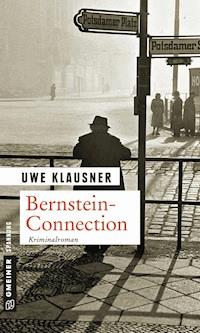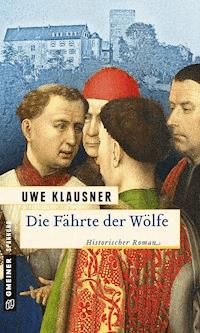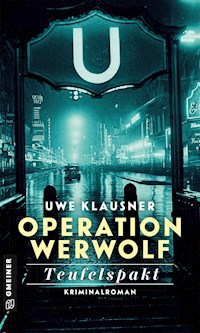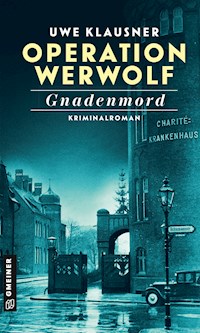Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Genf, 10. September 1898. Auf einer ihrer zahlreichen Reisen macht Elisabeth von Österreich im Hotel Beau Rivage Station. Dank eines Informanten der Lokalpresse bleibt der Aufenthalt der inkognito reisenden Kaiserin jedoch nicht geheim. Und so geht Cesare Monteverdi, Redakteur der Tribune de Genève, auf der Uferpromenade unweit des Hotels in Position, um die öffentlichkeitsscheue Monarchin abzulichten. Die Absicht, das Foto seines Lebens zu schießen, wird jedoch jäh durchkreuzt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Klausner
Sisis letzte Reise
Historischer Kriminalroman
Impressum
Alle Bücher von Uwe Klausner finden Sie unter www.gmeiner-verlag.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Arpád_von_Koppay_-_Kaiserin_Elisabeth_von_Österreich_auf_den_Stufen_des_Achilleons.jpg
ISBN 978-3-8392-5684-8
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind zu Teilen fiktional
TATORTSKIZZE
Zitat
Kaiser Franz Joseph I.
an seine Frau Elisabeth, genannt »Sisi«
(10. September 1898):
Adieu, schöner, guter, süßer Engel. Dein Kleiner.
Der Brief erreichte die Kaiserin nicht mehr.
REALE CHARAKTERE
(in alphabetischer Reihenfolge)
Elisabeth, genannt »Sisi«(1837–1898), Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn
Jean Fernex, Direktor des Évêché-Gefängnisses in Genf
Luigi Lucheni (1873–1910), italienischer Hilfsarbeiter und Attentäter
Irma Sztáray, Hofdame der Kaiserin Elisabeth
FIKTIVE CHARAKTERE
(in alphabetischer Reihenfolge)
Auguste Beaulieu, 27, Privatermittler und Konzertpianist
Dr. Max Burgstaller, Rechtsanwalt
Justine Delacroix, Inspizientin am Grand Théâtre de Genève
Mademoiselle Filigran, Beaulieus Vermieterin
Urs Lienhard, Chefredakteur der ›Tribune de Genève‹
Maurice Lupin, Kriminalkommissar
Inès Mirabeau, genannt »Schneewittchen«, Amüsierdame in Madame Passepartouts Etablissement
Cesare Vittorio Emanuele Monteverdi, 28, Redakteur bei der ›Tribune de Genève‹und Beaulieus ehemaliger Schulkamerad
Mademoiselle Papillon, Lienhards Sekretärin
Madame Passepartout, Bordellbesitzerin und Beaulieus Confidante
Raymond Pelletier, Prokurist bei der ›Crédit de Genève‹
Jean-Jacques Vannod, Gefängniswärter
Hugo Villefranche, Gendarmerie-Obermeister und Lupins Mann fürs Grobe
Des Weiteren:
Ein Kutscher
VORBEMERKUNG
Um die Authentizität zu wahren, wurden die französischen Begriffe u. a. bei Ortsbezeichnungen, Eigennamen und feststehenden Begriffenso weit als möglich beibehalten. Auch auf Anführungszeichen wurde in den genannten Fällen verzichtet.
Zitat
»In ihren Dichtungen sah sie (Elisabeth) sich meist als Feenkönigin Titania. Die erfolglosen Verehrer wurden als Esel dargestellt – wie im »Sommernachtstraum«, Elisabeths Lieblingsstück. In jedem Schloss, das die Kaiserin bewohnte, befand sich ein Bild Titanias mit dem Esel. (…)
Immer wieder beklagte sie Titania, die nie Erfüllung in der Liebe fand.«
Nur ich, die schier wie Verfluchte,
Ich Feenkönigin,
Ich find nie das Gesuchte,
Nie den verwandten Sinn.
(zit. bei Brigitte Hamann, Elisabeth. Kaiserin wider Willen. Wien – München 1982, S. 397)
ERSTES BUCH
GENF, 19. OKTOBER 1910
PROLOG
1
Jean Fernex, Direktor des Évêché-Gefängnisses, an den Polizeipräsidenten von Genf
»Oh mon Dieu, was ist denn hier los?«
»Der italienische Bastard hat sich erhängt, das ist los!«, platzte ich heraus, riss Vannod die Lampe aus der Hand und leuchtete dem Häftling aus Zelle 68 ins Gesicht. Kein Zweifel, um den Hurensohn war es nicht schade. Kein Mensch würde ihm auch nur eine Träne nachweinen. Und ich selbst am allerwenigsten. Nun ja, mit seinem Anblick war das freilich so eine Sache. Gliedmaßen wie ein Gnom, die Gesichtspartie grotesk verfärbt, unförmige Nase, geblähte Nüstern, hervorquellende Augen, Zunge wie ein Reptil. Kurzum, nichts für Ästheten. Und schon gar nichts für Leute mit schwachen Nerven. Etwa für einen Waschlappen wie Vannod, der wie ein Klageweib mit den Armen herumfuchtelte. »Oder denken Sie, er macht das nur zum Zeitvertreib?«
Na schön, ich gebe es zu. Es gehört sich nicht, über Tote herzuziehen. An der Tatsache, wer da von der Decke der Dunkelzelle baumelte, änderte dies jedoch nichts. Hatte mir dieser Querulant doch mehr Scherereien gemacht als sämtliche Knastbrüder zusammen. Andauernd Streit anfangen, die Zelle verwüsten, am Essen herummeckern und das Personal und mich auf das Übelste beschimpfen. Dass ich ihm das nicht durchgehen ließ, wird man ja wohl verstehen. Andernfalls hätte ich mich zum Gespött gemacht. Und so gab es nur einen Ausweg, nämlich drei Tage Dunkelarrest. Viel genützt hat diese Maßnahme leider nicht, und wenn ich ehrlich bin, ich wusste es schon im Voraus. Von daher hielt sich meine Trauer über sein Ableben in Grenzen.
Eins war von vornherein klar. Bei meinen Vorgesetzten würde die Nachricht wie eine Bombe einschlagen. Daran anschließend würden sich die hohen Herren auf die Suche nach dem Schuldigen für das Malheur begeben. Fast zwangsläufig würde dabei die Gefängnisleitung ins Visier geraten – also ich. Frei nach dem Motto: »Tritt nach unten, damit du obenauf bleibst.«
»Nein, Monsieur le Directeur, natürlich nicht.« Selbstmord in der Dunkelzelle. Schlimmer ging es wirklich nicht. Und dann auch noch Vannods Gewinsel, einfach zum Davonlaufen. »Wie konnte das bloß passieren!«
»Das frage ich Sie, Vannod.« Und das ausgerechnet mir, wo ich doch weiß Gott schon genug Probleme am Hals hatte. Und jede Menge Widersacher, die nur darauf warteten, mir eins auszuwischen. Allen voran die Reporter, meine Intimfeinde schlechthin. Eine Schande ist das, kaum zu glauben, was sich die Schmutzfinken vom Journal herausnehmen. Von nichts eine Ahnung, aber große Reden schwingen und kein gutes Haar an meiner Amtsführung lassen. Wirklich unerhört, die sollten sich was schämen. Ein Gefängnis ist schließlich kein Erholungsheim, auch wenn die Herren von der Presse das anders sehen. An manchen Tagen geht es hier zu wie im Irrenhaus, das kann ich mit Fug und Recht versichern. »Verdammt, wie stehen wir jetzt bloß da!«
Dass Häftlinge durchdrehen, ist weiß Gott nichts Neues. Wer könnte es den armen Teufeln verdenken. Aber wie man die Ruhe besitzen und bis zuletzt Arien schmettern kann, das will mir partout nicht in den Kopf.
Apropos Oberstübchen. Ganz richtig im Schädel war der Kerl ohnehin nicht gewesen. Und das ist noch zuvorkommend ausgedrückt. Wer, frage ich mich, macht sich die Mühe und kritzelt ein Heft nach dem andern voll, um sein verpfuschtes Leben auszubreiten. Antwort: einer, der mit der Realität auf Kriegsfuß steht. Der sich einbildet, Großes vollbracht zu haben.
Ein Wirrkopf, der um keinen Preis in Vergessenheit geraten möchte.
Nun ja, was das anging, konnte Lucheni beruhigt sterben. Der Platz in den Geschichtsbüchern war ihm sicher, so gut wie jedenfalls. So sicher wie eine Fahrkarte in die Hölle. Einfach, versteht sich. Schließlich hatte er die Kaiserin von Österreich auf dem Gewissen, wodurch der Herumtreiber zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt war. Vor zwölf Jahren hatte der Fall ganz Genf in Atem gehalten und für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Attentat auf die legendäre Sisi, dereinst schönste Frau der Welt, am helllichten Tag, vor den Augen zahlreicher Passanten, begangen von einem ruchlosen Anarchisten: Das war der Stoff, aus dem die fünfstelligen Auflagen gemacht waren. Der Stich war mitten durchs Herz gegangen, wie durch Papier, um es bildhaft auszudrücken. Anders als erwartet hatte Lucheni jedoch keine Reue gezeigt und sich im Gegenteil mit der Tat gebrüstet. Er habe ein Zeichen setzen und mit seiner Tat für Aufsehen sorgen wollen. Merkwürdige Begründung, nicht wahr? Auf einen Aristokraten mehr oder weniger komme es ja wohl nicht an. Von einem Tatmotiv, so der bekennende Anarchist, könne im Übrigen keine Rede sein. Er, Lucheni, sei darauf aus gewesen, einen Prominenten zu töten, wen genau, habe keine große Rolle gespielt. Je bedeutsamer, desto größer das Aufsehen, nur das habe in diesem Moment gezählt.
Das hatte er jedem gesagt, der es hören wollte. Immer und immer wieder, bis zum Überdruss. Auch wenn er nicht müde wurde, dies zu betonen, beim Untersuchungsrichter hatte er damit nicht landen können. Der allseits geschätzte und als überaus kompetent geltende Monsieur Léchet war nämlich nicht nur skeptisch, sondern von der Idee einer weitverzweigten Verschwörung geradezu besessen gewesen. Allein, er war den Beweis für die These schuldig geblieben, auch wenn er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hatte, um den verlausten Makkaronifresser zu überführen.
Excusez-moi, soll nicht wieder vorkommen. Ein Mann in meiner Position sollte sich im Griff haben. Wäre dem nicht so, hätte er den Beruf verfehlt. Auch wenn er wie ich noch nicht lange im Amt ist, besitzt ein Gefängnisdirektor Vorbildfunktion. Sonst darf er sich nicht wundern, wenn ihm die Ganoven auf der Nase herumtanzen. Männer vom Schlage eines Lucheni, die es hier gleich dutzendweise gibt, brauchen die harte Hand. Wer etwas anderes behauptet, weiß nicht, wovon er redet.
»Und was nun, Herr Direktor?«
»Das frage ich mich auch, Vannod.« Kein schöner Anblick, so ein Erhängter. Und dann erst die Ratten, von denen es nur so wimmelte. Der Geruch nach ihrem Kot, Schimmel und abgestandenem Schweiß. Die beklemmende Enge, die in der zwei auf drei Meter großen Dunkelzelle herrschte. Vom Gestank, der aus dem Abortkübel drang, nicht zu reden. Kein Wunder also, dass beinahe jeder, der hier landete, binnen Stunden aus dem letzten Loch pfiff.
So gut wie jeder, nur dieser Lucheni nicht.
Zwölf Jahre lang hinter Gittern, acht hier und der Rest in Saint-Antoine. Nicht gerade viel, wenn man bedenkt, was der Halunke auf dem Kerbholz hat. Beziehungsweise hatte. Wird auf Kosten der Allgemeinheit durchgefüttert, wo er es verdient gehabt hätte, einen Kopf kürzer gemacht zu werden. So gut wie der hätte ich es einmal haben sollen. Wenn ich am Ruder gewesen wäre, dann hätte er sich auf was gefasst machen können. Dann hätte ich sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, dass er an die Österreicher ausgeliefert wird, juristische Spitzfindigkeiten hin oder her. Und selbst wenn es im Kanton Genf keine Todesstrafe gab, es wäre ein Leichtes gewesen, das Problem aus der Welt zu schaffen. Ein für alle Mal. Aber nein – die Herren in Bern wissen ja immer alles besser. Schlugen sämtliche Ratschläge in den Wind, bestanden auf Einhaltung der Paragrafen. Wo kämen wir da hin, wenn sich jeder, dem es in den Kram passt, darüber hinwegsetzen könnte. Was Recht ist, muss auch Recht bleiben – basta.
Und was, bitte schön, kam dabei heraus? Die Subalternen, allen voran meine Wenigkeit, durften die Suppe auslöffeln.
Wie immer.
»Eins ist ja wohl klar, Monsieur le Directeur: Wir können ihn da nicht hängen lassen.«
»Was Sie nicht sagen, Vannod! Darauf wäre ich nun wirklich nicht gekommen.« Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird mich der Hohlkopf von Wärter in den Wahnsinn treiben. Das ist so sicher wie das Amen in der Cathédrale Saint-Pierre. Es sei denn, ich finde jemanden, der mich protegiert. Dann wäre ich fein raus, und das Geschwätz dieses Tölpels bliebe mir erspart. »Na dann mal los, Herr Kollege – nur keine Müdigkeit vorschützen!«
»Ich weiß nicht recht, Herr Direktor«, gab Vannod zu bedenken und knetete seine Trinkernase, was er immer dann tat, wenn er Fracksausen bekam. »Aber finden Sie nicht auch, wir sollten zuerst den Polizeichef benachrichtigen?«
»Und weswegen?«
»Deswegen!«, versetzte Vannod und deutete auf den Erhängten, der mir wie ein Grimassen schneidender Kobold erschien. Mir zumindest war das Lachen vergangen, und ich hätte aufgeatmet, wäre mir der widerwärtige Anblick erspart geblieben. Und die Scherereien, die mir ins Haus standen, mit dazu. »Schöne Bescherung, finden Sie nicht auch?«
Oh ja, das fand ich auch, wenngleich ich so tat, als ob ich die Frage überhört hatte. Vorausgesetzt, die Presse bekam Wind von der Sache, dann würde ich selbigen von vorn bekommen. In dem Punkt gab ich mich keinen Illusionen hin. »Ich frage mich, wie er das zuwege gebracht hat.«
»Mit Verlaub, Monsieur le Directeur: Hier sind schon ganz andere Dinge als ein Lederriemen reingeschmuggelt worden.«
»Aber nicht mit derart fatalen Konsequenzen, hab ich recht?«, gab ich zurück, irritiert durch die Unverblümtheit, mit der Vannod den Finger in die Wunde legte. Und angeekelt durch die feuchte Aussprache, mit der er sie garnierte. »Sind Sie so gut und tun mir einen Gefallen, Vannod?«
»Selbstverständlich, Monsieur le Directeur.«
»Behalten Sie Ihre Weisheiten für sich, auf die Tour macht man sich keine Freunde.«
Der Fettwanst antwortete mit einem devoten Nicken.
»So, und jetzt trommeln Sie Ihre Kollegen zusammen, damit sie Ihnen zur Hand gehen können«, fügte ich im Kommisston hinzu, wodurch ich meinem Ruf als Napoleon-Verschnitt einmal mehr alle Ehre machte. »Allez vite, sonst mache ich Ihnen Beine!«
Allein mit dem Leichnam des Mannes, der wie kein anderer für Schlagzeilen gesorgt hatte, wurde ich von schleichendem Unbehagen gepackt. Die Petroleumlampe in meiner Hand begann zu zittern, und je länger ich über die Konsequenzen der Geschehnisse nachgrübelte, desto unwohler wurde mir in meiner Haut. Die Fragen, um die meine Gedanken kreisten, waren stets die gleichen: Aus welchem Grund schmetterte jemand lauthals Arien, wenn er sich kurz darauf mit einem Lederriemen erhängte? Und wie in aller Welt hatte Lucheni es geschafft, die Gitterstäbe des Oberlichtes zu erreichen, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen? Etwa mit Hilfe eines Komplizen, der in seine Pläne eingeweiht gewesen war?
Beim Gedanken an eine weitere Variante, die mir im Angesicht des Leichnams in den Sinn kam, lief es mir eiskalt über den Rücken.
Gedanken, die ich jetzt, da ich dies niederschreibe, lieber nicht zu Papier bringen möchte.
Zitat
Schweizer, Ihr Gebirg ist herrlich / Ihre Uhren gehen gut; /
Doch für uns ist höchst gefährlich / Ihre Königsmörderbrut.
(Gedicht der Kaiserin Elisabeth, zit. bei Brigitte Hamann, Elisabeth. Kaiserin wider Willen,Wien – München 1982, S. 598)
GENF, 9. SEPTEMBER 1898
EINS
2
NACHRUF (I)
Irma Gräfin Sztáray, 34, Hofdame und Vertraute der Kaiserin Elisabeth, an ihre Mutter
»Eins weiß ich gewiss, Gräfin: Die Stunde, in der meine Seele gen Himmel fährt, ist nicht mehr fern.« Auch wenn es mir das Herz zerriss, die Kaiserin sollte recht behalten. Schon am darauffolgenden Tag, auf die Minute genau 24 Stunden später, traf die unheilvolle Prophezeiung ein. Und was das Schlimmste war, meine Herrin starb eines gewaltsamen Todes, von der Hand eines Meuchelmörders, der nicht zögerte, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Gewaltsam zwar, doch ohne erkennbare Qual.
Ein schwacher Trost, werden Sie vermutlich sagen. Und das, wie ich meine, mit Fug und Recht. War ich selbst doch im entscheidenden Moment wie gelähmt, außerstande, das Unheil in letzter Sekunde abzuwenden.
Zufall oder nicht, die Prophezeiung hat mich nicht mehr losgelassen. 15 Monate ist es jetzt her, dass meine Herrin Opfer einer Bluttat wurde, die in den Annalen des Hauses Habsburg ohne Beispiel war. Und doch vergeht kein Tag, an dem ich die Szene am Quai du Mont-Blanc nicht vor Augen habe, so sehr die Erinnerung auch schmerzen mag. Auch frage ich mich, ob alles genauso kommen musste, wie es kam, ob es sich um eine Laune des Schicksals oder um das Werk einer höheren Macht handelte, der es gefiel, den Stab über meine Herrin zu brechen.
Schicksalhafte Fügung oder nicht, ich selbst bin gewiss nicht frei von Schuld. Habe ich doch tatenlos zugesehen, wie das Kaninchen auf die todbringende Schlange.
Die Stunde, in der meine Seele gen Himmel fährt, ist nicht mehr fern. Bisweilen kommt es mir so vor, als seien die Worte gerade erst verklungen. Und doch sind genau ein Jahr, drei Monate und 20 Tage ins Land gegangen. An der Tatsache, dass sie mir nicht mehr aus dem Sinn gehen, wird dies jedoch nichts ändern.
Auch an den Ort, an dem die Kaiserin ihr Innerstes preisgab, erinnere ich mich noch genau. Man schrieb den 9. September 1898, und die Baronin Rothschild war so freundlich gewesen, die Kaiserin und mich auf ihr Schloss einzuladen. Dort wurden wir auf das Herzlichste begrüßt, unter falschem Namen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Was folgte, war ein Déjeuner á trois, bei dem selbst Könige vor Neid erblasst wären. Julie Rothschild, Gastgeberin mit ausgeprägtem Hang zur Extravaganz, hatte es an nichts fehlen lassen, um die Gunst der Kaiserin zu gewinnen. Und so saßen wir drei im Speisesaal, umsorgt von livrierten Lakaien, die uns jeden Wunsch von den Augen ablasen. Anders als sonst, wo ihr jedes Gramm zu viel die Laune verdarb, verschwendete die Kaiserin keinen Gedanken an ihre schlanke Linie und aß mit ungewohntem Appetit.
Unter uns gesagt, alles andere wäre einem Affront gleichgekommen. Auch ich konnte den Köstlichkeiten nicht widerstehen, angefangen mit Becherpasteten, über Forellen aus dem Bourget-See, Rindsfilet mit Gemüse, Geflügelmousse, Rebhuhn in Gelee, Biskuit in Zitronensaft und Schokoladensandkuchen, bis hin zu Eiscreme in den Farben Grün-Weiß-Rot, eine Hommage an Ungarn, die meine Herrin beinahe zu Tränen rührte. Nahm doch das Land der Magyaren einen besonderen Platz in ihrem Herzen ein, trotz der Kritik, die sie allenthalben erntete.
Kurz und gut, die Baronin hatte an alles gedacht, sogar an ein Orchester im Nebenraum, das wehmütige italienische Volksweisen intonierte. Auch die prachtvoll gedeckte Tafel sowie das Silberbesteck, die Gläser aus Bergkristall und das Geschirr aus Altwiener Porzellan ließen keine Wünsche offen. Besonders erfreut zeigte sich die Kaiserin über die weißen Orchideen, mit denen der Platz des hohen Gastes drapiert worden war. Aufmerksamkeiten wie diese verfehlten ihre Wirkung nicht, zumal es sich um ihre erklärten Lieblingsblumen handelte.
Am Ende des opulenten Mahls tat dann die Kaiserin etwas, das sie, wenn überhaupt, nur höchst selten zu tun pflegte. Sie griff nach dem Champagnerglas, ließ sich einschenken und brachte einen Toast auf das Wohl unserer Gastgeberin aus. Vor aller Augen, so frohgemut wie schon lange nicht mehr.
Das Beste, so man das Wort überhaupt in den Mund nehmen konnte, stand uns jedoch noch bevor. War das Déjeuner einer Kaiserin von Österreich wahrhaft würdig gewesen, so übertraf der Schlosspark sämtliche Erwartungen. Gewächshaus reihte sich an Gewächshaus, Rosenbeet an Rosenbeet, Zierteich an Zierteich. An den Volieren und ihren buntgefiederten Bewohnern konnte sich die Kaiserin ebenso wenig sattsehen wie an den Aquarien, bewohnt von Lebewesen, wie zumindest ich sie noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Apropos Lebewesen. Stachelschweine, wenngleich zahm, sind bestimmt nicht jedermanns Sache. Doch auch hier zeigte sich die Kaiserin von ihrer jovialen Seite, wie so oft, wenn wir in trauter Runde beieinandersaßen.
Und dann erst das Orchideenhaus, vor Entzücken verschlug es uns die Sprache. So viele Blüten auf engstem Raum, so viele Farnkräuter, exotische Pflanzen und Orchideenarten habe selbst ich, die ich an der Seite meiner Herrin die halbe Welt bereiste, nirgendwo zu Gesicht bekommen. An keinem Ort war ich auf eine derart überbordende Farbenpracht gestoßen, von der subtropischen Vegetation ganz zu schweigen. Die Gewächshäuser, der weitläufige Park, der sorgsam gepflegte Rasen, so weich wie grasfarbene Seide, die hoch aufragenden Zedern, die Schatten spendenden Grotten, die Skulpturen antiker Heroen – alles Dinge, von denen die Kaiserin nicht genug bekommen konnte. Mir war, als wandelten wir durch den Garten Eden, und ich hoffte, der Tag der Wunder würde niemals enden.
Dass der Tag des Grauens seine Schatten bereits vorauswarf, konnte ich nicht ahnen. Dementsprechend groß war mein Schrecken, als die Kaiserin auf ihren Tod zu sprechen kam. Die gute Stimmung, in der wir uns befanden, war natürlich dahin. Die Baronin und ich taten zwar, als sei nichts gewesen, waren jedoch zutiefst bestürzt.
Um es vorwegzunehmen: Ich kann mir den Stimmungsumschwung nicht erklären. Der Ehrlichkeit halber sei betont, die Kaiserin litt unter Depressionen. Gründe dafür gab es genug, zu viele, als dass ich ins Detail gehen könnte. Im Endeffekt war es jedoch ihre Schwiegermutter, die den Stein ins Rollen brachte. Wobei die Tatsache, dass Erzherzogin Sophie zugleich ihre Tante war, die Situation noch verschärfte. Einzig der Kaiser, der auf den Rat seiner Mutter großen Wert legte, hätte sie bereinigen können. Zum Leidwesen der Kaiserin hielt er sich jedoch aus allem heraus, mit fatalen Folgen, wie allenthalben gemunkelt wurde.
Ich spreche zwar ungern darüber, bin aber der Meinung, dass die Ehe zwischen Cousin und Cousine von Anbeginn zum Scheitern verurteilt war. Um es mit den Worten meiner Herrin auszudrücken: »Die Ehe ist eine widersinnige Einrichtung. Als fünfzehnjähriges Kind wird man verkauft und tut einen Schwur, den man nicht versteht und dann 30 Jahre oder länger bereut und nicht mehr lösen kann.« Was meine Eindrücke betrifft, kann ich dem nur beipflichten. Am Tag ihrer Verlobung, als der Kaiser den 23. Geburtstag feierte, war die Kaiserin 15, bei der Hochzeit 16 und bei der Geburt ihrer ältesten Tochter gerade einmal 17 Jahre alt. Und mit 20 bereits dreifache Mutter, das sei der Vollständigkeit halber hinzugefügt. Ich finde, das muss man erst einmal verkraften. Vorausgesetzt, die Betreffende ist dazu imstande. Und wenn wir gerade von Durchhaltevermögen sprechen: Wer behauptet, am Wiener Hof ginge es gesittet zu, der weiß nicht, wovon er redet. Nirgendwo auf der Welt gab und gibt es so viele Ränkespiele, Eifersüchteleien und ans Lächerliche grenzende Standesdünkel. Und nirgends ein derart widersinniges Protokoll, über dessen Sinn man nicht allzu lange nachgrübeln sollte.
Im Grunde gab es für die Kaiserin zwei Möglichkeiten. Entweder sie tat, was von ihr erwartet wurde, oder sie ging auf Distanz und kapselte sich vom Geschehen in der Hofburg ab. Wie allgemein bekannt, traf sie eine Entscheidung, die ihrem freiheitsliebenden Naturell entsprach, ohne Rücksicht auf überkommene Konventionen. Mit anderen Worten, die Kaiserin entledigte sich ihrer Fesseln. Ich finde, das verdient Respekt. Außer ihr hätte es wohl kaum jemand gewagt, das Dahinvegetieren im goldenen Käfig mit einem selbstbestimmten Leben zu vertauschen. Sie tat es. Und sie tat noch mehr. Dass Monarchinnen fernab des Hofes ihr eigenes Leben lebten und ein schmuckes Quartier zur Residenz auserkoren, um ihren individuellen Neigungen zu frönen, das war weiß Gott nichts Neues. Aber dass sich eine amtierende Kaiserin und mehrfache Mutter die Freiheit nahm, dem Hofleben Adieu zu sagen und aus Spaß an der Freude die Welt zu bereisen, so etwas war noch nicht dagewesen, weder in Österreich noch anderswo.
Nun gut, ich will nicht übertreiben. Auch bei Odysseus, einem ihrer Idole, verlief das Leben zumeist nicht in geraden Bahnen. Sprechen wir es ruhig aus, die Kaiserin war schwer krank, wie krank, sollte sich alsbald zeigen. Grund genug, um zwecks Bekämpfung der kräftezehrenden Hustenanfälle nach Madeira zu reisen und die Zwänge des Alltagslebens über Bord zu werfen.
Doch wer geglaubt hatte, mit einer fünfmonatigen Erholungspause auf der Blumeninsel sei es getan, der irrte. Die Quinta Vigia auf Madeira war erst der Anfang, der nächste Fluchtversuch eine Frage der Zeit. Die Reise nach Korfu war zwar nur einer davon – aber der mit Abstand kostspieligste. Es ziemt sich zwar nicht, über Geld zu sprechen, doch weiß ich aus sicherer Quelle, dass die Baukosten für das Achilleion in die Millionen gingen. Dort, in ihrer Prunkvilla hoch über dem Ionischen Meer, konnte sie ungestört ihren Träumereien nachhängen. Und brauchte auf nichts zu verzichten, dank der luxuriösen Ausstattung, die von Elektrolampen ins rechte Licht gerückt wurde. Von Dauer, das muss ich der Wahrheit halber eingestehen, war ihre Begeisterung für das auf steilem Fels aufragende Traumschloss jedoch nicht gewesen. Kaum hatte sie es bezogen, wandte sich meine Herrin neuen Ufern zu.
Von Korfu ging es nach Sizilien und von dort aus nach Malta und Tunis, nicht etwa als Passagier eines Linienschiffes, sondern an Bord der kaiserlichen Jacht Miramar. Weitere Reiseziele fern der Heimat sollten folgen, als da wären: Dover, Lissabon, Gibraltar, Tanger, Algier, Marseille, Florenz, Pompeji, Capri und – wenngleich nur für kurze Zeit – die Insel Korfu. Eine Audienz beim Heiligen Vater, Besuche bei Queen Victoria und Reitausflüge auf Schloss Gödöllö oder auf Schloss Meath in Irland nicht zu vergessen. Ich will es mal so ausdrücken: Meine Herrin war einfach überall – und nirgendwo wirklich heimisch geworden.
Aber lassen wir das. Und sprechen wir über ihre Vorahnungen, die binnen Tagesfrist Realität werden sollten. Im Nachhinein habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ob es Menschen gibt, die in die Zukunft blicken können. Bis zu jenem Tag, an dem wir im Garten der Baronin Rothschild lustwandelten, hätte ich die Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Für Mystizismus im Allgemeinen oder Prophezeiungen respektive Séancen im Besonderen hatte ich im Gegensatz zur Kaiserin nicht viel übrig. Kurz und gut, ich nahm all jene, die an übersinnliche Fähigkeiten glaubten, nicht für voll. Im Licht der Ereignisse, die auf die Minute genau einen Tag später ihren Lauf nahmen, wurde ich jedoch eines Besseren belehrt. Lassen Sie es mich so formulieren, teure Mutter: Zwischen Himmel und Erde gibt es nun einmal Dinge, die selbst klügere Menschen, als ich es bin, nicht erklären können. Mit dieser Binsenweisheit, so banal sie auch klingt, muss ich mich wohl oder übel begnügen.
Fakt ist, die Kaiserin war des Lebens überdrüssig geworden. Angedeutet hatte sich das schon lange, selbst für Außenstehende, die das Leben am Hof aus der Ferne betrachteten. Es begann mit dem Tod ihrer Erstgeborenen, die einem Fieber erlag, als das Kaiserpaar im Land der Magyaren weilte. Die Kaiserin hatte darauf bestanden, die über alles geliebte Sophie mitzunehmen, aus purem Trotz, um ihrer Schwiegermutter zu demonstrieren, wer das Sagen hatte. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Es bricht mir das Herz, wenn ich an die Qualen denke, die meine Herrin am Sterbebett ihrer Tochter erdulden musste. Denn anders als behauptet traf sie am Tod der Zweijährigen, die in Budapest einem Fieber erlag, auch nicht ein Hauch von Schuld. Das kann ich mit reinem Gewissen versichern. Allein, wer die Kaiserin kennt, der weiß, dass sie meine Ansichten nicht teilte. Am Tod ihres Sonnenscheins, das ließ sie immer wieder durchblicken, trage allein sie die Schuld. Trotz guten Zuredens, auch und gerade vonseiten des Kaisers, konnte man sie keines Besseren belehren.
Doch damit waren die Prüfungen, die ihr von Gott dem Herrn auferlegt wurden, nicht beendet. Lange Rede, kurzer Sinn: Der 30. Jänner des Jahres 1889 sollte der bislang schwärzeste Tag im Leben meiner Herrin werden. Etwas Schlimmeres als den Freitod des eigenen Kindes kann es für eine Mutter nicht geben, ich denke, da sind wir uns einig. Über die genauen Umstände, unter denen der Kronprinz zu Tode kam, war und ist indessen nicht viel durchgesickert. Warum? Ganz einfach. Die Hofkamarilla setzte sämtliche Hebel in Bewegung, um die Hintergründe der Tat zu vertuschen. Einstweilen nur so viel, verbunden mit der Bitte um Diskretion: Als er sich entschloss, sein gerade mal 30 Jahre währendes Leben zu beenden, befand sich der Thronfolger in Begleitung einer Dame. Den Rest kann man sich denken, es sei denn, dem Betreffenden mangelt es an Fantasie. Tatsache ist, die Geliebte des Kronprinzen, eine 17-jährige und obendrein unebenbürtige Komtess, wurde zwei Tage vor der Tat als vermisst gemeldet. Mehr möchte ich aus Angst vor etwaigen Konsequenzen, sprich Repressalien seitens des Kaiserhauses, nicht sagen. Doch egal, wen wie viel Schuld an den Geschehnissen vom Jänner 1889 trifft, für Reue ist es bekanntlich nie zu spät. Um vor aller Welt zu dokumentieren, wie sehr sie unter dem Tod des Thronfolgers litt, trug die Kaiserin von nun an Schwarz, mehr als neun Jahre lang, bis das Herz der Mater dolorosa von einem Mordinstrument durchbohrt wurde.
Merkwürdig, oder nicht? Da wandeln wir durch den Garten Eden, erfreuen uns an den Wundern der Natur, scherzen, lachen und plaudern munter und ungezwungen drauflos. Und plötzlich bleibt die Kaiserin stehen, ein Schatten auf dem Gesicht, in dem ihr 60 Jahre währendes Leben tiefe Spuren hinterlassen hat. Um kurz darauf, wie von einer unsichtbaren Macht gelenkt, im Flüsterton zu sagen: »Ich wollte, meine Seele entschwebte zum Himmel – durch einen winzigen Spalt in meinem Herzen.«
Durch einen winzigen Spalt in meinem Herzen. Auch jetzt, 15 Monate nach dem schrecklichsten Tag meines Lebens, läuft mir beim Gedanken an die Szene immer noch ein Schauder über den Rücken. Mag sein, es klingt absurd, aber was ich auch tue, ich bekomme die Bilder partout nicht aus dem Kopf. Plötzlich und gänzlich unerwartet steht da dieser Mann vor uns, mit Hut und von mittelgroßer Gestalt. Und dann zückt er auch schon seine Waffe und stößt zu.
Mitten ins Herz.
Und hinterlässt eine winzige Stichwunde.
*
Bitte habt Verständnis, wenn ich mir den Kummer von der Seele rede. Aber ich kann den Verlust nicht verwinden. Und selbst wenn, ich käme mir wie eine Verräterin vor. Egal, was geschieht, ich werde das Andenken an die Kaiserin in Ehren halten. Auch wenn noch so viel über sie getuschelt wurde. Menschenscheu sei sie gewesen, wurde in gewissen Kreisen kolportiert. Ob zu Recht, bedarf keines Kommentars. Menschenscheu und exzentrisch, genau wie König Ludwig, ihr unglückseliger Vetter. Nichts davon ist wahr, so war ich Irma Sztáray heiße. Es war eine Seelenverwandtschaft, welche die beiden verband, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Weder der König, über dessen Neigungen man den Mantel des Schweigens ausbreiten sollte, noch die Kaiserin, die seinen Tod nie verwinden konnte, waren verrückt. Derartiges zu behaupten grenzt an Infamie.
Zuerst die kleine Sophie, dann ihr Vetter, und danach, knapp drei Jahre nach dessen rätselhaftem Dahinscheiden, der Freitod des geliebten Sohnes. Wer behauptet, eine Kaiserin müsse imstande sein, diese Abfolge von Katastrophen zu verkraften, der verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel. Er möchte ihr Andenken in den Schmutz ziehen. Aus purer Niedertracht, ohne Rücksicht auf ihre Reputation.
Aber bleiben wir beim Thema, sonst geht mein ungarisches Temperament mit mir durch. Oder ich verliere den roten Faden, was nicht minder echauffierend wäre.
Wie gesagt, so herzlich der Empfang in Pregny auch war, so bedrückend verlief der Abschied. Die Baronin traf keine Schuld, für sie tat es mir unendlich leid. Ich weiß, was Ihr jetzt sagen würdet, teure Mutter. Im Nachhinein erscheinen die Dinge oftmals in einem anderen Licht. Bei allem Respekt, für meinen Teil bin ich zu einem anderen Schluss gelangt. Seit dem Moment, als die Kaiserin über ihren nahen Tod sprach, lag ein Schatten über ihrem Gesicht, und der Charme früherer Tage, der wie ein Komet aufgeleuchtet war, schien wie weggeblasen.
So nimmt es nicht Wunder, dass sie es ablehnte, auf einem Erinnerungsfoto zu posieren. Meine Herrin tat dies mit dem gebotenen Takt, wie zumindest ich es von ihr gewohnt war. An ihrem Entschluss, Fotografen tunlichst zu meiden, änderte dies jedoch nichts.
Na und, werden ihre Widersacher jetzt sagen, was ist denn dabei, wenn man sich auf Bitten seiner Gastgeberin ablichten lässt. Ich finde, das soll jeder selbst entscheiden. Die Kaiserin hatte ihre eigene Meinung dazu, und diese galt es zu respektieren. Gestellte Aufnahmen waren ihr ein Gräuel, und das schon seit geraumer Zeit. Dabei gab sie nicht etwa einer Laune nach, so gut glaubte ich sie zu kennen. Auch wenn man noch so viel Energie auf die Suche verwendet, Ablichtungen der Kaiserin sind dünn gesät. Speziell solche, die aus der Zeit nach der Königskrönung in Budapest stammen. Ein gefundenes Fressen für die Kamarilla, die behauptete, Ihre Majestät habe einen Kult um die eigene Person betrieben und den Anschein immerwährender Jugend erwecken wollen. Im Lauf der Zeit sei dies zu einer fixen Idee und zu einer eminenten Belastung für die Privatschatulle geworden. Um ihren Teint zu pflegen, sei ihr nichts zu teuer gewesen, was, so die böswilligen Gerüchte, die Grenzen des Vertretbaren überschritten habe. Welch ein Unfug, kann ich da nur sagen. Makellos weiße Haut war und ist nun einmal en vogue, je gepflegter, desto besser. Meines Wissens gibt es auch kein Gesetz, welches das Tragen von Sonnenschirmen verbietet, folglich kann man es der Kaiserin nicht zum Vorwurf machen. Und was ihre Gesichtspflege angeht, mir sind da ein paar Damen bekannt, die meiner Herrin in nichts nachstanden. Eine Mixtur aus Wachs, Walrat, Rosenwasser sowie diversen Ölen für den Sommer, sogenannte Crème Céleste aus Wachs, Walrat, süßem Mandelöl und Glycerin für kühlere Tage. Viel mehr kam nicht zur Verwendung, sieht man von den Gesichtsmasken ab, die sie vor dem Zubettgehen auftragen ließ. Zerdrückte Erdbeeren und rohes Kalbfleisch bewirken nun einmal Wunder, pflegte Ihre Majestät zu versichern, auch wenn es sich um eine ausgefallene Rezeptur handele. Was ich damit sagen will, ist: Auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten bildete die Kaiserin keine Ausnahme. Und selbst wenn, wen hätte das gekümmert? Außer den Lästerzungen, die ihr schaden wollten, doch wohl niemanden.
Und noch etwas. Ein Sprichwort sagt: »Wer schön sein will, muss leiden.« Dass die Kaiserin Wert auf ihre Figur legte, ist hinlänglich bekannt. Das Wort »Kult« oder andere Vokabeln sollte man sich jedoch verkneifen. Auch wenn sie es in puncto Wespentaille übertrieb und oft tagelang fastete, damit ihr Gewicht unter 50 Kilogramm blieb. Wisst Ihr, was ich denke? Viele waren ganz einfach neidisch, darunter etliche Hofdamen, die in ihrem Dunstkreis verkehrten. Neidisch vor allem auf ihr Haar, welches beinahe bis in die Waden reichte. Da nimmt es nicht Wunder, dass es bis zu drei Stunden am Tag frisiert werden musste. Doch damit war es natürlich nicht getan. Um der Pflege willen achtete die Kaiserin darauf, dass die Strähnen alle 14 Tage mit einer eigens zu dem Zweck hergestellten Mixtur aus Eigelb und Cognac gewaschen und bei Bedarf mit Indigo und Nussschalenextrakt getönt wurden. Dass dies keine Frage von Minuten, sondern von mehreren Stunden war, versteht sich quasi von selbst. Dennoch finde ich, man sollte ihr das nicht ankreiden. An den Höfen in Europa ist es gang und gäbe, dass die Damen in den allerhöchsten Zirkeln in puncto Schönheit miteinander wetteifern, warum also nicht auch in Wien.
Allein, die Zeit, in der meine Herrin als schönste Frau Europas galt, war bei unserer Visite in Pregny vorbei. Die Kaiserin war exakt 60 Jahre alt, litt an Gelenkrheumatismus und periodisch wiederkehrenden Depressionen und reagierte höchst ungnädig, als ihr Leibarzt ein ausgewachsenes Hungerödem diagnostizierte. Wohl auch deshalb hatte sie stets einen Schirm nebst schwarzem Spitzenfächer parat, damit Außenstehende nur ja keinen Blick auf sie erhaschten. Nicht immer mit Erfolg, wie ich im Rückblick auf die Geschehnisse jener Tage zu berichten weiß. Am 3. September und somit exakt eine Woche vor ihrem jähen Tod lauerte uns ein Reporter während eines Bummels durch Territet auf, schoss ein Foto und machte sich ohne ein Wort der Entschuldigung aus dem Staub. Das zum Thema Respekt vor der Privatsphäre, ein Begriff, der im Wortschatz der Sensationspresse nicht vorkommt. Dabei handelte es sich keineswegs um einen Einzelfall, wie ich der Akkuratesse wegen hinzufügen muss. Kurz davor, in Begleitung des Kaisers während eines Kuraufenthaltes in Kissingen, kam es beinahe zum Eklat. Kaum war das Foto geschossen, wurden bereits Dutzende von Postkarten in Umlauf gebracht. Allein, der erhoffte Gewinn blieb aus. Wie stets hatte die Kaiserin einen weißen Schirm in der rechten Hand – und war, wenn überhaupt, nur schemenhaft zu erkennen.
Ihr seht, liebe Mutter, Ihre Majestät hatte es nicht immer leicht. Kein Wunder also, dass sie unter der Bürde der Position zerbrach. Verfiel sie in Schwermut, dauerte es lange, bis sie einen Weg aus dem Tal der Tränen fand. Ob es ratsam war, Kokain zu spritzen, wage ich jedoch zu bezweifeln. Aber alles Zureden half nicht, die Kaiserin hielt unbeirrt daran fest. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, führte sie es auch durch, falls nötig, wider alle Vernunft.
Wie dem auch sei, das Abschiednehmen am Vorabend der Katastrophe lag sämtlichen Beteiligten auf der Seele. Und so kam es, dass wir uns auf dem Rückweg nach Genf zunächst ausschwiegen, umgeben von einem Panorama, das auf der Welt seinesgleichen sucht. Und dann, wie aus dem Nichts, die Worte: »Eins würde mich wirklich interessieren, Gräfin.«
»Und was wäre das, Majestät?«
»Wie Sie über den Tod denken – ob Sie Angst davor haben oder nicht.«
»›Angst‹ ist vielleicht das falsche Wort«, erwiderte ich mit Bedacht, während der Lac Léman im Glanz der Abenddämmerung erstrahlte.
Und wurde prompt am Weiterreden gehindert.
»Ich fürchte ihn«, sprach die Kaiserin wie in Trance, den Blick auf dem Mont-Blanc-Massiv, dessen schneebedeckte Spitze in Blut getaucht zu sein schien. »Obwohl ich es kaum erwarten kann, meine letzte Reise anzutreten. Jetzt schauen Sie nicht so, Gräfin – daran ist doch nichts Schlimmes. Wissen Sie, wenn man in ein Alter wie das meinige kommt, dann macht man sich so seine Gedanken.«
»Mit Verlaub, Majestät sind erst 60 – das ist doch kein Grund zu resignieren.«
Die Frau in Schwarz lachte bitter auf. »Machen wir uns nichts vor, wenn ich nicht Kaiserin wäre, würde kein Hahn nach mir krähen. Und kein Mensch würde sich die Mühe machen, ein Foto von mir zu schießen. Schauen Sie mich doch an, Gräfin. Finden Sie, ich sehe interessant aus?«
»Bitte um Vergebung, aber so dürfen Majestät nicht reden.«
»Und wieso nicht? Meines Wissens ist der Fiaker des Ungarischen nicht mächtig.«
»Wir alle, auch ich, werden bekanntlich alt. An dieser Tatsache ist kein Vorbeikommen. Schaut doch, Majestät, der Montblanc! Sieht er nicht wahrhaft Ehrfurcht gebietend aus?«
Die Kaiserin drohte tadelnd mit dem Zeigefinger. »Lenken Sie nicht ab, Gräfin – und beantworten Sie meine Frage.«
»Ich fürchte, das steht mir nicht zu, Majestät.«
»Na schön«, antwortete meine Herrin, die Augen starr nach vorn gerichtet, wo der Fiaker der Baronin an den Zügeln herumhantierte. »Dann beantworte ich sie eben selbst. Wissen Sie, was mir zu schaffen macht? Alle, die ein Stück Weges mit mir gegangen sind, alle miteinander sind sie tot. Mein kleiner Engel, mein Schwager Maximilian, der König von Bayern, mein geliebter Vetter, Graf Andrássy, Freund und Ratgeber aus besseren Tagen, und nicht zuletzt mein geliebter Sohn Ru…« Die Stimme der Kaiserin versagte ihren Dienst, und ich spürte, wie schwer es ihr fiel, Haltung zu bewahren.
So bedrückt sie mir auch erschien, die Reaktion kam nicht von ungefähr. Bei Hof durfte der Kronprinz mit keinem Wort erwähnt werden, weder privatim noch in Gegenwart der Majestäten. Seit Mayerling war das ein ungeschriebenes Gesetz. Geschah dies doch, musste der Betreffende mit Konsequenzen rechnen. »Ich weiß nicht, irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass sich der Tod seit geraumer Zeit an meine Fersen geheftet hat. Wann er mich einholt, vermag ich zwar nicht zu sagen, doch mir scheint, als seien meine Tage längst gezählt. Ich hoffe nur, er kommt rasch – und bereitet mir keine Schmerzen. Nichts schlimmer, als qualvoll dahinzusiechen – und nichts schöner, als mit einem einzigen Sensenhieb niedergemäht zu werden. Ohne Schmerz, ohne Gram zu empfinden, ohne Blutvergießen.«
Zutiefst beunruhigt, rang ich nach den passenden Worten. Und beging einen Fauxpas, der nicht hätte passieren dürfen. »Und der Kaiser?«, stieß ich mit Blick auf die wie eine Sitzstatue der Ker verharrende Gestalt hervor, deren Blick auf den wie im Feuerschein erglühenden Fluten ruhte. »Ohne Euch wäre er nur noch ein Schatten seiner selbst.«
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. »Franz Joseph als trauernder Witwer, dass ich nicht lache!«, stieß die Kaiserin in ungewohnt sarkastischem Ton hervor und breitete ihren Fächer aus, um ihr Gesicht vor den Blicken der Passanten zu verbergen. Bis zum Grandhotel Beau Rivage, wo unser Kommen bereits gemeldet worden war, waren es nur noch wenige Schritte, und auf dem Uferkai wimmelte es nur so von Menschen. Fast schien es, als habe der Sommer gerade erst Einzug gehalten, so warm fühlte sich die laue Brise an. Dass es der Hauch des Todes war, den ich im Nacken spürte, würde binnen Tagesfrist zur Gewissheit werden. Doch noch war davon nichts zu spüren, noch leuchtete die Sonne vom glutrot schimmernden Firmament. »Glauben Sie mir, Gräfin, so schnell, wie mein Gatte eine Trostspenderin aufgabeln würde, könnten Sie nicht mal ihren Namen aussprechen. Sie wissen doch: Je älter, desto schneller sind die Männer mit so etwas bei der Hand. Und wenn sein Charme nicht verfängt, dann … Na, dann hat er ja noch die Schratt, nicht gerade eine Pompadour, aber besser, als den lieben langen Tag Trübsal zu blasen. Keine Sorge, Gräfin, die Soubrette wird ihn auf andere Gedanken bringen.« Die Kaiserin holte tief Luft, gab ein gekünsteltes Hüsteln von sich und meinte: »Seien wir ehrlich, Gräfin. Ich bin meinem Gatten doch nur im Weg. Niemand weiß das besser als ich. Soll der Kaiser sie doch vor den Traualtar schleifen, wenn ich nicht mehr bin, meinen Segen hat er. Harmoniert haben wir beide ja noch nie, grundverschieden wie wir nun mal sind. Ich weiß, es klingt herzlos, wenn ich das sage, aber es ist höchste Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.«
»Aber Majestät – das … das ist doch wohl nicht Euer Ernst!«
»Ich will Ihnen mal was sagen, Gräfin – aber bitte nehmen Sie es sich nicht so zu Herzen. Wäre ich alt genug gewesen, um mein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, die Liaison mit dem Kaiser wäre nie zustande gekommen. Schauen Sie mich nicht so an, Irma, dazu besteht kein Grund. Frauen wie ich sind für die Ehe nicht geschaffen, das ist nun mal leider so. Auch wenn die Männer noch so schöntun und uns Honig um den Mund schmieren, weil es sich so gehört: Erwartet wird von uns Frauen nur eins, nämlich dass wir Kinder gebären. Und das in möglichst großer Zahl. Ist dies der Fall, haben wir unseren Zweck erfüllt. Dann gehören wir zum alten Eisen. Glauben Sie mir, Gräfin, ich weiß, wovon ich rede. Wie Sie wissen, bin ich 44 Jahre verheiratet, so etwas hinterlässt seine Spuren, ob man es wahrhaben will oder nicht.«
»Majestät sehen die Dinge zu pessimistisch, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.«
»Finden Sie?« Meine Begleiterin machte aus ihrer Skepsis keinen Hehl. »Nun ja, Sie werden Ihre Gründe dafür haben. Aber lassen wir das – sonst raube ich Ihnen die letzten Illusionen. Wer weiß, vielleicht finden Sie ja den Mann fürs Leben – und mein Gatte eine Frau, die ihn glücklich macht.«
»Majestät mögen mir die Impertinenz verzeihen, aber mein Eindruck ist ein gänzlich anderer.«
»So, ist er das?«
Anstatt zu antworten, nickte ich nur stumm mit dem Kopf. Gewiss, nach der Hochzeit hatte der Kaiser die eine oder andere Affäre gehabt. Und ja, die Gerüchte über eine Liaison mit Katharina Schratt wollten nicht verstummen. In Hofkreisen galt die Schauspielerin als Freundin des Kaiserpaares, zumindest nach offizieller Lesart. Hinter vorgehaltener Hand zerrissen sich die Klatschsüchtigen jedoch die Mäuler, was die Beziehung des Kaisers zu der vermeintlichen cœur dame betraf. An der Tatsache, dass die Kaiserin die Hände im Spiel gehabt hatte, änderte dies jedoch nichts. Sie war es gewesen, die dafür gesorgt hatte, dass ihr Gatte mit der 23 Jahre jüngeren Hofschauspielerin ins Gespräch gekommen war. Das weiß ich aus berufenem Munde, wenngleich es mir nicht zusteht, meine Meinung über die Ménage-à-trois zu äußern. Gewiss weiß ich allerdings, dass sich die Kaiserin darüber im Klaren war, was sie tat. Mit anderen Worten, um in puncto Privatleben freie Hand zu haben und um nach Herzenslust schalten und walten – sprich die Welt bereisen – zu können, traf sie Vorkehrungen, dass der Kaiser genau das bekam, was sie ihm nicht geben konnte – oder wollte.
Nämlich Zuneigung und das Gefühl von Geborgenheit.