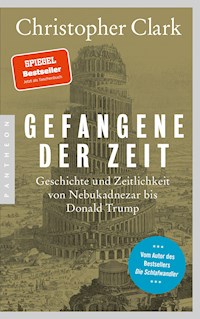21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das neue Buch des Bestsellerautors von „Preußen“ und „Die Schlafwandler“ – Königsberg 1835: Eine Phase des Friedens. Doch hinter der ruhigen Fassade brodelt die Angst
Bestsellerautor und Preußen-Experte Christopher Clark entführt uns ins frühe 19. Jahrhundert, in eine Welt voller Intrigen und Verrat. Königsberg, die verschlafene Kleinstadt und einstige Residenz von Immanuel Kant, wird in den späten 1830er-Jahren zum Schauplatz eines spektakulären Skandals, der zwei lutherischen Predigern zum Verhängnis werden soll. Sensationelle Anschuldigungen und dunkle erotische Geheimnisse erschüttern das Vertrauen der Gemeinschaft und versetzen die preußischen Behörden in Aufruhr. Meisterhaft erzählt Clark, wie religiöser Eifer, sexuelle Ausschweifungen und menschliche Unberechenbarkeit die Stadt ins Chaos stürzen, zu einer Zeit, in der moralische Fehltritte als Vorboten neuer Unruhen gefürchtet wurden. Eine kaum bekannte Episode ausdem alten Preußen – und ein Skandal, der überraschende Parallelen zur Gegenwart aufweist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Königsberg 1835: Eine Phase des Friedens Doch hinter der ruhigen Fassade brodelt die Angst
Bestsellerautor und Preußen-Experte Christopher Clark entführt uns ins frühe 19. Jahrhundert, in eine Welt voller Intrigen und Verrat. Königsberg, die verschlafene Kleinstadt und einstige Residenz von Immanuel Kant, wird in den späten 1830er-Jahren zum Schauplatz eines spektakulären Skandals, der zwei lutherischen Predigern zum Verhängnis werden soll. Sensationelle Anschuldigungen und dunkle erotische Geheimnisse erschüttern das Vertrauen der Gemeinschaft und versetzen die preußischen Behörden in Aufruhr. Meisterhaft erzählt Clark, wie religiöser Eifer, sexuelle Ausschweifungen und menschliche Unberechenbarkeit die Stadt ins Chaos stürzen, zu einer Zeit, in der moralische Fehltritte als Vorboten neuer Unruhen gefürchtet wurden. Eine kaum bekannte Episode aus dem alten Preußen – und ein Skandal, der überraschende Parallelen zur Gegenwart aufweist.
Der australische Historiker Christopher Clark, geboren 1960, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens. Er ist Autor einer Biografie Wilhelms II. und erhielt für sein Buch Preußen 2007 den renommierten Wolfson History Prize sowie 2010 als erster nichtdeutschsprachiger Historiker den Preis des Historischen Kollegs. 2013 erschien sein epochales Buch über den Ersten Weltkrieg, Die Schlafwandler, das wochenlang die deutsche Sachbuch-Bestsellerliste anführte und ein internationaler Bucherfolg war. 2018 erschien sein Bestseller Von Zeit und Macht, 2020 folgte Gefangene der Zeit und 2023 das Epochengemälde Frühling der Revolution. Einem breiten Fernsehpublikum wurde Clark als Moderator der mehrteiligen ZDF-Doku-Reihen Deutschland-Saga, Europa-Saga und Welten-Saga bekannt. Für seine Verdienste um die anglo-deutschen Beziehungen wurde Clark 2015 von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. 2022 wurde ihm zudem der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
CHRISTOPHER CLARK
Skandal in Königsberg
Eine Geschichte von Moral, Medien und Politik aus dem alten Preußen
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz
DVA
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel A Scandal in Königsberg,1835 – 1842 bei Allen Lane, einem Imprint von Penguin Books, Penguin Random House UK.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © Christopher Clark 2025
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Jonas Wegerer, Freiburg
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München,
unter Verwendung einer Vorlage von Daniele Roa
Umschlagabbildungen: Vorderseite: Hafen Königsberg, 1850 © akg-images / De Agostini Picture Lib.
Rückseite: © AdobeStock / t0m15
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-33664-6V001
www.dva.de
In memoriam Jonathan Steinberg (1934 – 2021)
Inhalt
1. Stadt des Beinahe
2. Nachrichten aus Königsberg
3. Der Prophet vom Pregel
4. Idas Erweckung
5. Die Vielfalt religiösen Verständnisses
6. Der schwierige Werdegang des Johannes Ebel
7. Die Ebelianer
8. Anklage und Gegenanklage
9. Prozessvorbereitungen
10. Der Prozess beginnt
11. Diestel sagt aus
12. Ein Medienspektakel
13. Sachs klagt an
14. Das Ende vom Lied
15. Abschließende Gedanken
Anhang
Dank
Bildnachweis
Anmerkungen
Zwischen 1835 und 1842 braute sich in Königsberg ein Skandal um zwei Geistliche zusammen. Ihr Ruf wurde ruiniert, sie verloren ihre Stelle, kamen ins Gefängnis und wurden aus dem öffentlichen Leben verbannt. Die juristische Entlastung von den schwersten Anklagen, die man gegen sie vorgebracht hatte, kam zu spät, um den Schaden wiedergutzumachen. Seit ich Anfang der 1990er-Jahre zufällig in den entsprechenden Akten auf diesen kleinen Strudel der Ereignisse stieß, ist mir die Sache nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Die Gerüchte- und Denunziationskampagne, welche die beiden lutherischen Prediger Johannes Ebel und Georg Diestel stürzte, gehört in eine Zeit vor den Paparazzi, vor dem Radio, dem Fernsehen und den digitalen sozialen Medien, aber eben dieser Umstand verleiht ihrer Geschichte geradezu fabelhafte Kraft. Ähnlichkeiten mit heutigen Personen und Situationen sind zwar keineswegs beabsichtigt, können aber nicht ausgeschlossen werden.
1.
Stadt des Beinahe
In den 1830er-Jahren sonnte sich Königsberg noch immer im Nachglühen der späten Aufklärung, zumindest in den Köpfen jener gebildeter Menschen, die nie persönlich dort gewesen waren. Immanuel Kant (1724 – 1804) hatte während des größten Teils seines Lebens in der Stadt gewohnt, studiert, geschrieben und gelehrt; die exakte Regelmäßigkeit seines Tagesablaufs lockte zu seinen Lebzeiten kleine Scharen von Gaffern an. Seine Überreste ruhten in der Krypta der Stadtkirche, und ein Mahnmal in Form einer Büste von Johann Gottfried Schadow auf einem Sockel aus grauem schlesischem Marmor stand im Hauptvorlesungssaal der Universität. Das ehemalige Haus und den Garten des großen Mannes hatte eine Badeeinrichtung übernommen, doch der Hausbesitzer hatte über der Tür eine Marmortafel mit der Inschrift angebracht: »Immanuel Kant wohnte und lehrte hier von 1783 bis 12. Febr. 1804.«1 Alle drei Orte zählten zu den touristischen Hauptattraktionen Königsbergs.
Die verzwickte Geografie der Stadt wurde zumindest manchen durch das sogenannte »Königsberger Brückenproblem« ins Gedächtnis eingebrannt, eins der berühmtesten mathematischen Rätsel. Sieben Brücken führten über die drei Arme des Pregels. War es möglich, fragte der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler im Jahr 1735, einen Stadtrundgang zu machen und dabei jede Brücke genau einmal zu überqueren? Und wenn nicht, ließ die Unmöglichkeit sich mathematisch beweisen? Die »Geometrie der Lage«, die Euler entwickelte, um zu beweisen, dass es nicht möglich war, legte den Grundstein der modernen kombinatorischen Topologie.2
Plan aus der Vogelperspektive von Königsberg, zu sehen sind die sieben Brücken über den Pregel und der Kneiphof in der Stadtmitte. Kupferstich von Matthäus Merian, 1652.
Königsberg war die Hauptstadt von Ostpreußen, der östlichsten Provinz des Königreichs Preußen. Das war der Überrest des früheren Herzogtums Preußen, eines baltischen Fürstentums, das der Deutsche Orden bis zu seiner Säkularisierung im Jahr 1525 kontrolliert hatte. Mithilfe einer raffinierten Heiratspolitik sicherten sich die Kurfürsten von Brandenburg in Berlin aus dem Hause der Hohenzollern das Erbrecht für dieses weitläufige Gebiet. Das Herzogtum Preußen des 17. Jahrhunderts, das annähernd so groß wie Brandenburg selbst war, lag außerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation an der Ostseeküste, umgeben von den Ländern Polen-Litauens, und unterstand damals der Souveränität der polnischen Könige. Es war ein Ort windumtoster Strände und Einbuchtungen, fruchtbarer Ebenen, großer Seen, Sümpfe und dunkler Wälder. Über siebenhundert Kilometer an Straßen und Wegen, die bei Regenwetter so gut wie unpassierbar waren, lagen zwischen Berlin und Königsberg.
Erst im Jahr 1657 verzichtete König Johann II. Kasimir von Polen auf die Lehnshoheit und trat das Herzogtum Preußen an die Hohenzollern in Brandenburg ab – ein Ereignis von enormer Bedeutung für die Zukunft der Dynastie. Im Jahr 1701, während der Herrschaft des Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg, gelang es mithilfe der Souveränität des Herzogtums Preußen, dem Haus Hohenzollern den Königstitel zu verschaffen. Im Lauf der Zeit sollte sogar der alte und ehrwürdige Name Brandenburg von dem Titel »Königreich Preußen« verdrängt werden, der Bezeichnung, die im 18. Jahrhundert zunehmend für alle von der Dynastie regierten Gebiete genutzt wurde. Die Randregion Ostpreußen erlangte folglich eine zentrale Stellung für die Geschichte des Königreichs. Es ist kein Wunder, dass sich die Ostpreußen selbst eher als Bewohner eines »Landes« und weniger als Bewohner einer Provinz sahen.
Mitte des 19. Jahrhunderts war Königsberg den Preußen in allen Ländern der Hohenzollern auch als Schauplatz des Kampfes gegen Napoleon und der Wiedergeburt des preußischen Königreichs in Erinnerung. Nach der Zerschlagung des preußischen Heeres durch Napoleon in den Jahren 1806/07 war der Hof nach Memel an der Grenze des Russischen Reichs geflohen. Königsberg wurde vom französischen Heer besetzt und musste massive Requirierungen und Abgaben über sich ergehen lassen. Die daraus resultierenden Kriegsschulden sollten erst im Jahr 1900 abgezahlt werden.3 Von Herbst 1807 an wurde die Stadt zum Sitz einer bemerkenswerten Kohorte von Staatsmännern und Beamten: Stein, Hardenberg, Scharnhorst, Clausewitz, Gneisenau, Wilhelm von Humboldt und Boyen, ganz zu schweigen von Theodor von Schön und Carl von Altenstein. Diese Männer bildeten den Keim einer neuartigen Verwaltung, die straff um thematische Verwaltungs- und Entscheidungszentren organisiert und darauf fokussiert war, die durch die Niederlage sich bietenden Chancen zu ergreifen, um Entscheidungsstrukturen zu rationalisieren und die schlummernden Energien des Staates und der Gesellschaft in neue Bahnen zu lenken.
Von hier aus begann Napoleon auch seinen zum Scheitern verurteilten Feldzug gegen das russische Zarenreich. Bis Juni 1812 hatte er rund 300 000 Mann – Franzosen, Deutsche, Italiener, Holländer, Wallonen und andere – in Ostpreußen zusammengezogen. Schon bald stellte sich heraus, dass die Provinzregierung überhaupt nicht imstande war, eine so riesige Streitmacht zu versorgen. Die Ernte des Vorjahres war schlecht ausgefallen, und die Getreidevorräte gingen rasch zur Neige. Hans Jakob von Auerswald, der Oberpräsident West- und Ostpreußens, hatte schon im April des Jahres gemeldet, dass das Vieh in beiden Provinzen hungers sterbe, dass die Straßen mit toten Pferden übersät seien und kein Saatgetreide mehr geblieben sei. Der Versorgungsapparat der Provinzregierung brach unter der Belastung zusammen, und einzelne Kommandeure wiesen ihre Truppen kurzerhand an, auf eigene Faust Lebensmittel zu requirieren. Es hieß, dass Bauern, die noch Zugtiere besaßen, bei Nacht pflügten und säten, damit ihnen nicht ihr letztes Pferd oder ihr Ochse weggenommen wurde. Andere versteckten ihre Pferde im Wald, allerdings durchschauten die Franzosen schon bald diese Praxis und fingen an, die Wälder nach versteckten Tieren zu durchkämmen. Es liegen unzählige Berichte über Verstöße durch französische Soldaten vor, insbesondere über Erpressung, Plünderung und Prügel. Ein hoher Beamter spricht in seinem Bericht von Verwüstungen, »wie sie kaum im Dreißigjährigen Krieg existiert haben mögen«.4
In der ganzen Provinz schlug die Stimmung allmählich von Unmut in einen glühenden Hass auf die napoleonischen Truppen um. Erste noch vage Gerüchte über französische Rückschläge in Russland wurden begeistert und voller Schadenfreude aufgenommen. Die zunächst bruchstückhaften Berichte über den Brand Moskaus (den die Russen gelegt hatten, damit die Franzosen kein Winterquartier hatten) erreichten Anfang Oktober Königsberg. Besonders groß war das Interesse an den Meldungen entsetzlicher Verluste, die irreguläre Kosakentruppen und bewaffnete bäuerliche Partisanen der Grande Armée zufügten. Am 14. Dezember 1812 räumte das 29. Bulletin der Grande Armée sämtliche Zweifel über den Ausgang des Russlandfeldzuges aus. Das im Namen des Kaisers gedruckte Bulletin gab dem schlechten Wetter und der Inkompetenz und dem Verrat anderer die Schuld an der Katastrophe. Darüber hinaus wurde gemeldet, dass Napoleon seine Männer in Russland verlassen und sich auf dem schnellsten Weg zurück nach Paris begeben habe. Der Text schloss mit einem bemerkenswert schonungslosen Ausdruck der kaiserlichen Egozentrik: »Der Kaiser erfreut sich bester Gesundheit.«
Als die letzten Nachzügler der französischen Grande Armée am 20. Dezember 1812 Königsberg erreichten, wurde die Stadt zur Kulisse eines welthistorischen Moments. Die einst unbesiegbare Armee Napoleons war ein übel zugerichteter Haufen. Johann Theodor Schmidt, der Polizeipräsident in Königsberg, erinnerte sich an den Anblick der Franzosen, die aus Russland über die Grenze nach Westen humpelten:
Von Frost und Hunger waren die edelsten Gestalten krumm zusammengeschrumpft. Voller blauer Flecken und weißer Frostbeulen. Ganze Gliedmaßen abgefroren und in Fäulnis […], verbreiteten sie einen pestartigen Geruch. […] Ihre Kleidung bestand aus Lumpen, Strohmatten, alten Weiberröcken, Schafsfellen, oder was immer sie sonst habhaft werden konnten. Keiner hatte eine ordentliche Kopfbedeckung, sondern das Haupt mit altem Tuch oder Hemde verbunden, statt der Schuhe und Strümpfe waren die Füße mit Stroh, Pelz oder Lumpen umwunden.5
Der schwelende Groll der Bauernschaft entlud sich nunmehr in Racheakten, als die Dorfbevölkerung die Sache selbst in die Hand nahm. »Die niederste Volksklasse«, berichtete der damalige Landrat Theodor von Schön aus Gumbinnen, »insbesondere die Bauern erlauben sich in ihrem Fanatismus die grässlichsten Misshandlungen gegen die im Elend verzweifelnden. […] in den Dörfern und auf den Landstraßen lässt man alle Wuth gegen sie aus […]. Es hat auch alle Folgsamkeit der Bauern gegen die Beamten aufgehört.«6
Einige Wochen lang hatte es den Anschein, die Franzosen hätten die Absicht, Königsberg gegen die nachrückenden Russen zu verteidigen – eine Entscheidung, welche die Stadt einem Artilleriebeschuss und der Zerstörung ausgesetzt hätte. Damals zahlte die Bevölkerung einer belagerten Stadt einen furchtbaren Preis für die Weigerung, zu kapitulieren. Am späten Abend des 4. Januar 1813, als der Himmel über Königsberg vom Leuchten der russischen Lagerfeuer rot glühte, stellten der Polizeichef und seine Leute jedoch fest, dass die Franzosen aus der Stadt verschwunden waren und sich klammheimlich nach Westen davongeschlichen hatten. Gegen Mitternacht sichtete man die ersten kosakischen Späher, die leise auf ihren unbeschlagenen Pferden heranritten, um sich zu vergewissern, dass die Franzosen abgezogen waren.7 Königsberg wurde nunmehr zu jenem Ort, an dem Preußen von einem widerwilligen Partner der Franzosen zum Mitglied jener Koalition wurde, die Napoleon und seine Truppen aus Deutschland vertreiben und die Integrität und Unabhängigkeit Preußens wiederherstellen sollte. Eben hier traten am 5. Februar 1813 unter einer russischen Interimsbesatzung die preußischen Provinzstände zusammen, die sich damals als »Vertreter der Nation« bezeichneten, um die neue Lage zu kontrollieren. Zeitgenossen erlebten und erinnerten diese Ereignisse als einen Wendepunkt in der Geschichte des Königreichs.
Wer Königsberg jedoch in den 1830er-Jahren zum ersten Mal besuchte, erlebte die Ankunft in der Stadt für gewöhnlich als eine Enttäuschung. Seit 1828 verband die »Reichsstraße Nr. 1« Berlin mit Königsberg, über 565 Kilometer staatlich gebaute Allwetterstraßen. Die »Geschwind-Postkutsche«, die man schon im Jahr 1821 auf dieser Route eingeführt hatte, konnte die Entfernung in nur fünf oder sechs Tagen bewältigen. (Erst im Jahr 1857, als die Bahnlinie fertiggestellt wurde, war es möglich, die Entfernung an nur einem Tag zurückzulegen.) Der Anblick, der müde Reisende erwartete, als sie aus den Kutschen stiegen, war nicht sonderlich erhebend. Die Stadtmauer hatte sieben Tore. Sie zeichneten sich allesamt nicht gerade durch besondere Schönheit aus, und die meisten gereichten der Stadt, wie ein Zeitgenosse kommentierte, »nicht zur Zierde«. Seit 1834 waren Pläne in Bearbeitung, das Sackheimer Tor, durch das General Yorcks Heer im Jahr 1813 ausmarschiert war, abzureißen und neu aufzubauen; so hätte die Stadt wenigstens einen ansehnlichen Zugang erhalten, aber die Arbeit an den vorgeschlagenen Verbesserungen hatte selbst im Jahr 1840 noch nicht begonnen.8 Sogar Freunde der Stadt räumten ein, dass es ihr an herausragenden öffentlichen und privaten Gebäuden fehle. Es gab keine prächtigen Residenzen im Stil Potsdams und Berlins.9 Die Häuser der Stadt waren schmal. Die meisten, schrieb ein Sohn der Stadt sinngemäß, seien nur drei Fenster breit, er kenne sogar einige, die nur Platz für ein Fenster hätten – in solchen Häusern, fügte er hinzu, gebe es folglich niemals ausreichend Licht.10
Die schönsten Häuser waren in der Langgasse zu finden, aber ihre Farben und Gestalt waren für eine reizvolle Straßenansicht zu verschieden. Die Durchgangsstraßen der ostpreußischen Hauptstadt waren einst recht breit gewesen, aber dank laxer Bauvorschriften hatte so gut wie jeder Grundbesitzer in den zentralen Bezirken den Raum vor seinem Haus entweder mit einer Treppe, einem Außengebäude oder einem anderen Vorbau gefüllt, sodass zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur der mittlere Teil der Straße, der für zwei Kutschen gerade breit genug war, frei geblieben war. Der erste gepflasterte Bürgersteig wurde im Jahr 1816 an der Fließstraße angelegt, aber es sollte noch lange dauern, bis weitere Straßen den gleichen Vorzug erhielten.11 Fußgänger waren gezwungen, in tiefem Mist und Dung zu gehen, der von unzähligen Fahrzeugen aufgewirbelt wurde. Häufig befanden sie sich in Todesgefahr, weil sie nirgendwo Schutz suchen konnten, wenn zwei Kutschen aneinander vorbeifuhren. Die verschiedenen Bretterbuden und Eingänge würden einen so unschönen und chaotischen Eindruck vermitteln, berichtete ein Bürger, dass man kaum glauben könne, dass man sich auf der Hauptstraße einer großen europäischen Stadt bewege.12
Die allergrößte Enttäuschung war jedoch das Flussufer. Alle waren sich einig, dass die Stadt günstig an einem hübschen, breiten Fluss lag, der so gut wie nie über die Ufer trat. Der Pregel näherte sich in zwei parallelen Armen der Stadt, die beim Zusammenfluss eine Insel, den Kneiphof – ein fast vollkommenes Rechteck – umschlossen. Das rechte Ufer stieg sanft an, und aus mehreren hübschen Teichen flossen Bachläufe, deren starke Strömung viele Mühlen antrieben. Der Kai entlang des Pregels hätte zu den schönsten in ganz Deutschland zählen können, wenn die Gebäude auf ihm nicht mit der Rückseite zum Fluss gebaut worden wären, also »ungeachtet der Aussicht mit dem schlechtesten Theil der Häuser«. Hinzu kam, dass die Ufer des Wasserlaufs nicht mit steinernen Kaimauern oder einer gepflasterten Ufereinfassung befestigt waren, sondern mit Holzstämmen. Die morschen, nassen Palisaden entlang des Pregels standen in einem unschönen Kontrast zu den stattlichen Kais der Spree in Berlin oder der Seine in Paris. Die Vororte waren besser angelegt, weil es dort weniger Nebengebäude und Hindernisse gab, aber sie waren ebenfalls zusammengestückelt und chaotisch, wobei die Straßen zwischen den Lattenzäunen der Gärten verliefen. Es gab auch unzählige unbebaute Flächen, selbst an den Hauptdurchgangsstraßen, zudem »findet man oft zwischen ansehnlichen Gebäuden nur kleine niedrige Hütten«.13
Das hieß jedoch keineswegs, dass die Stadt nicht einen gewissen Charme gehabt hätte. Allerdings boten die schönsten Ansichten von Königsberg nicht die Stadt selbst, sondern die Häuser und Brücken am Fluss und die umliegende Gegend. Der Fluss war das wahre kommerzielle Herz Königsbergs. Die Gewässer um den Kneiphof wimmelten im Frühjahr und Sommer von Schiffen. Einheimische und Gäste hatten gleichermaßen ihren Gefallen daran, die Handelsschiffe der Schweden, Engländer und Holländer anzusehen. Hinzu kamen die polnischen Modelle, gut fünfzig Meter lange, flache Flusskähne ohne Masten, die auf den nördlichen Flüssen fuhren. Viele dieser Schiffe waren saisonale Besucher, aber ein Teil blieb über den Winter hier und legte am Flussufer an.
Blick auf die Grüne Brücke über den Pregel, mit der Börse und dem Turm des Grünen Tors rechts davon. Man beachte die Masten der Schiffe im Königsberger Hafen in der Ferne. Ein von W. Barth veröffentlichter Druck, um 1810.
Im Sommer waren die Straßen voller Menschen, die an oder von Bord der Schiffe gingen: polnische Adlige, Gemeine und Juden, Russen und Schweden in der Landestracht. Im Rossgarten hörte man Lettisch, im Bezirk Sackheim Litauisch, Polnisch auf dem Ochsenmarkt, Russisch in der Vorstadt und Holländisch, Englisch, Schwedisch und Dänisch am Lizent, am Nordufer des Pregels, gleich östlich des Kneiphofs. (Der Lizent war der Packhof, wo Leute, die mit dem Schiff ankamen, ihre Koffer und anderes Gepäck zur Zollkontrolle abgaben.) Von der Grünen Brücke an der Südwestecke des Kneiphofs aus hatte man durch einen Wald aus Masten einen herrlichen Blick flussabwärts zum Holländer Baum – im Winter konnte man unzählige Spaziergänger und Schlitten auf dem Eis beobachten. Vom Baum aus nach Westen auf die Ostsee hatte man bei Sonnenuntergang eine schöne Aussicht, wenn die Wasser des Pregels sich in einen sich kräuselnden, goldenen Teppich verwandelten. Von den oberen Stockwerken der Häuser des Sackheimer Viertels sah man die Schiffe aus Litauen und den dahinter liegenden Ebenen kommen. Von Teilen des Rossgartens aus konnte man nach Westen über die Windungen des Flusses bis zur Küste bei Pillau blicken.
Die Anwesenheit Immanuel Kants an der städtischen Universität, der Albertina, hatte einst viele begabte junge Leute in die Stadt gelockt, die sich eine Meinung über die jüngsten philosophischen Entwicklungen bilden wollten. Aber nach Kants Tod fiel die Universität in den Stand einer verschlafenen Provinzhochschule zurück. In den Jahren 1802 bis 1805 schrieben sich durchschnittlich nur 132 Studenten ein. Selbst nach umfassenden Reformen des Lehrplans und der Einrichtung neuer Kliniken und Forschungseinrichtungen stieg die Zahl der Studenten nie über 452. Der politische Ton des Studentenlebens war gemessen am Standard der damaligen deutschen Städte verhalten.14 Unter den Professoren waren einige mäßig bekannte Gestalten wie der muntere Hegel-Schüler Karl Rosenkranz, und waren diese Personen in der Stadt auch bekannt, so hatte die Universität vor 1848 keine Koryphäen von Weltruf zu bieten. In einer 1842 veröffentlichten Skizze seiner Wahlheimat bezeichnete Rosenkranz, der seit neun Jahren in der Stadt lebte, die Stadt als eines der unbedeutenderen Lichter der deutschsprachigen Welt:
Ein Spötter könnte daher Veranlassung nehmen, Königsberg als die Stadt zu bezeichnen, in welcher alles in dem Zustande des Beinahe existire. Es sei beinah Residenz, denn Herzöge hätten darin residirt; Churfürsten, Könige auch zuweilen. Es sei beinah eine industrielle Stadt, denn es habe einige große Fabriken. Es sei beinah eine Seestadt, denn Zwei- und Dreimaster können bis mitten hinein, obwohl der eigentliche Hafen das sieben Meilen entfernte Pillau sei. Es sei beinah eine reiche Stadt, denn es zähle gar manche wohlhabende Kaufleute. Es habe beinah eine Festung, denn ein kleines Fort am Holländer Baum werde wenigstens so genannt u.s.w. …15
Königsberg war eine Welt der kleinen Entfernungen, die ohne Weiteres zu Fuß zurückgelegt werden konnten und wo jeder so gut wie jeden kannte. Der Prediger der Altstädtischen Kirche Johannes Ebel wurde von Gemeindegliedern und ehemaligen Schülern gegrüßt, wann immer er durch die Gassen lief, und auch den stämmigen Johann Georg Heinrich Diestel kannten alle, den Prediger und Kaplan der Haberberg-Kirche, der »wie ein verkleideter Husarenführer« durch die Stadt stolzierte.16
2.
Nachrichten aus Königsberg
Dem Bericht, den er aus Königsberg erhalten hatte, konnte Carl Sigmund Franz Freiherr vom Stein zum Altenstein aber auch gar nichts Erfreuliches entnehmen. So gut wie alles in ihm war alarmierend und unerquicklich.17 Eine bizarre Sekte, von den esoterischen Lehren eines toten Exzentrikers beeinflusst, hatte im Herzen des religiösen Lebens der Stadt Fuß gefasst. Der Anführer, ein Prediger namens Ebel, so der Bericht, stiftete seine Anhänger zu sexueller Unzüchtigkeit an, wobei Frauen, darunter viele Töchter der angesehensten Familien der Provinz, eine prominente Rolle spielten. Es kursierten Gerüchte von einer illegitimen Schwangerschaft, zwei junge Frauen waren offenbar an Erschöpfung gestorben, die durch exzessive Erregung verursacht worden war. Der Verfasser dieses Berichts war Theodor von Schön, der Oberpräsident der Provinz Preußen, ein langjähriger Bekannter Altensteins und eine bedeutende politische Figur des Königreichs.
Im Sommer 1835, als ihn der Bericht erreichte, hatte Altenstein den Posten des Ministers für kirchliche Angelegenheiten in Berlin bereits seit achtzehn Jahren inne. Es war ein Schlüsselposten im preußischen Kabinett. Mit insgesamt zwanzig hohen Beamten zählte es zu den größeren Ministerien des Königreichs. Es deckte ein strategisch bedeutsames Bündel an Zuständigkeiten ab. Der volle Titel lautete »Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten«, aber Zeitgenossen nannten es für gewöhnlich das Kultusministerium – wobei mit Kultus sowohl die Religion als auch die Kultur gemeint war, die ebenfalls in Altensteins Aufgabenbereich fiel.18
Altenstein hatte sich deshalb so lange auf diesem Posten gehalten – die durchschnittliche Amtszeit während der Existenz des Ministeriums (1817 – 1934) betrug fünf Jahre –, weil er sich den Ruf der Verlässlichkeit verdient hatte. Er war aus politischem Instinkt heraus ein Befürworter von Reformen. Im Winter 1804/05 hatte er Vorlesungen des Philosophen Johann Gottlieb Fichte über »Die Grundzüge des Zeitalters« besucht. Aus diesen und anderen Stellen in Fichtes Werk leitete er den Glauben an einen elementar fortschrittlichen Charakter der Geschichte ab, an die Entwicklung zu immer besseren Verhältnissen.19 Als Preußen 1806 nach der Niederlage gegen Napoleon in einen Abgrund stürzte, zählte er zu denjenigen, die darin die Chance zu einer Neugründung des preußischen Staates sahen. Die Rigaer Denkschrift von 1807, an deren Ausarbeitung Altenstein beteiligt war, schlug eine umfassende Erneuerung des Staatsaufbaus vor, deren Zweck es war, die in der preußischen Wirtschaft und Gesellschaft schlummernden Kräfte freizusetzen. Die Adels- und Ständeprivilegien sollten gestutzt, die Märkte dereguliert und die Verwaltung für Verdienst und Talent geöffnet werden. Wenn der Staat nicht von den von der Französischen Revolution geweckten Kräften hinweggespült werden sollte, musste er diese für die eigene Erneuerung aufsaugen. Zu den Voraussetzungen für diese Erneuerung zählte, argumentierte Altenstein, eine starke und einheitliche Verwaltung mit einem regen Bewusstsein für die eigene Berufung.20
Aber wenn der Minister ein Reformer war, so war er doch auch ein Mann der Ausgewogenheit und Umsicht. Als Mann mit Adelstitel, aber bescheidenen privaten Mitteln, hatte er sich stets an Quellen offizieller Schirmherrschaft gehalten. Er war ein überzeugter Anhänger von Autorität. Nur eine starke Monarchie konnte gut regieren. »In einem monarchischen Staate«, so schrieb er, »ist unstreitig das beste, wenn der König selbst regiert, sobald solcher […] doch wenigstens die gewöhnlichen Eigenschaften zum Regieren hat.«21 Zweck der Reform war es, die Energien einer befreiten Bürgergesellschaft mit den fortschrittlichen Zielen des Staates zu synchronisieren. Die Französische Revolution hatte gezeigt, dass das krampfhafte Festhalten an einem obsoleten politischen System zu dessen völliger Vernichtung führte. Der Staat musste beweglich bleiben. Geordnete Veränderungen in die Wege zu leiten, war möglich, wenn man kluge und bescheidene Köpfe fand, um sie zu lenken. Verwaltung war, nach dieser Lesart, ein Prozess des kontrollierten Umbruchs.
Carl Freiherr vom Stein zum Altenstein, 1826. Lithografie von Emil Krafft.
Sein gesamtes Erwachsenenleben hatte Altenstein stets zur politischen Mitte tendiert. Als in den 1790er-Jahren in seinem Heimatort Ansbach ein Streit zwischen Protektionisten und Verfechtern des Freihandels ausbrach, lavierte er pragmatisch zwischen den beiden Lagern und plädierte für Maßnahmen, die Elemente beider Haltungen miteinander kombinierten. Nach dem harten Durchgreifen von 1819, als die preußische Regierung und die Staaten des Deutschen Bundes massiv gegen Netzwerke radikaler Studenten vorgingen, protestierte er gegen jene Maßnahmen, die die Freiheit der Hochschulen von der Zensur einschränken würden. Altenstein war ein Anhänger der Freiheit der akademischen Forschung. Als zwei Philologen an der Universität von Berlin, die soeben von einer Forschungsreise aus Paris zurückgekehrt waren, von Polizeispitzeln angeklagt wurden, sie hätten sich in Straßburg mit gefährlichen Revolutionären getroffen, hielt Altenstein seine schützende Hand über sie und sorgte dafür, dass ihr guter Ruf wiederhergestellt wurde. Er verteidigte liberale Kollegen gegen die Machenschaften der Konservativen in der Regierung.22
Andererseits erhob er Einspruch, als die rationalistische, theologische Fakultät in Berlin behauptete, es sei unmöglich, die Dissertation des konservativen jungen Pietisten Friedrich Tholuck zu bewerten, und später unterstützte er dessen Bewerbung um den Posten, den der radikale Theologe Wilhelm Martin Leberecht de Wette 1819 räumen musste. Somit war Altenstein durchaus auch bereit, progressive Tendenzen zu korrigieren. Der Minister war es auch, der im Jahr 1818 dem Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel die durch den Tod Fichtes frei gewordene Professorenstelle an der Universität Berlin verschaffte. In dem Brief, den er zur Unterstützung der Kandidatur schrieb, fand er Worte, die eloquent seine eigene Linie als öffentliche Person bezeichnen.
Es hat große Schwierigkeiten, in der gegenwärtigen Zeit einen Universitätslehrer für das Fach Philosophie zu finden, der gleich fern von paradoxen, auffallenden, unhaltbaren Systemen und von politischen oder religiösen Vorurteilen mit Ruhe und Bedacht seine Wissenschaft lehrt.
Wenn Hegel der Mann für den Posten sei, so liege es nicht zuletzt daran, dass er »von religiöser Schwärmerei und von Unglauben« gleich weit entfernt sei.23
Wie diese letzte Äußerung andeutet, wählte Altenstein auch in religiösen Angelegenheiten, dem wesentlichen Betätigungsfeld seines Ministeriums, einen Mittelweg. Folglich lehnte er den dürren Rationalismus, der an vielen theologischen Fakultäten vorherrschte – eine Gesinnung, die in manchen Fällen bereits an Unglauben grenzte –, ebenso ab wie die unziemliche Euphorie, die sich in evangelikalen Erweckungsbewegungen und separatistischen Konventikeln äußerte. Es galt, auf keinen Fall einen polarisierenden Kulturkampf zu schüren: In einem Brief an den Chefredakteur der Allgemeinen Kirchenzeitung, einen Theologen namens Ernst Zimmermann, ermahnte Altenstein diesen, seine Zeitung nicht für etwas zu verwenden, das als eine Art Kriegserklärung an Andersdenkende aufgefasst werden könne.24
Für diesen umsichtigen Repräsentanten der Mitte kam nun der Bericht aus Königsberg einem Horrorszenario gleich. Beim zweiten Lesen wurde es auch nicht besser. Jahrzehntelang, schrieb Schön, seien religiöse Gruppen außerhalb der Amtskirche gewachsen und gediehen, deren Mitglieder sich tief in einer »vollendeten Sündhaftigkeit« wähnten, sprich: Es werde »auf Zerknirschung hingearbeitet und der Teufel sehr herausgehoben«. Dies könne auf die beteiligten Personen tiefgreifende Wirkung haben: So kenne Schön persönlich mehrere Anhänger einer solchen Gruppe, die in den Zustand eines religiösen Wahns verfallen seien.25
Ein besonders dynamisches und herausforderndes Gewächs sei die Gruppe, die sich seit Längerem um einen ungebildeten spirituellen Suchenden namens Johann Heinrich Schönherr herausgebildet habe. Anfangs hätten die Leute, berichtete Schön, über die Lehren dieses Mannes, der sich hauptsächlich mit kosmologischen Fragen befasste, noch gelacht. Er habe gelehrt, dass in dem urzeitlichen Nichts, das vor der Schöpfung bestanden habe, »zwei große Eier oder Kugeln herumgeschwommen wären, von denen die eine die Feuer- und die andere die Wasser-Kugel wäre und durch deren innige Verbindung die Welt und alles was in der Welt ist, entstanden sei«. Schönherr vertrete die These, dass alles in der Bibel wörtlich aufgefasst werden müsse. Als eine anerkannte kirchliche Autorität in der Person des verstorbenen Bischofs Ernst Ludwig von Borowski diese Ansicht anfocht und als Gegenargument die Worte Jesu anführte »Ich bin der Weinstock«, habe Schönherr seelenruhig erwidert, dass Jesus wirklich ein Rebstock gewesen sein müsse.26
Ungeachtet der Absonderlichkeit dieser Lehren hatte Schönherr eine große und loyale Anhängerschar angelockt, darunter viele Handwerker und Hafenarbeiter, die innerhalb der Stadtmauern lebten und den Flussverkehr auf dem Pregel bedienten, der in mehreren Armen durch die Stadt und weiter nach Pillau floss, gut zehn Kilometer entfernt an der Ostseeküste. Aber unter seinen begeisterten Verehrern waren auch, aus Gründen, die sich Schön unmöglich erschließen wollten, »mehrere Männer und Frauen aus den gebildeten Ständen«. Dazu zählte etwa der schon erwähnte Johann Wilhelm Ebel, damals noch ein junger Theologe, inzwischen jedoch Prediger an der Altstädtischen Kirche. Ebel gehe, so berichtete Schön, noch viel weiter, als sein 1826 verstorbener Mentor es jemals getan hatte, und er habe in kurzer Zeit eine große Gesellschaft um sich geschart. »Gelehrte, Geistliche und Männer aus den ersten Familien des Landes« würden zu ihm strömen. Vor allem Frauen würden von seinen Lehren angezogen.27