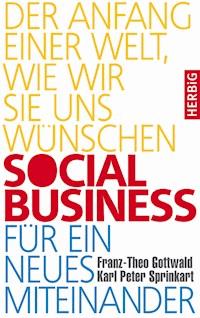
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die kalte Marktlogik des Turbokapitalismus hat uns ungeheuerliche Folgekosten in allen Lebensbereichen beschert. Besonders der Sozialbereich hat unter rigiden Sparzwängen zu leiden. Doch anstatt eine innovative und zukunftsfähige Politik zu betreiben, halten wir an einer überholten Sozialindustrie fest, die aufgrund falscher Zielsetzungen und Handlungsmodelle unnötig Geld verschwendet und die Situation der Kranken, Armen und Hilflosen verschlimmbessert. Franz-Theo Gottwald und Karl Peter Sprinkart machen Front gegen die "sozialen Dinosaurier" und zeigen Wege auf, wie mit sinnvollem Social Business eine neue, lebenswerte Gesellschaft entstehen kann, in der jeder Einzelne von uns gebraucht und geschätzt wird. Ein Buch voller Perspektiven für eine bessere Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.herbig-verlag.de
Inhalt
Einleitung
1 Die Krise der industriellen Lösungen
Soziale Innovation als aktuelle Utopie
Katalog der gesellschaftlichen Herausforderungen
Innovationsstau und Wissensgesellschaft
2 Kleine Geschichte der Zukunftsträume vom Miteinander
Vom Wünschen und Träumen des Neuen
Sozialutopien – so aktuell wie nie
3 Mehr als Zukunftsmusik – Social Business
Von der Notwendigkeit einer neuen »Wir-Kultur«
Sozialunternehmer – wer ist das?
Social Business und seine Beziehungen zu Markt, Staat und Drittem Sektor
Die Macher des Neuen – Vorreiter des Social Business
4 Neues wagen – Beispiele für gelebte soziale Kreativität
Wie gute Social Businesses gefunden werden können
Gelebte soziale Kreativität – Beispiele konkreter Utopien
Vom neuen Miteinander
Professionalisierung und andere Gefahren
Wie sich lösungsorientierte Gemeinschaften organisieren lassen
5 Social Business erfolgreich aufgesetzt
Ökonomie der Gemeingüter
Die Frage nach den Zukunftsszenarien
Vom Ehrenamt zum Social Business
Zur Persönlichkeitsentwicklung von Sozialunternehmern
Social-Business-Pläne und das MIND-Beratungsmodell
Anhang
Ausgewählte Literatur
Zitierte Websites
Dank
Lesetipp
Einleitung
Zusammenbrüche, Götterdämmerungen, wohin man blickt. Dies sind kaum Zeiten, die Mut machen für Visionen. Das Undenkbare, das Unwahrscheinliche, der nicht enden wollende Schrecken haben Hochkonjunktur, während zeitgleich in den Medien alte Sicherheiten beschworen und mit ausgesuchter Dialektik Problemursachen zu Lösungen herausgeputzt werden. Zu den realen Krisen kommt so eine Krise der Sprache und Bilder, eine Krise des Nachdenkens über mögliche Zukünfte und ihre Wünschbarkeit. Unser Blick auf die Welt ist »alternativlos« geworden.
Dabei hatte es, gerade was das Thema »Social Business« angeht, richtig gut begonnen. Dieser Begriff hatte innerhalb kürzester Zeit in allen Diskursen über gesellschaftliche Innovation eine immense Strahlkraft entfaltet. Er versprach ein neues Netz des ökonomischen, ökologischen und sozialen Miteinanders, das vom Mikrokreditnehmer in Bangladesh bis zum CEO großer multinationaler Konzerne reichte. Mit dem Begriff »Social Business« war geradezu eine Zauberformel gefunden, der es scheinbar mühelos zu gelingen schien, Paradoxien der modernen, globalisierten Wirtschaftswelt harmonisch aufzulösen und so eine echte Alternative oder, besser gesagt, einen dringend nötigen dritten Weg zu eröffnen. Entstanden aus einer sozial verantwortlichen Wirtschaftspraxis, die in Bangladesh durch die Bereitstellung von Mikrokrediten den Ärmsten der Armen die Beteiligung am Wirtschaftsleben ermöglichte und so eine Lebensperspektive als Unternehmer bzw. die Chance auf soziale Beteiligung bot, hatte sich ein konkurrenzloser Ansatz zur Bekämpfung von Armut entwickelt, der in seinen Wirkungen weit über die gängige Praxis von Armutsbekämpfung im Rahmen von Entwicklungshilfe hinausging. Durch die Förderung von wirtschaftlicher Eigenständigkeit beinhaltete er eine echte Perspektive der Nachhaltigkeit. Für diesen radikalen Ansatz wurde Muhammad Yunus 2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. In der Folge gelang es, große multinationale Konzerne wie Danone, Adidas, BASF ins Boot zu holen, und so stagnierende Wirtschaftskreisläufe auszuweiten. Für die Dritte Welt entstand zugleich ein neuer Blick auf das Potenzial von Social Business als Lösungsmodell für drängende soziale Probleme der Ersten Welt.
Heute, kaum fünf Jahre danach, ein Bild der Ernüchterung: Es läuft zumindest teilweise eine Entzauberung der magischen Formel des Social Business und seiner Protagonisten. Ein Verlust an Glaubwürdigkeit und Gestaltungskraft für ein neues Miteinander steht dahinter. Eine Serie schlechter Nachrichten ging durch die Presse, allen voran diese: Die Symbolfigur der Social-Business-Bewegung, Muhammad Yunus, zunächst im Gefängnis, dann unter Hausarrest gestellt, verliert trotz Rehabilitierung einen Großteil ihrer Strahlkraft. Das zentrale Produkt, das Modell der Mikrokredite, erst als Allheilmittel gepriesen, ist inzwischen zu einem Standardprodukt für die Menschen am Boden der sozialen Pyramide verkommen. Man hört dazu kaum Gutes z.B. aus Indien: Es ist die Rede von Zinshaien und regulären Banken, die einfach ihr Businessmodell ein klein wenig erweitert haben, von Menschen, die unter dem Gruppendruck in den Selbstmord getrieben werden. Und was die viel gepriesenen Kooperationen zwischen Yunus’ Grameen Foundation und großen Unternehmen angeht, so sind auch diese schwerstens in die Kritik geraten. Das Kooperationsprojekt mit Danone ist dem Vorwurf ausgesetzt, die einheimische Bevölkerung zu vergiften, statt, wie erklärt, zur Steigerung der Volksgesundheit beizutragen. Und auch jenseits der Dritten Welt, also bei uns in Deutschland, gerät die Social-Business-Bewegung ins Stocken: Es sind immer die gleichen Projekte, die von wechselnden Akteuren herausgestellt werden, es sind Randphänomene in den komplex gestalteten sozialen Netzen der Ersten Welt, die von Social-Business-Projekten bearbeitet werden, mit viel Engagement, aber oft wenig Kenntnis der Systemlogiken einer sozialindustriell organisierten Landschaft des Helfens. Und: Gemessen an Kostenstrukturen in den Bereichen Bildung, soziale Sicherung oder Gesundheit bzw. gemessen am täglich bewegten Finanzkapital sind es minimale Geldmengen, die für die Investition in Social-Business-Projekten über Fonds, Genossenschaften, Stiftungen oder ähnliche finanzielle Vehikel zur Verfügung stehen.
Der Anfang einer Welt, wie wir sie uns wünschen … ist vielleicht doch wieder in weite Ferne gerückt? Dies sind Zeiten, in denen das Hoffen schwerfällt und der Glaube zunimmt, dass nur noch radikalere Systemwechsel die einzige realistische Option darstellen. Also keine Harmonisierung, wie es sie Social Business anzubieten scheint?
Genau hier setzt die Reflexion dieses Buches ein. Mit einer gewissen Starrköpfigkeit will sie am Potenzial von Social Business festhalten. Allen Schreckensbildern, Trivialisierungen und Enttäuschungen zum Trotz will sie seine Gestaltungskraft untermauern. Es ist die feste Überzeugung der Autoren, dass der mit dem Begriff »Social Business« verbundene Paradigmenwechsel immer noch gelingen kann, wenn eine Vertiefung, eine Wendung ins Fundamentale vollzogen wird. Diese Tieferlegung erfordert eine doppelte Stoßrichtung: Statt einer naiven betriebswirtschaftlichen Orientierung des Sozialen rund um ein idealisiertes Unternehmerbild des bisherigen Social-Business-Verständnisses braucht es erstens eine stärker volkswirtschaftlich ausgerichtete Reflexion über den gesellschaftlichen Sinn wirtschaftlicher Tätigkeit. Zweitens bedarf es einer neuen Ökonomie des Sozialen, die das Soziale zwar auch in ökonomischen Kategorien begreift, ohne es aber sozialtechnisch und sozialwirtschaftlich zu verkürzen. In dieser doppelten Denkbewegung eröffnet sich jener Möglichkeitsraum, der in diesem Buch kartografiert und für Prozesse der Kolonisierung und Entwicklung eröffnet werden soll. Dann nämlich gibt es ein Nova Atlantis, das es neu zu vermessen, neu zu besiedeln gilt, dann nähern wir uns dem Anfang einer Welt, wie wir sie uns wünschen.
Grundlegend für dieses Buch ist die Einsicht, dass wir uns mit der realpolitischen Organisation des Sozialen in einer Sackgasse verrannt haben. Ein einfaches Beispiel: Unser Politdiskurs ringt über Jahre um eine gerichtlich angeordnete Neuberechnung des Hartz-IV-Regelsatzes, um am Ende eine Lächerlichkeit von fünf bis zehn Euro auf den Weg zu bringen, ein Betrag, der angesichts des bisherigen Regelsatzes von 359 Euro im Verhältnis zu erheblich gestiegenen Lebenshaltungskosten ebenso peinlich ist, wie die Spiegelfechtereien der diesen Entscheidungsprozess begleitenden politischen Inszenierung und Selbstdarstellung. Weder wurde eine zentrale soziale Gestaltungsaufgabe nachhaltig gelöst – es steht den Sozialgerichten eine Klagewelle ins Haus – noch wollen die Bürger den Beteuerungen der Politik Glauben schenken, dass die Entscheidungsfindung ein vorbildliches Funktionieren parlamentarischer Prozesse belegen würde. Denn angesichts dieses Ergebnisses wäre eigentlich nur nackte Scham und eine große Entschuldigung für den peinlichen Prozess angesagt. Doch der Öffentlichkeit präsentiert man immer nur Sieger und nur Siege; das Scheitern, die Wahrnehmung der eigenen Verantwortungslosigkeit hingegen ist aus dem Politvokabular gestrichen.
Dieses Verfahren lässt sich als Symptom diagnostizieren, dass das Miteinander der gesellschaftlichen Kräfte aus dem Gleichgewicht geraten ist. Es lässt sich auch als Zeichen dafür verstehen, dass Kriterien wie Rationalität, Verhältnis von Ritual und Ergebnis, Effizienz der Prozesse und Wirklichkeitsnähe der Wirkungsannahmen, dass Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Effektivität der geplanten Maßnahmen und Plausibilität der Lösungen schlichtweg nicht mehr zur Beschreibung der aktuellen Vorgänge taugen, die sich bei der Gestaltung unserer sozialen Versorgungsnetze abspielen. Das Fatale daran: Die Beispiele ließen sich beliebig ausweiten. Die Bastelei an kleinformatigen, schmalbrüstigen Detaillösungen folgt immer dem gleichen Schema: Die Öffentlichkeit und die Betroffenen werden systematisch für dumm verkauft, ob das Thema Gesundheit, Alter, Wohnen, Integration, Energiewende, neue Mobilität, Finanzmarktreform, Verbraucherschutz oder Ernährung heißt. Die Symptome des Systemversagens sind die immer gleichen: Stets wird über Problemlösungen für soziale Lebensrisiken geredet, diskutiert und gestritten, wobei der Diskurs schon längst zum durchschaubaren Politikklamauk erstarrt ist und jede Gestaltungskraft verloren hat; und stets werden soziale Problemlösungen propagiert, die zu gigantischen Industrien des Helfens verkommen, mit allem Schmutz, wie wir ihn aus der Frühphase der Industrialisierung und der Durchsetzung des industriellen Modells kennen. Auf der Tagesordnung sind Ausbeutung der Pflegekräfte, kaum vertretbare Arbeitszeiten und Dienstpläne, wertlose Massenprodukte, die nur der Logik ihrer Abrechenbarkeit folgen, und am Ende Verelendung, Prekarisierung.
Ist es deshalb nicht allzu verständlich, dass der Ruf nach einer innovativen Form der »Gestaltung des Sozialen« und nach einem neuen Paradigma zur Organisation sozialer Dienstleistungsangebote laut wird? Und ist es nicht allzu verständlich, dass neue Organisationsmodelle, die ein Mehr an Wirkungsorientierung, Rationalität und Wirtschaftlichkeit zu versprechen scheinen, Konjunktur haben?
Genau an diesem kardinalen Punkt ist der Diskurs um das Organisationsmodell des Social Business zu verorten. Denn er eröffnet mit seiner scheinbar paradoxen Verbindung von »Business« und »Social« eine neue Ebene, die aufs Grundsätzliche zielt. Zugleich bietet er mit seinen praktischen Beispielen hoffnungsvolle Ansätze, wie es anders gehen kann, wie bisher vernachlässigte soziale Dienstleistungen z.B. in der Betreuung von Autisten entstehen bzw. bestehende intelligenter organisiert werden können. Es ist uns Autoren klar, dass diese Botschaft von den Kartellen der Dienstleistungsanbieter nicht gerne gehört wird. Diese wissen zwar um die Absurdität der aktuellen Kostenspiralen, haben aber aus puren Existenzängsten kein Interesse daran, dass die Logik des Systems verlassen wird, dass sich etwas ändert. Auch deshalb wird Social Business kleingeredet.
Unser Ziel ist es, den Diskurs um Social Business vorzustellen, ihn aber gleichzeitig voranzutreiben, indem wir eine verdrängte Tiefenschicht des Diskurses um soziale Gerechtigkeit wieder freilegen, die Schicht von Zukunft und Nachhaltigkeit nämlich. Es geht im Gegensatz zu dem zyklischen Immergleichen eines sich selbst verzehrenden Turbokapitalismus und einer sich ins Groteske ausweitenden Sozialindustrie um die Öffnung des herrschenden Modells durch ein erweitertes Leitbild von Social Business und der mit der Social-Business-Bewegung verbundenen Innovationskraft. Deshalb wird es darum gehen, den großen Faden der Sozialphilosophie des 18. und 19. Jahrhunderts wieder aufzugreifen und diese in nüchterner Weise zu nutzen, um aus dem Ansatz des Social Business mehr zu machen als ein neues Businessmodell für die in ihren eigenen Wachstumsdynamiken überforderte Sozialindustrie, mehr zu machen als eine neue Form wirkungsorientierter Steuerung sozialer Dienstleistungsangebote auf der Basis von sogenannten Wirkungsmodellierungen, Zielsystemen, Akteursanalysen und Balanced Scorecard Prozessen, Cash Cows, Stars, Lame Ducks … und wie die anderen schönen Buzzwords aus dem Jargon sozialtechnologisch orientierter Beratung heißen mögen. Gerade davon haben wir in den letzten Jahren im Sozialbereich genug gesehen und gehört. Bis jetzt hantiert man mit »Organisationsentwicklungsprozessen«, die einer rein betriebswirtschaftlichen Handlungslogik folgen und die allen gegenteiligen Versprechungen zum Trotz – Schicksal aller Industrialisierung – zu einer Aufblähung der Apparate und zu einer Bürokratisierung der jeweiligen Kerndienstleistungen geführt haben.
Im Gegensatz zu dieser selbstzerstörerischen Entwicklungsspirale für das gesellschaftliche Miteinander will das Buch rund um den Begriff »Social Business« eine Innovationsperspektive eröffnen. Die Hoffnung, die dieses Buch formuliert, ist die Hoffnung nach einem neuen Wertedialog, innerhalb dessen wirtschaftliche Aktivität sich in einem neuen Kraftfeld zu Politik und Zivilgesellschaft entfalten kann. Um dies zu ermöglichen, braucht es einen kardinalen Punkt, der Soziales mit Wirtschaftlichem verbindet, braucht es etwas, was sich am besten mit dem aus der Mode gekommenen Begriff der »politischen Ökonomie« beschreiben lässt. Damit ist für unseren Zusammenhang zunächst nichts anderes als ein systemisches Denkmodell gemeint, das unter dem Primat des Sozialen wirtschaftliche Prozesse so zu denken versucht, dass daraus eine Ökonomie des Gemeinwohls werden kann. Und es braucht Menschen, die sich inspiriert von diesem Leitbild eines Social Business daranmachen, sozial innovativ zu werden, um Dienstleitungen und Güter mit gesellschaftlichem Mehrwert auch gegen hohe Widerstände durchzusetzen.
1 Die Krise der industriellen Lösungen
Es war einmal eine kleine, idyllisch gelegene Stadt im Schwarzwald, Schönau. Unauffällig, bis zum 26. April 1986, jenem Tag, an dem sich in Tschernobyl der bis dahin schwerste Atomunfall der Geschichte ereignete und eine radioaktive Wolke auch über Süddeutschland hinwegzog. In Schönau hinterließ dieses Ereignis Spuren. Schönauer Bürger beschlossen, sich für eine atomstromlose und nachhaltige Energieversorgung einzusetzen. Sie wollten einfach nicht warten, bis Politiker und Energieversorger etwas unternehmen würden.
Neun Jahre und zwei Bürgerentscheide später konnten sie das örtliche Stromnetz von einem Atomkraftwerksbetreiber freikaufen. Seitdem betreiben die bürgereigenen Elektrizitätswerke Schönau (EWS) das Ortsnetz ökologisch vorbildlich und wirtschaftlich erfolgreich – und versorgen darüber hinaus bundesweit mehr als 100 000 Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen mit sauberem Strom (Stand 12/2010). Die EWS sind aus einer Bürgerbewegung entstanden und strengen ökologischen Leitlinien verpflichtet. Die Geschäftsführung und Gesellschafter setzen nicht auf unbedingte Gewinnmaximierung, sondern investieren in eine nachhaltige Energieversorgung.1› Hinweis
Was hier nur kurz umrissen ist, klingt wie ein Märchen, ist es aber nicht. Es ist vielmehr eine jener verblüffenden Geschichten, die erzählt werden können, wenn alles zusammenkommt: Bürger-(Eigen-)Sinn, soziales Engagement, klare Zukunftsvisionen gepaart mit entschlossenem praktischem Handeln und ein Verständnis von Ökonomie, das konsequent Nachhaltigkeitszielen verpflichtet ist. Kurz: Die EWS als eine in jeder Hinsicht praktische Alternative zu den industriellen Lösungen, die unseren Alltag fest im Griff haben.
Vielleicht wären die Elektrizitätswerke Schönau angesichts ihrer Größe zu einer vernachlässigbaren Randnotiz der Geschichte verkommen, hätte sich nicht am 11. März 2011 im japanischen Fukushima Tschernobyl aufs Grausamste wiederholt. Das Undenkbare, das bis auf ein vernachlässigbares Restrisiko Ausschließbare war erneut geschehen. Und aus einem Politdiskurs, der die Laufzeitverlängerungen deutscher Atomkraftwerke als alternativlos dargestellt hatte, wurde über Nacht ein Wettrennen der Parteien, wer den Atomausstieg am schnellsten bewerkstelligen könnte. Mit einem Mal war eine unverzichtbar erscheinende industrielle Lösung des Energieproblems in die Krise geraten.
Nun aber gehören die Elektrizitätswerke Schönau in die Reihe jener Projekte, die mit einer klaren Vision und Wertehaltung Zukunft vorweggenommen haben. Ihre Erfolgsstory kann zur Inspiration werden, wie Produkte und Dienstleistungen, die unsere Gesellschaft in die Hände einiger weniger industriellen Großanbieter gelegt hatten, aus ebendiesen Händen zurückgeholt werden können, wenn es nur gelingt, genügend Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren. Und sie kann uns zeigen, dass ökonomische Spielregeln gestaltbar sind, dass sie nicht naturgegeben einer Shareholder-Value – Logik folgen müssen, sondern dass es eines gesellschaftlichen Diskurses bedarf, der zur Klärung beiträgt, an welchen Kriterien wir betriebswirtschaftliche Spielregeln ausrichten wollen. Oder anders gesagt: Der Höhenflug der EWS offenbart, wie dringend nötig es ist, neben dem technisch-industriellen Verständnis von Innovation und Fortschritt, soziale Innovation als gewichtiges Modell unserer Zukunftsgestaltung zu etablieren.
Soziale Innovation als aktuelle Utopie
In der Diskussion um die Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Miteinanders hat in jüngster Zeit der Begriff »soziale« bzw. »gesellschaftliche Innovation« zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die beiden Adjektive »sozial« und »gesellschaftlich« werden hier synonym verwendet. Dies geschieht in Anlehnung an den amerikanischen Sprachgebrauch, der mit »social« immer auch einen aufs gesellschaftliche Ganze zielenden Begriff meint und damit aktiv gestaltete Prozesse der Entwicklung, Durchsetzung oder Vorbereitung neuer sozialer Spielregeln, Wertsysteme und Praktiken des gesellschaftlichen Miteinanders einschließt. Diese sozialen Innovationen können sich entweder auf veränderte Spielregeln der Kommunikation, Kooperation oder sozialen Interaktion beziehen oder aber von ihrer Zielrichtung her, d.h. über ihren Lösungsbeitrag für drängende gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen definiert werden.2› Hinweis
Bei einem engeren Verständnis werden soziale Innovationen stark mit Fortschritten in Verbindung gebracht, was die Ausgestaltung sozialer Netze zur Daseinssicherung anbelangt. Darunter fallen etwa Meilensteine der Sozialgesetzgebung oder die Durchsetzung von sozialen Beteiligungschancen zuvor ausgegrenzter gesellschaftlicher Gruppen. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang auch an die Realisierung eines Mehr an Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen. Innerhalb der klassischen Innovationsforschung dagegen werden soziale Innovationen häufig »nur« als sozialtechnologische Instrumente zur Begleitung technischer Innovationen angesehen; dabei geht es im Regelfall darum, durch Information und Kommunikation das gesellschaftliche Klima gegenüber technischer Innovation zu verbessern und so die Durchsetzung technischer Innovationen in der Bevölkerung zu erleichtern.
Beide Verständnisformen von sozialer Innovation verkürzen jedoch den Begriff unzulässig, ja schwächen sein Bedeutungspotenzial. Deshalb soll hier nun ein kommunikationswissenschaftlicher Zugang vorgeschlagen werden, der unter »sozialer« bzw. »gesellschaftlicher Innovation« einen Diskurs bzw. eine Diskursstrategie versteht, die auf eine Erweiterung der symbolischen Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit zielt. Was heißt das im Klartext? Um über die gesellschaftliche Situation nachdenken zu können, macht man sich in der Regel ein Bild davon, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und funktioniert. Man glaubt, das Bild sei rund und stimmig, aber diese Konstruktion ist, die Realität offenbart es, nie perfekt. Es gibt blinde Flecken, Ungereimtheiten, Problemstellen, die nun konkret entlarvt und bestimmt werden. Dabei helfen insbesondere Lösungsbeispiele aus der Praxis, sprich Realität, die dort ansetzen, wo die Gesellschaftskonstruktion und ihr reales Äquivalent mangelhaft sind. Diese Beispiele (u. a. die EWS) zeigen machbare Alternativen auf und öffnen dadurch den Blick für neue soziale und gesellschaftliche Handlungsspielräume. Ziel dieser sogenannten dekonstruktivistischen Denkmethode ist eine systematische Infragestellung von eingefahrenen Denkmustern und Sprachspielen, von altgewohnten Erfolgskriterien und Wertevorstellungen und letztlich – das ist das konstruktive Moment – eine komplette Reorganisation des gesellschaftlichen Miteinanders und des Dialogs seiner Akteure, indem man die Defizite als Hebel für Neues nutzt.
Auf diese Weise wird, ganzheitlich gesehen, die soziale Praxis auf völlig neue Füße gestellt, sie bekommt eine neue Grundlage, ein neues Set von Spielregeln und Sprachspielen. Diese totale Reorganisation käme einem Paradigmenwechsel gleich, betrachtet man das traditionelle Verständnis von »sozialer Innovation«, wie es vor allem in den Wirtschaftswissenschaften gepflegt wird. Dort knüpft der Begriff an die Ursprünge der Innovationsforschung etwa bei Joseph Schumpeter an.3› Hinweis In dessen Lehre geht es primär um die Beschreibung von technisch-wirtschaftlichen Innovationsprozessen und ihrer unverzichtbaren Rolle für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt, der für Schumpeter immer Aufbau und Zerstörung zugleich bedeutet. Auslöser für solche Innovationsprozesse bilden sichtbar gewordene Lücken, Ungleichgewichte in einem bestimmten Bereich des Güter- oder Dienstleistungsangebots. Die Innovation sucht diese Lücken durch eine Neustrukturierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots zu schließen und so ein Funktionieren des Systems auf einem höheren Niveau, auf einem neuen Equilibrium, zu erreichen. Soziale Innovationen haben bei Schumpeter somit lediglich eine flankierende, kompensatorische Funktion, die darauf abzielt, die ökonomische Effektivität von technischen Innovationen zu gewährleisten.
Soziale Innovation im Sinne eines eigenständigen Innovationskonzepts ist jedoch mehr. Im deutschen Sprachraum setzte sich erstmals Wolfgang Zapf 1989 mit ihr auseinander. Zapf definierte soziale Innovationen als »neue Wege, Ziele zu erreichen, insbesondere neue Organisationsformen, neue Regulierungen, neue Lebensstile, die die Richtung des sozialen Wandels verändern, Probleme besser lösen als frühere Praktiken und die deshalb wert sind, nachgeahmt und institutionalisiert zu werden«4› Hinweis. In einem Übersichtsbeitrag der Querschnittsgruppe »Arbeit und Ökologie« des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung definiert Katrin Gillwald: »Soziale Innovationen sind, kurz gefasst, gesellschaftlich folgenreiche, vom vorher gewohnten Schema abweichende Regelungen von Tätigkeiten und Vorgehensweisen. Sie sind überall in gesellschaftlichen Systemen möglich, im Ergebnis Verhaltensänderungen und verwandt, aber nicht gleich mit technischen Innovationen.«5› Hinweis
Zugegeben, beide Definitionsversuche sind nicht unbedingt sehr spezifisch gefasst. Man könnte sie auch als deskriptive Metaphern sozialen Wandels lesen. Wichtiger allerdings als begriffliche Klarheit ist an dieser Stelle die Tatsache, dass es überhaupt zur Formulierung eines von technischer, wissenschaftlicher, künstlerischer oder wirtschaftlicher Innovation abgegrenzten, ja unabhängigen Konzepts der sozialen Innovation kommt. In dieser Begriffsbildung spiegelt sich eindeutig das Anliegen, sozialen Innovationsprozessen eine eigenständige Bedeutung zuzuweisen.
Soziale Innovation als selbstständiges Konzept steht zweifelsohne in direktem Zusammenhang mit dem, was man aus heutiger Sicht als Legitimationsverlust der wissenschaftlich-technischen Utopie der Nachkriegsära nennen könnte. Angefangen mit dem Sichtbarwerden der »Grenzen des Wachstums« und der zunehmenden Kritik an der technologischen Entwicklung und ihren Problemlösungspotenzialen (im Zuge der Technikfolgenabschätzungsforschung) wird der Ruf nach sozialen Innovationen immer lauter. Diese Selbstbehauptungstendenz wird durch das ungebrochene, fast starrsinnige Fortbestehen einer technikfixierten Innovationspolitik weiter verstärkt.
Wichtig gerade für die aktuelle Diskussion ist ein zweiter Zusammenhang: Wir erleben derzeit einen gewaltigen Umbau unserer Wirtschaftsordnung, einen sehr weit reichenden Übergang von der Industrie- zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Hierbei spielen die digitale Revolution und eine wachsende mediale Vernetzung unserer Arbeits- und Lebenswelt eine führende Rolle. Damit verbunden ist eine erhebliche Veränderung der sozialen Spielregeln, nach denen Unternehmen intern organisiert werden, nach denen sich Märkte, d.h. die Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden, gestalten. Produktinnovation, in der Unternehmensorganisation früher ein Geschäft für Entwicklungsabteilungen und klar getrennt vom Vertrieb und Marketing dieser Produkte, gestaltet sich zunehmend als vernetzter Zusammenhang.6› Hinweis Denn Mitarbeiter und ihr Wissen werden in die Formulierung innovativer Unternehmensstrategien eingebunden, Kunden können mit ihren spezifischen Erfahrungen und Wünschen bereits in der Phase der Produktentwicklung mitreden. Die Entwicklung von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen sowie von neuen Unternehmensstrategien geschehen dialogisch – schlicht und einfach aus der Einsicht heraus, dass sich so der Innovationsprozess in seiner Qualität verbessern und zugleich spätere Akzeptanzprobleme vermeiden lassen. Vergleichbares lässt sich auch im institutionellen Bereich feststellen: Politische Parteien, bisher Hort von im Hinterzimmer getroffenen Entscheidungen, fragen ihre Mitglieder nach ihrer Meinung oder Haltung zu zentralen Zukunftsfragen; Kirchen, bislang eher als Inbegriff autoritärer Führungsstrukturen bekannt, veranstalten gemeinsam mit ihren Gläubigen sogenannte Zukunftswerkstätten, in denen beispielsweise eine Reform der Kirchenorganisation diskutiert wird. Man setzt auf Innovation durch Teilhabe, man setzt darauf, den Weg in die Zukunft durch eine Intensivierung des Dialogs erfolgreicher gestalten zu können.
Anhand dieser wenigen Beispiele können wir erkennen, dass eine deutliche Veränderung des Innovationsverständnisses stattgefunden hat: Innovation hat nicht mehr zwingend etwas mit Technik zu tun, sie hat das Feld des Sozialen längst erobert. Dabei wird sie nicht mehr als ein linear ablaufender Vorgang (von Wissenschaft und Forschung hin zu marktfähigen Produkten und Dienstleistungen), sondern als komplexer sozialer Prozess beschrieben.
Ein wesentliches Kennzeichen dieses neuen Innovationsparadigmas ist daher die Öffnung des Innovationsprozesses hin zur Gesellschaft. Neben Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden auch Bürger und Kunden zu relevanten Akteuren im Innovationsprozess, indem sie zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen und damit zur Lösung von Problemen beitragen. Konzepte wie Open Innovation, Kundenintegration, Koproduzenten-Netzwerke usw. spiegeln einzelne Aspekte dieser bedeutsamen Entwicklung wider.
Soziale Innovationen finden in unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen statt und kommen in vielfältigen Formen daher. Die Folge: Sie lassen eine ganze Reihe von breit angelegten Forschungsfeldern entstehen wie beispielsweise:
die Untersuchung von Dienstleistungsinnovationen (insbesondere im Bereich sozialer und gesundheitsbezogener Dienstleistungen)
die Begleitung neuer Organisationsmodelle und Managementkonzepte in den Unternehmen und Organisationen (z.B.
Corporate Social Innovation
)
die Begleitung der Entwicklung tragfähiger Strukturen in kommunalen und regionalen Kontexten (z.B. von Regionalentwicklung bis
Nation Building
)
die Untersuchung von Nachhaltigkeitsinnovationen (z.B. Bewältigung der Folgen des Klimawandels im Tourismus)
die Begleitung von Entwicklungen in der sozialen Ökonomie und bei der sozialen Integration (z.B. lokale und regionale Transferwährungen)
die Untersuchung der sozialen Besonderheit von Kultur- und Kreativwirtschaft (z.B. für die Attraktivität von Standorten und Metropolregionen)
die Entwicklung nutzergerechter Ansätze in den Informations- und Kommunikationstechnologien
Diese Liste ließe sich durchaus noch verlängern. Denn man kann davon ausgehen, dass in allen großen gesellschaftlichen Funktionsbereichen, d.h. in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, im Staat und in den Medien, Prozesse sozialer Innovation auftreten können. Was die konkrete Untersuchung dieser Prozesse dann im Einzelnen angeht, lassen sich vier zentrale Forschungsbereiche bilden: die Management- und Organisationsforschung, die Erforschung des Zusammenhangs von Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen, die Kreativitätsforschung und schließlich die Erforschung von Prozessen der lokalen und regionalen Entwicklung. Doch das nur anbei.
Was bei all dieser Unterteilung jedoch immer und überall präsent bleibt: Soziale Innovation ist eng mit der Entwicklung von Zivilgesellschaft verknüpft. Es sind nachweislich die Akteure der Zivilgesellschaft, Bürger und Bürgerinnen eines Landes, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Bildung, die sich sozial engagieren und dafür stark machen, dass »Konzepte für soziale Innovationen in öffentlichen Diskursen wirksam verankert und in zentralen gesellschaftlichen Sektoren wie Wirtschaft, Bildung und Politik eine wachsende Zahl von effektiven sozialen Innovationen realisiert werden«7› Hinweis – mit dem Effekt, dass den sozialen Innovationen über kurz oder lang »ein ähnlicher Stellenwert zukommt, wie ihn bisher nur wirtschaftlich verwertbare technische Innovationen haben«8› Hinweis.
Bemerkenswerterweise wird diesem Thema auch auf der internationalen politischen Ebene zunehmend Aufmerksamkeit entgegengebracht. Präsident Obama hat ein »Büro für Soziale Innovationen und Bürgerbeteiligung« eingerichtet9› Hinweis und mit Haushaltsmitteln von 50 Millionen US-Dollar im Haushaltsjahr 2010 ausgestattet.10› Hinweis Für die EU-Kommission erklärte ein Jahr zuvor Kommissionspräsident Manuel Barroso in einem Statement: »Kreativität und Innovation im Allgemeinen und soziale Innovation im Besonderen sind gerade in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise die wesentlichen Faktoren für die Förderung von nachhaltigem Wachstum, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.«11› Hinweis Zudem hatte in der europäischen Innovationspolitik frühzeitig ein Umdenken begonnen, das sich in der veränderten Gewichtung bei EU-Forschungsrahmenprogrammen und in klaren Aussagen der EU-Kommission niederschlug: »Innovation ist nicht nur ein wirtschaftlicher Mechanismus oder ein technischer Prozess. Sie ist vor allem ein soziales Phänomen. (…) Von daher sind Zweckbestimmung, Folgen und Rahmenbedingungen der Innovation eng mit dem sozialen Klima verbunden, in dem sie entsteht.«12› Hinweis
Offenkundig gewinnt die Idee eines Innovationsmanagements auf der Grundlage sozialer Innovation auf vielen Ebenen, selbst auf höchsten politischen, erhöhte Akzeptanz. Das darf angesichts einer Wertschöpfung, die zunehmend wissensbasiert ist, nicht weiter verwundern. Auch wenn es dem Konzept der sozialen Innovation bislang noch an begrifflicher Schärfe mangeln mag, mit ihm hat man einen Ansatz gefunden, der über das Paradigma technisch-industrieller Lösungen hinausgeht. Immer wenn heutzutage in Wirtschaft und Gesellschaft von Innovationen die Rede ist, spannt der Begriff »soziale Innovation« eine konkrete Utopie auf. Und da es zum Reden in der Regel Worte braucht, die an soziale Codes gebunden sind, bleibt es nicht aus, dass sich in der Auseinandersetzung mit diesem Begriff eine wertebasierte Kommunikationsutopie entspinnt, die sich an Leitwerten wie Partizipation, soziale Teilhabe, Nachhaltigkeit der Problemlösung und Rationalität im Sinne einer herrschaftsfreien Kommunikationssituation orientiert, in der am Ende das bessere Argument gewinnt.
Mit dem vorgeschlagenen Verständnis sozialer Innovation ist nicht einfach eine inhaltsleere Prozesslogik beschrieben, hinter der sich beispielsweise nur eine Umdeutung des Bestehenden verbirgt. Nein, durch die bewusste Verknüpfung des Innovationsbegriffs mit dem Diskursbegriff gelingt es vielmehr, reale gesellschaftliche Entwicklungsprozesse zu berücksichtigen und vor allem an die Inhalte und Spielregeln des gesellschaftlichen Fortschritts- und Wohlfahrtsdiskurses anzuknüpfen. Folglich entfaltet sich der Begriff der sozialen Innovation nicht länger im luftleeren Raum einer bloß sozialwissenschaftlichen Beschreibungskategorie, sondern ist eingebunden in einen mit Ideen und Fantasien, mit Bildern und Metaphern gefüllten Sprachraum des Diskurses über ein gerechtes gesellschaftliches Miteinander, in eine Rhetorik der Zukunft. Doch müssen wir uns klar darüber sein, dass sich all das Reden und Streiten aus klar definierten Traditionslinien und Sprachformen speist. Häufig wird dies im Eifer des Gefechts vergessen bzw. gerät angesichts des sozialen Pathos und der Rhetorik der Betroffenheit aus dem Blick. Das aber ist fatal, denn so läuft man Gefahr, angesichts der unhaltbaren Zustände des Heute in ein Morgen zu springen, dessen Ton schnell verdächtig ideologisch oder heilsgeschichtlich theologisch wird. Ein solches Morgen hilft nicht weiter, wenn es darum geht, die konkreten gesellschaftlichen Herausforderungen von Heute zu meistern. Sein Beitrag zur Problemlösung bleibt deshalb sehr gering.
Katalog der gesellschaftlichen Herausforderungen
Bis weit in die 1980er-Jahre schien es, dass es auf jede der großen gesellschaftlichen Herausforderungen auf diesem Globus eine angemessene Antwort geben würde. Die Wissenschaft zeichnete dazu immer neue Lösungshorizonte: die Welt des Subatomaren, die Welt des Genoms, die Welt integrierter Schaltungen und Mikrochips, den Weltraum oder später dann die Nanowelt. Technologien, die im industriellen Maßstab diese neuen Welten kolonisierten und neuartige Massenprodukte aus Bereichen erschlossen, die vorher nicht einmal auf der Landkarte existiert hatten, ermöglichten eine globale Umsetzbarkeit dieser Lösungen. Hinzu kam ein Wirtschaftssystem, das dank dieser industriellen Logik zu immer neuen Wachstumsrekorden eilte und so steigenden Wohlstand für eine immer größere Zahl von Menschen versprach. Das Potenzial schien unendlich, der Blick auf das große Ganze wiegte uns in Sicherheit, dass bei einem erfolgreichen Zusammenspiel von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft es schon gelingen würde, alle großen Menschheitsprobleme aus dem Weg zu räumen.
Herausforderung
Neue Welten
Großtechnologie
Energie
Subatomare Welt
Atomwirtschaft
Mobilität
Welt der Magnetkräfte
Magnetschwebebahn
Ernährung
Welt des Genoms
Grüne Gentechnologie
Gesundheit
Welt des Genoms
Rote Gentechnologie
Materialien
Nanowelt
Neuartige Werkstoffe und Eingriffsmöglichkeiten
Kommunikation
Weltraum Computerwelt
Weltumspannender Austausch mittels Satelliten Digitale Revolution
Finanzindustrie
Welt der mathematischen Prognostik
Geldschöpfung durch Hedging und innovative Finanzprodukte
Betrachtet man obige Aufstellung, stellt man schnell fest, dass es immer wissenschaftlich basierte Lösungsansätze waren, die, ins Großtechnologische gesteigert und an einen komplexen Finanzierungs- und Wertschöpfungskreislauf angebunden, die richtige Antwort auf eine drängende gesellschaftliche Frage bereitzuhalten schienen. Die klassische Futurologie, wie sie etwa Hermann Kahn oder John Naisbitt vertreten, prognostizierte, dass dank eines exponentiellen Wissenswachstums dieser Trend zu immer neuen, auf Wissenschaft und Technik gegründeten Lösungen anhalten würde. Welches Problem auch immer auftauchen würde, man konnte angesichts der Wissensdynamik sicher sein, dass es innerhalb kürzester Zeit nach dem vertrauten Muster eines Technological Fix bewältigt werden würde. Die geistigen Eliten sahen deshalb die Welt am Beginn eines nicht enden wollenden paradiesischen Zeitalters des Wohlstands und der Freizügigkeit.
Leider kam es anders. Es wurde nämlich deutlich, dass weder die neu erschlossenen Welten noch das großtechnologische Umsetzungsmodell, noch die Grundprämisse eines unbegrenzten Wirtschaftswachstums wirklich taugten, die Herausforderungen einer zusammenwachsenden Welt zu meistern. Warum? Zum einen gab es da ein echtes Wissensproblem. Was innerhalb der Erkenntnislogik der modernen Wissenschaftstheorie als gesichertes Wissen gelten konnte, erwies sich als weit entfernt von jener Sicherheit, die gefordert war, wenn man aus theoretischen Modellen – ihre ganze Wahrheit darin bestand, bisher nicht falsifiziert zu werden! – die Grundlagen für technische Lösungen machte. Folglich verwischten sich in der Unschärfe einer zur Ideologie gewordenen Wissenschaft die Grenzen zwischen Begründbarem und nur als begründet Angenommenem ebenso wie die Grenze zwischen technischem Expertentum und einer politischen Entscheidungskompetenz, die obendrein den gesellschaftlichen Diskurs ausklammerte. Fazit: Rationalität wurde alternativlos, wo jede andere Argumentation außer einer technisch-wissenschaftlichen als irrational galt. In dieser Grauzone entstanden fatalerweise Scheinsicherheiten, die die großtechnische Anwendung wissenschaftlichen Wissens zur Risikoquelle ersten Ranges werden ließen. Ein Beispiel hierfür liefern die als finanzielle Innovationen gefeierten Modelle zum Risikomanagement für Spekulationsgeschäfte, für die ihre Erfinder Myron S. Scholes und Robert C. Merton 1997 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden sind. Ohne jeden Zweifel standen hinter diesen neuen Finanzprodukten eindrucksvolle mathematische Modelle, z.B. Differentialgleichungen aus der Quantenphysik, die statt auf die Wechselwirkung von Teilchen nun auf die Beschreibung der Wechselwirkungen in Finanzmärkten angewandt wurden. Unbefragt blieben allerdings die Anwendungsvoraussetzungen für die angenommenen Wahrscheinlichkeitsmodelle – mit der Konsequenz, dass sich das scheinbar ausgeschlossene Risiko durch die Hintertür einer nicht bedachten Ausgangsvoraussetzung wieder einschlich. Ein finanzieller GAU war die Folge.
Der zweite Grund für das Scheitern des Technological Fix bestand darin, dass die Grenzen des Wachstums zunehmend sichtbar wurden. An den Tag gebracht wurde dies durch eine Form des Zukunftsdenkens, das auf die Untersuchung von Ressourcen und Systemzusammenhängen setzte, anstatt Trends von Zukunftstechnologien linear fortzuschreiben, wie es die klassische Futurologie tut. So wurde man plötzlich der Ressourcenknappheit gewahr, man erkannte die Begrenztheit der Ernährungsgrundlagen für eine exponentiell zunehmende Menschheit oder das absehbare Ende der unser Wirtschaftssystem antreibenden fossilen Brennstoffe. Gleichzeitig gerieten die Kosten industriell betriebener Großtechnologien in den Blick: Industriebrachen, auf Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte zerstörte Landschaften an den klassischen Industriestandorten, und vor allem eine globale Erwärmung aufgrund eines unkontrollierten CO2-Ausstoßes. Doch nicht nur die Grenzen des Wachstums gerieten in den Fokus des Interesses, auch auf die sozialen Grenzen der industriellen Zivilisation wurde man nun aufmerksam. Den Zustand gesicherter Lebensbedingungen mit adäquater Bildung, ausreichendem Arbeitseinkommen und Sicherung gegen Krankheit genießt nur eine Minderheit der Weltbevölkerung, während eine ständig wachsende Mehrheit weit von diesen Standards entfernt leben muss. Was daran deutlich wird, ist, dass das Weltbild des stetigen Wachstums ein auf die westlichen Industrienationen zentriertes Bild ist – ein Bild, das die Menschen an den Rändern der westlichen Zivilisation glatt vergessen hat. Was neben einer Ökologisierung des Blicks deshalb nottut, ist eine Dekolonialisierung im Sinne einer kulturellen Weitung des verengten Blickwinkels und damit eine Wahrnehmung der sozialen Zustände im Weltmaßstab. Doch damit nicht genug. Die Grenzen des Wachstums haben auch kommunikative Grenzen sichtbar gemacht. Es wird immer offensichtlicher, dass die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in industrielle Zukunftstechnologien nicht nur die Frage nach dem technisch Machbaren aufwirft, sondern auch die Frage nach dem politisch Durchsetzbaren. Mit anderen Worten: Was machbar ist, muss noch lange nicht von der Gesellschaft gewollt sein. Denken wir nur an die Bürgerproteste im Zusammenhang mit gentechnisch verändertem Saatgut.
In der Folge dieser umfassenden Zukunftskrise des technisch-industriellen Modells kristallisierten sich zwei völlig voneinander getrennte Lager heraus, die je einen eignen Zukunftsdiskurs pflegen. Beide Parteien beanspruchen exklusiv für sich, das richtige Rezept für die Herausforderungen der Zukunft gefunden zu haben.
Das erste Rezept besteht in einem gigantischen »Weiter so«, also in der Flucht nach vorne, der Idee nämlich, dass es bei einer extremen Liberalisierung der Märkte gelingen könnte, der Krise durch noch stärkeres Wachstum zu entkommen. Die Grenzen des Wachstums durch eine Steigerung des Wachstums, durch die Erschließung neuer Ressourcen und Märkte zu überwinden erinnert an den genialen Einfall des Barons Münchhausen, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. Es muss eingeräumt werden, dass dieses Programm für eine gewisse Zeit wider Erwarten erstaunlich gut funktioniert hat, dass es dank neoliberaler Deregulierung auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder gelang, Märkte zu globalisieren, immer neue Regionen in das Produktions- und Konsummuster des Westens einzugemeinden, den Standard großtechnologischer Lösungen als weltweites Referenzsystem für die Lösung von Ernährungs-, Energie-, Mobilitäts-, Stadtentwicklungsproblemen, ja sogar der Klimaprobleme zu etablieren und über alldem noch eine globalisierte Finanzindustrie zu schaffen, die zu einem unvergleichlichen Schrittmacher wirtschaftlichen Wachstums und grenzenloser spekulativer Hoffnungen stilisiert wird. Unterstützt wurde diese Entwicklung in den letzten drei Jahrzehnten durch eine revolutionäre Veränderung der medialen Kommunikation, die am besten als Zusammenwachsen der sogenannten Times – Märkte, d.h. der Märkte Telekommunikation, Informationstechnologie, Entertainment und Sicherheitstechnologie, beschrieben werden kann. Dieses Zusammenwachsen brachte eine fundamentale Veränderung unserer Arbeits- und Lebenswelt mit sich und bescherte der Weltwirtschaft ein nie zuvor da gewesenes Wachstum. Die Helden des Anytime-Anywhere-Prinzips, die Meister der Milliardendeals und Macher der multinationalen Konzerne schienen das passende Rezept für eine neue globalisierte und digitale Welt gefunden zu haben. Denn sowohl die Globalisierung als auch die digitale Revolution machten glauben, dass die Grenzen des Wachstums nicht erreicht sind, dass immer dann, wenn das Spiel scheinbar zu Ende ist, sich die Tür zu einem neuen Reich, zu einer neuen Domäne öffnet. So gab es im Zuge der Globalisierung immer neue Länder, die sich anboten, um per Outsourcing von Produktion und Dienstleistungen Kosten zu senken. So entstanden im Bereich der digitalen Welt und der Finanzindustrie immer neue Produkte, die aus der Virtualisierung und digitalen Vernetzung bisher unentdeckte Wertschöpfungspotenziale verfügbar machten.
Allerdings kann nicht verhehlt werden, dass die Dot-Com-Blase, ähnlich wie andere Spekulationsblasen in den 1980er-Jahren und die Finanzkrise von 2008, schnell platzte. Ebenso kann nicht verhehlt werden, dass die Kollateralschäden einer im neoliberalen Verständnis betriebenen Globalisierung auch ihren Preis hatten, den vor allem die Entwicklungsländer zu zahlen haben. Zudem lässt sich aus heutiger Sicht feststellen, dass durch die Rückzugsgefechte einer auf Wachstum und industrielle Logik setzenden neoliberalen Zukunftsprogrammatik wertvolle Zeit vergeudet wurde, Zeit, die angesichts der Dramatik der vor uns liegenden Herausforderungen wesentlich sinnvoller genutzt hätte werden können.
Ein zweites, deutlich glaubwürdigeres Rezept wurde Mitte der 1980er-Jahre kreiert: Es entwickelte sich eine vielgestaltige Bewegung, die angesichts der sichtbar gewordenen Grenzen des Wachstums und der Umweltzerstörungen vor allem Nachhaltigkeit forderte. Getragen durch engagierte Akteure der Zivilgesellschaft begann sie, eine neue bürgerschaftliche Beteiligungskultur zu entwickeln, welche die soziale Ausschlusskultur, die durch den Neoliberalismus gepflegt wurde, beenden sollte. Kennzeichnend für diese Form des Zukunftsdiskurses ist die Einsicht, dass Herausforderungen, vor denen wir stehen, nur im globalen Maßstab zu lösen sind und nur in einem neuen Miteinander, in weltumspannender Solidarität. Als wesentlicher Referenzpunkt für diesen Diskurs können die sogenannten Millennium Development Goals gelten, jene Ziele also, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat, um gut und gerecht durch das 21. Jahrhundert zu kommen:13› Hinweis
Im Zuge der Bekämpfung von extremer Armut und Hunger soll zwischen 1990 und 2015 der Anteil der Menschen halbiert werden, die weniger als den Gegenwert eines US-Dollars pro Tag zum Leben haben; zwischen 1990 und 2015 soll ebenso der Anteil der Menschen halbiert sein, die Hunger leiden. Generell gilt es, eine Vollbeschäftigung in ehrbarer Arbeit für alle zu erreichen, auch für Frauen und Jugendliche.
Alle Menschen sollen eine Primarschulbildung erhalten; dazu soll bis zum Jahr 2015 sichergestellt sein, dass Kinder in der ganzen Welt, Mädchen wie Jungen, eine Primarschulbildung vollständig abschließen können.
Die Rolle der Frauen soll weltweit gestärkt und die Gleichstellung der Geschlechter durchgesetzt werden. Das Geschlechtergefälle in der Primar- und Sekundarschulbildung muss beseitigt werden, das soll möglichst bis 2005 und bis spätestens 2015 auf allen Bildungsebenen geschehen.
Zwischen 1990 und 2015 soll eine Senkung der Kindersterblichkeit von Unter-Fünfjährigen um zwei Drittel (von 10,6 Prozent auf 3,5 Prozent) erreicht sein.
Um die Gesundheitsversorgung der Mütter zu verbessern, soll zwischen 1990 und 2015 eine Senkung der Sterblichkeitsrate von Müttern um drei Viertel erreicht und bis 2015 ein allgemeiner Zugang zu reproduktiver Gesundheit garantiert werden.
Weltweit sollen schwere Krankheiten, darunter HIV/AIDS und Malaria radikal bekämpft werden. Dazu soll bis 2015 die Ausbreitung von HIV/AIDS zum Stillstand gebracht und eine Trendumkehr bewirkt werden. Bis 2010 soll ein weltweiter Zugang zu medizinischer Versorgung für alle HIV/AIDS-Infizierten, die diese benötigen, sichergestellt werden, bis 2015 die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten gestoppt werden, um auch hier eine Trendumkehr zu erreichen.





























