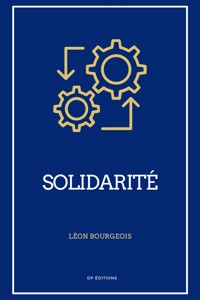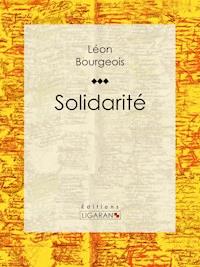16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Einen interessanteren Tischnachbarn als Bourgeois habe ich kaum jemals gehabt« – so Bertha von Suttner über den französischen Juristen und Politiker Léon Bourgeois (1851-1925), den sie bei den Haager Friedenskonferenzen kennenlernte und der zu den Initiatoren der Gründung des Völkerbunds 1920 gehörte. Der Frieden, so seine Vision, wird ein Baum sein, unter dem sich die Völker erholen können, und Solidarität ist seine Wurzel. Auch 100 Jahre später ist die Idee einer juristisch geregelten Solidarität als Grundlage dauerhaften Friedens theoretisch und politisch überaus relevant. Es ist also an der Zeit, sich wieder mit Bourgeois zu beschäftigen, dessen berühmter Essay zum Thema sowie weitere seiner zentralen Texte nun erstmals in deutscher Sprache vorliegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Léon Bourgeois im Alter von drei Jahren (Gemälde von Victor Casimir Zier, 1854) und als gestandener Politiker
3Léon Bourgeois
Solidarität
Von den Grundlagen dauerhaften Friedens
Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Effi Böhlke
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Solidarität
Die sozialen Grenzen der Solidarität
Der Völkerbund
Europäischer Rat der Carnegie-Stiftung für den Internationalen Frieden
Die Rolle des Werks von Den Haag im internationalen Leben
Der Völkerbund vor der Friedenskonferenz
Nachwort der Herausgeberin
Danksagung
Textnachweise
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
7Solidarität
Das Wort Solidarität gehört erst seit wenigen Jahren zum politischen Vokabular. Mitte des Jahrhunderts haben Bastiat[1] und Proudhon[2] sehr wohl Phänomene von Solidarität wahrgenommen und aufgezeigt, die sich durch alle menschlichen Gemeinschaften »hindurchziehen«. Doch aus all diesen Beobachtungen ist keine ganzheitliche Theorie hervorgegangen;[3] jedenfalls setzte sich das Wort nicht durch, und bei Littré findet sich 1877, abgesehen von juristischen und physiologischen Verwendungen, nur eine Definition aus der »Umgangssprache«, das heißt ohne Präzision und Tragweite: »Das ist«, heißt es dort bloß, »die wechselseitige Verantwortlichkeit, die zwischen zwei oder mehreren Personen entsteht.«[4]
Heutzutage taucht das Wort Solidarität in den politischen Reden und Schriften ständig auf. Zunächst hat man es offenbar für eine einfache Variante des dritten Terminus der republikanischen Losung gehalten: der Brüderlichkeit. Es setzt sich mehr und mehr an dessen Stelle; und der Sinn, den ihm die Schriftsteller, Redner und die öffentliche Meinung beimessen, scheint von Tag zu Tag voller, tiefer und umfangreicher zu werden.
8Handelt es sich hierbei nur um ein neues Wort, um eine Laune der Sprache? Oder drückt dieses Wort nicht tatsächlich eine neue Idee aus, ist es nicht das Indiz für eine Evolution des allgemeinen Denkens?
Erstes Kapitel: Evolution der politischen und sozialen Ideen
I
Der Begriff der Beziehungen zwischen dem Individuum und der Gesellschaft hat sich seit einem Vierteljahrhundert grundlegend gewandelt.
Scheinbar hat sich nichts verändert. Die Debatte zwischen der ökonomischen Wissenschaft und den sozialistischen Schulen vollzieht sich nach wie vor in denselben Termini: Der Individualismus und der Kollektivismus stehen einander in einer Antithese gegenüber, die die politischen Ereignisse so offensichtlich und fassbar machen wie nie zuvor.
Innerhalb und außerhalb Frankreichs geben die Fragen der reinen Politik den sozialen Diskussionen den Vortritt, und die Wahlerfolge der diversen sozialistischen Gruppen in Deutschland, Belgien, Frankreich und anderswo gestatten es, die nahende Stunde zu verkünden, zu der sich die Mehrheiten und die Minderheiten in den Versammlungen ausschließlich ökonomisch bekämpfen und als einzigen Schlachtruf die »liberale« oder »sozialistische« Lösung des Problems der Verteilung des Reichtums wählen.
Doch wie üblich ist der Zustand der Parteien nur eine ungenaue Übersetzung des Zustands der Geister. Die Parteien sind immer hinter den Ideen zurück: Bevor sich eine Idee genügend ausgebreitet hat, um zur Formel einer kollektiven Aktion, zum Grundsatz eines Wahlprogramms zu werden, braucht es eine lang anhaltende Propaganda; wenn sich die Parteien endlich um sie herum organisiert haben, dann haben viele Geister schon dasjenige entdeckt, was sie an Unvollkommenem, Ungenauem, in jedem Fall Relativem enthielt, und es eröffnet sich bereits eine neue, umfassendere und höhere Sicht, aus der die Idee von morgen hervorgeht, welche ihrerseits Ursache und Gegenstand neuer Schlachten sein wird.
9Auf diese Weise hat sich zwischen der klassischen politischen Ökonomie und den sozialistischen Systemen langsam eine nicht vermittelnde, sondern höhere Anschauung herausgebildet; eine Anschauung von einem höheren Standpunkt aus, von wo aus das Licht gleichmäßiger und weiter ausstrahlt. Wohlgemerkt handelt es sich dabei nicht um einen Versuch des Ausgleichs zwischen den Gruppen und Parteien, um eine politische Taktik. Nicht zwischen den Menschen, sondern zwischen den Ideen versucht sich ein Einklang zu bilden; was sich da anbahnt, ist kein Vertrag, sondern eine Synthese.
Diese Synthese ist nicht vollendet. Zwar gibt es eine Doktrin, die bereits über Untersuchungs- und Denkverfahren verfügt sowie über ihr Ziel und ihre Mittel; doch gibt es noch kein geschlossenes System, das Schlussfolgerungen zu allem bietet.
Wie sollte dies anders sein? Das ist nicht das Werk einer einzelnen Person, das ist das Werk aller. Das ist eine allgemeine Denkweise, deren Spuren sich fast überall finden, bei den Gebildeten wie bei den Politikern, in den Schriften der Philosophen wie in den Taten der Staatsmänner, in den privaten Institutionen und in den Gesetzen, sowohl bei den romanischen Völkern als auch bei den Angelsachsen oder den Germanen, in Monarchien ebenso wie in den republikanischen Demokratien.
Diese Doktrin hat nicht im ersten Anlauf einen jener Aufsehen erregenden Namen erhalten, die sich zunächst aufdrängen, als würden ihre Silben selbst die Lösung der Probleme in sich bergen.
Von unterschiedlichsten Parteigängern gefordert, die auf den am weitesten entfernt liegenden Polen des philosophischen und politischen Spektrums stehen, trägt sie einen Namen, der von allen akzeptiert wird; jeder versucht sie auf seine Weise an die Gesamtheit seiner vormaligen Doktrinen anzupassen. So wird sie von den christlichen Sozialisten, für welche sie die Anwendung der Vorschriften des Evangeliums bildet, ebenso verkündet wie von bestimmten Ökonomen, für die sie die Verwirklichung der wirtschaftlichen Harmonie darstellt. Für einige Philosophen ist sie das »biosoziologische« Gesetz der Welt; für andere ist sie das Gesetz der »Entente« oder der »Einheit für das Leben«;[5] für 10die Positivisten ist es, mit einem Wort ausgedrückt, »der Altruismus«.
Aber im Grunde ist die Lehre – auch unter den verschiedenen Namen – für alle dieselbe, und sie lässt sich eindeutig auf folgende Grundanschauung zurückführen: Zwischen jedem Individuum und allen anderen gibt es eine notwendige Beziehung der Solidarität; allein das genaue Studium der Ursachen, der Bedingungen und der Grenzen dieser Solidarität wird das Maß der Rechte und Pflichten eines jeden gegenüber allen und aller gegenüber jedem angeben und die wissenschaftlichen und moralischen Schlussfolgerungen der sozialen Frage bereitstellen können.
Woraus mag die Übereinstimmung so unterschiedlicher Geister in ein und derselben Idee resultieren? Man könnte sagen, aus einem universellen Angriff auf die Schranken zu enger Systeme.
Denn dieser Begriff der Solidarität ist die Resultante zweier einander lange Zeit fremder Kräfte, die sich heutzutage bei allen Nationen, welche auf eine höhere Stufe der Evolution gelangt sind, einander angenähert und miteinander kombiniert haben: die wissenschaftliche Methode und die moralische Idee.
Er ist die Frucht der doppelten Bewegung der Geister und Bewusstseine, die den grundlegenden Rahmen der Ereignisse unseres Jahrhunderts bildet; die, einerseits, dazu führt, die Geister von apriorischen Systemen sowie von ungeprüften Glaubensartikeln zu befreien und die per Tradition und Autorität durchgesetzten geistigen Kombinationsweisen durch solche zu ersetzen, die der freien Forschung verpflichtet und einer unaufhörlichen Kritik unterworfen sind; und die, andererseits, die Bewusstseine dazu zwingt, noch viel angestrengter jenseits unrealistischer Begriffe und nichtverifizierbarer Sanktionen nach den Verhaltensregeln zu suchen, deren verpflichtender Charakter einzig aus der Übereinstimmung von Gefühl – dem Maß des Guten – und Vernunft – dem Kriterium der Wahrheit – resultiert.
Das, was man mancherorts bereits die solidaristische Bewe11gung nennt, verdankt also seinen Ursprung und seine wachsende Kraft sehr allgemeinen und tiefgreifenden Ursachen. Der Moment scheint gekommen, sie eingehend zu untersuchen und aufzuzeigen, wie sie bereits zu einer Änderung der Perspektive ökonomischer und sozialer Studien führt.
II
Die Ökonomen verdammen jegliche staatliche Intervention in das Spiel der Phänomene von Produktion, Distribution und Konsumtion des Reichtums. Die Gesetze, welche diese Phänomene regeln, sind, so sagen sie, Naturgesetze, gegen die der menschliche Gesetzgeber nichts ausrichten darf – und im Übrigen auch nichts ausrichten kann.
Philosophisch gesehen ist der Mensch frei; der Staat muss sich darauf beschränken, ihm die Ausübung dieser Freiheit im Kampf um die Existenz zu gewährleisten, welcher darüber hinaus die Quelle und die Bedingung jeglichen Fortschritts ist.
Das Privateigentum ist, wie die Freiheit selbst, ein der menschlichen Person inhärentes Recht; das Privateigentum ist nicht bloß eine Konsequenz der Freiheit, sondern deren Garantie. Dieser Charakter des Rechts auf Eigentum ist also absolut: Das ist das jus utendi et abutendi. Das Eigentumsrecht des einen darf nur durch das Eigentumsrecht des anderen eingeschränkt werden. Außer der Erhebung von Steuern gibt es keinen sozialen Anteil am Privateigentum. Wenn die Wohltat eine Pflicht, ja eine gebieterische Pflicht ist, so ist sie doch nur eine rein moralische.
Wenn der Staat notwendige Maßnahmen zur Verteidigung der Freiheit und des Eigentums eines jeden gegen Übergriffe und Beeinträchtigungen getroffen hat, dann hat er all seine Pflicht erfüllt und all sein Recht ausgeschöpft. Jegliche Intervention, die über diese Grenze hinausginge, wäre ihrerseits ein Übergriff auf die menschliche Person und eine Beeinträchtigung derselben von Seiten des Staates.
Die Sozialisten hingegen fordern die Intervention des Staates in die Phänomene des ökonomischen Lebens. Gerade mangels einer Gesetzgebung für die Produktion und die Verteilung des Reichtums hat sich, trotz der erstaunlichen Errungenschaften der Wissenschaften, die Wohlfahrt der großen Mehrheit der Menschen 12nicht spürbar erhöht; mehr noch, die Transformation der Welt durch die Wissenschaft hat das Elend der einen umso grausamer gemacht, als es sich mit dem außergewöhnlichen Wachstum des Reichtums der anderen vergleicht und misst.
Die Indifferenzthese der Ökonomen ist im Grunde nichts als die Rechtfertigung der Gewaltexzesse. Im freien Kampf um die Existenz zerstört der Starke den Schwachen: Das ist das Schauspiel, das uns die gleichgültige Natur bietet. Sind die Menschen deshalb in Gesellschaft, um da stehen zu bleiben? Wenn die menschliche Freiheit ein Prinzip ist, dann ist das Recht auf Existenz auch eines, es geht notwendigerweise den anderen voran, und der Staat muss es vor allen anderen garantieren.
Was das Recht auf Eigentum anbelangt, so die Sozialisten weiter, zeigt uns die Geschichte dasselbe als hinsichtlich seiner Natur und seiner Grenzen variabel. Es ist nur dann die Verlängerung der Freiheit, wenn es tatsächlich die Frucht der Freiheit ist, doch fast immer wird es, im Gegensatz dazu, aus der Ungerechtigkeit geboren, sei es direkt durch gewaltsame Eroberung, sei es indirekt durch wucherische Aktivitäten des Kapitals. Heutzutage ist die Arbeit, diese Manifestation der persönlichen Aktivität und Freiheit, ohnmächtiger denn je, das Eigentum zu begründen, welches das Privileg derjenigen wird, die über das Kapital verfügen.
Der Staat, dessen Daseinsberechtigung darin besteht, die Gerechtigkeit zwischen den Menschen zu errichten, hat also das Recht und, in der Konsequenz, die Pflicht zu intervenieren, um das Gleichgewicht herzustellen. Da der menschliche Egoismus nur durch die Autorität besiegt werden kann, setzt er, wenn nötig mit Gewalt, die Gerechtigkeitsregel durch und sichert auf diese Weise jedem seinen legitimen Anteil an der Arbeit und an den Produkten.
III
Dies sind die beiden Thesen, deren Streitigkeiten ihre Unvereinbarkeit täglich deutlicher hervortreten zu lassen scheinen. Wie aber kann dann eine Harmonie zwischen den »Kontrahenten« möglich werden? Wie kann sich der in beiden vorhandene Anteil an wissenschaftlicher und moralischer Wahrheit Schritt für Schritt freimachen und sich unmerklich in den Meinungen, Sitten und Gesetzen festsetzen?
13Wissenschaftliche Wahrheit und moralische Wahrheit: Die Erneuerung der sozialen Vorstellungen wird, so haben wir gesagt, in der Tat durch die enge Übereinstimmung von wissenschaftlicher Methode und moralischer Idee vorbereitet und vollendet; und dies eigentümlicherweise zu einem Zeitpunkt, da bestimmte Autoren lautstark die endgültige Trennung von Moral und Wissenschaft und den sozialen Bankrott der Letzteren verkünden.
Die wissenschaftliche Methode durchdringt heute alle Wissensordnungen. Selbst die widerspenstigsten Geister ordnen sich ihr, wenn auch protestierend, Schritt für Schritt unter.
Auf soziologischem Gebiet wie auf allen anderen Gebieten scheint die Wahrheit nur durch unparteiliche Tatsachenfeststellung erzielt werden zu können.
Die ökonomischen und sozialen Phänomene gehorchen, wie man nunmehr weiß, ebenso unumgänglichen Gesetzen wie die physikalischen, chemischen und biologischen Phänomene. Die einen wie die anderen sind notwendigen Kausalitätsbeziehungen unterworfen, welche die Vernunft einzig durch die methodische Induktion erkennen und messen kann.
Da die Phänomene hier komplexer sind und die Beobachtung komplizierter ist, kann auf diesem Gebiet nur selten experimentiert werden; aber die Komplexität der Phänomene und die Schwierigkeit ihrer Untersuchung ändern nichts an der Unumstößlichkeit ihrer Verbindung.
Die natürlichen Gesetze der Gesellschaft sind nichts anderes als der höhere Ausdruck der physikalischen, biologischen und psychischen Gesetze, nach denen sich die lebenden und denkenden Wesen entwickeln.
Keine politische Macht ist stark genug, um das gute oder schlechte Schicksal vorzuschreiben, denn es gibt keine, die Gesundheit oder Krankheit dekretieren könnte, Klugheit oder Dummheit, Faulheit oder Energie, Ordnungssinn oder Verschwendungssucht, Vorsorge oder Unbekümmertheit, Egoismus oder Gleichgültigkeit.
All das, was außerhalb der Naturgesetze oder gegen sie unternommen wird, ist also nichtig und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Systeme von Reformern, die die soziale Welt nach dem Bild ihres Traumes rekonstruieren, und sei dies der Traum eines Genies, haben schlicht ebenso viel Realität und Überlebenschancen wie das Ptolemäische Weltbild.
14Doch damit sich eine Wissenschaft konstituieren kann, genügt es nicht, dass sie ihre Mittel und Wege gefunden hat. Ihr Objekt, ihr Charakter, ihre eigene Natur müssen klar erkannt und definiert sein. Indes ist das Problem der Beziehungen des Menschen und der Gesellschaft von besonderer Natur. Dieses Problem steht vor uns nicht aus Gründen reiner intellektueller Neugier, sondern aus moralischer Notwendigkeit; freizulegen gilt es nicht bloß eine Wahrheit intellektueller, sondern eine Wahrheit moralischer Ordnung.
Die Entdeckungen der physischen Wissenschaften waren für den Menschen nicht nur ein einfaches Schauspiel, das ihm einen klareren Blick auf die Welt eröffnete; sie gestatteten ihm vielmehr, die Oberfläche dieser Welt zu transformieren und aus den Naturkräften – bis dahin verschleierte, mysteriöse und gefürchtete Gestalten – seinem Willen unterworfene Sklaven zu machen.
Was die Entdeckung der Gesetze der physischen Welt hinsichtlich der Transformation des materiellen Lebens zu tun erlaubte, das muss nunmehr die Entdeckung der Gesetze der moralischen und sozialen Welt hinsichtlich der Transformation des sozialen Lebens selbst gestatten.
Der Mensch ist nicht nur ein intelligibles Wesen, das sich die Natur vermittels der Wissenschaft erklärt; er ist zugleich ein bewusstes Wesen.
Als vernünftiges Wesen sucht er die Wahrheit; als bewusstes Wesen sucht er das Gute. Dieses Gute fühlt er sich zu realisieren verpflichtet, in sich selbst – das ist die individuelle Moral – und zwischen den anderen ihm ähnelnden vernünftigen und bewussten Wesen – das ist die soziale Moral.
Dem sozialen Drama gegenüber kann er nicht gleichgültig bleiben. Hier ist er nicht bloß Zuschauer, sondern auch Akteur: Komplize oder Opfer, wenn das Drama in Tränen, Gewalt und Hass endet; Held, wenn sich die Handlung in Frieden, Gerechtigkeit und Liebe auflöst. Eine innere Kraft – das Gesetz seiner Art und seines Wesens selbst – mahnt ihn jederzeit und treibt ihn an.
Sicher – über Jahrhunderte hinweg hat er gedacht, dieses Drama würde sich anderswo vollenden, außerhalb dieses Lebens, wo all die Wunden geheilt würden, all die Leiden gelindert, all die Fehler bestraft, all die Verdienste belohnt. Und an langen Tagen hat er sich damit begnügt, diese Morgenröte zu erwarten, die seine Au15gen erst dann erleuchten könnte, wenn sie endgültig geschlossen wären. Doch diese Resignation hat der Ungeduld und dem Zweifel Platz gemacht. Und wenn die Gerechtigkeit nach dem Tode nur ein Wunder wäre, ähnlich all jenen Träumen, die die Wissenschaft zum Verschwinden gebracht hat? … Und dieselbe Ungeduld hat zugleich jene ergriffen, die leiden und die schon in diesem Leben ihren Anteil am Glück erreichen wollen – und jene, die denken und suchen, die mit eigenen Augen das Ideal verwirklicht sehen wollen, zu dem ihre Vernunft und ihr Herz streben.
So also stellt sich nunmehr das Problem dar. Die Gesellschaft darf dem fatalen Spiel der ökonomischen Phänomene gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Sicherlich kann sie die Welt nicht neu erschaffen; sie maßt sich nicht an, die in dieser wie in jeder anderen Ordnung notwendigen Ursachen und Wirkungen in ihrer Verknüpfung zu modifizieren. Doch ebenso, wie sie sich die anderen Naturkräfte unterworfen hat, will sie nun die psychischen, historischen und ökonomischen Kräfte, deren Triebfedern die menschliche Intelligenz durch genaue Beobachtung entdeckt hat, der Ordnung der moralischen Idee unterwerfen.
Und um mit Sicherheit formulieren zu können, was diese moralische Idee bedeutet und erfordert, wird sich die Sozialwissenschaft bemühen, mittels der allen Wissenschaften gemeinsamen Methode diese Frage der Beziehungen von Individuum und menschlicher Gesellschaft zu lösen. Sie wird all die bestehenden Systeme beiseitelassen: Die Kombinationen des Rechts, der Geschichte oder der Politik wird sie als relative und jederzeit hinterfragbare Ansichten betrachten; selbst die ältesten und ehrwürdigsten Institutionen wird sie dem Kriterium der freien Vernunft, der Prüfung durch Erfahrung unterwerfen. Unter den traditionellen Formeln und Wesenheiten wird sie einzig nach den natürlichen Realitäten suchen: nach physischen, intellektuellen, moralischen Realitäten, nach Bedürfnissen, Fähigkeiten und Gefühlen des menschlichen Wesens und der menschlichen Art. In einem Wort: Sie wird alles auf die Analyse der menschlichen Person zurückführen, jenes Wesens von Leidenschaft, Vernunft und Bewusstsein, das weder abstrakt ist noch auf einmal geschaffen wurde, sondern aus einer Folge von Vorfahren hervorgegangen und deren Erbe unterworfen ist und in einem Milieu lebt, mit welchem es sich in der Beziehung beständigen Austauschs befindet, letztlich in unaufhörlicher Evolution in 16Richtung eines höheren Typus der physischen, intellektuellen und moralischen Persönlichkeit.
Solcherart werden die objektiven, tatsächlichen Bedingungen des besten zwischen jeder einzelnen dieser menschlichen Personen und all den ähnlichen Wesen herzustellenden Gleichgewichts aussehen; auf diese Weise wird die friedliche und kontinuierliche Evolution eines jeden und aller in Richtung auf die volle Entwicklung des menschlichen Typus und der menschlichen Gesellschaft gesichert sein.
IV
Beide Bedingungen des Problems sind also miteinander verbunden. Die durch die Wissenschaft geleitete Vernunft definiert die unumgänglichen Gesetze des Handelns; der vom moralischen Gefühl angetriebene Wille führt dieses Handeln aus.
Die Sozialisten – nicht jene, welche hassen und die Gewalt predigen, sondern jene, die den Frieden wollen und die lieben – haben Recht, wenn sie die Gleichgültigkeit verurteilen und die Heilung des Übels verfolgen; die Ökonomen haben Recht, wenn sie jeglichen Heilungsversuch den Regeln der Tatsachenwissenschaft unterordnen.
Von der Geschichte, der Psychologie, der Statistik, der experimentellen Politik, von der politischen und sozialen Ökonomie fordert die Vernunft die Mittel; das Bewusstsein markiert das Ziel und drängt uns dorthin.
Das Gute kann nur durch das Wahre verwirklicht werden; aber das Wahre ist nur wertvoll, wenn es der Verwirklichung des Guten dient. Die Verwirklichung des Guten – das heißt die Befriedigung des moralischen Gefühls – unter den Bedingungen des Wahren – das heißt mit Zustimmung der Vernunft –: So lautet letztlich die Aufgabe.
Ist die Lehre der Solidarität die Lösung?
17Zweites Kapitel: Wissenschaftliche Lehre von der natürlichen Solidarität
I
Die Entdeckungen der Naturwissenschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben zunächst einmal der individualistischen These ein Reservoir schlagkräftiger Argumente geliefert. Die Gesetze des physiologischen Kampfes um die Existenz schienen die Erklärung und Rechtfertigung der Gesetze der sozialen Konkurrenz zugleich zu bieten.
Die Individuen, die spezifischen Typen, befinden sich in der Natur in einem Zustand beständiger Konkurrenz. Das Individuum entwickelt und vervollkommnet sich durch die ununterbrochene Ausübung von Funktionen, die seine Organe entwickeln, durch kühne Anpassung der Organe an die Bedingungen der Umwelt. Durch Beseitigung der Schwächsten und das Überleben und die Reproduktion der Stärksten verfestigen sich die nützlichen Eigenschaften der Art und entwickeln sich die sie bildenden Wesen in Richtung einer je höheren Form.
Indem sie uns so das Gesetz des Fortschritts der Lebewesen eröffnet, bietet uns die Natur – so sagen die Individualisten – die Lösung der sozialen Frage: Der Fortschritt der Gesellschaften ist von gleicher Ordnung wie der Fortschritt der Arten. Die ökonomische Konkurrenz ist nur eine der Formen der vitalen Konkurrenz. Die Leistung ist das Gesetz des sozialen wie des physischen Lebens, und ebenso wenig wie die Natur kennt die Gesellschaft andere Belohnungen und andere Strafen als diejenigen, die dem Individuum direkt aus der Erhöhung oder Verminderung seines Wirkens zufließen.
Lassen wir also machen, und lassen wir geschehen. Jegliche Intervention einer kollektiven Macht, um den Konflikt zwischen individuellen Interessen zu regeln, ist willkürlich und vergeblich zugleich. Der Staat hat genau eine Funktion: Er muss darüber wachen, dass der soziale Kampf nicht gewaltsam und blutig ausgetragen wird wie derjenige der Arten, er muss den materiellen Frieden, »die öffentliche Ordnung« zwischen den Menschen aufrechterhalten. Doch ist diese Funktion erfüllt, endet seine Rolle.
18Die Pflicht des Staates besteht in erster Linie in der Gewährleistung der Sicherheit für alle. Was die Personen anbetrifft, denen der Staat diese Sicherheit garantiert, so können diese mit ihrem Eigentum (oder, besser gesagt, mit ihren Aktivitäten) machen, was ihnen gut erscheint. Der Staat hat sich nicht in die privaten Beziehungen einzumischen: Es ist an den Privatpersonen, ihre Angelegenheiten zu ihrem eigenen Besten zu regeln.[6]
Das ist die Lehre, welche die biologischen Wissenschaften erteilen. Das ist die Bedingung der Evolution der Gesellschaften.
II
Doch ist sie die einzige Bedingung? Und beschränken sich die Naturwissenschaften auf diese Lehre?
Das zu untersuchen waren sich Philosophen und Moralisten selbst schuldig, und ihrerseits entliehen sie nun von den Naturwissenschaften die Formulierung eines neuen, der Theorie vom »Kampf ums Dasein« entgegengesetzten Gesetzes, nämlich die Lehre von der »Solidarität der Wesen«.
Die Physiologen definieren die organische Solidarität als »die notwendige Beziehung zwischen zwei oder mehreren Akten der Ökonomie« und betrachten die Existenz dieser notwendigen Beziehungen zwischen den diversen Organen als gemeinsames Gesetz aller Lebewesen. Kant zufolge ist es genau die Wechselseitigkeit zwischen den Teilen, welche den Organismus konstituiert, wo alles zugleich Zweck und Mittel ist.[7]
»Die Solidarität«, sagte Charles Gide,
19ist in den Naturwissenschaften eine Tatsache von großem Gewicht, da sie das Leben charakterisiert. In der Tat, will man das Lebewesen, das Individuum definieren, so kann man dies nur über die Solidarität der Funktionen tun, welche die unterschiedlichen Teile miteinander verbindet, und der Tod ist nichts anderes als die Unterbrechung dieser Beziehung zwischen den verschiedenen Elementen, die das Individuum konstituieren, und die, nunmehr unverbunden, in neuen Wesen neue Verbindungen eingehen werden.[8]
Aber diese Beziehungen wechselseitiger Abhängigkeit zwischen den Teilen der Lebewesen existieren ebenso zwischen den Wesen selbst und auch zwischen der Gesamtheit dieser Wesen und dem Milieu, in dem sie sich befinden. Die Gesetze der Art – die Gesetze von Vererbung, Adaptation, Selektion, die Gesetze von Integration und Desintegration – sind nichts als die verschiedenen Aspekte desselben allgemeinen Gesetzes wechselseitiger Abhängigkeit, das heißt der Solidarität, der Elemente des universellen Lebens.
Der Mensch entgeht diesem Gesetz nicht.
Bis zu Kepler und Galilei galt die Erde als Zentrum des Universums. Die moderne Astronomie hat sie auf ihren Platz verwiesen, in das bescheidene Gefolge der um die Sonne kreisenden Planeten; und diese Sonne ist nichts als ein Stern mittlerer Größe, den seinerseits, in der unzählbaren Vielheit von Sternen, dasselbe Gravitationsgesetz bewegt, das Gesetz der Solidarität der Himmelskörper.
Auch dem Menschen hat die Wissenschaft seinen Platz unter den Wesen zugewiesen. Sie kennt nicht länger den abstrakten Menschen, der plötzlich – im Vollbesitz seiner Intelligenz und seines Willens – auf der Erde erschienen ist. Er ist nicht länger Ziel und Zweck des Weltsystems. Auch er ist den Beziehungen wechselseitiger Abhängigkeit unterworfen, die ihn mit seinesgleichen verbinden, mit der Rasse, aus der er hervorgeht, mit den anderen Lebewesen, mit dem irdischen und kosmischen Milieu.
Und diese Abhängigkeit ist nicht auf die Bedingungen seines physischen Lebens beschränkt; sie erstreckt sich auf die intellektu20ellen und moralischen Phänomene, auf die Akte seines Willens, auf die Werke seines Genius.
Diese Abhängigkeit verbindet ihn mit allen und allem, im Raum und in der Zeit.
Er lebt, und seine Gesundheit ist unablässig bedroht durch die Krankheiten der anderen Menschen, deren Leben wiederum durch die Krankheiten bedroht ist, die er sich selbst zuzieht. Er arbeitet, und durch die notwendige Teilung der Arbeit kommen die Produkte seiner Tätigkeit anderen zugute, so wie die Produkte der Arbeit anderer unumgänglich sind zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. Er denkt, und jeder seiner Gedanken reflektiert das Denken seiner Mitmenschen, in deren Hirn dieser sich seinerseits reflektieren und reproduzieren wird. Er ist glücklich oder er leidet, er hasst oder er liebt, und all diese Gefühle sind die Effekte oder die Ursachen gleichartiger oder gegensätzlicher Gefühle, die zur selben Zeit all die anderen Menschen bewegen, mit denen er im Verhältnis beständigen Austausches steht. Auf diese Weise ist jeder Zustand seines Ichs in jedem Moment der Zeit die Resultante der unzähligen Bewegungen der ihn umgebenden Welt, der Zustände des universellen Lebens.