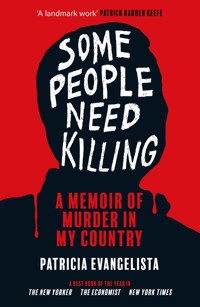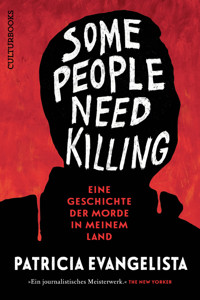
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein journalistisches Meisterwerk.« The New Yorker »Eine packende Reportage über eine Schreckensherrschaft auf den Philippinen – und eine universelle, hochaktuelle Warnung über den Zustand der Demokratie.« The Atlantic Patricia Evangelista wuchs auf in den Nachwehen einer demokratischen Straßenrevolution, die den Philippinen eine neue Zukunft bescherte. Drei Jahrzehnte später muss das Land erfahren, wie schnell es geschehen kann, dass eine Nation in eine gewaltsame Autokratie abgleitet. In Evangelistas von der Kritik gefeierten, akribisch recherchierten Reportage berichtet die international renommierte Journalistin mit tiefem humanitären Gespür von Präsident Rodrigo Dutertes sogenanntem Krieg gegen die Drogen – einem staatlich sanktionierten Feldzug, bei dem Tausende philippinische Bürger brutal ermordet wurden. Sie taucht tief ein in die Welt der Täter und Überlebenden und fängt die Atmosphäre des Schreckens ein, die sich ausbreitet, wenn ein gewählter Präsident entscheidet, dass einige Leben weniger wert sind als andere. Ein mitreißendes, unverzichtbares Zeitdokument, die vielstimmige Geschichte eines komplexen Landes und eine literarisch-journalistische Tour de Force – getragen von Evangelistas einzigartigem Stil: schonungslos, bildgewaltig, mutig. »In dieser eindringlichen Mischung aus Memoir und Reportage beschreibt Patricia Evangelista nicht nur die Ursprünge eines autoritären, die demokratischen Institutionen zerstörenden Regimes auf den Philippinen, sondern auch dessen universelle Gefahr für unser aller Demokratien.« Anne Applebaum
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
›Ein journalistisches Meisterwerk‹, schreibt der New Yorker über dieses erschütternd aktuelle Debüt. Patricia Evangelista, eine der renommiertesten Reporterinnen der Philippinen, berichtet bewegend und klug von den staatlich sanktionierten Morden an philippinischen Bürgern während Präsident Rodrigo Dutertes sogenanntem ›Krieg gegen die Drogen‹. Sie erzählt die hochinteressante Geschichte eines vielschichtigen Landes – und zeigt auf eindrucksvolle Weise, mit welchen Folgen es autoritären Regimen weltweit gelingt, demokratische Institutionen auszuhöhlen und zu zerstören. Evangelista taucht tief ein in die Welt der Killer und der Überlebenden und fängt die Atmosphäre des Schreckens ein, die sich ausbreitet, wenn ein gewählter Präsident entscheidet, dass einige Leben weniger wert sind als andere.
Über die Autorin und die Übersetzerin
Patricia Evangelista, geboren 1985, gehört zu den renommiertesten Journalistinnen der Philippinen. Sie berichtete als investigative Reporterin und Trauma-Journalistin für das Nachrichtenmagazin Rappler der Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa über Naturkatastrophen, bewaffnete Konflikte, Menschenrechte und Präsident Dutertes »Krieg gegen die Drogen«. Für ihre Arbeit wurde sie weltweit mit zahlreichen Preisen und Stipendien geehrt, darunter der Kate Webb Prize für »herausragenden Journalismus unter gefährlichen Bedingungen«, der Helen Bernstein Book Award für journalistische Exzellenz und der Whiting Creative Nonfiction Grant. Ihr Buch wurde von TIME Magazine zum »Sachbuch des Jahres« gekürt. Patricia Evangelista lebt in Manila.
Patricia Evangelista
Some People Need Killing
Eine Geschichte der Morde in meinem Land
Inhaltsverzeichnis
Ich will Angst verbreiten.
Prolog
Über einen Zeitraum von etwas mehr als sieben Monaten veröffentlichte der Philippine Daily Inquirer von 2016 an täglich eine Kill List, wie er es nannte, eine Todesliste. Es handelte sich dabei um ein öffentliches Archiv der Toten, das sich aus Berichten von Korrespondenten aus dem ganzen Land speiste. Die Einträge waren nummeriert und chronologisch geordnet. Die Todesumstände wurden knapp umrissen. Die Ortsangaben beschränkten sich auf Städte und Provinzen, es gab keine genauen Adressen. Wenn man sie kannte, wurden die Namen genannt, wenn nicht, wurden Nummern benutzt.
Der erste »nicht identifizierte mutmaßliche Drogendealer« beispielsweise wurde am 1. Juli ermordet, dem ersten Tag von Rodrigo Dutertes Amtszeit, am selben Morgen, an dem Jimmy Reformado, Nummer fünf der meistgesuchten Drogendealer in Tiaong, von »unbekannten Killern« erschossen wurde. Am folgenden Tag, dem 2. Juli, wurde Victorio Abutal, der meistgesuchte Drogendealer in Lucban, von »unbekannten Killern vor den Augen seiner Frau getötet«, eine Stunde und zehn Minuten vor dem Tod von Marvin Cuadra, Nummer zwei auf der Liste, und weniger als 14 Stunden, bevor die Nummer sieben, Constancio Forbes, »vor einem Wettbüro aus nächster Nähe« ermordet wurde. Einen Tag später, am 3. Juli, wurde der meistgesuchte Drogendealer von San Antonio, Arnel Gapacaspan, »von unbekannten Killern, die in sein Haus eindrangen«, umgebracht, exakt zur selben Zeit, zu der Orlan Untalan, auf der Liste der Meistgesuchten in Dolores auf Platz zehn, »tot in einem Abflusskanal, von Kugeln durchsiebt« aufgefunden wurde.
»Unbekannte Killer« war eine gängige Formulierung, aber es sind ihre Opfer – mutmaßliche Drogendealer, mutmaßliche Drogenhändler, ganz allgemein wegen Drogendelikten angeklagt, regional wegen Drogendelikten zur Fahndung ausgeschrieben, meistgesucht –, die verdeutlichten, dass es sich bei dem Geschehenen keineswegs um Zufälle handelte. Vielmehr waren es, wie Präsident Duterte versprochen hatte, gezielte Tötungen von »Menschen, die dabei sind, mein Land zu zerstören«.
Die Durchführung war einzig durch die Vorstellungskraft der Mörder begrenzt. Ein Mann wurde »tot aufgefunden, nachdem er aus seinem Haus entführt worden war«. Drei wurden »tot in einem Kanal« entdeckt, »gefesselt und mit ausgestochenen Augen«. Einem Mann wurde »in seinem Schlafzimmer in den Kopf geschossen«, und einer wurde morgens um sieben »vor der Grundschule seiner Tochter« getötet. Die tägliche Zahl der Toten war manchmal zweistellig, wie am 9. Juli, beginnend um Mitternacht mit Danilo Enopia Morsiquillo, mutmaßlicher Handlanger eines Drogenhändlers, der neben seiner Freundin schlafend erschossen wurde. Die zwölf anderen Tode unterschieden sich in Todesursache und Tötungshergang. Ein ehemaliger Wanderarbeiter wurde erschossen, als er die Autobahn entlangfuhr. Zwei fand man erdrosselt unter Kartons mit Schildern, auf denen sie als Kriminelle bezeichnet wurden. Drei weitere fand man tot auf, »die Schusswunden in Kopf und Mund mit Paketband abgeklebt«. Die restlichen Männer, die alle ebenfalls im Verdacht standen, etwas mit Drogen zu tun zu haben, waren »von unbekannten Killern umgebracht« worden.
Keine dieser Tötungen geschah offiziell durch die Polizei. Wenn man der Regierung glauben durfte, waren diese Morde von Privatpersonen und Mitgliedern von Drogenkartellen ausgeführt worden, von denen einige den Krieg als Ausrede benutzten, um mögliche Informanten zu beseitigen.
Die konstanten und ungemein schnellen Abläufe erforderten ihre eigene Nomenklatur. Man nannte sie drogenbezogene Tode. Illegale Tötungen. Es waren gezielte Mordanschläge, Exekutionen, Leichenentsorgungen, Drive-by-Shootings. Es waren »Verluste im Krieg der Duterte-Regierung gegen das Verbrechen« oder wie es der Nachrichtensender ABS-CBN formulierte, »diejenigen, die umkamen«. Selbst philippinische Beamte schienen nicht in der Lage, sich auf eine Terminologie zu einigen. Ein Senator nannte sie »Tötungen im Schnellverfahren«. Der Innenminister bezeichnete sie als »mutmaßlich durch Selbstjustiz ausgeführte Tötungen von Persönlichkeiten aus dem Drogenmilieu«.
Es gibt einen Begriff für dieses Phänomen. Er lautet »extrajudicial killings«, außergerichtliche Tötungen. Diese Floskel setzte sich auf der Straße und im Fernsehen durch, sodass ein Senatsbeschluss erlassen wurde, um »die jüngst grassierenden außergerichtlichen Tötungen und Schnellhinrichtungen von Kriminellen« zu untersuchen. Die Wiederholung erzwang eine Abkürzung – EJK. Die Presse benutzte sie als Attribut. Die Familien der Opfer als Verb. Die Kritiker als Vorwurf.
Mit Beginn der Duterte-Ära wurde das Archivieren dieser Tode zu meiner Arbeit. Als Außenreporterin für Rappler in Manila war ich eine derjenigen, die über die Auswirkungen von Dutertes Versprechen berichteten, jeden zu vernichten – ohne Anklage oder Verhandlung –, den er oder die Polizei oder irgendwelche Mitglieder einer Selbstjustiz ausübenden Bürgerwehr verdächtigten, Drogen zu nehmen oder zu verkaufen. Die Anzahl von Dutertes Toten war zeitweise überwältigend, und ebenso erdrückend war es, über die Mächtigen zu berichten in einem Land, in dem die Mächtigen sich weigern, Verantwortung zu übernehmen.
Mitten während des Kriegs lief ich davon.
Zu der Zeit untersuchte ich gerade eine Mordserie in der Hauptstadt. Meine Arbeit ging nur langsam voran. Ich jagte Zeugen nach. Ich klaubte offizielle Berichte zusammen. Ich traf mich mit Männern, die mir detailliert schilderten, wie genau sie ihre eigenen Nachbarn auf Anordnung von oben getötet hatten, und schickte dann Interviewanfragen an die Polizeibeamten, die sie beschuldigten. Rappler war der Auffassung, dass meine Anwesenheit in Manila ein Sicherheitsrisiko darstellte. Ich sah das genauso. Nicht davon auszugehen, dass die Killerkommandos aus Eigeninteresse davon Abstand nehmen würden, mich auf der Stelle abzuknallen, war sicherer. Meine Herausgeberin verschob die Veröffentlichung, bis mein Flieger von der Startbahn abgehoben hatte.
Aus all diesen Gründen überquerte ich Anfang Oktober 2018 den Pazifik. Wenn die netten Leute des Logan Nonfiction Fellowship glaubten, ich könne Literatur produzieren, spielte ich sehr gern mit. Die Künstlerresidenz auf einem bewaldeten Anwesen in Upstate New York dauerte drei Monate. Es hätte für mich eine Erholung sein müssen, aber wenn man jahrelang über ein staatlich sanktioniertes Massaker berichtet, macht das komische Sachen mit dem Kopf. Ich hatte gelernt, jede Aussage zu relativieren und Mitschriften auf dem Balkon zu verbrennen. Ich hatte nächtelang in der Überzeugung wach gelegen, dass ein falsch gesetztes Komma Anlass für eine Verleumdungsklage geben würde. Die pragmatische Vorsicht, die eine Reporterin, die über den Drogenkrieg berichtet, dringend benötigt, wandelte sich dank meiner zwanghaften Einbildungskraft in nahezu lähmende Paranoia. Nichts war mehr sicher. Alle logen. Der Mann mit dem Selfiestick war ein Polizeispitzel oder ein Mörder oder ein fanatischer Unterstützer des Präsidenten, der ein Foto von mir, wie ich eine Quelle treffe, auf Twitter hochladen könnte.
Die Tatsache, dass ich damit gelegentlich richtiglag, befeuerte den Irrsinn nur noch. Vieles erschien verdächtig: weiße Lieferwagen, Blinklichter, Spam-Mails, Männer auf Motorrädern, automatisierte Kreditkartenabbuchungen, der Kellner im Coffeeshop, der Hotelangestellte, der mich nach meiner Rechnungsadresse fragte, ein klingelndes Telefon, ein unterbrochener Anruf, die Türklingel. Ich las meine eigenen Geschichten wieder und wieder durch, suchte nach Lücken, zermarterte mir das Hirn wegen bestimmter Formulierungen, überzeugt davon, einen Fehler übersehen zu haben, der den Tod eines Zeugen nach sich ziehen würde. Als ich schließlich mit meinem leeren Einreiseformular in der Hand am New Yorker Flughafen stand, traute ich meinem Gedächtnis nicht mehr zu, meinen eigenen Namen schreiben zu können. Ich überprüfte die Schreibweise, indem ich sie mit meinem Ausweis abglich. Ich erinnere mich noch genau an den Drang, eine zweite Quelle zu finden – die ich auch fand, in meiner Geburtsurkunde.
Die Landschaft rund um Albany war sehr hübsch, auch wenn ein Päckchen Zigaretten 13 Dollar kostete. Es war kalt. Die Leute waren warmherzig. Es gab Schokoladenmousse zum Nachtisch, manchmal Beeren. Während der ersten Wochen versuchte ich, in einem Nebel aus Star Trek und Agatha Christie abzutauchen, aber im Gegenzug für das Aufenthaltsstipendium musste ich mich ernsthaft an einem Exposé für ein Buch versuchen. Ich schrieb darüber, wer ich war und woher ich kam und wie es sich anfühlte, morgens um zwei vor einer Leiche zu stehen.
Am Ende meines Aufenthalts unterschrieb ich einen Verlagsvertrag. Ich verpflichtete mich, aus der Ich-Perspektive von dem philippinischen Drogenkrieg zu erzählen. Es ging alles sehr schnell. Es war nicht meine Absicht zu lügen. Dieses Versprechen von Nähe und Intimität schien weit entfernt, als es inmitten der Glaswände eines Konferenzraums an diesem kalten Wintermorgen diskutiert wurde, Tausende Meilen entfernt von der drückenden Hitze eines kurz vor dem Kollaps stehenden Manilas.
Ich ging nach Hause. Ich fing an zu schreiben. Der erste Entwurf umfasste 73.000 Wörter, die sorgfältig und im Detail die Umstände eines jeden Mords beschrieben, die Tatorte so zahlreich und raumgreifend, dass es kaum mehr möglich war, die Leichen voneinander zu unterscheiden. Es war eine Reportage, kalt und präzise. Nirgendwo schrieb ich, wer ich war oder woher ich kam oder wie es sich anfühlte, morgens um zwei vor einer Leiche zu stehen.
Journalisten lernen, dass sie selbst niemals Teil der Geschichte sein dürfen. Und tatsächlich: Je länger ich als Journalistin arbeitete, desto gelegener kam es mir, hinter der professionellen Stimme einer allwissenden dritten Person zu verschwinden, überall und nirgends hinzugehören; Fragen zu stellen, ohne selbst welche zu beantworten. Bei jedem Fazit, das ich veröffentlichte, gab es zwei Quellen, einen Faktencheck und Querverweise. Mein Name stand zwar unter der Überschrift, aber die Geschichten, die ich schrieb, gehörten anderen Leuten an anderen Orten; Familien, deren Trauer und Schmerz so gewaltig waren, dass meine Gefühle dahinter verschwanden.
All das war richtig, aber es war ebenfalls richtig, dass ich Angst hatte. Meine Unfähigkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen, war nicht nur einem fehlgeleiteten Bekenntnis zur Objektivität geschuldet. Mir fehlten schlicht und einfach die Nerven.
In diesem Buch geht es um die Toten und die Menschen, die zurückbleiben. Aber es ist auch eine persönliche Geschichte, erzählt in meiner eigenen Stimme, als Bürgerin einer Nation, die ich nicht als die meine anerkennen kann. Die vielen Tausend, die starben, wurden mit der Erlaubnis meines Volkes getötet. Ich schreibe dieses Buch, weil ich mich weigere, meine zu geben.
Manila, Juni 2023
1 Positiv
»Ich heiße Lady Love«, sagt das Mädchen.
Das Mädchen ist elf Jahre alt. Für ihr Alter ist sie klein, sie scheint nur aus dürren, braunen Beinen und großen, dunklen Augen zu bestehen. Den Namen Lady Love schreibt sie in Druckbuchstaben in die erste Zeile der Schulzettel und benutzt ihn sonst nirgendwo. Ihre Großmutter hat sie so genannt. Alle anderen nennen sie Love-Love. Ma nannte sie so, wenn sie Love-Love zum Markt schickte. Zieh die Kinder an, Love-Love. Stör mich nicht, wenn ich Karten spiele, Love-Love. Halt mir keine Vorträge, Love-Love.
Niemand nennt sie Lady, und nur Dee nannte sie Love. Einfach nur Love.
Love, sagte er immer, umarm doch mal deinen Dee.
Dee ist die Abkürzung für Daddy. Manchmal ist es Love-Love peinlich, also nicht die Umarmungen, die von Dee sind gut, sondern dass sie ihn Dee nennt. Nur reiche Mädchen nennen ihre Väter Daddy. Für ein Mädchen aus den Slums von Manila sollte Pa ausreichen. Aber bitte, Dee und Love, Love und Dee, sie gehen am frühen Abend die Straße entlang, und das schmale Mädchen streckt einen dürren Arm aus, um ihn dem großen Mann um die Taille zu legen.
Love-Love wäre eigentlich das dritte von acht Kindern, aber das älteste starb an Tollwut, und das zweite war kaum zu Hause. So wurde es zu Love-Loves Aufgabe, Ma vom Trinken und Dee vom Rauchen abzuhalten. Du bist wieder betrunken, sagte sie Ma ständig, und dann sagte Ma zu Love-Love, sie solle verschwinden.
Love-Love machte sich Sorgen, sie könnten krank werden. Sie machte sich Sorgen wegen der Gerüchte, ihr Vater würde Drogen nehmen. Sie machte sich um sie alle Sorgen, weil sie wohnten, wo sie wohnten, an einem Ort, an dem eigentlich jeder ein Polizeispitzel sein konnte.
Ma und Dee sagten ihr, es sei alles in Ordnung. Dee bekam seinen Führerschein zurück. Ma verdiente mit Maniküren Geld. Sie hatten bereits vor der neuen Regierung kapituliert und versprochen, Drogen nie wieder auch nur anzurühren.
Lass uns wegziehen, sagte Love-Love zu Dee, aber Dee tat es mit einem Lachen ab.
Lass uns wegziehen, sagte sie zu Ma, aber Ma sagte, die Kleinen müssten zur Schule gehen. Wir können überall zur Schule gehen, sagte Love-Love.
Ma schüttelte den Kopf. Sie müssten erst sparen. Mach dir keine Sorgen, sagte Ma.
Love-Love machte sich Sorgen, und sie sollte recht damit haben.
Love, sagte ihr Vater eines Abends im August.
Love, sagte er, kurz bevor die Kugel in seinen Kopf einschlug.
Ich treffe sie bei ihrer Tante. Sie sitzt auf einem abgewetzten Sessel. Ich gehe vor ihr in die Hocke und strecke meine Hand aus, um ihre zu schütteln. Ein Interview ist nicht zuletzt ein Austausch. Sag mir, wie du heißt, dann sag ich dir, wie ich heiße.
»Ich heiße Pat«, sage ich zu Love-Love. »Ich bin Reporterin.«
Ich wurde 1985 geboren, fünf Monate, bevor eine friedliche Revolution die Demokratie zurück auf die Philippinen brachte. In jenem Jahr schien jede zweite Mittelschichtsmutter ihre Tochter Patricia zu nennen. Evangelista, mein Nachname, ist in meinem Land ziemlich weitverbreitet und geht auf das griechische Wort euangelos zurück, »Überbringer guter Nachrichten«. Eine Ironie, auf die ich häufig hingewiesen werde.
Meine Arbeit besteht darin, an Orte zu fahren, an denen Menschen gestorben sind. Ich packe meine Koffer, rede mit Überlebenden, schreibe meine Geschichten und kehre nach Hause zurück, um auf die nächste Katastrophe zu warten. Ich warte nie sehr lang.
Ich kann von diesen Orten erzählen. Während des letzten Jahrzehnts gab es viele davon. Die Küstendörfer nach den Taifunen, wo man Babys in Rucksäcke packte, weil die Leichensäcke ausgegangen waren. Die Berghänge im Süden, wo Journalisten lebendig unter Schichten aus Autos und Leichen begraben wurden. Die Kornfelder im von Rebellen kontrollierten Hinterland und die Zeltstädte außerhalb verbrannter Dörfer. Die Hinterzimmer, in denen Mütter flüsternd von ihren Kindern sprachen, die sie aus Verzweiflung abgetrieben hatten.
Ein überschaubares Vokabular ist bei meiner Arbeit nützlich. Zuerst kommen die Namen, dann die Opferzahlen. Farben sind gut für die Beschreibung. Der Hügel ist grün. Der Himmel ist schwarz. Der Rucksack ist lilafarben, genau wie die Prellung auf der linken Wange der Frau.
Kurze Wörter sind präzise. Sie sind genau das, was sie sind, und sie lassen sich schneller tippen, wenn der Akku zur Neige geht.
Verben sind mir am liebsten. Sie brechen die Geschichten auf logische Bewegungen herunter, Finger an Abzug, Messer an Bauch: ducken, rennen, schlagen, ertrinken, erschießen, zerreißen, zerplatzen, zerbomben.
Seit Seine Exzellenz, Präsident Rodrigo Roa Duterte, gewählt wurde, habe ich eine Handvoll neuer Wörter gesammelt. Sie wechseln durch, tauschen die Plätze, wiederholen sich immerfort.
Töten, zum Beispiel. Mein Präsident benutzt dieses Wort oft. Er sagte es mindestens 1254-mal während der ersten sechs Monate seiner Präsidentschaft, zu unterschiedlichen Anlässen und bezogen auf zahlreiche Feinde. Er sagte es zu vierjährigen Pfadfindern, wobei er versprach, die Menschen zu töten, die sich ihrer Zukunft in den Weg stellten. Er sagte im Ausland beschäftigten Filipinos, für sie gäbe es zu Hause Jobs, indem sie Drogenabhängige töteten. Er forderte Bürgermeister, die des Drogenhandels angeklagt waren, dazu auf, zu büßen, zurückzutreten oder zu sterben. Er drohte damit, Menschenrechtsaktivisten zu töten, sollte sich das Drogenproblem verschlimmern. Er sagte Polizisten, sie bekämen von ihm Medaillen für das Töten. Er versprach Journalisten, sie könnten zu legitimen Zielen von Mordanschlägen werden.
»Ich scherze nicht«, sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung 2016. »Wenn ich Präsident werde, weise ich das Militär und die Polizei an, diese Leute aufzustöbern und zu töten, Punkt.«
Ich kenne nur die Namen von ein paar Dutzend Toten. Dem Präsidenten sind sie egal. Er hat schon genügend Namen für sie. Sie sind Süchtige, Drogenhändler, Konsumenten, Dealer, Monster, Verrückte.
Love-Love kann zwei von ihnen benennen. Es sind Dee und Ma.
Es fing mit einem Schlag gegen die falsche Tür an, nur ein Stück den Flur runter. Danach Aufruhr, Fäuste prallten auf Holz, Bewohner protestierten, und eine Tür nach der anderen wurde zugeschlagen, untermalt von der Stimme eines Mannes.
»Negativ«, sagte der Mann. »Negativ, negativ, negativ.«
Der Mann brauchte nicht lange, bis er Love-Loves Tür erreicht hatte. »Aufmachen«, schrie der Mann.
Drinnen kauerte Love-Love neben ihrer Mutter. Es war drei Uhr morgens. Dee schlief tief und fest auf dem Rücken, eins der Kleinkinder lag auf seiner Brust. Die anderen Kinder schliefen über das Zimmer verteilt. Der Mann trat die Tür ein.
So würden ihre Eltern also sterben, dachte Love-Love.
Ihre Mutter öffnete die Tür, aus Angst, die Männer draußen würden durch die Fenster eindringen und sie alle im Kugelhagel töten. Zwei Männer stürmten ins Zimmer. Beide trugen Masken mit Löchern für Augen, Nase und Mund.
»Positiv«, sagte einer von ihnen und baute sich vor Dee auf. »Steh auf«, sagte er.
Dee schreckte hoch. Er wollte sich aufsetzen, aber ein Baby klammerte sich an seine Brust. Er ließ sich zurückfallen.
»Love«, sagte er, bevor ihn einer der Männer erschoss. Die Kugel brach aus seiner rechten Schläfe aus. Blut spritzte über das Baby.
»Dee!«, schrie Love-Love.
Das Baby heulte. Ma weinte. Sie warf dem Mann, der ihren Ehemann getötet hatte, einige Papiere hin. Hier sei der Beweis, schluchzte sie, dass sie sich gebessert hätten.
Ma fiel auf die Knie. Love-Love zerrte ihre Mutter wieder auf die Beine. Es war Love-Love, die sich zwischen den Schützen und Ma schob. Es war Love-Love, die dort stand, die Mündung nur wenige Zentimeter von ihrer Stirn entfernt. Es war Love-Love, mit ihren großen Augen und den dünnen braunen Beinen, die den Schützen verfluchte und aufforderte, er solle stattdessen sie erschießen.
»Töte mich«, sagte sie. »Nicht meine Ma.«
Der zweite Gangster hielt den ersten zurück. »Nicht schießen«, sagte er. »Sie ist noch ein Kind.«
Sie gingen. Aber es dauerte nicht lange, bis sie zurückkamen. Der erste Gangster wandte sich wieder Love-Loves Mutter zu und hob die Waffe.
»Wir sind Duterte«, sagte er und schoss das Magazin leer.
Ma starb auf ihren Knien.
Love-Love verfluchte die Mörder. »Ihr verdammten Wichser«, sagte sie. »Ihr habt schon meinen Dee umgebracht. Und jetzt noch meine Ma.«
Der Schütze hielt Love-Love die Mündung vors Gesicht.
»Halt die Fresse«, sagte er, »oder wir erschießen dich auch noch.«
Als sie weg waren, entdeckte Love-Love das Loch in Mas Kopf. Das Blut sprudelte durch Love-Loves Finger. Dee lag noch dort, wo er zusammengebrochen war. Seine Augen hatten sich verdreht. Love-Love wollte ihn umarmen, aber sie hatte Angst. Er sah nicht wie ihr Dee aus.
»Dee«, fragte das Mädchen namens Love. »Verlässt du mich, Dee?«
1945 veröffentlichte der Reporter Wilfred Burchett im Londoner Daily Express die Story über einen Atomsprengkopf, der über Hiroshima explodiert war. Er berichtete von, wie er es nannte, »der grauenhaftesten und erschreckendsten Verwüstung in vier Jahren Krieg«. Burchett marschierte mit einer Pistole, einer Schreibmaschine und einem japanischen Sprachführer in Hiroshima ein. »Ich gebe diese Fakten so objektiv wieder, wie ich nur kann«, schrieb Burchett, »in der Hoffnung, dass sie der Welt als Warnung dienen werden.«
Ich bin eine Reporterin, wie Burchett. Aber anders als er, bin ich keine Auslandskorrespondentin. Ich habe die vergangenen zehn Jahre damit verbracht, in ausgebombte Städte zu fliegen, Leichensäcke zu zählen und sowohl über die natur- wie die menschengemachten Katastrophen zu berichten, die mein eigenes Land heimsuchen. Und dann waren da noch die letzten sechs Jahre, in denen ich die Morde dokumentierte, die unter der Regierung von Präsident Rodrigo Duterte begangen wurden.
Der Umstand, dass ich eine Philippinerin bin, die auf den Philippinen lebt, bedeutet, dass ich nach einem Einsatz nicht einfach nach Hause gehen kann. Es gibt keinen Sieben-Tage-Drehplan mit im Voraus gebuchten Flügen und der Option zu verlängern; nur immer mehr Leichen, jeden Tag. Ich brauche keinen Übersetzer, der mir sagt, dass der Mann, der neben seinem toten Bruder putang ina schreit, »Wichser« und nicht »Mistkerl« meint. Ich verstehe, warum Särge manchmal wochenlang in Wohnzimmern stehen, und ich bin darauf vorbereitet, während der Totenwache das Sandwich auszuschlagen, das mir die Witwe anbietet, die so schrecklich arm ist, dass sie sich die Formaldehyd-Injektion für 20 Dollar nicht leisten kann, die nötig ist, um eine verwesende Leiche zu konservieren.
Als die Morde ihren Höhepunkt erreichten, gab es jede Nacht neue Leichen. Sieben, zwölf, sechsundzwanzig, die Brutalität auf einen Absatz reduziert, manchmal auf nur einen einzelnen Satz. Die Sprache versagte, während die Opferzahl stieg. Es gibt keine Synonyme für Blut oder bluten. Das Blut strömt nicht mehr, wenn ich zu einem Tatort komme. Es gurgelt oder spritzt nicht mehr. Es hat eine Lache unter der Tür gebildet, oder es sickert, wie im Fall des Jeepney-Barker, der vor einem 7-Eleven erschossen wurde, in Rinnsalen aus dem Mund.
Tot ist ein gutes Wort für Journalisten im Zeitalter von Duterte. Tot verhandelt nicht, verlangt wenig Verifikation. Tot ist eine sichere Sache, hat Knochen, Haut und Fleisch, tot lässt sich anfassen und ansehen und fotografieren und für die Ausstrahlung verpixeln. Tot, ob nun 44 oder 58 oder 27.000 oder 1, ist tot.
Ich gebe diese Fakten so ehrlich wieder, wie ich kann, aber ich bin nicht objektiv, während ich sie niederschreibe. Dass ich Philippinerin bin, bedeutet auch, dass ich Schuld auf diese komplexe Weise verstehe, wie sie nur auf den kolonialisierten Philippinen aufgewachsene Katholiken kennen. Ich weiß, warum ein Vater niederkniet, um das Blut seines Sohnes abzuwaschen, und dabei Entschuldigungen in den Linoleumboden murmelt. Ich weiß, dass er glaubt, persönlich schuld daran zu sein, die vier Kugeln nicht aufgehalten zu haben, die den Körper seines 30-jährigen Sohns durchschlagen haben – Stirn, Brust und die schmalen Schultern, sodass er darin das Zeichen des Kreuzes erkennt – im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Ich weiß das alles, weil ich die Tochter meines Vaters bin und verstehe, dass mein eigener Vater ebenfalls betet, weil mein Überleben ein einziges Privileg ist.
Präsident Duterte sagte: Tötet die Drogenabhängigen, und die Drogenabhängigen starben. Er sagte: Tötet die Bürgermeister, und die Bürgermeister starben. Er sagte: Tötet die Anwälte, und die Anwälte starben. Manchmal waren die Toten keine Drogendealer oder korrupten Bürgermeister oder Menschenrechtsanwälte. Manchmal waren es Kinder, aber sie wurden trotzdem getötet, und der Präsident sagte, es seien Kollateralschäden.
Während der ersten Monate des Kriegs sah ich viele junge Frauen und Mädchen, und nicht alle haben überlebt und konnten ihre Geschichten erzählen. In derselben Woche, in der Love-Loves Eltern getötet wurden, starb die fünfjährige Danica Mae durch eine Kugel, die für ihren Großvater bestimmt war.
Ich sprach mit ihm in einem engen Raum mit Betonwänden, an denen Jesus gütig von einem Wandkalender herabblickte. Er hieß Maximo, und er nahm nicht an der Beerdigung seiner Enkelin teil. Seine Familie hatte ihn davon abgehalten. Seine Töchter versprachen ihm, Handyvideos zu machen. Wir stellen sie auf Facebook, sagten sie. Warte auf die Beerdigungsvideos, wir sorgen dafür, dass du sie dir ansehen kannst. Ihm war klar, warum er nicht hingehen sollte und warum ihn seine Familie direkt aus dem Krankenhaus in eine Wohnung verfrachtet hatte, die weit weg von dem Ort lag, an dem er den größten Teil seines Ehelebens verbracht hatte. Die Männer mit den Masken könnten zum Haus zurückkommen und den Job zu Ende bringen. Niemand würde dann seine Danica Mae besuchen. Er wollte, dass Danica von ihren Trauergästen umgeben war. Das hatte sie verdient, und so vieles mehr.
Maximo hatte die Duterte-Kandidatur unterstützt. Er trug immer noch das rot-blaue Armbändchen, auf dem in weißen Buchstaben der Name des Präsidenten aufgedruckt war. Maximo hatte für Duterte gestimmt, weil Duterte ein starker Mann war. Es war egal, dass Maximo selbst schon Drogen genommen hatte. Vielleicht wäre Danica auch ohne Duterte als Präsident gestorben, vielleicht auch nicht. Er wusste nur, dass es viele Tote gegeben hatte, darunter Männer, die auf derselben Liste standen, auf der sich auch sein Name befunden hatte. Die Liste nannte ihn einen Drogendealer.
»Sollen sie mich doch töten, wenn sie können«, sagte er. »Ich überlasse es Gott. Gott weiß, wer die Sünder sind und wer die Wahrheit spricht.«
Also wartete er allein. Er war ein großer Mann mit einem dicken, strammen Bauch und geröteten Augen. Er weinte ein wenig, betete ein wenig, säuberte die Schusswunden, an die er herankam. Er rief Danicas Eltern an und bat sie, sich über ihren Sarg zu beugen und ihr zuzuflüstern, dass ihr Opa sie lieb hatte.
Er bat sie, ihr zu sagen, dass er ihr zuliebe wegblieb.
Ich hatte mich immer für eine höchst pragmatische Zynikerin gehalten, bis zu dem Jahr, in dem Präsident Duterte gewählt wurde. Ich wusste, dass guten Menschen schreckliche Dinge zustießen. Ich war krankhaft stolz darauf, zu jener besonderen Sorte von Korrespondenten zu gehören, denen es möglich war, neben einer Leiche zu stehen und festzustellen, dass es sich da unten im Wasser vermutlich um eine Frau handelte, dass unter dem ausgebleichten gelben Shirt die Überreste von Brüsten zu erkennen waren, trotz des Umstands, dass dem Gesicht über dem Shirt Haut und Fleisch fehlten.
Falls mein Journalismus einer moralischen Hierarchie folgte, so stand an erster Stelle, dass es galt, unter allen Umständen den Verlust des Lebens zu vermeiden, denn das wäre das Allerschlimmste. Natürlich war das kein revolutionäres Konzept. Ich wuchs als Bürgerin der ältesten Demokratie Südostasiens auf, und ich glaubte, so wie vermutlich die meisten meiner Generation, an Meinungsfreiheit und Menschenrechte und die Pflicht, meine Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Ich glaubte 2009 an die Demokratie, als ich über den Mord an 32 Journalisten schrieb. Ich glaubte 2013 daran, als ich über das Bombardement von Zamboanga City berichtete. Ich glaubte 2015 daran, nachdem 44 ahnungslose Polizisten durch die Arroganz der Regierung in ein Maisfeld geschickt wurden und Rebellen zum Opfer fielen. Ich glaubte genauso an Demokratie, wie ich an kurze Sätze und einfache Wörter glaubte.
Demokratie ist ein einfaches Wort, so wie Mord. Ich betrachtete sie als Gemeinwohl, im Gegensatz zu einer von persönlichen Machtinteressen bestimmten Politik. Mit Demokratie meinte ich nicht die gewählte Regierung. Die Regierung, jede Regierung, versagte oft, war oft mitschuldig, war weitgehend inkompetent, verlogen und realitätsfremd. Die Demokratie, an die ich glaubte, war die Nation, eine Gemeinschaft von Millionen, die Brutalität als Fehlentwicklung betrachtete, die es so oft und so heftig zu verurteilen galt, wie es erforderlich war.
Ich glaubte immer noch an die Demokratie, als ich anfing, Präsident Dutertes Tote zu zählen. Da verstand ich noch nicht, dass die Demokratie, auf die sich mein Journalismus berief, nur für mich und ein paar wenige andere Geltung besaß. Anderswo im Land starben die Menschen, verhungerten, wurden zu Witwen oder Waisen oder wurden ignoriert. In der Welt, wie sie sich Rodrigo Duterte vorstellte, bestand diese Nation aus einem Haufen Idioten und Ahnungsloser, die von Gaunern und Verbrechern aufgehetzt wurden. Seine Nation waren die Badlands, wo der Frieden gestört und kein Bürger in Sicherheit lebte; wo jeder Abhängige bewaffnet war und bereit zu töten.
Duterte stärkte den Menschen den Rücken, er sagte, die Mühsal ende hier und jetzt. Scheiß auf Sentimentalität. Scheiß auf Bürokratie. Kein Vergeben mehr, keine zweite Chance, es müsse endlich eine Grenze gezogen werden, und auf einer Seite dieser Grenze stünde er mit einer geladenen Waffe in der Hand. Das Gesetz mochte beliebig sein, die Verbrecher am Ruder, aber Duterte war ein Mann, der sagte, was er meinte, und meinte, was er sagte, der einen vielleicht einmal vorwarnte und dann langsam bis drei zählte.
Das war die Republik der Philippinen, die Rodrigo Duterte versprach zu retten. Sechs Monate, und er würde dem Verbrechen und der Korruption ein Ende setzen. Sechs Monate, und das mit den Drogen hätte sich erledigt.
Man applaudierte ihm, feierte ihn, und schließlich wurde er ins Amt eingeführt.
»Hitler vernichtete drei Millionen Juden«, sagte er. »Hier gibt es drei Millionen Drogenabhängige. Ich werde sie liebend gern abschlachten.«
Im Dezember, fünf Monate nach Beginn des Drogenkriegs, musste ein weiteres Mädchen dabei zusehen, wie ihr Vater starb. Sie hieß Christine, und sie war 14 Jahre alt.
Sie sagte: »Eines Tages kamen die Cops und suchten nach Pa.« Stattdessen fanden sie nur ihre Mutter. Die Cops behaupteten, Christines Mutter sei drogenabhängig. Sie war im achten Monat schwanger. Sie nahmen sie in einem weißen Van mit. Als Pa nach Hause kam, sagten ihm alle, er müsse verschwinden. Die Polizei, sagten seine Nachbarn, würde ihn umbringen, wenn sie ihn fanden.
Monate später kam Pa trotzdem eines Abends nach Hause. Er sagte, er vermisse die Kinder. Er kochte Spaghetti. Er sang ihnen etwas vor. Er fütterte die Kleinsten von Hand. Er gab Christine die Hälfte von seinem Kaffee ab. Er sagte ihnen allen, dass er sie sehr lieb habe und dass es eine Weile dauern würde, bis er wieder zurückkäme.
Draußen vor dem Haus hörten sie am nächsten Morgen Geschrei. Drei Gewehre erschienen am Fenster, die Läufe glänzten im Sonnenlicht. Die Tür wurde aufgebrochen. Fünf Polizisten kamen ins Haus gerannt. Sie zwangen Pa, sich auf den Sessel zu knien, und drückten sein Gesicht in das Rückenkissen. Er umklammerte seinen Ausweis. Er sagte, er sei clean.
»Bitte«, sagte er, »bitte nehmt mich einfach nur fest. Ich habe so viele Kinder.«
Die Polizisten wiesen die Kinder an, rauszugehen. Christine schlang die Arme um Pa. Einer der Polizisten riss sie weg und schleuderte sie gegen die Wand.
»Raus hier«, sagte er.
Nur, dass Christine nicht rausging, zumindest nicht schnell genug. Sie war dort, als der Polizist ihrem Vater in den Hinterkopf schoss, in die Brust schoss, aus nächster Nähe, sodass ihr kleiner Bruder am nächsten Tag den Finger in das Loch im Polster stecken und die Kugel rauspulen konnte.
Die Polizisten behaupteten, Pa hätte sich gewehrt. Sie sagten, er wäre ein Drogendealer. Sie sagten, sie hätten Pa in Notwehr getötet.
Erst lange, nachdem Pa gestorben war, fing Christine wieder an zu sprechen. Ihr erstes Wort lautete: Entschuldigung. Sie entschuldigte sich bei ihrer Großmutter und bei ihren Geschwistern. Sie entschuldigte sich, weil sie Pa an dem Morgen, an dem er getötet worden war, losgelassen hatte. Hätte sie sich besser festgehalten, hätte sie ihn stärker umarmt, wäre Pa noch am Leben.
Mein Nachrichtenunternehmen hat einen komischen Namen: Rappler. Meine Chefinnen haben ihn sich ausgedacht, von rap für diskutieren und ripple, für Welle. Sie erklärten es mir am Tag meiner Einstellung im dritten Stock eines Gebäudes, das an einer Straße lag, die zur Sommerzeit überflutet war. Fast hätten sie sich Rippler genannt, sagten sie, hätte nicht jemand darauf verwiesen, dass es ein wenig nach Nippel klang. Ich musste lachen. Während der ersten Monate fing jedes meiner Außeninterviews damit an, dass ich einer verwirrten Quelle, die an die Bezeichnungen der Fernsehsender gewöhnt war, den Unternehmensnamen mehrfach wiederholte. »Raffler, sagen Sie? Rapper? Rapeler?« Rappler, antwortete ich. Rappler. Ja, Sie finden uns auf YouTube. Nein, ich arbeite nicht für YouTube. Irgendwann gab ich auf, nuschelte den Namen leise weg und bot an, ihren Teenie-Neffen einen Facebook-Link zu schicken.
Ich fing im Spätsommer 2011 bei Rappler an. Ich war damals 26 Jahre alt, und anders als Rappler glaubte ich nicht daran, dass die Welt durch Social Media ein besserer Ort werden würde. Aber ich glaubte, dass es mit dem Journalismus vorangehen würde, wenn wir uns nur genug Mühe gaben. Rappler glaubte daran, die neue Korrespondentin für das digitale Zeitalter erschaffen zu können, eine Ein-Frau-News-Crew, die fotografieren, filmen, Fragen stellen, live über die Entwicklungen twittern, Artikel abliefern und die Konkurrenz schlagen konnte, und das alles, während sie mit nichts weiter als einem mobilen Internetstick und einem iPhone eine Live-Reportage produzierte. Das Experiment war zum Scheitern verurteilt, zumindest für mich. Ich war die Reporterin, die sich auf dem Weg zum Büro verirrte und eine halbe Stunde brauchte, um einen einzigen Satz zu Papier zu bringen. Ich könnte, da es sich hier um eine Erinnerungsübung handelt, über Streitigkeiten berichten, bei denen es um die Anzahl der Wörter und die Redaktionssoftware und die Farbe Orange ging, die sie für das Logo auswählten. Ich könnte über den Nachmittag schreiben, an dem die Herausgeberinnen endlich ein Sofa kauften, nachdem sie einmal zu oft entdeckt hatten, dass Reporterinnen unter ihren Schreibtischen schliefen. Ich könnte über den Tag schreiben, an dem ich eine zukünftige Friedensnobelpreisträgerin dazu gebracht hatte, aus Frust zu heulen. Es war meine Schuld, aber ich sage immer auch dazu, dass sie angefangen hat.
Diese Geschichten sind alle wahr, aber es stimmt auch, dass Rappler mich an zu viele Orte geschickt hat, an denen das Alltägliche mit einer Leiche auf dem Boden endete. Fragt man mich nach einer Geschichte über Rappler, kann ich nur sagen, dass jede Geschichte über Rappler genauso eine Geschichte über die Leute ist, die uns ihre Geschichten erzählen. Ich bin Trauma-Reporterin. Jemand wie ich arbeitet in dem unbehaglichen Raum zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte. Meine Geschichten boten keine Lösungen, sie versprachen kein Heil. Ich trieb keinen Handel mit Hoffnung. Manchmal, wenn wir Glück hatten, bezahlte ein Leser für einen Sarg oder einen neuen Stuhl für einen Friseur in Guiuan, der bei einem Sturm seinen Salon verloren hatte.
Jede Geschichte begann mit dem Alltäglichen, weil es unterstrich, was als Nächstes geschah. Der blaue Himmel vor der Leichenflut. Der Abschiedskuss vor dem Kugelhagel. Nachdem der Supertaifun Haiyan die Stadt Tacloban in Schutt und Asche gelegt hatte, saß ich mit der Kamera vor einem Mann, der mich bat, eine Nachricht an seinen Sohn zu übermitteln. Ich stellte das Bild scharf und drückte den Aufnahmeknopf. Bitte komm nach Hause, sagte Edgardo, Papa macht auch Spaghetti zu Weihnachten. Sein Sohn war verschwunden, sehr wahrscheinlich ertrunken, aber Edgardo versuchte trotzdem, ihn zu erreichen, weil das Alltägliche ihn vielleicht zurückholen würde.
Ich schrieb über schreckliche Dinge, die geschahen, weil diese Dinge nicht hätten geschehen dürfen und nie wieder geschehen sollten. Dann versprach eines Tages der Mann, der Präsident sein würde, seine eigenen Bürger zu töten. Das Schreckliche wurde zum Alltäglichen, begleitet von donnerndem Applaus.
Nacht für Nacht schallten Schüsse durch die Slums. Auch diese Geschichten begannen mit dem Alltäglichen. Ich wachte auf, sagte die Freundin von jemandem, und er lag nicht mehr neben mir. Ich nahm ein Bad, sagte die Mutter von jemandem, als ich die Rufe hörte. Ich war zu Hause, sagte die Tochter von jemandem, als die Cops die Tür eintraten und meinen Vater erschossen. Ich schrieb auf, was ich konnte, und obwohl es viele Menschen gab, die trauerten, waren da gleichzeitig auch so viele, die über die Toten lasen und sagten, es müssten noch mehr sterben.
Rappler war kaum vier Jahre alt, als Rodrigo Duterte zum Präsidenten gewählt wurde. Wir waren nur sehr wenige, aber wir taten, was wir konnten, um über Korruption und Machtmissbrauch zu berichten und über den Krieg gegen die Drogen. Präsident Duterte gab Rappler einen anderen Namen. Er nannte uns Fake News. Er sagte, wir seien bezahlte Schreiberlinge. Wir wurden wegen Steuerhinterziehung und Online-Verleumdung und Urheberrechtsverletzung verklagt. Rappler wurde die Lizenz entzogen, was noch immer angefochten wird. Unseren Reporterinnen wurde verboten, über den Präsidenten zu berichten. Täglich wurden wir auf Social Media bedroht. Weil wir Frauen sind, befanden sich auch Vergewaltigungsandrohungen darunter.
Ich veröffentlichte viele Geschichten, jede einzelne drehte sich um eine Leiche, die einmal einen Namen gehabt hatte, auch wenn mein einziger Anhaltspunkt »Nicht identifizierte Leiche Nr. 4« gewesen war. Ich schrieb, dass die fünfjährige Danica erschossen wurde, bevor sie ihren neuen, pinkfarbenen Regenmantel tragen konnte. Ich schrieb, dass Jhaylord der Liebling seiner Mutter gewesen war und dass Angel in der Nacht ihrer Ermordung eine Barbie-Puppe bei sich getragen hatte. Ich fügte so viele Details wie möglich hinzu, einfach alles, die Farbe des Schuhs, der Klang des Schreis, der Umstand, dass der Tote eine knappe, rot-weiße Unterhose trug, als man die Leiche auf der Straße auszog.
»Ich will ehrlich zu Ihnen sein«, sagte der Präsident. »Sind das Menschen? Wie lautet Ihre Definition eines menschlichen Wesens?«
Hier ist Danica Mae Garcia, Maximos Enkeltochter.
Hier ist Constantino de Juan, Christines Pa.
Hier sind Love-Loves Dee und Ma.
Hier ist der Mann, der sie getötet hat.
»Wir sind Duterte«, sagte der Schütze mit der Maske.
2 Die Mehrheit der Überlebenden
In der Geschichte, die mein Großvater erzählte, trafen die ersten weißen Männer mit einer Flotte aus fünf Kriegsschiffen ein, angeführt von der Trinidad.
Es war 1521. Hinter der Flottille lag über ein Jahr, das geprägt war von Unglücksfällen und Meuterei. Der Kapitän der Trinidad, ein bärtiger Abenteurer namens Ferdinand Magellan, sah am Horizont eine bewaldete Insel. Die Männer der Trinidad fielen auf die Knie und priesen den Herrn, und da ihnen der Rum ausgegangen war, sahen sie zu, sich ordentlich mit Bireley’s-Orange-Soda und Siu-Hoc-Tong-Reiswein zu betrinken.
Magellan setzte den Anker. Er grüßte ein vorbeifahrendes Boot mit Einheimischen.
»Um zu zeigen, dass er das Herz am rechten Fleck hatte«, sagte mein Großvater, »ließ sich Magellan von seinem Proviantmeister ein paar rote Mützen, Ferngläser, Kämme, Schellen und die 16.-Jahrhundert-Entsprechung dessen, was wir heute einen Zoot Suit nennen, reichen. Magellan übergab alles dem einheimischen Oberhaupt und sagte: »So etwas finden Sie in keinem Sears-Roebuck-Katalog. Es ist der letzte Schrei für den gut gekleideten Kopfjäger, nehmen Sie es mit den besten Empfehlungen des Königs und auch von mir, und hätten Sie vielleicht noch ein paar überflüssige Goldbarren irgendwo rumfliegen?«
Wenn ich sage, mein Großvater erzählte Magellans Geschichte, dann meine ich nicht, dass er sie mir erzählte, sondern den Leuten, die vielleicht ein von der Philippinischen Buchgesellschaft vertriebenes Buch gekauft hatten, geschrieben 1951 von Mario P. Chanco. »The Fredding of Ferdinand Magellan« war eine von einer Handvoll volkstümlicher Erzählungen, die mein Großvater veröffentlicht hatte, während er seinem Beruf als Zeitungsjournalist nachging. Mein Großvater, schrieb einer seiner Freunde liebevoll, »erging sich deutlich zu oft in albernen Bemerkungen und respektlosen Äußerungen, besonders was ernsthaftes Schreiben betraf«.
Und so segelte sein imaginierter Magellan weiter in die Inselgruppe hinein, aus der später die Philippinen werden sollten. Er traf auf andere Einheimische, tauschte seine Fracht gegen Gold und Gewürze, bis er Lapu-Lapu begegnete, dem grimmigen Anführer der Insel Mactan. Lapu-Lapu weigerte sich, Magellan zu huldigen oder dem spanischen König seine Loyalität zuzusichern.
»Natürlich machte das Magellan unglücklich«, erklärte mein Großvater, »schließlich verbreitete er das Wohlwollen und den Segen seines Monarchen zur Erleuchtung und zum Wohle aller Ungläubigen auf der Welt. Was machte es da schon, wenn besagtes Wohlwollen mit einer geladenen Muskete im Anschlag dargeboten wurde? Kam das nicht auf dasselbe hinaus?«
Die Eroberer wateten nach einem »fantastischen Trommelfeuer an den Stränden« in Richtung der Küste. Dort stießen sie auf die mit Speeren bewaffneten Männer von Mactan, die »sich auf sie stürzten wie Rachedämonen«. Magellan wurde von einem geschärften Bambusspeer getötet. Seine Männer, oder was von ihnen übrig war, segelten davon, nur zwei Schiffe der Flotte hatten überlebt.
»Was Magellan angeht«, schloss mein Großvater, »der blieb, wo ihn die Mactan-Inseln erwischt hatten. Und die Moral von der Geschicht: Wenn du das nächste Mal was willst, sag Bitte.«
Niemand, der das liest, wird meinen Großvater für einen Historiker halten, aber seine Version davon, wie die spanischen Eroberer das erste Mal zu den Philippinen segelten, hat durchaus eine gewisse Verwandtschaft mit der Wahrheit. Lapu-Lapu von Mactan, dessen Krieger Giftpfeile auf Ferdinand Magellan schossen, hielt die spanische Invasion der Philippinen für fast ein halbes Jahrhundert auf. Ein weiterer Versuch, das Land zu erobern, diesmal durch Ruy López de Villalobos, scheiterte 1544. Villalobos’ einziger Erfolg bestand darin, einen Namen für die Inseln zu hinterlassen, von denen man ihn verscheucht hatte: Las Islas Filipinas, zu Ehren des zukünftigen Königs, Philipp dem Zweiten von Spanien.
Erst 1565 fielen schließlich mit der Ankunft von Miguel López de Legazpi die Inseln dem spanischen Kolonialreich zu. Während der folgenden Jahrzehnte luden spanische Galeonen dann dort ihre Soldaten und Statthalter und tonsurierten Mönche ab. Meinem Volk wurde beigebracht, vor dem katholischen Gott zu knien und vor seinen irdischen Gesandten zu leiden, aber die Spanier mussten bald feststellen, dass ihre neue Kolonie im Südosten nicht bereit war, Jahre voller Missbrauch und Messen zu erdulden. Es gab geheime Gesellschaften und bewaffnete Revolten, stille Aufstände und öffentliche Hinrichtungen. Gegen Ende versuchten es die Spanier sowohl mit Gewalt wie auch Versöhnung, richteten hier einen Schriftsteller hin, verbannten dort einen Revolutionsführer.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts waren es nicht nur die Philippinen, die sich gegen Mutter Spanien auflehnten. Mexiko, Puerto Rico und Kuba rebellierten ebenfalls, gerade als Theodore Roosevelt, damals stellvertretender Marineminister, bestrebt war, die amerikanischen Grenzen zu erweitern. 1898 erklärten die Vereinigten Staaten Spanien den Krieg, um ihre Interessen in Kuba zu schützen. Die Kriegshandlungen breiteten sich bis an die Ränder des bröckelnden spanischen Königreichs aus.
Hier zeigte sich Amerikas offenkundige Bestimmung im großen Stil: Eine 125.000 Mann starke Freiwilligenarmee marschierte in Santiago de Cuba ein. Roosevelts Rough Riders donnerten durch Las Guásimas und stürmten den San Juan Hill hinauf. Eine Armada, die das US-Asiengeschwader transportierte, wurde zur Hauptstadt des spanischen Brückenkopfs in Asien entsandt – nach Manila.
Wir gewannen den Krieg gegen Spanien nicht, denn Amerika beanspruchte den Sieg für sich selbst.
Die Schlacht in der Bucht von Manila war ein Debakel. Spanische Schiffe sanken. Der Rest wurde gekapert. Die amerikanischen Verluste waren vernachlässigbar.
Commodore George Dewey hielt die Stellung auf See, aber an Land kämpften Filipinos und befreiten eine Stadt nach der anderen, auf Kosten Tausender Leben. Viele Jahre bewaffneter einheimischer Revolution kamen zu einem Ende. General Emilio Aguinaldo sagte seinen Männern, als er aus dem Exil in Hongkong zurückkehrte, sie sollten sich in Scharen versammeln, wann immer sie eine amerikanische Flagge würden wehen sehen. Amerikaner, sagte er, hätten ihren »Schutzmantel über unser geliebtes Land« gebreitet, »um der Menschlichkeit willen, und aufgrund der Wehklagen so vieler verfolgter Menschen«.
Die bewaffnete philippinische Miliz bildete eine Allianz mit den Vereinigten Staaten. General Aguinaldo erklärte die Unabhängigkeit. Spanien weigerte sich, den Filipinos die weiße Flagge zu zeigen, und die Amerikaner sprangen nur zu gern bei. Die Vereinigten Staaten und Spanien schlossen einen geheimen Deal, um die Filipinos in Schach zu halten, und fochten einen choreografierten Kampf aus. Die spanische Flagge wurde eingeholt, die amerikanische Flagge gehisst. Philippinische Truppen umzingelten Manila, wurden aber von ihren eigenen Verbündeten daran gehindert, in die Stadt einzudringen.
Vier Monate später forderte Präsident McKinley von den Filipinos, »die militärische Okkupation und Befehlsgewalt der Vereinigten Staaten anzuerkennen«. Das in Paris unterzeichnete Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Königreich Spanien belief sich somit auf den Verkauf einer kompletten Kolonie zum Schnäppchenpreis von 20 Millionen Dollar.
In England, jenseits des Meeres, ermutigte Rudyard Kipling die Herren des neuen amerikanischen Imperiums, sie sollten es auf sich nehmen, »die Bürde des Weißen Mannes« zu tragen.
Bannt eure Söhne ins Exil
den Bedürfnissen euerer Gefangenen zu dienen;
in schwerem Geschirre aufzuwarten
verschreckten wilden Leuten –
euren neugefangenen verdrossenen Völkern,
halb Teufel und halb Kind.
Die halb teuflischen, halb kindlichen Bürger der kurzlebigen philippinischen Republik forderten die Unabhängigkeit, die ihnen die Söhne der Freiheit versprochen hatten. Amerika antwortete mit eiserner Faust. Rebellen wurden massakriert. Städte wurden zerstört. William Howard Taft mag die Filipinos Amerikas »kleine braune Brüder« genannt haben, aber die Soldaten am Boden sangen ein anderes Marschlied. Gelegentlich wechselte jemand die Seiten für die philippinische Sache, doch die übergelaufenen afroamerikanischen Soldaten wurden für ihre Überzeugung hingerichtet.
So begann die Herrschaft des neuen amerikanischen Imperiums, das ein weißer Präsident der neuen Welt einem weißen König der alten Welt abgekauft hatte.
Wir waren Spanien, und danach waren wir 48 Jahre lang Amerika.
Mein Großvater wurde 1922 geboren, gut 24 Jahre nach Beginn der amerikanischen Besatzung. Er war der Ururenkel eines chinesischen Händlers namens San Chang Co, der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Manila gesegelt war und sich mit einer philippinischen Ehefrau niedergelassen hatte. Als mein Großvater als Kind eines Universitätsbeamten und einer Kaufhauserbin geboren wurde, hatte sich der Nachname zu Chanco geändert. San Chang Cos Nachfahren wurden als englischsprechende Untertanen der Vereinigen Staaten von Amerika geboren.
Mario Chanco war das sechste von sieben Kindern. Sie wohnten in der San Antonio Street in einem weitläufigen Haus mit schweren Möbeln und Wänden voller Bücherregale. Ein nicht geringer Teil des Familienvermögens floss in die Ausbildung der jüngeren Generation. Zu Hause lernten sie Spanisch, in der Schule Englisch und überall sonst Filipino.
Als mein Großvater zwölf war, verabschiedete der 73. US-Kongress den Tydings-McDuffie Act, ein Bundesgesetz, das die philippinische Unabhängigkeit regelte. Die Philippinen wurden von einer Kolonie zum Teil des Commonwealth, mit der Zusage der Eigenstaatlichkeit innerhalb von zehn Jahren.
Der Zweite Weltkrieg brach sowohl in die Schulzeit meines Großvaters als auch in die letzten Jahre des Commonwealth der Philippinen hinein. Mein Urgroßvater verlor seine Stelle an der Universität, nachdem die Japaner herausfanden, dass der ältere Bruder meines Großvaters, ein in West Point ausgebildeter Armeeoberst, Brücken gesprengt hatte, um die vorrückenden Japaner aufzuhalten. Ein Teil der Familie zog sich in die Hauptstadt zurück, verkaufte, was von ihrem Land noch übrig war, und betätigte sich unter anderem als Kartenverkäufer für Untergrundboxkämpfe. Der Rest verteilte sich anderweitig.
Die Familie überlebte. Anders als viele andere, denn es wurden mehr als 100.000 Menschen getötet. Ein »Bericht über die Gräueltaten«, der am 15. Februar 1945 von einem U.S.-Army-Major in Manila eingereicht wurde, veranschaulichte die Barbarei der letzten Monate der Besatzung. Der Major und seine Männer hatten acht verwesende Leichen in einem Haus in einem Vorort von Manila entdeckt. Fünf der Erwachsenen, darunter zwei Frauen, waren mit auf dem Rücken gefesselten Händen hingerichtet worden. Ein Baby war mit dem Bajonett aufgespießt worden. Weitere Nachforschungen in der unmittelbaren Nachbarschaft »führten zu einem Gespräch mit einem Filipino, einem gewissen Mario Chanco, dem Nachbarn der Verstorbenen«, den der Bericht als Zeitungsjournalist beschrieb.
»Wir konnten sehen, wie [die Japaner] ins Haus eindrangen«, erzählte mein Großvater den Amerikanern. »Kurz darauf hörten wir fünf Schüsse. Was noch geschah, weiß ich nicht, weil ich zusammen mit anderen Zeugen von dort geflohen bin.«
Zu diesem Zeitpunkt waren die Japaner bereits auf dem Rückzug. Der Bruder meines Großvaters überlebte den Todesmarsch von Bataan, bei dem viele Tausend Soldaten den Tod fanden, und kehrte zurück, um sich dem Kampf der Guerillas anzuschließen. Er wurde Kommandeur des 91. Engineer Battalion der US-Armee im Fernen Osten.
Unmittelbar nach der Kapitulation Japans beendeten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre »hohe Mission« der »wohlwollenden Assimilation«, wie sie es nannten. Nach fast 400 Jahren Kolonialherrschaft wurde die Philippinische Republik zur freien Nation erklärt. Sie erhielt eine Verfassung, die als »ein getreues Abbild der US-Verfassung« beschrieben wurde und als »ein Musterbeispiel für eine liberale Demokratie«. Zu diesem Zeitpunkt hatte Amerika festgestellt, dass globale Hegemonie nicht die kostspielige Aufrechterhaltung eines ganzen Archipels von unbequemen Nicht-ganz-Bürgern erforderte, insbesondere wenn eine Nation bereit war, Handelspräferenzen und Militärbasen anzubieten.
Als die Vereinigten Staaten ihren Kolonialbesitz aufgaben, war mein Großvater 24. Er weigerte sich, an die Uni zurückzukehren und widmete sich stattdessen ganz dem Journalismus. Er schrieb über die philippinisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen und von Studebaker gesponserte Radiomusik und hob die Einfuhr von »brandneuen Automobilen, der neusten Damen- und Herrenmode, einem Dutzend Lippenstiftfarben und alle möglichen Sorten bunter Stoffe« hervor. Er hatte eine Radiosendung, durch die er sich den Spitznamen Mao einhandelte, weil er in chinesischem Pidgin-Akzent sarkastische Interviews mit Politikern führte. Er verlegte im ersten Stock des Hauses in der San Antonio Street eine Gemeindezeitung und schrieb nebenbei Belletristik. Als Reporter im Rathaus sammelte er Bekanntschaften in der Verwaltung, darunter »ein adrettes junges Fräulein mit einem faszinierenden Lächeln«. Sein Schreibstil – zu dem, wie ich zugeben muss, der recht unbekümmerte Gebrauch von Adverbien gehörte – wurde als »trügerisch leicht« und »skandalös humorvoll« beschrieben. Er war Gründungsmitglied des National Press Club und der erste Moderator von Meet the Press, wo »sein Witz und seine augenzwinkernden Kommentare die Wichtigtuerei der Politiker auf ein Minimum reduzierten«. Er wechselte von Zeitung zu Zeitung, von Magazin zu Magazin und arbeitete für The Philippines Herald, This Week, Sunday Times, Literary Song-Movie, Women’s Magazine, bis er zum Chefreporter des Manila Daily Bulletin befördert wurde.
Laut derer, die sich an ihn erinnern, war er im Großen und Ganzen ein angenehmer Mensch. »Er war immer heiter und ernst, nie tragisch, launenhaft oder engstirnig, wie man es von Humoristen sonst erwarten würde«, schrieb die Historikerin Carmen Guerrero Nakpil. »Er war nett zu sämtlichen Streunern, die sich in den Hinterhöfen von Manilas Zeitungsviertel herumtrieben, weichherzig im Umgang mit gut aussehenden jungen Frauen und respektvoll gegenüber den Herausgebern. Er ging regelmäßig in die Paco-Kirche und gab für seine Gemeinde eine entfernt religiöse, halb rotarische Publikation namens Paco Town Crier heraus. Er kleidete sich nach jener einfallsreichen Mode, die dem philippinischen Mann nach der Befreiung aufgezwungen wurde. Außerdem war er ein unternehmungslustiger junger Mann, der immer wieder an kleinen, gewagten Verlagsprojekten herumtüftelte.«
1955 ernannte man ihn zum landesweit »herausragendsten jungen Mann im Journalismus«. Er nahm ein Fulbright-Stipendium in den USA an. Er veröffentlichte ein Kompendium namens The Orient. Das »adrette junge Fräulein«, das er im Rathaus kennengelernt hatte, wurde die Mutter seiner vier Kinder. Bis in alle Ewigkeit würde er sich in seinen Kolumnen auf sie als die Wunderschöne Ehefrau beziehen, Großbuchstaben inbegriffen.
»Chanco ähnelt mehr als jeder andere Journalist der dank Hollywood verbreiteten allgemeinen Vorstellung von einem Zeitungsmann«, schrieb Felix Bautista für das Sunday Times Magazine. »Er ist übersprudelnd, aufbrausend, unverbesserlich extrovertiert. Er hat immer eine witzige Antwort parat, eine spritzige Schlagfertigkeit, besitzt das typische Gespür eines Journalisten für geistreiche Bemerkungen und schauderhafte Wortspiele. Wenn seine Hände nicht gerade auf einer Schreibmaschine herumhämmern, sind sie entweder damit beschäftigt, Leute mit einer herzlichen ›Hallo Kumpel‹-Geste zu begrüßen oder mit einem anklagenden Finger auf etwas zu zeigen – meistens auf irgendwelchen Unfug in der Regierung.«
Während der folgenden Jahrzehnte tippte er jeden Morgen vier Stunden lang das, was er scherzhaft als »meine unsterbliche Prosa« bezeichnete, auf seiner IBM-Selectric-Schreibmaschine. Er eröffnete eine vollwertige Druckerei, die es ihm ermöglichte, seine eigenen Notizbücher herzustellen – in einem Format, das genau in die Gesäßtasche seiner abgewetzten Hosen passte. Nach den Mahlzeiten rauchte er Rothmans, und, wenn ihm diese ausgingen, Dunhills, aber beim Schreiben hatte er immer eine offene Packung Marlboro Reds zur Hand, wobei er die Asche in alle Richtungen schnippte, wenn der Aschenbecher außer Reichweite war. Meine Mutter war seine älteste Tochter, und die Art und Weise, wie er seine Kinder großzog, hatte sie als weitgehend sorglos in Erinnerung behalten. Dies war, wie sie mir erzählte, vor allem dem Unternehmungsgeist der Wunderschönen Ehefrau zu verdanken, einer examinierten Krankenschwester, die den Mittelpunkt der sich rasant drehenden Welt meines Großvaters bildete.
Die Wunderschöne Ehefrau investierte in Land, führte einige Geschäfte und bewirtete den Strom von Freunden, die mein Großvater mit nach Hause brachte. Es handelte sich um Journalisten, Politiker und Umweltschützer, darunter auch ein ehemaliger Kriegsberichterstatter namens Benigno Aquino Jr.
1965 wurde ein Senator, der für sich beanspruchte, der »am höchsten ausgezeichnete Kriegsheld auf den Philippinen« zu sein, zum zehnten Präsidenten des Landes gewählt. Sein Name war Ferdinand Edralin Marcos. Weder war er ausgezeichnet noch ein Kriegsheld, aber es dauerte Jahre, bis seine Geschichte aufflog. 1972 rief Marcos nach den beiden Amtszeiten, die die Verfassung zulässt, unter dem Vorwand grassierender Gewalt und der kommunistischen Bedrohung das Kriegsrecht aus. Er verkündete eine neue Verfassung und machte sich faktisch zum Präsidenten auf Lebenszeit, während er seine Kritiker und die freie Presse systematisch ausschaltete.
Das Diktatorenehepaar Ferdinand und Imelda Marcos herrschte mehr als 14 Jahre, freudig von den Vereinigten Staaten unterstützt. Imelda tanzte mit Präsident Ronald Reagan und kaufte sich mehrere Tausend Paar Stilettos in Größe 39,5, außerdem eine komplette Sotheby’s Auktion, die auch das Stadthaus beinhaltete, welches die ersteigerte Sammlung beherbergte. Die Zeit des Kriegsrechts, wie wir sie nennen, war von Korruption, Vetternwirtschaft und politischer Unterdrückung geprägt. Ihr Ergebnis waren schätzungsweise fünf bis zehn Milliarden aus der Staatskasse gestohlene Dollar, die Inhaftierung von 70.000, die Folterung von 34.000 und die unrechtmäßige Ermordung von 3240 Aktivisten. Wahrscheinlich waren es noch mehr.
Laut der Familienlegende wurde mein Großvater damals zusammen mit Dutzenden anderen politischen Gefangenen inhaftiert. Der Cousin meiner Mutter, mein Onkel Boo, zu dem Zeitpunkt ein 22-jähriger Reporter, musste zusehen, wie alle seine Freunde gefangen genommen wurden, und gab umgehend den Journalismus auf: »Ich bin haarscharf einer Verhaftung entgangen, und jetzt soll ich mich auf dem Silbertablett präsentieren? Auf keinen Fall.« Das Kriegsrecht endete 1981, zumindest auf dem Papier, nachdem internationaler Druck auf das Marcos-Regime ausgeübt worden war. Doch tatsächlich änderte sich nur wenig. In der Folgezeit brachte Vizepräsident George H. W. Bush einen Toast auf Marcos aus: »Uns gefällt Ihr Festhalten an demokratischen Prinzipien.«
Zwei Jahre später, nach der Rückkehr einer der führenden Oppositionsstimmen des Landes, scheiterte dieses Festhalten erneut. Benigno Aquino Jr., genannt Ninoy, war Kriegskorrespondent, bevor er zum Gouverneur und später zum jüngsten Senator der Philippinen gewählt wurde.
Er wurde während der ersten Verhaftungswelle unter dem Kriegsrecht verurteilt und verbrachte sieben Jahre in Haft. 1980 durfte er für eine Bypass-Operation in die Vereinigten Staaten ausreisen, da er versprochen hatte, seinen Kreuzzug gegen die Marcos-Regierung zu beenden.
Er hielt sich nicht an sein Versprechen. Als er beschloss, zurückzukehren, hatte er drei Jahre lang Vorlesungen in Harvard gehalten und eine internationale Unterstützung für die Opposition aufgebaut. Der Filipino, sagte er in einer seiner letzten Reden, ist es wert, dass man für ihn stirbt.
Am frühen Morgen des 21. August 1983 zog er denselben weißen Anzug an, den er auf seinem Flug ins Exil getragen hatte, und bestieg mit falschen Papieren den China-Airlines-Flug 811. Eine Journalistenmeute umringte ihn, während die Maschine Kurs auf Manila nahm. »Sie müssen Ihre Kameras jederzeit bereithalten«, hatte er den Reportern tags zuvor gesagt. »Es kann sehr schnell geschehen. Alles kann in drei, vier Minuten vorbei sein, und dann werde ich vielleicht nie wieder mit Ihnen reden können.«
Tausende warteten am Manila International Airport. Man hatte gelbe Schleifen um die Bäume gebunden, als Anspielung auf einen Song von Tony Orlando über einen nach Hause zurückkehrenden Gefangenen. A hundred yellow ribbons round the ole oak tree; I’m comin’ home. Tie a ribbon ’round the ole oak tree.
Als das Flugzeug zu seinem Gate rollte, erschien ein militärisches Einsatzkommando. Aquino wurde durch den Jetway zum Terminal eskortiert. Alle anderen Passagiere wurden aufgefordert, auf ihren Plätzen zu bleiben, selbst als Reporter versuchten, sich an den Soldaten vorbeizudiskutieren. Es ertönten Schüsse. Eine junge Frau, die das Geschehen von einem der Fenster des Flugzeugs aus beobachtete, fing an zu schreien. Viele Jahre später sagte sie vor dem philippinischen Sandiganbayan, einem hochrangigen, auf Korruption durch Beamte und Amtsträger spezialisierten Gericht, und dem US-Kongress aus: »Euer Ehren, und selbst wenn ich der schlechteste Mensch der ganzen Welt wäre, würde es nichts daran ändern, dass es ein Soldat war, der Ninoy erschossen hat.«
Ninoy Aquino, eine schlaffe Gestalt in Weiß, die leuchtende Hoffnung der philippinischen Opposition, verblutete auf der Rollbahn, bevor er die Rede halten konnte, die er in Boston so sorgfältig vorbereitet hatte: »Ich kehre aus dem Exil zurück in eine ungewisse Zukunft, mit nichts als Entschlossenheit und Vertrauen.«
Mindestens vier Millionen Menschen trotzten dem Monsunregen, um neben dem Sarg mit seinem zerschmetterten Leichnam zu marschieren. Sie trugen Plakate und Schilder – DU BIST NICHT ALLEIN. Die Prozession dauerte elf Stunden. Die Ermordung war für viele der Gipfel der Kränkung nach Jahren brutaler Menschenrechtsverletzungen. In meinem Geburtsjahr, zwei Jahre nach der Ermordung, zwang der internationale Druck Ferdinand Marcos dazu, Präsidentschaftswahlen anzukündigen. Seine Herausforderin war die Witwe von Ninoy Aquino, eine sanftmütige Hausfrau, die eine große Brille und gelbe Kleider trug.
Ihr Name, Corazon, bedeutet »Herz«. Alle im Land nannten sie Cory.
Der Wahlkampf um die Präsidentschaft dauerte 45 Tage. Am 7. Februar 1986 öffneten um sieben Uhr morgens 85.000 Wahllokale. Vor internationalen Beobachtern, dem philippinischen Pressekorps und mehr als 1000 Auslandskorrespondenten wurde unverfroren betrogen. Mindestens 80 Menschen wurden landesweit getötet. Freiwillige Wahlhelfer wurden verprügelt. Bewaffnete Männer drangen mit Gewehren und Granaten in Wahllokale ein. In der Provinz Antique schoss ein Attentäter auf den Stufen des Regierungsgebäudes 24-mal auf Aquinos Wahlkampfleiter Evelio Javier. In Manila durchschlug die Kugel eines Scharfschützen ein Schild, das ein 23-jähriger Demonstrant in den Händen hielt. Auf dem Schild stand MARCOS GIB AUF. Der Demonstrant starb durch die Kugel in seiner Brust.
Bei einer unabhängigen Auszählung führte Cory Aquino, aber die Nationalversammlung rief Marcos’ vierte Amtszeit als Präsident der Philippinen aus. Mindestens 30 junge Computerprogrammierer, die die Stimmen auswerteten, verließen die Versammlung. Sie sagten, die Regierung habe die Zahlen manipuliert.
Die katholische Kirche veröffentlichte eine beispiellose Erklärung, in der sie die Wahl als betrügerisch verurteilte. Ausländische Staatsoberhäupter hielten sich mit Glückwünschen zurück. Präsident Reagan, der zunächst behauptet hatte, beide Seiten hätten betrogen, gab dem Druck seiner eigenen Regierung und der amerikanischen Presse nach und prangerte »umfassenden Betrug und Gewalt« an, »die größtenteils von der Regierungspartei verübt wurde«. Gerüchte über einen Staatsstreich machten die Runde.
In der dritten Februarwoche 1986 setzten sich Verteidigungsminister Juan Ponce Enrile und der stellvertretende Generalstabschef der Streitkräfte, Fidel Ramos, mit einer kleinen Gruppe von Putschisten ab. Sie verbarrikadierten sich in den Hauptquartieren von Polizei und Militär. Der Untergrundsender Radio Veritas, der von einer Frau und zwei Jugendlichen betrieben wurde, sendete einen Appell des Erzbischofs von Manila: Beschützt die Rebellen.
»Als sich der Vollmond letzte Nacht über den Philippinen erhob, wurden diese durch einen Akt der Rebellion erschüttert«, schrieb Phil Bronstein im San Francisco Chronicle. »Vor den Toren von zwei Militärlagern in Manila bewacht das Volk die Soldaten.«
Jedes Land hat seine eigenen Sagen. Für viele meiner Generation beginnt der Mythos der modernen Philippinen mit der Circumferential Road 4, einem von sechs Highways, die das U.S.-Army-Ingenieurscorps in den Dreißigerjahren geplant hatte, und der sechs Städte miteinander verband, bevor er an der Taft Avenue entlang der Manilabucht endete. Die Amerikaner nannten ihn Highway 54. Er wurde ein Jahr vor der Landung von 43.000 Soldaten der Kaiserlich Japanischen Armee an den Küsten des neuen Commonwealth der Philippinen fertiggestellt.
Nach dem Krieg, in den späten Fünfzigerjahren, schlug ein gemeinsamer Ausschuss einen neuen Namen für die Straße vor, die sich zur Hauptverkehrsroute der Hauptstadt entwickelt hatte. Sie wurde in Epifanio de los Santos Avenue umbenannt, nach einem Journalisten und Wissenschaftler, der sich für die Unabhängigkeit der Philippinen von Spanien eingesetzt hatte. Als Marcos Ende 1985 vorgezogene Neuwahlen ansetzte, hatte die Straße bereits ein Kürzel erhalten: EDSA.
Ich war in der zweiten Klasse, als ich die Geschichte zum ersten Mal hörte. Ich saß in meiner zerknitterten blau-weißen Uniform im Geschichtsunterricht und sah zu, wie meine Lehrerin zwei parallele Kreidestriche an die Tafel malte.
»Das«, sagte Frau Chua, »ist EDSA.«
Sie zeichnete zwei kleine Kästchen auf jede Linie. Hier, sagte sie, befanden sich Camp Crame und Camp Aguinaldo, die Hauptquartiere von Polizei und Armee, die an der EDSA einander gegenüber lagen. Alles andere malte sie mit weißer Kreide aus.
»Und alles das hier sind Menschen«, sagte sie.
Mit meinen acht Jahren wusste ich nicht, was EDSA war, und so kam es, dass meine erste Vorstellung von der Epifanio de los Santos Avenue nicht die einer Straße, sondern die eines Schlachtfelds war.