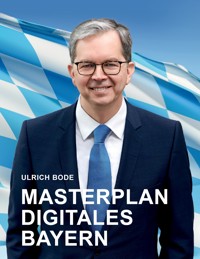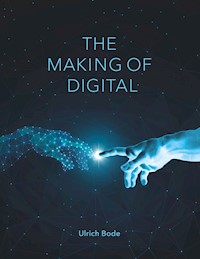Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sozial 4.0 ist ein Quantensprung auf dem Weg zum Grundeinkommen. Mit Hilfe der Digitalisierung gelingt schrittweise die Revolution: Ein einfaches, integriertes und motivierendes System. Ulrich Bode vermittelt einen kompakten Überblick und entwickelt die Roadmap für ein Grundeinkommen. Sozial 4.0 statt Hartz IV bringt neuen Schwung in die politische Debatte. Grundeinkommen in nur einer Minute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einführung: Denken wir groß
Historie
1.1. Negative Einkommenssteuer
1.2. Bürgergeld
1.3. Hartz Reformen
Prinzipien
2.1. Zusammenfassung verschiedener Transferleistungen
2.2. Das Finanzamt als zentrale Finanzinstanz
2.3. Existenzminimum als Mindestabdeckung
2.4. Einkommensanrechnung versus Bedingungslosigkeit
2.5. Integrierte Bedürftigkeitsprüfung
2.6. Motivation vor Sanktion
Menschenwürde
3.1. Menschenwürdiges Existenzminimum
3.1.1. Das Existenzminimum als Referenz
3.1.2. Wer Transferleistungen bezieht
3.2. Armut und Armutsgefährdung
3.2.1. Relative Armut
3.2.2. Einkommensarmut
3.2.3. Kaufkraftarmut
3.2.4. Absolute Armut
3.3. Wege in die Grundsicherung
3.4. Wege aus der Grundsicherung
3.5. Sanktionen im ALG II
Freiheit
4.1. Risikobereitschaft
4.2. Motivation
4.3. Megatrend Mensch
4.4. Existenzgründung
Gerechtigkeit
5.1. Die Grenzen des Wissens
5.2. Sozialleistungsbetrug
5.3. Verdeckte Armut
5.4. Stabile Verhältnisse
5.5. Machtasymmetrie
Arbeit
6.1. Erwerbsfähigkeit
6.2. Berufsausübung
6.3. Arbeitslosigkeit
6.4. Alternative Arbeitsmärkte
6.5. Unbezahlte Arbeit
6.6. Zukunft der Arbeit
6.7. Anfang und Ende der Arbeit
Steuern
7.1. Rechtliche Integration
7.2. Nur noch Konsumsteuer
7.3. Stufentarif
7.4. Partizipationsbelastung
7.5. Effektive Grenzbelastung
Bürokratie
8.1. Überschneidungen
8.2. Ausufernde Verwaltung
8.3. Antrag auf ALG II
8.4. Atmende Verträge
8.5. Tod durch Bürokratie
Kontext
9.1. Sozialleistungen
9.2. Familie und Kinder
9.3. Alleinstehende
9.4. Vermögen
9.5. Wohnen
9.6. Altersvorsorge
9.7. Krankheit
9.8. Berufsunfähigkeit
9.9. Private Verpflichtungen
9.10. Selbständigkeit
9.11. Berufsstand
9.12. Globalisierung
Digitalisierung
10.1. Kognitive Entlastung
10.2. Virtualisierter Staat
10.3. Informationelle Selbstbestimmung
10.4. Ziele kalkulieren
10.5. Digitale Politik
Konzept Grundeinkommen
11.1. Ziele
11.2. Begrifflichkeit
11.3. Existenzminimum
11.4. Anspruchsberechtigung
11.5. Bedürftigkeitsprüfung
11.6. Anrechnung
11.6.1. Berechnungsweise
11.6.2. Anrechnungsfunktion
11.6.3. Social dividend und poverty gap
11.6.4. Ohne Anrechnung
11.7. Zulagen
11.8. Sach- und Dienstleistungen
11.9. Finanzierung
11.9.1. Finanzierungsquelle
11.9.2. Gegenfinanzierung
11.9.3. Schrittweise Optimierung
System Grundeinkommen
12.1. Schrittweise Realisierung
12.1.1. 1. Schritt: Zahlungen über das Finanzamt
12.1.2. 2. Schritt: Integriertes Antragsverfahren
12.1.3. 3. Schritt: Automatisierte Bedürftigkeitsprüfung
12.1.4. 4. Schritt: Konvergenz der Maßnahmen
12.1.5. 5. Schritt: Integrierter Steuer- und Sozial-Bescheid
12.1.6. 6. Schritt: Motivation statt Sanktion
12.1.7. 7. Schritt: Automatisierter Antrag
12.2. Universelles Steuerungsmodell
12.3. Zentrale Steuerungsdatei
12.4. Steuerungsgruppe
12.5. Nur eine Minute
Zusammenfassung: Sozial 4.0 statt Hartz IV
Anhang
14.1. Bundesverfassungsgericht
14.1.1. Urteil zum Umfang des Anspruchs
14.1.2. Urteil zu den Sanktionsgrenzen
14.2. Parteiprogramme
14.2.1. AfD
14.2.2. Bündnis 90/Die Grünen
14.2.3. CDU/CSU
14.2.4. Die Linke
14.2.5. FDP
14.2.6. SPD
14.3. Wortführer
14.3.1. Milton Friedman
14.3.2. Evelyn L. Forget
14.3.3. Joachim Mitschke
14.3.4. Götz W. Werner
14.3.5. Dieter Althaus
14.3.6. Rutger Bregman
14.4. Initiativen
14.4.1. Netzwerk Grundeinkommen
14.4.2. Partei „Bündnis Grundeinkommen“
14.4.3. Teilhabegeld der Bertelsmann-Stiftung
14.4.4. Bündnis Kindergrundsicherung
14.4.5. Dauphin in Kanada
14.4.6. Europäische Bürgerinitiative
14.4.7. Finnland
14.4.8. Deutschland
14.4.9. Schweiz
Danksagung
Über den Autor
Einführung: Denken wir groß
Warum ist Deutschland so kompliziert? Als Informatiker bin ich von Berufswegen geschult, Strukturen möglichst smart zu gestalten. Je klarer und allgemeingültiger ein Konzept gehalten ist, desto geringer ist der organisatorische Aufwand, desto leichter fällt auch die Entwicklung der Software. Aber Deutschland leistet sich eine komplizierte Intensiv-Bürokratie, die Bürger und Verwaltungen an ihre Grenzen bringen. Strukturell überfrachtet und ohne umfassende digitale Unterstützung hat die COVID-19-Pandemie die Schwächen des Systems überdeutlich offengelegt.
In bin einst in die Politik gegangen, um nicht nur zu meckern, sondern einen Beitrag zu leisten, es besser zu machen. Ich kenne das politische System also auch von innen. Immer wieder wird die Politik nur mit einer einzigen Frage lahmgelegt: Wer zieht in das Bundeskanzleramt ein? Und wer auch immer dann darin Platz nimmt, muss vielfältige Ideen und Interessen beachten. Politische Logik und mathematische Logik sind völlig verschiedene Welten.
In keinem politischen Feld setzen wir so viel Geld ein und ist die Bürokratie so umfassend, wie in der Sozialpolitik. Ein effizientes und effektives Sozialsystem würde den Menschen besser helfen und die Kosten für das Staatswesen reduzieren. Eine gute Sozialpolitik ist für mich die größte Herausforderung in der Politik. Ich staune, wie oberflächlich die Diskussionen und wie dünn die Konzepte sind. Bei 1 Billionen Euro jährlichem Sozialbudget in Deutschland springen wir viel zu kurz.
Im Bundestagswahlprogramm 1994 präsentierte die FDP erstmalig das Bürgergeld. Damals war dies revolutionär, konsequent formuliert und hätte ein sozialpolitischer Meilenstein werden können. Im Laufe der Zeit ist von dem Elan nicht mehr viel übriggeblieben. Die tiefe Reformdiskussion der 1990er Jahre verblasst, die Mitgliederschaft wandelt sich und das Wissen entschwindet.
Um die Jahrhundertwende gab es einen breiten Konsens in der Politik für grundlegende Reformen, allen voran in der Steuerpolitik. Neben der FDP beschäftigten sich auch die Grünen mit ihren Bundestagsabgeordneten Christine Scheel und Oswald Metzger vielfältig mit Steuerreformen. In CDU ist der Vorschlag von Friedrich Merz, eine Steuererklärung auf einem Bierdeckel, legendär. Aber auch die Wissenschaft mit Paul Kirchhof und Peter Bareis sowie Wirtschafts- und Gesellschaftsverbände nahmen intensiv an der Debatte mit eigenen Vorschlägen teil.
Von den konzeptionellen Vorschlägen blieb am Ende vor allem die Diskussion über Steuersätze übrig. Die Sozialpolitik verlor sich wie meistens in Aktionismus. Die Schröder-Regierung schnürte mit der Agenda 2010 aus verschiedenen Elementen das Hartz-Paket. Dies war die letzte größere Reform, auch wenn sie mehr eine Bündelung verschiedener Elemente war, als eine strukturelle Veränderung des Staatsgebildes.
Mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel wurde auf grundlegende Veränderungen verzichtet. Krisenmanagement wurde zum Markenkern der Regierung. Die FDP war hierbei mit ihrer Regierungsbeteiligung 2009-2013 fehl am Platz. Sie vertraute fälschlicherweise darauf, dass die Union bei den Reformen schon mitziehen würde. Der Wunsch, endlich wieder zu regieren, war stärker als ein solider Koalitionsvertrag.
Konzeptionelle Debatten sind seitdem weitgehend aus der Politik verschwunden. Andrea Nahles hatte im November 2018 mit einem Beitrag in der FAZ einen Versuch unternommen, ein sozialpolitisches Gesamtkonzept zu entwerfen. Dies ist unabhängig vom konkreten Inhalt allein schon deshalb bemerkenswert, weil die SPD eine starke Neigung zu Einzelaktionen hat. Zwar beschloss die SPD 2019 noch den entsprechenden Antrag, aber mit dem Abgang von Andrea Nahles fehlt dieser Initiative der Motor.
So dümpelt die deutsche Politik vor sich hin, hangelt sich von Krise zu Krise und belässt die Nation ohne Perspektive. Wenn der demokratischen Mitte die Luft ausgeht, werden die politischen Ränder stärker. Es ist Zeit, dass die deutsche Politik die mehr als überfällige Erneuerung der staatlichen Strukturen angeht.
Außerhalb des engeren Politikbetriebs diskutieren unterschiedlichste Gruppen in der ganzen Welt intensiv über das Grundeinkommen. Besonders die Variante „bedingungslos“ erhitzt die Gemüter. Auffällig viel Mühe verwenden die im Bundestag vertretenen Parteien darauf, diese Diskussion nicht in ihre Parteien schwappen zu lassen.
Bei näherem Hinsehen ist das Modell eines Grundeinkommens – mit oder ohne Bedingungen – sehr flexibel. Zwischen den verschiedenen Vorstellungen ist aus Sicht eines Gesamtkonzepts nur ein geringer Unterschied. Egal, ob das Kind Grundeinkommen, Bürgergeld, negative Einkommenssteuer oder Garantiesicherung genannt wird, technisch-organisatorisch sind die Unterschiede gering. Aber statt gemeinsam an der Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts zu arbeiten, bleiben alle lieber in ihren bewährten Schützengräben.
Ich verwende den Begriff „Grundeinkommen“ als Leitbegriff. Dieser Begriff hat sich durchgesetzt. Die ausführliche Begründung folgt im Kapitel über die Begrifflichkeit. Mit dem Begriff ist aber kein bestimmtes Modell gewählt. Mir geht es in diesem Buch nicht darum, ein bestimmtes Modell zu favorisieren und zu begründen, sondern um ein Gesamtkonzept. Darüber hinaus möchte den Leserinnen und Lesern einen kompakten Überblick zu den unterschiedlichen Fachthemen und den vielfältigen Diskussionen geben.
Mein Anliegen ist ein einfaches, integriertes Verfahren, um ein Grundeinkommen gestalten zu können. Die einzelnen Parameter wie die Höhe des Grundeinkommens oder die Anrechnung von eigenem Einkommen sollen unkompliziert eingestellt werden können. Die Digitalisierung ermöglicht es uns, ein flexibles System zu entwickeln, das einfach und benutzerfreundlich zu bedienen ist – für Verwaltung, Politik und die betroffenen Bürger.
In nur einer Minute.
1 Historie
Die Idee eines Grundeinkommens hat eine lange Historie. Aber erst seit den 1960er Jahren nimmt sie Fahrt auf, als Milton Friedman die negative Einkommensteuer1 vorschlägt. In seinem 1962 veröffentlichten Buch „Capitalism and Freedom“ fordert Friedman ein effizientes und effektives Wohlfahrtsmodell. Mit der negativen Einkommenssteuer könnten andere sozialstaatlichen Zahlungen entfallen. Zugleich würde die Motivation, die eigene Situation zu verbessern („Free to choose“), nicht gänzlich abgetötet werden. In den USA wurde 1975 das Earned Income Tax Credit (EITC)2 beschlossen, das bis heute Niedriglöhne ohne Bedürftigkeitsprüfung anteilig erhöht (Lohnauffüllung).
1.1. Negative Einkommenssteuer
Als Urheberin der Idee einer negativen Einkommensteuer gilt die britische Politikerin Juliet Rhys-Williams anfangs der 1940er Jahre. Bei der negativen Einkommenssteuer wird ein Grundeinkommen, z.B. das Existenzminimum, festgelegt. Liegt das eigene Einkommen oberhalb des Wertes (positiver Bereich), so zahlt man Steuern. Liegt man unterhalb des Grundeinkommens (negativer Bereich), so erhält man Geld, die Negativsteuer.
Bei „positiver“ Steuer zahlt man einen prozentualen Anteil des Einkommens als Steuer. Analog wird bei der Negativsteuer das eigene Einkommen nur anteilig verrechnet. Eigenes Einkommen wird auch als Markteinkommen (ME) oder Erwerbseinkommen bezeichnet. Unterstützungsgeld aus öffentlichen Zahlungen wird als Transfereinkommen bezeichnet, ggf. auch als Transferleistung oder Transferzahlung. Die Summe aus Markteinkommen und dem Transfereinkommen ist das verfügbare Einkommen (VE).
Bei einem stark vereinfachten Beispiel mit monatlich 1.000 Euro als Grundeinkommen und 50 % Steuersatz sieht die Rechnung für den positiven oder negativen Steuertransfer wie folgt aus:
Markteinkommen (ME) * Steuersatz
- Grundeinkommen (GE)
Die vierte Spalte (ST) ergibt den Zahlbetrag zwischen Bürger und Finanzamt. Negative Transferbeträge (im Beispiel die ersten 4 Zeilen) erhält der Steuerzahler ausbezahlt, positive Beträge (im Beispiel die letzten beiden Zeilen) muss der Steuerzahler an das Finanzamt überweisen. Bei 2.000 Euro Markteinkommen liegt im Beispiel die Grenze zwischen negativen und positiven Steuern.
In den 1970er Jahren wurden vor allem in den USA einige Experimente mit der negativen Einkommensteuer durchgeführt, die jeweils rund 1.000 bis 5.000 Personen umfasste. Aber auch andere Länder beschäftigten sich mit der negativen Einkommenssteuer.
Historie
1514 schlägt Thomas Morus in seinem Roman Utopia ein Grundeinkommens vor, um Diebstahl vorzubeugen.In der Folgezeit gibt es immer wieder verschiedene Vorschläge für ein Grundeinkommen.31942 wirbt die Britin Juliet Rhys-Williams für ein Grundeinkommen mit negativer Einkommenssteuer (social dividend).1962 schlägt Milton Friedman die negative Einkommensteuer (poverty gap) vor.1974-1977 experimentiert der Ort Dauphin in Kanada unter der Bezeichnung Mincome mit einem Grundeinkommen bei 50 % Anrechnung von eigenem Einkommen.1974 entwickelt Prof. Dr. Joachim Mitschke das Konzept für ein Bürgergeld.1994 beschließt die FDP im Bundestagswahlprogramm das Bürgergeldsystem im Sinne einer negativen Einkommenssteuer („Negativsteuer“) mit 50 % Anrechnung.42005 setzt sich Götz Werner, Gründer von dm drogeriemarkt, für ein bedingungsloses Grundeinkommen ohne Anrechnung eigenen Einkommens ein.2006 stellt Dieter Althaus (CDU) das Konzept „solidarisches Bürgergeld“ vor, ein Grundeinkommen von 600 Euro (Kinder 300 Euro) mit einer 50 % Anrechnung von eigenem Einkommen.52019 beschließt die SPD ein ebenfalls als Bürgergeld bezeichnetes verbessertes Hartz IV bei einer zweijährigen Schonfrist für Vermögensanrechnung und einem längeren Bezug von ALG I.2020 beschließen die Grünen ein Grundsatzprogramm mit einer Garantiesicherung, falls Einkommen und Vermögen nicht ausreichen (eine Art Hartz IV ohne Sanktionen).6Bekannt ist das 1974 in dem kanadischen Ort Dauphin mit rund 10.000 Einwohnern durchgeführte Experiment unter der Bezeichnung Mincome mit 50 % Anrechnung. Die negative Einkommenssteuer wurde nahezu perfekt durchgeführt. Erst 2011 veröffentlichte Dr. Forget eine Auswertung, die positive Folgen auf Schulausbildung und Gesundheit zeigten.7
1.2. Bürgergeld
Ebenfalls in den 1970er Jahren entwickelte Prof. Dr. Joachim Mitschke gemeinsam mit Prof. Dr. Wolfram Engels und Dr. Bernd Starkloff das Bürgergeld. Dieses basiert auf dem Prinzip der negativen Einkommenssteuer mit 50 % Anrechnung auf das eigene Einkommen. Neu ist der Begriff: Bürgergeld. Mitschke hat in zahlreichen Schriften die Steuer- und Transferordnung aus einem Guss ausgelotet und vertieft.
Die FDP präsentierte das Bürgergeld-Konzept in ihrem Bundestagswahlprogramm 1994 erstmalig und eingehend.8 Im folgenden Koalitionsvertrag 1994 vereinbarten CDU/CSU und FDP eine Expertenkommission, die die Integration von Einkommensbesteuerung und steuerfinanzierten Sozialleistungen prüfen sollte. Diese untersuchte die verschiedenen Facetten des Sozialsystems sowie die Möglichkeiten und Auswirkungen eines Bürgergeld-Systems. 1996 legte die Kommission ihren Bericht vor.9 Tenor der Ergebnisse war, dass eine direkte und einfache Umsetzung des Bürgergeldsystems nicht möglich sei. Zu komplex sei die Lage und zu zahlreich die Hürden.
Stattdessen empfahl die Kommission, eine schrittweise Annäherung der Systeme und eine Koordination der Verwaltungen.
Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP 1994
Auszug:10
Um soziale Hilfe zielgenauer zu leisten, Anreize für reguläre Erwerbsarbeit zu stärken und Sozialbürokratie abzubauen, soll eine Expertenkommission entsprechende Lösungsvorschläge prüfen. Dazu gehört auch das Konzept eines sog. Bürgergeldsystems, in dem Einkommensbesteuerung und steuerfinanzierte Sozialleistungen zusammengefasst würden. Der Bericht soll im Frühjahr 1996 vorgelegt werden.
Die Koalition vereinbart die Einsetzung einer Regierungs-Kommission mit Beteiligung von Experten zur systematischen Durchleuchtung des gesamten Systems sozialer Transferleistungen. Die Kommission soll Wechselwirkungen zwischen Arbeits- und Sozialeinkommen aufzeigen, kumulative und gegenläufige Effekte untersuchen, die Verteilungs- und Transferwirkungen überprüfen sowie Hinweise zur Harmonisierung der verschiedenen Einkommensbegriffe geben.
So sei beispielsweise eine einheitliche Bemessungsgrundlage und Einkommensermittlung kaum möglich, weil Leistungsfähigkeit und Bedürftigkeit sich zu stark unterscheiden. Aber sehr wohl sei es möglich, die Berechnungen in einem Vorgang zusammenzuführen und ein gemeinsames Rechenschema zu definieren. Damit würde die Gesamtrechnung übersichtlicher, besser vergleichbar und Unterschiede könnten auf ihren Sinngehalt überprüft werden.
Auch sei es schon verfassungsrechtlich schwierig, alle Ämter in einem zentralen Steuertransferamt zusammenzuführen. Jedoch könne durch eine stärkere Koordination der Ämter eine entsprechende Realisierung auch im heutigen System dargestellt werden.
Ebenso kritisch bewertet die Kommission die fiskalische Wirkung. Das Bürgergeldsystem würde die Transferleistungen ausweiten und die Staatsfinanzen erheblich belasten. Dies wäre besonders dann gegeben, wenn das einheitliche Bürgergeld pauschaliert eine Vielzahl von Ansprüchen zusammenführen würde.11
Die Kommission empfahl schließlich, das Bürgergeld-Konzept als Leitbild zu betrachten. Die Ziele seien in weniger radikalen Schritten im herrschenden Steuertransfersystem realisierbar.
Weiterhin empfahl die Kommission, ein Sozialtransferamt einzuführen, das steuerfinanzierte Sozialtransfers verwaltet. Die Einkommensermittlung sollte nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen. Belastungssprünge bei veränderten Einkommen oder gar „Umkippeffekte“ sollten vermieden werden.
In der Koalition hatte das Ergebnis der Kommission praktisch ein Ende der Reformbemühungen zur Folge. Bundeskanzler Helmut Kohl galt Mitte der Legislaturperiode als unanfechtbar und war intensiv mit den Verhandlungen zum europäischen Währungssystem beschäftigt. Die Koalitionäre konzentrierten sich auf die geplante, aber dann gescheiterte Steuerreform 199712. Bei der Bundestagswahl 1998 verlor die Koalition von CDU/CSU und FDP ihre Mehrheit. Die neue rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder entwickelte eine eigene Agenda, die Agenda 2010 mit den Hartz-Reformen als Herzstück.
1.3. Hartz Reformen
Unter Leitung von VW-Vorstandsmitglied Peter Hartz wurde Anfang 2002 von der rot-grünen Bundesregierung eine Kommission eingesetzt, um die Arbeitsmarktpolitik effizienter zu gestalten.
Wesentliche Ergebnisse in vier Gesetzen I bis IV waren:
Gleichstellung von Leiharbeitern
Minijob und Midijob
Ich-AG
Einrichtung von Jobcentern
Umbau der Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitsamt) in die Bundesagentur für Arbeit
Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe (BfA) und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zum Arbeitslosengeld II (ALG II)
In dem „Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“13 führten Bündnis 90 / Die Grünen und die SPD die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu einer „Grundsicherung für Arbeitssuchende“, kurz Arbeitslosengeld II (ALG II), zusammen, besser bekannt als Hartz IV. Manchmal wird auch von „Leistung nach SGB II“ gesprochen, weil es im Sozialgesetzbuch II14 verankert ist. Für nichterwerbsfähige Personen einer Bedarfsgemeinschaft spricht das Gesetz von Sozialgeld.15 Diese haben keinen eigenständigen Anspruch auf Leistungen. Der Anspruch leitet sich vielmehr von einer erwerbsfähigen und leistungsberechtigten Person ab, mit der sie in einer Bedarfsgemeinschaft leben.16 Am 1.1.2005 trat das Gesetz in Kraft.
Das Arbeitslosengeld I erhalten Arbeitslose aus der Arbeitslosenversicherung für 6 bis 24 Monate, je nach Versicherungsdauer und Alter. Es beträgt 60 % vom letzten Nettogehalt, mit Kindern 67 %, unabhängig von eigenem Vermögen. Die Details sind, wie in Deutschland üblich, noch differenzierter.17
Arbeitslosengeld II wird aus Steuermitteln finanziert und nachrangig gezahlt, wenn eigenes Vermögen oder Einnahmen nicht zur Existenzsicherung ausreichen. Folglich kann auch ein zu niedriges ALG I parallel mit ALG II aufgestockt werden. Der Regelbedarf von ALG II beträgt für eine alleinstehende Person 446 Euro ab dem 1. Januar 202118. Aufgeschlüsselt nach den Abteilungen (Abt.) der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 19 entspricht dies:
Abt.
Anteil am Regelbedarf
Betrag
(Pro 30 Tage) Tag
Anteil
1, 2
Nahrung, Tabakwaren Getränke,
154,78 €
5,16 €
34,70 %
3
Bekleidung, Schuhe
37,01 €
1,23 €
8,30 %
4
Wohnungsmieten, Wohninstandhaltung Energie,
38,32 €
1,28 €
8,59 %
5
Innenausstattung, Haushaltsgeräte -gegenstände, laufende und Haushaltsführung
27,17 €
0,91 €
6,09 %
6
Gesundheitspflege
17,02 €
0,57 €
3,82 %
7
Verkehr
40,01 €
1,33 €
8,97 %
8
Post und Telekommunikation
39,88 €
1,33 €
8,94 %
9
Freizeit, Unterhaltung, Kultur
43,52 €
1,45 €
9,76 %
10
Bildungswesen
1,61 €
0,05 €
0,36 %
11
Beherbergungs- tendienstleistungen und Gaststät-
11,65 €
0,39 €
2,61 %
12
andere Dienstleistungen Waren und
35,53 €
1,18 €
7,97 %
Volljährige Partner erhalten 401 Euro, Kinder je nach Altersgruppe zwischen 283 Euro und 357 Euro. Unterkunft und Heizung werden in „angemessener Höhe“ übernommen.20 Was als angemessen gilt, muss vom Jobcenter in einem schlüssigen Konzept21 dargelegt werden und hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von einem Mietspiegel und der Zahl der Personen einer Bedarfsgemeinschaft.
Die dauerhafte Kritik am ALG II22 verstärkt die Diskussion über ein Grundeinkommen.
Zusammenfassung
Die Geschichte des Grundeinkommens ist Jahrhunderte alt.Die negative Einkommensteuer verrechnet das eigene Einkommen mit dem Grundeinkommen nur anteilig.Das Bürgergeld-Konzept basiert auf der negativen Einkommenssteuer und ist seit 1994 Teil der FDP-Programmatik.Die Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II, Hartz-IV) ist Teil der Hartz-Reformen der rot-grünen Regierungszeit 1998-2005.1 Man beachte, dass die Einkommensteuer auch die Lohnsteuer umfasst. Die Lohnsteuer ist durch Abzug vom Arbeitslohn nur eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer. https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__38.html
2https://de.wikipedia.org/wiki/Lohnauffüllung
3https://ubi-europe.net/ubi/brief-history-basic-income-ideas
4https://www.freiheit.org/wahlprogramme-der-fdp-zu-den-bundestagswahlen
5https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/das-solidarische-buergergeld
6https://antraege.gruene.de/45bdk/kapitel_6_solidaritaet_sichern-33969
7 Mehr dazu siehe Anhang
8 Mehr dazu siehe Anhang
9 Probleme einer Integration von Einkommensbesteuerung und steuerfinanzierten Sozialleistungen: Gutachten der Experten-Kommission „Alternative Steuer-Transfer-Systeme“, Stollfuß Verlag Bonn 1996, Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen Heft 59
10https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/koalitionsvertraege Seite 24
11 Deshalb wird im nachstehenden Konzept eine Kombination aus Grundbetrag und Zulagen vorgeschlagen.
12https://www.reformkompass.de/de/fallstudien/grosse-steuerreform
13http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP15/968/96840.html
14https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/
15https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__19.html
16https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__7.html
17https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/arbeitslosengeld-anspruch-hoehe-dauer
18https://www.lpb-bw.de/regelsatz-hartziv
19http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2663/266352.html
20https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__22.html
21https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/2020_09_17_B_04_AS_11_20_R.html
22https://www.reformkompass.de/de/fallstudien/agenda-2010
2 Prinzipien
Ein Grundeinkommen umfasst eine Reihe von Prinzipien, die unterschiedlich diskutiert werden und nachfolgend zusammengefasst sind:
2.1. Zusammenfassung verschiedener Transferleistungen
Die Zusammenfassung verschiedener Transferleistungen zu einem System ist unstrittig, weil es notwendige Voraussetzung für ein Grundeinkommen ist. Offen ist allerdings die Reichweite. Im engeren Sinne umfasst das Grundeinkommen nur bedarfsabhängige und steuerfinanzierte Transfers wie die Grundsicherung, Kindergeld und Wohngeld, aber auch nicht zwingend alle.
Weitergehend könnte ein Grundeinkommen auch beitragsfinanzierte Systeme wie Altersvorsorge und Gesundheitsversicherung (Krankheit, Pflege, Unfall) integrieren.23 Schon wegen der Grundsicherung im Alter gilt es, die Altersvorsorge zumindest in den Betrachtungen zu berücksichtigen und miteinander abzustimmen.
2.2. Das Finanzamt als zentrale Finanzinstanz
Zur Vereinfachung wird das Finanzamt als zentrale Drehscheibe für Finanztransfers zuständig. Alternativ schlug die Bürgergeld-Kommission neben den Finanzbehörden ein Sozialtransferamt für die Zahlungen an die Bürger vor.
2.3. Existenzminimum als Mindestabdeckung
Das Existenzminimum zu sichern, ist Konsens und von der Verfassung geboten. Es gibt allerdings auch die Ansicht, dass das Grundeinkommen höher als das Existenzminimum sein müsse. Wie hoch, darüber gehen die Meinungen auseinander.
2.4. Einkommensanrechnung versus Bedingungslosigkeit
Eigenes Einkommen wird mit dem Grundeinkommen automatisch verrechnet. Zu welchem Anteil die Anrechnung erfolgt, ist Teil einer intensiven Diskussion.
Die Extremfälle sind die vollständige Anrechnung und der Verzicht auf jegliche Anrechnung. Ein Grundeinkommen mit voller Anrechnung von Eigeneinkommen entspricht im Wesentlichen der heutige Situation:
Bis zur Unterstützungsgrenze (im Beispiel 1.000 Euro) wird jeder selbst verdiente Euro vom Grundeinkommen abgezogen. Eigene Leistung lohnt sich erst, wenn das Eigeneinkommen das Grundeinkommen überschreitet.
Das Gegenteil davon ist die Auszahlung des Grundeinkommens ohne jede Anrechnung auf eigenes Einkommen. Sie findet zunehmend Anhänger und wird meist mit dem Begriff des „bedingungslosen Grundeinkommens“ gleichgesetzt. Dabei wird ein pauschaler Sockelbetrag (Kopfpauschale) an jeden Bürger ausgezahlt, im Beispiel ebenfalls 1.000 Euro. Auf diesem Sockel aufbauend erfolgt die normale Besteuerung des Eigeneinkommens:
Für die negative Einkommenssteuer wird typischerweise die Mitte mit 50% Anrechnung favorisiert (negative Einkommenssteuer). Die Unterstützung, wieder 1.000 Euro, verläuft gleitend und endet erst bei 2.000 Euro.
2.5. Integrierte Bedürftigkeitsprüfung
Die Bedürftigkeitsprüfung ist bei einer Verrechnung mit eigenem Einkommen bereits systemimmanent eingebaut. Sie hängt in diesem Fall nur vom eigenen Einkommen ab, ggf. bei Kindern noch vom Alter. Beim bedingungslosen Grundeinkommen wird auf eine Anrechnung verzichtet und in der Folge erübrigt sich die Bedürftigkeitsprüfung für den Grundbetrag, nicht jedoch für Zusatzbedarfe. Im heutigen System der Grundsicherung erstreckt sich die Prüfung auch auf das Vermögen und die Angemessenheit des Konsums. In einem Grundeinkommenssystem wären solche weitergehenden Prüfungen konzeptionell möglich, sofern politisch gewünscht.