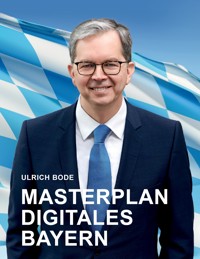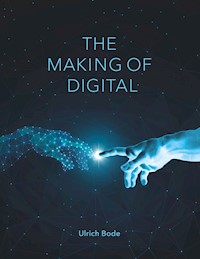
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
The Making of Digital zeigt kompakt und verständlich die Schlüsselfaktoren der digitalen DNA erfolgreicher Unternehmen. Die Digitalisierung verändert nicht nur Märkte, sondern führt auch zu einer Neugestaltung der Arbeitswelt, ja der ganzen Gesellschaft. Als Homo Digitalis wird der Mensch selbst zum Megatrend. Wie gelingt die digitale Transformation konkret? Warum ist dafür gutes Design elementar? Was unterscheidet Agilität von Chaos? Lassen sich digitale Geschäftsmodelle methodisch entwickeln? Und wie sieht das Internet der Zukunft aus? The Making of Digital ist Wegweiser und Ratgeber. Aus dem Inhalt: Lost Champions und der innere Wert Permanente Revolution und das Ende der Phasenmodelle Harte Arbeit im agilen Maschinenraum Smart Lot: Losgröße kleiner 1 Industrie 4.0 - die Revolution kommt anders Die Grenzen der Blockchain und die Zukunft des Geldes Unzerbrechliche Systeme dank Null-Toleranz Design oder nicht sein Homo Digitalis und künstliche Intelligenz Alles ist ein Projekt, wirklich alles Ein letztes Mal „Change Management“ High Performance Organisation aufbauen Business Profiling: Geschäftsmodelle methodisch entwickeln In der digitalen Welt: Megatrend Mensch Das Internet der Zukunft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Das digitale Ebenbild
Virtuelle Maschinen
Digital first
Digitaler Zwilling
Digitales Kerngeschäft
Digitales Geschäftsmodell
Agilität durch Automatisierung
Im agilen Maschinenraum
Das agile Manifest
Hochgradig agil
Monitoring der Zukunft
Das automatisierte Rechenzentrum
Das automatisierte Unternehmen
Disruptive Innovation
Treiber Technologie
Kunde statt Händler
Die Welt als Plattform
Marktforschung live
Smart Lot: Losgröße kleiner 1
3D-Druck
Software Defined Industry
Unzerbrechliche Systeme
Null Toleranz
Kryptographie
Hashfunktion
Blockchain
Digitalgeld
Digitale Identität
Compliance as Code
Security by Design
Design oder nicht sein
Der menschliche Faktor
Gutes Design
Dialogisches Prinzip
Radikal einfach
Homo Digitalis
Das Prinzip Mensch
User Experience
Menschen statt Märkte
Digitale Realität
Künstliche Intelligenz
Robo Sapiens
Innovatives Mindset
Der innere Wert
Extreme Thinking
Zurück in die Zukunft
Trends adaptieren
Kontext wechseln
Wandel organisieren
Permanente Revolution
Design Thinking
Design driven Innovation
Der blaue Ozean
Die Disruption
Digitale Geschäftsmodelle
Business Profiling
Alles ist ein Projekt
Das Produkt seiner Organisation
Intrinsische Transformation
Strategiewechsel durch Selbstorganisation
Das Internet der Zukunft
Universal Task Container
Flexibilität und Integration
Das WorkNet
Enterprise Edition
Im Cockpit
X-Work
High Performance Organisation
Cross-funktionale Teams
Doppelte Fehlerkultur
Agile Arbeitswelt
Die digitale DNA
Der Code der Veränderung
The Driving Leader
Digitale Megatrends
Digitalisierung als Chance
Anhang
Vorwort
Als ich in den 1980er Jahren an der TU München Informatik studierte, war die IT-Welt noch überschaubar. Die Befehle eines Mikroprozessors kannte ich bald auswendig, das Programmieren fiel den meisten von uns leicht, einzig die Mathematik war anspruchsvoll. Die Informatik ist so jung, dass ich manchen Pionier wie Konrad Zuse oder Steve Jobs noch persönlich erlebt habe.
Zu meinen Lehrmeistern gehörten der Nestor der deutschen Informatik, Friedrich L. Bauer, und der Altmeister der österreichischen Informatik, Heinz Zemanek. Beide waren auf ihre Weise Universalgelehrte, die nicht nur selbst Teil der Informatikgeschichte sind, sondern sich auch intensiv für die Aufarbeitung der informatischen Historie engagierten. Zemanek hat dies in Büchern und Vorträgen dargestellt und Bauer hat die Informatik-Abteilung im Deutschen Museum in München aufgebaut.
Beide bemühten sich auch darum, ihrer Studentenschaft die Geschichte der Informatik nahezubringen. Was ich dabei gelernt habe, ist, einen Sinn für die langfristigen Trends in der Informatik zu entwickeln. Die Revolutionen fallen auch in der Informatik nicht einfach so vom Himmel.
Heute ist es allerdings viel schwieriger, den Überblick zu behalten. Kannte man einst die Akteure persönlich und konnte sich in einem Studium noch als Einzelner einen breiten Kenntnisstand verschaffen, so ist mit dem World Wide Web die technologische Basis geradezu explodiert. Es ist schon für die Fachleute anstrengend, die Übersicht zu bewahren, aber für Außenstehende ist das kaum leistbar. Vielen Unternehmen fällt es schwer, die wenigen, aber entscheidenden, Maßnahmen zu erkennen und umzusetzen.
Mit diesem Buch möchte ich auch für Nicht-Experten einen verständlichen Überblick zur digitalen Revolution geben. Ich möchte Unternehmen und ihren Mitarbeitern zeigen, wie sie die Digitalisierung nicht nur beherrschen, sondern auch für ihren eigenen Fortschritt nutzen können.
Die Digitalisierung hat einen epochalen Wandel in allen Bereichen ausgelöst. Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in einem grundlegenden Veränderungsprozess.
Die digitale Transformation bedeutet für Unternehmen eine doppelte Revolution: Zum einen treibt diese Transformation die Digitalisierung der Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen voran - die Transformation von analog zu digital; zum anderen strukturiert sie die Organisation auf hohes Tempo und permanente Veränderung, zum agilen Unternehmen um.
Nicht nur die Unternehmen werden digitalisiert, sondern ganze Geschäftsmodelle sind von der Digitalisierung erfasst. Die Informationstechnologie (IT) ist vom Dienstleister zum Treiber eines umfassenden Wandels geworden. Neue Organisationsstrukturen und Abläufe werden in der IT erprobt und erobern das ganze Unternehmen. Produkte und Dienste entstehen auf digitaler Basis.
Die Technologien sind kein Selbstzweck, sondern dynamische Wegbereiter für neue Organisationsstrukturen, neue Produkte und neue Märkte.
Die Nutzung der digitalen Möglichkeiten erschafft neue Giganten der Wirtschaft, die global ganze Märkte vereinnahmen. Nur einer kann gewinnen, für den Zweiten ist kein Raum - The Winner Takes It All. „The Making of Digital“ zeigt, wie ein Unternehmen die Marktführerschaft im globalen Wettbewerb übernimmt und was auf diesem Weg konkret angepackt werden muss.
Über die einzelnen Aufgaben zur Umsetzung der Digitalisierung hinaus zeigt das Buch die Grundmechanismen und wegweisenden Trends der Digitalisierung sowie des Wandels auf. Auf diese Weise lassen sich künftige Entwicklungen langfristig abschätzen und werden somit vorhersehbar.
Wir leben in einer VUCA-Welt, ist häufig zu hören und zu lesen. Das Akronym steht im Englischen für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit (ambiguity). Diesen angstgeprägten Begriffen möchte ich eine andere Perspektive entgegensetzen: ACH - Agilität, Kreativität (Creativity) und Humanität.
Die bemerkenswerteste Entwicklung wird sein, dass die Digitalisierung den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt. Dies geschieht nicht immer wohlmeinend und ist auch nicht immer beabsichtigt. Und doch ist der Spannungsbogen von universeller Digitalmaschine und emotionalem Analogmenschen treibende Kraft für Wandel und Innovation.
Agilität, Kreativität, Humanität
Das Buch ist allgemeinverständlich gehalten, so dass sich auch Nicht-Experten mit der Lektüre einen fundierten Überblick verschaffen können. Kurz und prägnant wird das Wesentliche herausgearbeitet und die zukünftige Entwicklung erläutert. In den Textkästen sind ergänzende Informationen enthalten, die auch zum Nachschlagen einladen. Die Entwicklung bleibt bekanntlich nicht stehen. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, findet regelmäßig aktuelle Themen im Blog:
http://themakingof.digital
DAS DIGITALE EBENBILD
Das digitale Ebenbild
Die Schöpfungsgeschichte des Menschen ist auch eine Geschichte der Abstraktionsfähigkeit des Menschen. Das berühmte Gemälde von Michelangelo zeigt als Sinnbild dieser Schöpferkraft den Augenblick, als der göttliche Funke des Lebens auf den Menschen überspringt. Neuroanatomischen Analysen zufolge soll Michelangelo seine für die damalige Zeit ungewöhnlichen Kenntnisse über die Anatomie des Menschen in seiner Gottes-Komposition zum Ausdruck gebracht haben, welche frappierend dem Querschnitt eines Gehirns entspricht. Mit seinen naturwissenschaftlichen Forschungen stand Michelangelo der Kirche durchaus kritisch gegenüber. Und so könnte der Funke Gottes auch interpretiert werden als geistiger Funke. Oder neuzeitlich gar als neuronaler Funke.
Insofern erzählt der Schöpfungsmythos auch die Geschichte einer geistigen Entdeckungsreise des Menschen: Von der Erschaffung als Gottes Ebenbild über den Baum der Erkenntnis bis hin zur wissenschaftlichen Forschung der Neuzeit. Die menschliche Fähigkeit zur Abstraktion ist ein wesentlicher Teil der Menschheitsgeschichte und der menschlichen Sicht der Dinge. Das Verhalten der Natur verstand der Mensch zunächst als eine innewohnende Seele, wie die Seele eines Baums und das Wesen des Wassers. Später abstrahierte der Mensch die Baumseelen zu einem Gott der Bäume, einem Gott des Wassers und zu Göttern aller Elemente und Kräfte. Und diese Abstraktionsfähigkeit führt schließlich zu dem einen universellen Gott als Ursprung alles Seins.
Die eigene Schöpferkraft entdeckte der Mensch in der Bearbeitung der Natur und gestaltet seither die Welt nach seinem eigenen Maßstab. Auf der Suche, was die Welt im Innersten zusammenhält, zerlegt er die Dinge in ihre Einzelteile, bis in das kleinste Detail der Atome. Mit der Abstrahierung auf 0 und 1 läutet er schließlich das digitale Zeitalter ein. Alles, was sich irgendwie technisch abbilden lässt, kann darauf abgebildet werden. Das Elementarteilchen der digitalen Welt ist das Bit. Digitalität ist die Maximierung der Einfachheit.
Digitalisierung vereint sowohl höchste Abstraktion als auch kleinstmögliche Zerlegung.
Die Abstraktionsfähigkeit des Menschen hat mit dem minimalistischsten Prinzip, das überhaupt denkbar ist, den größten Hebel aller Zeiten geschaffen. Die Digitalisierung eröffnet dem Menschen nicht nur die Möglichkeit, die Realität zu verändern, sondern die Realität neu zu erfinden. Der Mensch wird selbst zum Schöpfer. Er erschafft ein digital veränderbares Ebenbild seiner Realität und neue virtuelle Welten.
Computerspiele lassen uns in fremde Rollen schlüpfen und virtuelle Fabriken Arbeitsabläufe erproben, noch bevor eine Fabrik gebaut wird. Reale und virtuelle Welt verschmelzen zunehmend. Das eigene digitale Ebenbild eröffnet dem Menschen überdies ungeahnte Möglichkeiten, um mittels ,Human Enhancement' über sich selbst und seine biologischen Grenzen hinauszuwachsen. Ebenso hinterlässt er jedoch auch in Datenbanken von Staaten und Unternehmen einen digitalen Fingerabdruck.
Gleichwohl sind Schein und Sein fortan abgekoppelt voneinander. Digitalisierung trennt Form und Funktion vollständig. An einem Fahrrad erkennt man die Funktion sofort; es lässt sich nicht als Brille benutzen. Funktion und Erscheinungsbild, Sein und Schein, sind eins. Beim Computer ist das tatsächliche Sein mit Prozessor, Speicher und Netzwerk unabhängig von der möglichen Erscheinung als Spiel oder Antriebssteuerung. Form und Funktion sind getrennt. Die daraus folgende unvergleichliche Flexibilität verleiht dem Computer seine fundamentale Kraft. Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch eine gesellschaftliche Herausforderung, da Digitalisierung eine noch nie dagewesene Schöpferkraft offenbart. Bestehendes wird grundlegend verändert und neue Realitäten entstehen. Was heute noch ein spannendes Computerspiel ist, kann morgen schon Wirklichkeit sein.
Virtuelle Maschinen
Diese Fähigkeit zu abstrahieren, nutzt die IT-Branche für ihre ureigenen Aufgaben. Schon als Klassiker gilt die Virtuelle Maschine (VM). Auf einem realen Computer wird ein anderer Computer simuliert, eben die VM. Eine VM kann ein anderer Rechnertyp mit einem anderen Betriebssystem sein als der reale.
Durch diese Virtualisierung eines Computers besteht die Möglichkeit, beliebig verschiedene VMs auf einer realen Maschine zu betreiben. Praktisch hat das seine Grenzen, denn irgendwann wird der reale Rechner an seine Leistungsgrenzen stoßen. Sind zu viele VMs aktiv, werden sie entsprechend langsam. Doch mit einem entsprechend leistungsfähigen Server kann eine respektable Zahl von VMs auf nur einer Maschine laufen. Als Server („Diener“) bezeichnet man seit den 1980er Jahren mit dem Auftreten der Personal Computer (PC) einen zentralen Rechner, der von mehreren Clients genutzt wird und Dienste zur Verfügung stellt. Aus der Zeit der Großrechner in den 1960er Jahren stammen die vergleichbaren Bezeichnungen Host („Gastgeber“) und Terminal. Während Terminals weitgehend vom Host gesteuert werden, sind Clients typischerweise selbst vollwertige Rechner, etwa PCs oder Laptops. Server und Clients sind, wie auch Host und Terminal, über Netzwerke miteinander verbunden.
Ein Server ist zwar deutlich teurer als mehrere kleine Maschinen, aber dennoch günstiger als diese einzelnen Maschinen in der Summe. Zudem wird er besser ausgelastet, ist energieeffizienter und die Wartungskosten für einen großen Server sind ebenfalls günstiger als für viele kleine Maschinen. Darüber hinaus können sie flexibel genutzt werden und ermöglichen eine zentrale Verwaltung, etwa von Zugriffsrechten.
Cloud Computing
Die klassische IT verfügt über ein unternehmenseigenes Rechenzentrum. Im Zuge des IT-Outsourcing in den 1990er Jahren übernahmen Dienstleister die Aufgabe das Rechenzentrum zu betreiben. Das Bild des „Rechners in einer Wolke“ beschreibt das Konzept eines Rechenzentrums „irgendwo“ außerhalb des eigenen Unternehmens.
Damals entstanden die ersten Ideen und Produkte für Cloud Computing. Amazon bot ab 2006 seinen Dienst Amazon Web Services (AWS) an und damit im großen Stil IT-Infrastruktur in einem externen Rechenzentrum, die flexibel genutzt und bedarfsabhängig bezahlt wird.
Für Aufbau und Betrieb einer Cloud wurde eine Reihe von Softwareprodukten entwickelt. Diese werden nicht nur für Cloudsysteme von Dienstleistern (Public Cloud) genutzt, sondern auch für firmeninterne Rechenzentren (Private Cloud) – oder für einen Mix aus beiden, als Hybrid Cloud.
Zwischen realem System und der virtuellen Maschine verbindet ein spezielles Steuerungsprogramm, ein sogenannter Hypervisor. Der Hypervisor steckt für die VMs die technischen Ressourcen ab, d.h. welches Betriebssystem der VM zur Verfügung gestellt wird, welche Prozessoren und wie viel Speicher. Zugleich überwacht er die VMs. Ein Hypervisor definiert also für die VM die verfügbare Hardware. Auf diese Weise können auf einem Server verschiedene VMs zum Einsatz kommen, die ganz unterschiedliche Anforderung an Hardware und Betriebssystem haben.
Die Virtualisierung hat einen weiteren Vorteil: Ausfallsicherheit. Ist eine reale Maschine defekt, können die auf dieser Maschine laufenden VMs auf einer anderen realen Maschine weiterlaufen, als wäre nichts passiert. Voraussetzung ist natürlich, dass mindestens ein weiterer gleichartiger Server zur Verfügung steht. Es ist dann nur ein kleiner Schritt in die Cloud, sprich die Frage, ob die VM im hauseigenen Rechenzentrum läuft, in einem externen Rechenzentrum oder auch wahlweise (hybrid) je nach aktuellem Bedarf. Sofern überhaupt ein eigenes Rechenzentrum genutzt werden soll, empfiehlt es sich, auch dort Cloud-Technologien einzusetzen. Der Übergang zwischen Private Cloud und Public Cloud kann dann fließend gestaltet werden.
Der Mechanismus „Virtualisierung“, die Simulation einer Komponente auf einer realen Hardware, ist so kraftvoll, dass inzwischen alle IT-Komponenten virtualisiert sind und Lego-artig standardisiert werden. So können auch Netzwerke als sogenannte Software-defined Networks (SDN) virtualisiert werden; oder der klassische Desktop als Virtual Desktop. Dahinter steckt selbstverständlich immer reale Hardware.
Die Digitalisierung eines Unternehmens sowie die seiner Produkte und Dienstleistungen ist die Grundlage für das weitere Geschehen. Diese kann in mehreren Ebenen beschrieben werden:
•
Ebene
Art der Digitalisierung
Beispiele
•
Ebene 0
Keine oder nur marginale Digitalisierung
Die Zahl der Beispiele wird immer weniger
•
Ebene 1
Digitalisierung Verwaltung
Die meisten Unternehmen
•
Ebene 2
Digitale Anreicherung Kerngeschäft
Spedition mit GPS und optimierten Routing
•
Ebene 3
Digitalisierung Kerngeschäft
Finanz-App, eBook
•
Ebene 4
Digital basiertes Kerngeschäft
Cloudspeicher, Suchmaschine
In den folgenden Kapiteln betrachten wir, wie diese vier Ebenen konkret beschaffen sind.
Digital first
Auf Ebene 1 wird digitalisiert, was sich digitalisieren lässt und die analoge Version soweit wie möglich abgeschafft. Das digitale Objekt hat Vorrang und steuert reale Objekte, soweit diese noch relevant sind. Gehen wir das einmal am Beispiel „Digitalisierung der Papierpost“ durch:
An der Eingangsstelle, etwa Poststelle oder Kundenberatung, werden die Briefe per Scanner digitalisiert. Je früher digitalisiert wird, desto besser. Dadurch können Medienbrüche vermieden und die Vorteile der Digitalisierung von Anfang an genutzt werden.
Ein gesondertes digitales Archiv in Analogie zu einer Registratur würde zum Bruch in den fachlich strukturierten Geschäftsprozessen führen. Deshalb muss die digitale Version in die Fachlichkeit integriert werden, in der Regel in die entsprechende Fachanwendung.
Das Original geht davon getrennt einen eigenen Weg. Je nach fachlicher Anforderung wird es vernichtet, zurückgegeben oder archiviert. Im operativen Tagesgeschäft wird nur noch die digitale Version verwendet.
Die Organisation hat allein dadurch bereits wichtige Fortschritte erzielt:
•
Sofort:
Das Dokument steht in Sekundenschnelle zur Verfügung.
•
Überall:
Das Dokument kann weltweit aufgerufen werden.
•
Für jeden:
Jeder kann das Dokument einsehen, sofern er dazu berechtigt ist.
Daten-Management
Wichtige Aufgaben im Daten-Management sind, die grundsätzliche Verfügbarkeit der Daten sowie ihre Sicherung und Integrität zu gewährleisten. Darüber hinaus sind Datenschutz und Datenqualität zu behandeln. Ziel ist die Ressource Daten zu schützen und ihren Nutzen zu optimieren.
Content-Management
Während sich Daten-Management vor allem mit Daten als einzelne Werte beschäftigt, konzentriert sich Content-Management auf zusammenhängende Informationen wie Texte, Bilder, Audio- und Videodateien. Neben Aufgaben wie im Datenmanagement ist im Content-Management auch die Veröffentlichung etwa auf einer Website oder das Management von Urheberrechten relevant.
Digitales Kuratieren
Mit strukturierten Linksammlungen wurden im Internet schon früh Webseiten nach Themen kuratiert. Später liefen ihnen die Suchmaschinen den Rang ab. Manche Suchmaschinen versuchen, Suchergebnisse maschinell in kuratierter Form aufzubereiten. Mit dem Beginn des Internet-Zeitalters explodiert die Menge an neuen Daten und Information. Die tägliche Datenmenge übertrifft die Gesamtmenge an Daten, die die Menschheit je vor dem Internet insgesamt produziert hat. Und mit der Digitalisierung werden die Datenmengen weiter exorbitant steigen. Trotz Suchmaschinen ist die im Internet verfügbare Information heute schon kaum mehr zu überblicken. Die klassische Stichwortfilterung reicht oft nicht aus, um spezielle Produkte und Inhalte zu finden, beispielsweise, um semantische Inhalte wie Designqualität zu erkennen. Hier wird Künstliche Intelligenz eine zunehmende Rolle spielen, um digitales Kuratieren noch mehr auf die Kriterien menschlicher Wahrnehmung und Emotion abzustimmen.
Digitaler Zwilling
Auf Ebene 2 erhalten die Bestandteile eines Unternehmens, die sich nicht digitalisieren lassen, einen digitalen Zwilling. Ein Unternehmen besteht aus vier strukturellen Bestandteilen: Ziele, Ressourcen, Prozesse und deren Koordination.
Reale Struktur und ihr digitales Ebenbild
Der digitale Zwilling einer Fabrik kann diese virtuell darstellen, sogar bevor sie gebaut wird. Umstellungen können virtuell durchgespielt werden, Mitarbeiter neue Abläufe trainieren, Optimierungen erforscht und im Betrieb Soll und Ist ständig abgeglichen werden.
Diese Digitalisierung kann bis zu jedem kleinsten Bauteil und einfachsten Prozessschritt vorangetrieben werden. Jede Schraube, jede Aktion kann digital kontrolliert und gespeichert werden. Spannend ist das Wechselspiel zwischen realem und digitalem Objekt, etwa der laufende Abgleich von Simulation und realen Verhalten.
Die vier Elemente erhalten jeweils ein digitales Gegenstück:
•
Was
Ebenbild
Beispiele
•
Ziel
Jeder reale Zielwert wird digital gemessen und bewertet.
Durchlaufzeit einer Bestellung, Kosten einer Lieferung
•
Ressource
Jedes reale Element bekommt einen digitalen Zwilling.
Virtuelles Gerät, digitalisiertes Bauwerk, virtuelle Fabrik
•
Prozess
Jede reale Aktion wird digital begleitet.
Digitale Versandverfolgung
•
Koordination
Das gesamte Zusammenspiel wird digital abgewickelt.
Digitales Workflow-Management
Das Prinzip „digitaler Zwilling“ ist auf andere Bereiche übertragbar. So ist es nur eine Frage der zeit, bis jeder Mensch seinen digitalen Zwilling erhält. Dazu wird der Mensch vollständig radiologisch durchleuchtet, sein Gesundheitszustand fortlaufend erfasst und das Genom entschlüsselt. Bei Krankheiten kann ein Medikament nicht nur maßgeschneidert, sondern auch vorab am digitalen Zwilling erprobt werden. Entsprechende Tests werden automatisiert durchgeführt.
Die Zwillingsidee findet sich auch in der modellbasierten Entwicklung wieder. Viele traditionelle Vorgehensmodelle für Software-Projekte sind dokumentzentriert, wie etwa das V-Modell. Es geht stets darum, dass bestimmte Dokumente in den verschiedenen Entwicklungsphasen erstellt werden müssen. Beispielsweise würde man in einem Anforderungsdokument die Eigenschaften eines Elektromotors beschreiben und ergänzend mit Skizzen den Aufbau darstellen. Statt einer schriftlichen Spezifikation wird in der modellbasierten Entwicklung das digitale Modell, der digitale Zwilling, verwendet. Die Spezifikation steckt dann in den Parametern, die das Modell definieren.
Digitales Kerngeschäft
Auf Ebene 3 wird das Kerngeschäft digitalisiert. Am Beispiel Fahrzeugantrieb sehen wir, wie eine analoge Baugruppe digitalisiert wird:
Das klassische analoge Automobil verfügt über einen zentralen Motor, dessen Leistung über das Getriebe an die vier Räder weitergeleitet wird. Wie lässt sich ein derart klassisch analoges Bauteil wie ein Getriebe vollständig durch Software ersetzen?
Wir werfen hierfür einen Blick in die Geschichte: Ferdinand Porsche erhielt schon im Jahre 1900 auf der Weltausstellung in Paris Lob und Anerkennung für den von ihm entwickelten Radnabenmotor.
Beim Radnabenmotor verfügt jedes Rad über einen separaten Elektromotor. Statt eines zentralen Motors erhält jedes Rad einen eigenen elektrischen Antrieb. Die elektrische Energie wird von der Batterie über Kabel geleitet. Ein analoges Getriebe ist somit überflüssig. Erforderlich ist nur noch die digitale Steuerung der Energie. Dazu kann jedes Rad einzeln angesteuert werden – stufenlos. Natürlich ist dies alles auch analog möglich; aber mit was für einem Aufwand!
Der Radnabenmotor hat viele Vorteile:
Der Motor sitzt direkt am Rad und erzielt so einen höheren Wirkungsgrad von über 90 Prozent.
Die Drehzahl kann für jedes Rad individuell gesteuert werden, verbessert auf diese Weise die Straßenlage, was Sicherheit und Fahrdynamik erhöht sowie den Energieaufwand senkt.
Die Bremsenergie kann besser rückgewandelt werden (Rekuperation), was die Reichweite erhöht. Zugleich kann die klassische Reibungsbremse verkleinert werden oder fällt gänzlich weg.
Die Gelenkwellen fallen weg und ermöglichen so einen besseren Lenkwinkel. Der Wendekreis wird kleiner und sogar seitliches Einparken wird möglich.
Fällt ein Motor aus, können die anderen dies bis zu einem gewissen Grad kompensieren.
Durch die weggefallenen Bauteile steht mehr Innenraum zur Verfügung: Außen Kleinwagen, innen Mittelklasse.
Nachteilig ist das höhere Gewicht der Räder, welches eine erhebliche Schwungmasse darstellt und zusätzlichen Aufwand für eine komfortable Federung erfordert. Dies ist neben der elektrischen Reichweite ein wichtiger Grund, warum der Radnabenmotor bislang noch ohne Erfolg geblieben ist. Dank neuer leichter Materialien und immer kleinerer und leistungsfähiger Elektronik – verbunden mit entsprechender Ingenieurkunst – wird Größe und Gewicht so weit reduziert, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Radnabenmotor zum Durchbruch kommt–eine Innovation mit einer Anlaufzeit von über einem Jahrhundert.
Automobilantrieb im Wandel der Zeit
Um 1900 waren 40 Prozent der Autos in den USA dampfbetrieben, 38 Prozent elektrisch und nur 22 Prozent mit Benzin.
Der elektrische Radnabenantrieb führt dazu, dass der Antriebsstrang mit Kupplung, Getriebe, Antriebswelle und Differentialgetriebe komplett entfällt und digital gesteuert wird. Die digitale Steuerung integriert auch die optimale Verteilung der Antriebs- und Bremskräfte, wie sie heute schon in der Fahrdynamikregelung (Electronic Stability Control, ESC) zum Einsatz kommt. Der Antriebsstrang ist ein Klassiker für komplexe analoge Technologien und kann mit einer disruptiven Technologie digitalisiert werden.
Digitales Geschäftsmodell
Auf Ebene 4 lebt ein Geschäftsmodell allein in der digitalen Welt. Digitale Speicher wie Dropbox, Hörbuchanbieter wie Audible oder Notizbücher wie Evernote sind rein digitale Geschäftsmodelle.
Das Geschäftsprinzip solcher Unternehmen ist Daten-Verarbeitung auf einem neuen Niveau. Daten sind ihr Rohstoff, die Geschäftsgrundlage. Es werden massiv Daten gespeichert und in Echtzeit in Beziehung gesetzt. Unternehmen wie Google, Facebook oder YouTube verdanken ihre Finanzkraft den Daten ihrer Kunden.
Digitale Geschäftsmodelle leben typischerweise von
Daten in großem Umfang (Big Data),
die intelligent in Beziehung stehen
und jederzeit überall verfügbar sind.
Daten sind die Basis für diese Geschäftsmodelle. Erst durch Daten wird die Realität in den digitalen Systemen buchstäblich erfassbar. Der Rohstoff „Big Data“ wird durch Daten-Veredelung zu hochwertigen und nutzbringenden „Smart Data“.
Die Digitalisierung verändert alle Ebenen eines Unternehmens:
Unternehmen und Geschäftsmodelle
Prozesse und deren Koordination
Produkte und Dienstleistungen
Digitale Geschäftsmodelle verändert ganze Märkte.
Digitalisierung
Im Englischen wird der deutsche Begriff „Digitalisierung“ unterschieden:
Digitisation:Die Digitalisierung der Ressourcen, etwa ein Papierdokument in digitaler Form nach dem Scan.Digitalisation:Die Digitalisierung der Prozesse.Die digitale Revolution ist unter anderem gekennzeichnet durch:
Hohe Geschwindigkeit:
Das Tempo der Veränderung nimmt mit rasender Geschwindigkeit zu und verlangt eine Aktionsgeschwindigkeit der Unternehmen in Echtzeit.
Weitreichende Innovation:
Innovationen verändern bestehende Strukturen massiv oder ersetzen sie vollständig. Nichts ist mehr sicher.
Software first:
Die Software ersetzt die Hardware und steuert die verbliebenen Hardwareanteile.
Skaleneffekte:
Eine steigende Zahl von Nutzern oder Kopien der Software erfordern nur geringe Mehrkosten.
The Winner Takes It All:
Anstatt vieler Einzelakteure übernimmt ein Monopolist ganze Märkte.
Wie kann ein Unternehmen dabei erfolgreich sein und wo bleibt der Mensch?
ZUSAMMENFASSUNG Kapitel 1
Die Digitalisierung ist Ausdruck der Abstraktionsfähigkeit des Menschen.
Die Virtualisierung ermöglicht eine wesentlich flexiblere Nutzung.
Soweit möglich werden physische Objekte digitalisiert.
Nicht digitalisierbare Objekte erhalten einen digitalen Zwilling.
Kerngeschäft und sogar das Geschäftsmodell kann digital basiert sein.
AGILITÄT DURCH AUTOMATISIERUNG
Agilität durch Automatisierung
Sie haben sicherlich schon von „agilen Unternehmen“, „die Schnellen fressen die Großen“ und Ähnlichem gehört. Vielleicht haben Sie auch davon gelesen, dass Führungskräfte mehr Verantwortung an die Mitarbeiter abgeben sollen, dass die Strukturen flexibler werden müssen oder man die Unternehmenskultur ändern soll. Mit agilen Organisationen sei die Arbeit locker und leicht, schnell und günstig – einfach großartig.
Oft ist Agilität nur ein schönerer Begriff für das real existierende Chaos. Die Wahrheit ist, dass Agilität harte Arbeit im „Maschinenraum“ voraussetzt. Die grundlegenden Ideen zur Agilität haben sich in der Softwareentwicklung gebildet. Wer die Blaupause aus der IT versteht, kann Agilität in allen Bereichen umsetzen. Es lohnt sich daher, einen Blick in die Ursprünge der IT-Agilität zu werfen und die Erkenntnisse auf andere Bereiche zu übertragen.
Das Phasenmodell
In der IT gibt es ein traditionelles Entwicklungsverfahren: Das Phasenmodell. Dies wird auch als Wasserfall-Modell bezeichnet, was allerdings ein schiefes Bild vermittelt. Im Phasenmodell wird nach Planung und Konzeption die Software entwickelt, anschließend zusammengebaut (Build), getestet (Qualitätssicherung) sowie zu guter Letzt installiert (Deployment) und der Betrieb (Operating) aufgenommen.
Eine Phase nach der anderen wird abgearbeitet. Bedeutende Phasen wie Entwicklung und Testung benötigen typischerweise mehrere Monate.
Traditionelles Phasenmodell
Es galt lange Zeit die Lehrmeinung, dass jede Phase nur einmal durchlaufen wird und jeweils zu einem abschließenden Ende gelangt. Die Pipeline der Softwareentwicklung, vom Konzept bis zum Betrieb, erinnert stark an eine Lieferkette oder an die allgemeine Arbeitsweise zwischen den Bereichen (Silos) eines Unternehmens.
In einer Welt, die sich immer schneller dreht, hat das leider große Nachteile. Die Abfolge der einzelnen Bearbeitungsschritte nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Auch können sich die ursprünglichen fachlichen Gründe verändern, bevor das System in Betrieb geht. In der Folge kommt es zu hektischen Änderungen im Projekt (Change Request), die meist von Kostensteigerungen und Zeitverzug begleitet werden. Im schlimmsten Fall kommt das Produkt viel zu spät auf den Markt, den andere schon besetzt haben, oder wird abgebrochen.
Agile Softwareentwicklung dagegen teilt den Gesamtaufwand in kleine Entwicklungspakete, sogenannte Sprints. Innerhalb von 3 Wochen, dem Sprint, durchläuft ein Entwicklungspaket alle Phasen, von der Entwicklung über das Testen bis zur Inbetriebnahme.
Traditionelles Phasenmodell versus agiles Prozessmodell
Die Grafik unten zeigt den Unterschied zwischen dem traditionellen Phasenmodell und dem agilen Prozessmodell. Zur Vereinfachung sind nur die beiden Phasen Entwicklung und Test dargestellt. Das Zusammenspiel dieser beiden Phasen ist für die agile Entwicklung entscheidend.
Im traditionellen Phasenmodell sind Entwicklung und Test in zwei lange Phasen eingeteilt. Sie werden jeweils einmal durchgeführt und setzen klare Vorgaben zu Beginn jeder Phase voraus.
Im agilen Modell werden dagegen viele kurze Sprints durchlaufen, mit einer überschaubaren Zahl an Teilaufgaben, welche jeweils mit einem definierten Ergebnis abschließen. Dies sind im Bild die Entwicklungs-Sprints.
Permanente Testdurchläufe begleiten die einzelnen Sprints und gewährleisten somit eine ständige Qualitätssicherung. Ein dreiwöchiger Sprint hat typischerweise mehrere hundert Testdurchläufe. Entwicklung und Test laufen im Sprint gemeinsam – also parallel statt sequentiell.
Traditionelles Phasenmodell versus agiles Vorgehensmodell