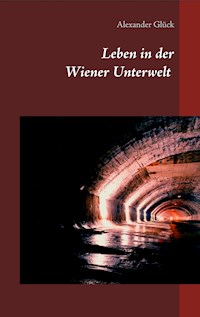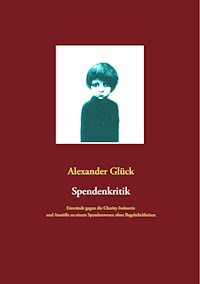
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was müssen Spender über die Methoden wissen, mit denen man ihnen ein gutes Gefühl verkauft? Was sollten Fundraiser wissen, die sich für eine neue Kultur der Verantwortung positionieren wollen? Dieses Buch ist eine Zusammenfassung der seit 2004 bis in die jüngste Zeit veröffentlichten Kritik am Spendenwesen, am Charity-Kartell, dem Fundraising und der Mitleidsindustrie. Die umfassende Spendenkritik behandelt Verantwortungsverschiebung und kognitives Unbehagen, Reaktanz und Marketingmodelle im Fundraising. Das Grundlagenwerk versteht sich jedoch keineswegs als Aufruf gegen das Spenden. Vielmehr geht es dem Verfasser darum, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen und eine neue Spendenkultur zu skizzieren, damit Fundraising sich nicht länger darauf beschränkt, die Menschen mit der Illusion zu übertölpeln, sie hätten mit zehn Euro die Welt gerettet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vom Paulus zum Saulus – reflektierte Umkehr
Die Verwalter des Mitgefühls
Wie wir uns und andere belügen
Das Innenleben des Turbospenders
Die Unfreiheit des Helfenden
Die Sprache der Gönner
Probleme zwischen Spendern und Initiativen
Was bringt unsere Hilfe wirklich?
Wer spendet, wird Jesus!
Das Kreuz mit den Patenschaften
Das eigene und das fremde Kind – ein Unterschied?
Bausteine zu einem reflexfreien Spenden
Verantwortungsübertragung im Spendenwesen
Spendensammeln durch Überrumpelung
Das Spenderbild der Fundraiser
Die Methoden der Fundraiser
Verwaltungsprogramme
Galas und Charity-Bankette
Entenrennen und andere Torheiten
Die Übergabe der Verantwortung an die Fundraiser
Die Rolle der Transparenz im Fundraising
Gütesiegel, Prüfstellen und ihre Arbeit
Ausblick
Zwölf Mythen im Spendenwesen
Berufs-Eldorado Fundraiser
Ackerbau und Viehzucht
Literaturverzeichnis
Vom Paulus zum Saulus – reflektierte Umkehr
Was können Elendskinder dafür, wenn Spender in materiell bessergestellten Gegenden aus diesem oder jenem Grund den Bettel hinschmeißen und sich als das, was für die Spendenempfänger ihre einzig relevante Funktion ist, nämlich: Spender zu sein, in Rauch auflösen? Natürlich nichts. Wir müssen die Frage anders stellen: Was bringt Menschen dazu, eine erhebliche soziale Selbstverpflichtung, freiwillig übernommen, in der ursprünglichen Form nicht mehr wahrzunehmen? Oder anders: Was davon – Verpflichtung eingehen und Verpflichtung lösen – entscheidet der Kopf und was entscheiden Herz und Bauch? Und wenn man diese Fragen von der Person des Spenders löst und auf die Gesamtsituation erweitert, ist man doch wieder bei den Elendskindern und muß fragen: Wie kommen Menschen überhaupt dazu, sich von anderen Menschen alimentieren lassen zu müssen, und nach welchen Mustern läuft das ab?
Dieses Buch handelt von der fragwürdigen Mechanik des Spendens. Zuweilen erscheint das ihm zugrundeliegende Konzept als ein moderner Ablaßhandel, der entweder von Schuldgefühlen loskauft oder ein rentables Investment in die Imagepflege von Konzernen und ihren Vorständen darstellt. Unentwegt wird dabei der Spender selbst zur Hauptfigur gemacht, sein Selbstwertgefühl angesprochen, seine Affekte stimuliert. Es ist deshalb längst überfällig, den Blick auf das Innenleben dieses Spenders zu richten, denn dadurch läßt sich erklären, wie Spenden funktioniert und welchen Gesetzen es gehorcht. Mittlerweile hat sich eine riesige Spendenindustrie entwickelt, der auf bemerkenswerte Weise das Kunststück gelingt, fast nur von den Zuständen in den Zielgegenden und Initiativen zu sprechen, dabei aber permanent die Anspruchs- und Gefühlswelt des Spenders selbst zum bestimmenden Moment des Spendens zu machen – dabei sollte man doch annehmen, daß die Lebenssituation von Elendsschicksalen im Vordergrund zu stehen hat. Genau die landet aber ganz schnell in der zweiten oder dritten Reihe: „Sie können helfen!“ – „Ihre Spende zählt!“ – „Retten Sie ein Kind vor dem Elend!“ Wer das Spenden untersuchen will, muß also den Blick darauf richten, wie der Spender funktioniert und auf welche Weise er angesprochen wird.
Verschiedene Erfahrungen mit Helfern und Hilfswerken haben mich nachdenklich gemacht, gerade auch hinsichtlich des interessanten Phänomens, daß etwas, das zunächst negativ erscheinen mag, in anderen Zusammenhängen durchaus positiv sein kann – und umgekehrt. Sehr viele Teilnehmer an diesem Spiel begnügen sich mit einfachen, schablonenhaften Fragen und Antworten, wo ein etwas genaueres Abwägen der verschiedenen Aspekte die Treffsicherheit des Engagements deutlich erhöhen könnte. Aber der entscheidende Auslöser der in diesem Buch zusammengefaßten Gedanken lag in einem scheinbar belanglosen Kommentar, mit dem die Mitarbeiterin einer österreichischen Künstleragentur mein Ansinnen abwehrte, durch ihre Hilfe einige bekannte Schriftsteller und Musiker in das einzubinden, was ich ihr vorgeschlagen hatte: Eine Spendenveranstaltung in einem Wiener Kulturverein, große Bilder schlechtversorgter rumänischer Kinder, Informationen über ein damals auch mir als vorbildlich erscheinendes Kinderheim unter deutscher Leitung, dazu die Heimleiterin persönlich in Begleitung eines ihrer Schützlinge, kurz: sichtbare Notwendigkeit und fühlbarer Sinn sofortigen Helfens aus dem Plüschsessel heraus, aufbereitet als Wanderzirkus zum Anfassen.1
Meine Bekannte stieß sich an der Ausnutzung und Kommerzialisierung von Leid und Elend. So notwendig es mir damals erschien, mit drastischen Mitteln gegen das Elend anzugehen: Der Einwand war doch vollkommen berechtigt.
Die Veranstaltung scheiterte keineswegs an der Agentur, sondern an der Heimleiterin, die zwar ihr Kommen ankündigte, aber keine Projektpapiere schickte. Da man bekannten Schriftstellern und Musikern irgendeine Art von Konzeptpapieren in die Hand drücken muß, wenn man sie für eine Wohltätigkeitsveranstaltung einspannen will, konnten wir ohne das Zutun der Initiative nichts machen. Beides ließ mich nicht mehr los: die Tatenlosigkeit der Initiative, die ich als stets besonders begehrlich kennengelernt hatte, und der Denkanstoß hinsichtlich der Wahl der Mittel. Beides beeinflußte meine innere Haltung gegenüber den Initiativen und dem Spendenbetrieb insgesamt, und ich begann die bestehenden Strukturen und meine Rolle darin gründlich zu hinterfragen. Das vorliegende Ergebnis dieser Inventur geht über eine Selbstrechtfertigung hinaus, schließt sie aber ein: Man kann durchaus mit den fast Pawlowschen Stereotypien des emotional bestimmten Wohltäters sehr hart ins Gericht gehen, auch wenn man sich vordem mit aller Überzeugung und Verbissenheit für die Behebung der bei uns mittlerweile sehr bekannt gewordenen Mißstände in Rumänien einzusetzen versucht hat – ja, gerade wenn und weil guter Wille und heiße Einsatzfreude an den Brükkenköpfen dieser Hilfswerkerei, in den Initiativen also, steigenden Verwaltungsaufwand verursachten und die Projektbetreiber, die in ihrem Tagesgeschäft doch wirklich ganz andere Probleme haben als wir, dazu nötigten, Gedanken mitzudenken, die nicht ihre waren. So gesehen, scheitert Unterstützereinsatz an der fehlenden Wendigkeit der anderen; aber anders gesehen, sind es wir zügellose und unbeherrschbare Unterstützer, die eine Sache zum „Verderben durch Überkochen“ bringen. Das mag als Beispiel gelten für strukturelle Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und für gegenseitiges Mißverstehen.
In diesem Buch werden einige Grundstrukturen der Beziehungen zwischen den Akteuren im Spendenbetrieb besichtigt, um den beiden Fragen nachzugehen, ob die Ausgestaltung des Spendenbetriebs seiner postulierten Zielsetzung wirklich dienlich ist oder nicht, und um welchen Preis er sie erreicht. Das ist die Grundlinie, sie führt durch die Täuschungen und Selbsttäuschungen, denen die Spender unterliegen, durch ein Dickicht vieler kleiner und größerer Manipulationen und Programmierungen bis in den Bereich ganz grundlegender Fragen der menschlichen Existenz. Die Thematik dringt damit zum Menschen als Kern seines Handelns vor und erweitert sich zugleich ins Universelle, Philosophische. Daß einigen der hier zusammengestellten Thesen etwas Brisantes anhaftet, zeigten die teilweise heftigen Abwehrreaktionen von mir sehr nahestehenden Spendern. Bei denjenigen, an die sich die Kritik richtet, wird sie gewiß ähnliches auslösen, und zuweilen ist es der Unwillen der Angesprochenen zur logischen Gegenargumentation, der diese Gedankengänge in ihnen schmerzvoll verhallen läßt, ohne daß aus ihnen ein tragfähiges Ergebnis der Reflexion erwüchse.
„Was Kultur unter anderem leistet, ist, daß sie den Menschen Möglichkeiten des Nachdenkens über ihr Tun liefert“, schreibt Jedediah Purdy in Das Elend der Ironie.2 „Die Menschen können dann eine Beziehung zwischen ihrer Arbeit, ihren Begabungen und den Bedürfnissen der Welt erkennen. Sie nehmen ihre Arbeit als Teil des ganzen wahr.“ Menschen, die aus dem unbestimmten, aber sehr persönlichen Drang heraus, etwas für die Verbesserung der Welt tun zu wollen, Kontakt zu Hilfsinitiativen aufnehmen, wollen sich damit in den Kontext so eines Ganzen stellen. Manchmal wollen sie wohl auch, daß ein bißchen Sternenstaub auf ihre Schultern fällt. Sie wollen, daß man ihren Altruismus erkennt und anerkennt; sie sind mit subjektivem Recht stolz darauf, das in Europa kulturell tief verwurzelte Gebot der Nächstenliebe angenommen und – in ihrem Bereich – erfüllt zu haben. Schon dadurch wird das Spenden, eine ihrem Wesen nach auf Freiwilligkeit gegründete Sache, zum gesellschaftlichen und persönlichen Zwang. Auf die damit verbundenen christlichen Implikationen kommt dieses Buch ebenso zu sprechen wie auf das unscheinbare, aber sehr verläßliche emotionale Räderwerk, in dem auf bestimmte Reize meist die entsprechende Reaktion folgt. Gleichwohl: „Ihre Arbeit als Teil des ganzen“ wahrzunehmen, wie es Purdy formuliert, das ist in vielen Bereichen des Spendenwesens zum reinen Selbstzweck oder zur kalkulationssicheren Propaganda geworden. Für große, hochprofessionalisierte Initiativen haben die Unterstützer zunächst und vor allem die Funktion, Geld zu geben. Persönlicher Kontakt zu den Spendenempfängern, zu einem Patenkind etwa, ist offiziell zwar in den allermeisten Fällen erwünscht, normalerweise achten die Initiativen aber aus guten Gründen sehr genau darauf, daß diese Kontakte unter Kontrolle bleiben und nicht zu weit gehen. Auch die Expeditionen pädophiler Unterstützer finden im Umfeld von Initiativen statt, und selbstverständlich sollte davon auszugehen sein, daß die Initiativen das nicht billigen. Aber verhindern können sie es auch nicht, und die netten Herren, die gerne mal mit einem Knaben um die Ecke gehen, wissen das genau. Jemand, der die rumänische Hilfsinitiative eines ehemaligen Gefängniswärters aus der Schweiz besucht hatte, berichtete später, dort würden Bilder leichtbekleideter Muskeltypen an den Wänden hängen. Die Gefahr, aber auch die denkbaren Arrangements rund um Pädophilie und Prostitution geben Anlaß zur Sorge – einerseits aufgrund der unmittelbaren Folgen, andererseits aus ethischen Erwägungen: Die Bordelle sind ja in Armutsgegenden gerade deshalb so billig, weil die Menschen dort nichts zu essen haben. Die Grenzen verschwimmen.
Nicht jeden interessiert es, was jenseits des Zahlscheins wirklich mit seinem Geld passiert; für das gute Gefühl ist nicht die Wirkung einer Spende ausschlaggebend, sondern allein der Vorgang des Spendens. Es reicht, eine „seriöse“ Initiative gefunden zu haben, und die wird es schon richtig machen. Und das ist ja auch so: Die Initiativen können in ihrem Sinne effektiver arbeiten, wenn sie nicht so viel erklären müssen. Das Nachdenken über das eigene Tun wie über das der anderen ist für dieses Funktionieren von Geben und Nehmen nicht nur überflüssig, sondern geradezu hinderlich, und je mehr einer nachdenkt, desto zielstrebiger steuert er auf irgendeine Form der Eskalation zu. Kultur gibt uns also die Möglichkeiten, über das eigene Handeln nachzudenken, die Verwirklichung dieser Möglichkeiten stellt aber zwangsläufig Form und Inhalt des Handelns zur Disposition. Das ist ein destruktiver Vorgang, denn er kann aus Sicht der Initiativen das Versiegen eines Spendenstroms bewirken und aus Sicht des Spenders die als unbehaglich empfundene Situation herbeiführen, die christlich-sozial verankerte Wohltätigkeit nicht durchgehalten zu haben.
Es gibt natürlich überaus viele Spender wie auch Hilfswerke, bei denen ständig und mit beachtlichen Ergebnissen nachgedacht wird. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Die selbstverordnete Unmündigkeit wird dadurch jedoch nicht inexistent, es gibt sie, und hier setzt dieses Buch an. Es soll eine Mechanik ans Licht holen, in der sich die Dinge allzu einfach zeigen und die längst von Spendenwerbern in bare Münze umgesetzt wird. Friedrich Wilhelm Foerster schreibt in seinem überaus lesenswerten Buch „Lebensführung“3, das bloße Geldgeben sei eine sehr passive Art, sich von sozialen Gewissensbissen zu befreien. Befreit uns das Spenden von diesem Druck, so wird uns derjenige am ehesten zum Spenden bewegen, dem es gelingt, diesen Druck unter seine Kontrolle zu bringen und nach erfolgter Entladung bedarfsweise neu aufzubauen. Ein kleiner Stromschlag ins Gewissen, ein Klicken wie von Handschellen, und ein kleiner Geldquell ist erschlossen, dessen Sprudeln durch die Fortsetzung und Steigerung der emotionalen Stromschläge sichergestellt wird. Man soll sich nicht vormachen, daß die autodidaktischen oder hochprofessionellen Spenderjäger das nicht kapiert hätten – sie wissen sehr gut, auf welche Art der Ansprache die stärkste Reaktion erfolgt.
Wie sehr das Spendenwesen eine Sache der emotionalen Selbstverpflichtung geworden ist, zeigt sich schon daran, daß gerade in der Vorweihnachtszeit besonders viele Initiativen an unsere Mildtätigkeit appellieren. Man sendet uns personalisierte Absenderaufkleber mit unserem Namen, Postkarten mit fußgemalten Bildern, Taschenkalender und manches mehr, wohl auch mit dem Hinweis, man müsse sich deswegen nicht zu einer Spende verpflichtet fühlen, aber doch ist es genau dies, was uns – kühl kalkuliert – zum Spenden in die Pflicht nimmt. Wenn wir nämlich die Absenderaufkleber und Postkarten verwenden, aber nicht gespendet haben, regt sich schon bald das schlechte Gewissen. Und wir denken uns: Diese Initiative, die sich eigentlich die Versorgung von Elendskindern angelegen sein läßt, schenkt uns von Spendengeldern solche Drucksachen, wir verursachen den Kindern also einen Schaden, wenn wir nicht spenden – wir sind ihnen unsere Spende schuldig. Die Initiativen können sich solche Aktionen schon deshalb leisten, weil sie genau berechnen können, wie einträglich diese Form des Bettelbriefes ist, auch wenn nur ein Teil der Adressaten spendet. Initiativen, die auf diese Weise arbeiten, müssen deswegen nicht unseriös sein. Aber sie arbeiten ohnehin mit einem großen Etat, sind also in ihrem Fortbestand nicht gefährdet. Die kleinen Hilfswerke, die zuweilen unkonventionell arbeiten, aber oft ebenfalls gute Ergebnisse vorweisen – sie können ihre Geldgeber nicht auf diese Weise akquirieren. Finanziell pfeifen deshalb viele von ihnen aus dem letzten Loch. Und wer nun für eine große Initiative gespendet hat und danach von einer kleinen erfährt, der fühlt sich womöglich schon wieder einer Unterlassung schuldig.
Das Spenden erscheint auf den ersten Blick simpel: Da ist Not, hier ist Überfluß, also gibt man etwas vom Überfluß ab und lindert dadurch die Not. Soweit ist das ein ehrenwerter Gedanke, der in der Geschichte vom Heiligen Martin vorbildhaft verdichtet wurde und tatsächlich auch ein Grundpfeiler des sozialen Miteinanders ist. Teilen, wie es der legendäre Martin vorgelebt hat, bedeutet jedoch nicht, das abzugeben, was übrig ist, was man also selbst kaum braucht, sondern: mit dem Schwert mitten in den eigenen Besitz zu fahren, auch wenn dies dazu führt, daß man danach mit einem halben Mantel weiterreiten muß. Die Brotkrümel unterm Tisch zu spenden, um sich als Sankt Martin zu fühlen, geht völlig an der Lehre vorbei, die man aus dieser Geschichte ziehen soll. Wenn nun einer die Sache ernst nehmen will und nicht nur spendet, sondern teilt, ist überlegtes und verantwortungsbewußtes Handeln besonders wichtig – und zwar ein Handeln, das nicht durch Schuldgefühle geleitet ist. Es zeugt keineswegs von Geringachtung gegenüber den Spendenempfängern, wenn der Spender zunächst für Stabilität in den eigenen Angelegenheiten sorgt, sondern von Vernunft und planmäßigem Vorgehen. Wer noch finanzielle Verbindlichkeiten offen hat und vor ihrer Tilgung spendet, der spendet mit fremdem Geld. Und wer eigene Kinder hat, ihnen aber nicht als erstes alle Fürsorglichkeit, Aufmerksamkeit und Zeit angedeihen läßt, die ein Vater oder eine Mutter ihrem Kind abstrichlos schuldig sind, der spendet ebenso auf fremde Kosten, denn er zieht das, was er zur Behebung irgendwelchen Elends verstreut, dort ab, wo es ebenfalls dringend gebraucht wird und wo der Spender gewiß kein Einverständnis mit seiner Entscheidung voraussetzen kann. Manche betäuben ihre Schuldgefühle gegenüber den eigenen Kindern sogar mit besonderem Engagement auf fernen Handlungsplätzen. Die Auswahl des Spendenempfängers verkommt dabei nicht selten zu einer völlig beliebigen Sache. Die Tatsache, daß es Not und Elend in sehr vielen Gegenden auf der Welt gibt, steht in hartem Kontrast zu der Unbedingtheit, mit der sich viele Spender irgendein Objekt ihrer Wohltätigkeit aussuchen, obwohl die Hilfsbedürftigkeit schon einen Steinwurf entfernt sehr viel größer sein könnte.
Es erfordert sehr gutes Augenmaß, einerseits zunächst die persönlichen Lebensdinge ins Lot zu bringen, bevor man sich spendend verausgabt, andererseits daraus aber nicht einen Freifahrtschein für die Verweigerung sozialer Verantwortung abzuleiten. An solchen Beispielen wird deutlich, wie wenig anhand einfacher Rezepte entschieden werden kann und wie nötig es bleibt, sein Tun immer neu zu überdenken. Sankt Martin, Mutter Teresa und viele andere haben ihre Mittel und Möglichkeiten zwar spontan und vollständig zur Dispositionsmasse erklärt, dabei jedoch den Fortbestand ihrer eigenen Existenz nicht aus den Augen verloren. Viele haben ihre Existenz umgewidmet, wohl auch in Frage gestellt, aber nicht verschleudert. Was aber auf der moralischen Ebene entscheidend ist: Sie haben nicht des Spendens wegen geholfen, sondern um Not zu lindern.
Die Verpflichtung, Geld zu spenden, ist auf die Empfindung zurückzuführen, daß es in der Welt erhebliche Unterschiede in den Lebensbedingungen der Menschen gibt, und auf die aus dieser Erkenntnis erwachsenden Schuldgefühle und Selbstbezichtigungen. Ist aber der einzelne Bürger in der Ersten Welt wirklich verpflichtet, gerade auf diese Weise gegen diese Unterschiede tätig zu werden? Man sollte doch auch einmal der Frage nachgehen, wie sich beispielsweise die rumänische Gesellschaft hinsichtlich ihrer Verantwortung für die Kinder des eigenen Volks verhält. Und daß die „Kollateralschäden“ des entfesselten Globalkapitalismus ohnehin von Hilfsinitiativen und Spendern aufgefangen werden, das wiederum kalkulieren Börsenspekulanten, Hedgefonds und Regierungen regelmäßig in ihre Maßnahmenkataloge mit ein. Denn die Mechanik dieses Loskaufs von subjektivem Schuldigkeitsgefühl ist eine verläßliche Sache: „Wenn dieser Welt-Verteilungs-Konflikt nun schon politisch oder wirtschaftlich ungelöst bleibt, so denke ich, ist es die Verpflichtung eines jeden, der in der sogenannten besseren Welt lebt, ein bißchen Wohlstand abzugeben, damit es jemand anderem besser gehen kann“, begründet die engagierte Spenderin Sabine Schmitt4 ihr Tun. „Das darf ruhig mal mein eigenes Portemonnaie ein Stück anschneiden. Ich unterstütze Projekte vor Ort, die nur ermöglicht werden, wenn es Leute im Wohlstandswesten gibt, die bei der Finanzierung helfen. Darüber hinaus versuche ich durch Briefkontakt, diesen Kindern und Familien ein Gefühl der Anteilnahme an ihrem Leben zu vermitteln.“
Eine moralische Grundverpflichtung zur Aktion (gleich welcher Art) gibt es durchaus, weil das Konsumleben in einer Industrienation ein Teil der globalen Ausbeutung ist. Aber ist derjenige, der sein Konsumverhalten verantwortungsvoll und fair ausrichtet, moralisch auch noch verpflichtet, für das zu bezahlen, was andere angerichtet haben oder ihm zu regulieren überlassen? Und falls ja, geht dann mit dieser moralischen Verpflichtung nicht noch eine andere einher, nämlich die, sich Klarheit zu verschaffen über das, was als unmittelbare Folge aus der Spende resultiert oder was durch sie legitimiert wird? Und wenn beispielsweise die kostenlose Verteilung von Kleiderspenden zur Folge hat, daß die kleine Arbeitsinitiative nebenan keine gestrickten Pullover mehr verkaufen kann, dann liegt die reale Folge dieser Spende in der Zerstörung eines kleinen Wirtschaftsprojekts, in einem Zurückstoßen in die Unselbständigkeit, in einem Erziehen zur Bettelei. „Der Transport von Sachgütern ist wirklich nicht das Problem“, schrieb mir ein Teilnehmer einer Rumänien-Mailgruppe, „aber die Frage ist, was danach mit diesen Sachgütern passiert. Es sind genug Fälle bekannt, wo ein ganzes Dorf seinen Jahreskreislauf auf den Terminplan der Hilfslieferungen ausrichtet: Warum soll ich noch selbst aufs Feld und Kartoffeln anbauen, wenn zweimal im Jahr die alten Konserven aus Deutschland kommen?“
Wie leicht lassen sich viele Beispiele finden, wo der überwiegende Teil des Spendenakts auf die Selbstbefriedigung der Spender gerichtet, wo der Spendenempfänger instrumentalisiert, ausgebeutet und erniedrigt wird oder wo durch gutgemeinte Hilfsarbeit das Gegenteil von dem bewirkt wird, was man eigentlich beabsichtigt. Dieses Buch will den Leser einladen, seine eigenen Reflexe und Beweggründe des Spendens oder auch Nichtspendens, seine Ansichten und Überzeugungen einer schonungslosen Inventur zu unterziehen. Nur so können wir dahin kommen, eine Beziehung zwischen unserer Arbeit, unseren Begabungen und den Bedürfnissen der Welt zu erkennen.
1 Mein Engagement erfolgte uneigennützig.
2 Die Zeit Nr. 37/2000, S. 11
3 Foerster, Friedrich W.: Lebensführung. Hrsg. von Matthias Dräger. St. Goar: Reichl-Verl., 2004
4 Name geändert
Die Verwalter des Mitgefühls
Bei den sogenannten NGOs gibt es seit einigen Jahren einen deutlichen Trend zur Ökonomisierung, Mediatisierung, Inszenierung und Dramatisierung. „Fundraising“, das Einsammeln von Spendern und Spenden, wurde professionalisiert und mechanisiert, und wer heute auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung ist und etwas Sinnvolles tun will, der wird womöglich Fundraiser – schon des guten Zwecks wegen. Das neue Bettelmanagement wirkt integer, es kündet von sozialem Verantwortungsgefühl und klingt ein bißchen nach Jet Set. Immerhin geht es allein in Deutschland um einen Markt von geschätzten zweieinhalb Milliarden Euro, die Jahr für Jahr gespendet werden. Rechnet man alle spendenähnlichen Beiträge hinzu, kommt man fast auf das Doppelte. Zum Vergleich: Der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lag im Jahr 2007 bei 4,5 Milliarden Euro, von denen ungefähr ein Drittel an Organisationen wie UNICEF und etwa ein Achtel an nichtstaatliche Organisationen fließen. Alles in allem wenden die Deutschen also rund sieben bis 9,5 Milliarden Euro pro Jahr für diesen Bereich auf, Zeitspenden nicht eingerechnet. Einhundert Euro pro Jahr: ein mäßiger Tribut für den Dauerplatz auf der vermeintlichen Sonnenseite, die jedoch für immer mehr Menschen gar nicht so sonnig ist. Ein erheblicher Anteil davon geht in „Werbung und Verwaltung“, fließt also in Büromieten, Werbefirmen, Druckaufträge, Portokosten und natürlich auf die Gehaltskonten von Mitarbeitern und Fundraisern. Das tut der heimischen Wirtschaft wohl, es sichert Arbeitsplätze und läßt die Spendenbranche mit dem sie begleitenden Troß an Dienstleistern prosperieren.
Unter Fundraising versteht man die systematische Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten einer Nonprofit-Organisation, die darauf abzielen, alle für die Erfüllung des Satzungszwecks benötigten Ressourcen (Geld-, Sach- und Dienstleistungen) durch eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Ressourcenbereitsteller ohne marktadäquate materielle Gegenleistung zu beschaffen. Nach einer anderen Beschreibung umfaßt Fundraising die gesamte Nonprofit-Organisation, und zwar vom Endergebnis her betrachtet, also vom Standpunkt des Förderers. Da wie dort stehen die Bedürfnisse der Ressourcenbereitsteller im Mittelpunkt der Arbeit. Die Fundraising-Fachleute sprechen nun Einzelpersonen, Gruppen und Unternehmen an, wobei sich in der letztgenannten Gruppe die Arbeit des Fundraisers mit der Corporate Social Responsibility verzahnt. Diese CSR ist laut verzahnt. Diese CSR ist laut Grünbuch der Europäischen Kommission ein „Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren.“ Unter der Bezeichnung „Stakeholder“ werden alle zusammengefaßt, die sich in irgendeiner Weise für die Arbeit des Unternehmens interessieren, vor allem also Investoren, aber auch die Medien und die Öffentlichkeit, Arbeitnehmer und Gewerkschaften, Kunden und Lieferanten, Anwohner, Verbraucher- und Umweltschutzverbände. „Während Nonprofit-Organisationen vielfältige Unterstützung von Unternehmen erhalten, erhoffen sich Vertreter der Wirtschaft von den Maßnahmen vor allem wirtschaftliche Vorteile“5, schreibt die Kommunikationsforscherin Friederike Schultz. Die Unternehmen sehen sich also nicht den tatsächlichen Mißständen gegenüber in der Pflicht, sondern sind zuerst und vor allem auf das Ansehen bedacht, das sie bei Ihren Stakeholdern genießen. Genau das entlarvt die CSR als eine (wenn auch zufälligerweise oft sinnvolle) Abteilung der Unternehmenswerbung und des Marketings. Hier geht es um die Wirkung nach außen, und damit hat es sich. „Je mehr ein Unternehmen durch Manager und Kapitalanleger gesteuert wird, umso unmittelbarer ist CSR in das originäre Eigeninteresse des Unternehmens eingebunden,“ meint auch der Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, Burkhard Wilke6. „Die CSR-Maßnahmen müssen sich direkt und konsequent durch ihren kurz-, mittel- und langfristigen Nutzen für das Unternehmen legitimieren.“
Fundraising ist das kalte Geschäft mit heißen Gefühlen. „Mit viel Phantasie möglichst viel Geld für den Verein besorgen!“ – so bringt es die Titelseite einer Fundraising-Yahoogruppe auf den Punkt. Folgt der Dialog zwischen Fundraiser und Unternehmen den kühlen Gesetzen erfolgreicher Unternehmenswerbung, so zielt er doch auf die Emotionen der Stakeholder. Bei der Bearbeitung des Einzelspenders ist weit mehr auf der Moll-Tonleiter zu spielen, denn hier kann der Fundraiser nicht auf das Marketing-Kalkül seines Gegenübers rechnen, sondern muß dessen Herz und sein Selbstbewußtsein treffen. Der Spender wird hier überwiegend emotionalisierend angesprochen, bis hin zur Aktivierung seines Selbstwertgefühls. Die Ansprache des Spenders zielt darauf ab, ihn emotional aufzuladen und ihm zur Wiederherstellung seiner Behaglichkeit eine Entladungsmöglichkeit anzubieten. „Spenden sind eine Möglichkeit, die Selbstachtung zu erhöhen“, meint auch Marita Haibach.7 Die Spende wird buchstäblich durch eine Gefühlskontraktion freigesetzt. Riesige Beträge werden in Kampagnen investiert, deren unmittelbares Ziel nicht die Behebung von Not und Elend ist, sondern das Aktivieren neuer Spenden durch das Wechselspiel von Aufladung und Entladung. In diesem Spendenmarketing verdienen viele ihren Lebensunterhalt, sie leben genau so von Spenden, wie jemand aus der Werbewirtschaft von den Einschaltungen lebt und letztlich von der durch sie mitverursachten Umsatzsteigerung.
„Die Entscheidungsträger sind Privatpersonen oder Unternehmen, die auf der Basis ganz individueller Motivlagen darüber entscheiden, wann sie wem Mittel in welcher Höhe zukommen lassen“, heißt es in Michael Vilains Buch „Finanzierungslehre für Nonprofit-Organisationen“. Es ist auffällig, daß im Spendenwesen die Hauptenergien nicht auf die Straffung des Verwaltungsapparats, die künftige Entbehrlichkeit der Hilfsarbeit oder andere Möglichkeiten zur Kostendämpfung gelegt werden, sondern ganz überwiegend auf die Erschließung neuer und immer neuer Geldströme und die Pflege der bereits vorhandenen. Fundraising geht von dem Dogma aus, daß immer noch mehr Geld beschafft werden muß, um die steigenden Aufgaben zu bewältigen. Denkt man dies konsequent weiter, muß das Spendenkarussell in den Kollaps führen, ohne tatsächlich die prekäre Gesamtsituation der Zielländer grundlegend ändern zu können. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Unterdessen vervollkommnen die Fundraiser das Instrumentarium, mit dem sie die „ganz individuellen Motivlagen“ der Spender beakkern. Besonders deutlich ist das bei den Aussendungen und „Aktionen“ von Tierschutzorganisationen zu sehen: Hier wird in den meisten Fällen ausschließlich auf der Mitleidsebene gearbeitet, indem die Spender mit möglichst erschreckenden Bildern und möglichst grauenvollen Szenarien traktiert werden. Die andere Seite, also beispielsweise die verheerenden Auswirkungen von Überpopulationen auf Biosysteme, wird dann konsequenterweise ausgeblendet oder allenfalls gestreift.
In den Broschüren, mit denen automatisierte Fundraising-Programme angepriesen werden, kann man besichtigen, wie das geht. „Organisationen aus der Sozialwirtschaft können jetzt ein zielgruppenindividuelles Beziehungsmanagement zu ihren Geldgebern aufbauen, maßgeschneiderte Fundraising-Kampagnen planen, durchführen und auswerten sowie die eingenommenen Spendengelder transparent verwalten“, schreibt die Firma CIWI über ihr Programm Fundtrac. Neben dem automatischen Erstellen von mit Textbausteinen „individualisierten“ Dankschreiben und Berichten gibt es unter anderem eine „Kaltadressenverwaltung“. Der Anwender kann unterschiedliche Aktionstypen wählen („seicht, aggressiv oder informativ“) und Fundraising-Ziele dokumentieren („Rettung von kritischen Spendern, Aktivierung von schlechten Spendern, Bindung von aktiven Spendern oder Gewinn von Neuspendern“)8. Die Adressen der Spender können beliebig vielen dynamischen Zielgruppen zugeordnet werden. „Dadurch läßt sich das Verhalten der einzelnen Geldgeber in den jeweiligen Gruppen genau beobachten, wie etwa das Abwandern von Best-Spendern oder die Aktivierung kritischer Spender. Für jede Gruppe liegen statistische Daten wie Umsatz, Qualität oder Trends vor und werden in definierbaren Zyklen automatisch neu berechnet. So gewinnt der Anwender detailliert Einblicke in den aktuellen Stand der wichtigen Zielgruppen und kann die Ergebnisse miteinander vergleichen.“ Zu allen Aktionen werden hochwertige Analysedaten bereitgestellt, „von Grunddaten wie Datum und Anzahl über Response bis hin zum Return on Investment“, unter anderem Umsatz-, RFM-, Pareto-, Potential-, Frequenz- und Trendanalysen.9
Auch das Programm Context K der Firma Kigst erlaubt die gründliche Durchleuchtung der Spender: „In der Adressenhistorie werden alle statistischen Werte der Person angezeigt: Teilnahmen an Aktionen, Buchungen, Response, statistische Werte, Kommunikationsdaten, Konfession, Sperren, Milieudaten, Familienstand, Alter, Geburtsdatum, Protokolleinträge, Künstlernamen, Ordensnamen, VIP Spender, Lastschriften und vieles mehr … “10 Was wir dem modernen Verkaufsmarketing des Cookie-Zeitalters nur ungern zubilligen, gehört in diesem Bereich zum Basiswerkzeug. Selbst unsere Milieudaten werden für ein automatisiertes Abschöpfen unserer Spendenbereitschaft herangezogen. Und der Response: Da sieht man, auf welche Art von Reiz die angesprochenen Menschen am ehesten reagiert haben, und der wird dann natürlich wiederholt. Welche Bilder am ehesten die Kassen klingeln lassen, läßt sich einem Fachbuch von Raphela Keller entnehmen.11
Man kann einwenden, daß den Initiativen gar nichts anderes übrig bleibt, als sich um Spendengelder zu bemühen, daß es den Elendsschicksalen zugute kommt, wenn mehr Geld aktiviert wird, und daß es den sozialen Anliegen dient, wenn diese Arbeit professionalisiert wird. Dennoch ist zu kritisieren, wenn von Spendengeldern alles mögliche finanziert wird, was gar nicht in Lumpen herumläuft: die Fundraiser selbst mit ihren Provisionen, die Verwalter und Koordinierer, die ja nicht immer ehrenamtlich arbeiten. Das soll nicht heißen, daß nur die aufopferungsvolle, selbstlose Freiwilligenarbeit zu tolerieren wäre. Die Angehörigen der Sozialberufe lassen sich für ihre gute und wichtige Arbeit ja ebenfalls bezahlen, was ganz normal und anders kaum denkbar ist. Dennoch läßt sich zwischen der ostentativen Mittellosigkeit, die uns aus den Bettelbriefen entgegenweint, und dem hochentwickelten Marketing, das dahinter steht, ein gewisses Mißverhältnis erkennen. Nicht jeder gespendete Euro verwandelt sich in Medikamente, Lebensmittel oder Schulbildung: Drückerkolonnen und Fundraising-Profis, Werbedesigner, die Bank, die Post, die Druckerei – sie alle bekommen von dem gespendeten Geld ihren Anteil ab, und der wird üblicherweise schamhaft hinter einem Feigenblatt versteckt, während gleichzeitig der Bereich der sicheren und einträglichen Spendenindustrie wächst. Zu kritisieren ist ferner, wie sehr mit Emotionalisierung gearbeitet wird, obwohl die Marketingstrukturen des Spendenwesens überwiegend kühl durchkalkuliert werden. Und schließlich macht die marktschreierische Arbeitsweise der Spendenakquise die ganze Sache zweifelhaft, denn in diesen vorgeblich „unbürokratischen“ Strukturen, in Initiativen, die zupacken und die gegenwärtigen Probleme angehen, ohne lange zu reden, in diesem entstaatlichten Bereich des Sozialwesens also bekommt doch nicht der am meisten, der es am nötigsten hat. Sehr viel Geld geht zunächst einmal an die Initiative, deren Instrumentarium zur Aktivierung der potentiellen Spender am besten entwickelt ist. Und dasjenige Elendsschicksal wird vorrangig saniert, dem das Glück beschieden ist, von einer Initiative oder von den Medien zum Thema gemacht worden zu sein. Die Auswahl erfolgt jedoch meist nach Geschmack, nach Marktkalkül oder Medienstimmung – wenn nicht sogar zufällig. Man kann der Bürokratie mit gutem Recht etliches zur Last legen, aber bei der Verteilung von Leistungen geht es erst dann wirklich ungerecht zu, wenn es „unbürokratisch“ wird. Dann werden zuerst die am weitesten aufgerissenen Mäuler gestopft, dann wird „Soforthilfe“ nach Augenschein und persönlicher Neigung verteilt, und das Gedrängel um die Futtertröge läßt eine Verteilungsgerechtigkeit gar nicht erst zu.
Die Erodierung des Sammlungsrechts in den verschiedenen Bundesländern dient offiziell der Entbürokratisierung. Wer sich engagieren will, soll schnell und unkompliziert sein kleines Hilfswerk gründen können – befreit von Verwaltungszwängen und Wirtschaftsprüfungspflichten. Tatsächlich entzieht sich der Staat auf diese Weise seiner Verantwortung gleich doppelt: Er schiebt Teile seines Aufgabenbereichs dem einzelnen Bürger zu und läßt ihn dafür aufkommen. Und dann kontrolliert er nicht einmal, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Dadurch wird zwar dazu beigetragen, daß sich das deutsche Spendenaufkommen erhöhen dürfte, aber die unseriösen Spendenwerber haben es künftig leichter.
Der Bürokratisierungsgrad einer Initiative im Sinne notwendiger und sinnvoller Verwaltung gehört zu den wesentlichen Prüfungskriterien bei der Vergabe des Spendensiegels des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI): Die Mittelverwendung muß sparsam und wirtschaftlich sein, aber bis zu fünfunddreißig Prozent des Gesamtetats kann eine Organisation ohne weiteres für Werbung und Verwaltung ausgeben. Bei den zertifizierten Organisationen liegt dieser Anteil durchschnittlich bei fünfzehn Prozent. Im Jahr 2000 lag er noch bei 9,1 Prozent – ein Anstieg um zwei Drittel! Trotzdem kommen auch große und angesehene Organisationen wie UNICEF schon einmal in die Medien, weil man ihnen Spendenverschwendung, übertriebene Prämien für Fundraiser oder zu teure Verwaltungsbauten nachsagt. Das Deutsche Kinderförderwerk in Wetzlar hat im Jahre 2003 gar nur 4,5 Prozent im Jahr darauf 5,9 Prozent der bundesweiten Spendeneinnahmen für Hilfeleistungen verwendet. Die Internationale Kinderhilfe e. V. in Pfungstadt wollte sich ganz besonders schlau anstellen und beauftragte eine hochkarätige Werbeagentur, die Firma Creative Direct Marketing International (CDMI). Von den eingeworbenen Spenden (eine Million Euro im Jahr 2005) konnte nicht einmal die Honorarrechnung von CDMI beglichen werden, die Sache endete in der Verschuldung. Auch hier machen sich die unguten Folgen der Entbürokratisierung bemerkbar. Nicht einmal die Finanzbehörden, zuständig für die Anerkennung „gemeinnütziger und besonders förderungswürdiger“ Vereine, lassen sich die Effizienz der damit gekürten Initiativen ein Anliegen sein: Lediglich die Hälfte der Spendeneinnahmen muß in den angegebenen Sammlungszweck fließen. Auch bei den als „seriös“ angesehenen Hilfswerken, die das DZI-Spendensiegel tragen, darf ein gutes Drittel des gespendeten Geldes in der heimischen Volkswirtschaft verbleiben, im Nahbereich der jeweiligen Initiative, bei Fundraisern, Callcentern und Werbetextern. Sie alle, Ehrenamtliche ausgenommen, leben davon, daß sie anderen Menschen die Bedürftigkeit der Spendenempfänger nahebringen.
Die erfolgsabhängige Vergütung gibt den Initiativen zwar das Gefühl, auf der sicheren Seite zu sein, sie verleitet aber dazu, den emotionalen Druck auf die Spender zu erhöhen. Wer sich an einem Informationsstand oder per Post für eine Mitgliedschaft keilen läßt, zahlt nicht selten zuerst hundert bis hundertfünfzig Prozent eines Jahresbeitrags an die Werber. Kein Wunder, daß findige Werbeagenturen kleine Initiativen vor ihren Karren spannen, wie auch DZI-Geschäftsführer Burkhard Wilke gegenüber dem „Focus“ erklärt.12 Diese „moderne Form der Sklaverei“ könnte sich in Zukunft häufen, weil immer mehr private Werber auf den Markt drängen.13 Die Agentur L. A. & Friends sicherte sich im Januar 2005 unter ihrem damaligen Namen „Lichtblick“ einen Vertrag mit dem Deutschen Kinderförderwerk (DKFW), der ihr dreißig Prozent aller durch sie geworbenen Mitgliedsbeiträge zusprach – vom ersten bis zum letzten Tag der Mitgliedschaft. Als das DKFW plötzlich ohne Sammelberechtigung dastand, begannen die gegenseitigen Schudzuweisungen. Nach der Tsunami-Katastrophe in Südostasien bedrängten die Werbeagenturen die von ihnen bearbeiteten Hilfswerke, dieses Thema verstärkt in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu rücken – ohne Sachkenntnis, allein mit dem Ziel, den gerade angestochenen Spendenstrom weidlich auszunutzen. Beispiele dieser Art belegen, wie schnell naive Hilfswerke ihren Vereinszweck dem Geldhunger ihrer Dienstleister opfern. Manchmal kann man den Initiativen nicht einmal Gutgläubigkeit zugutehalten. Und manchmal ist es reines Showgeschäft: Nach dem schweren Erdbeben im indischen Bhuj im Jahre 2001 fielen die Hilfsorganisation und Fernsehteams in der Region ein wie die Heuschrecken. Nach jeweils drei Wochen verschwanden erst die Presseleute und dann die überwiegende Mehrheit der selbsternannten „Nothelfer“. Nach einem Erdbeben in Bam, ebenfalls in Indien, errichteten spanische Feuerwehrleute ein mobiles Krankenhaus lediglich für eine Medieninszenierung ihrer Außenministerin. Zwei Wochen später rissen sie es wieder ab.14
In der Akquise tobt die entfesselte Marktwirtschaft mit einem Dauerfeuer der verschiedensten Aufforderungen, hierhin und dahin zu spenden oder das und jenes zu unterstützen. Der hilfswillige, mündige Mensch hat kaum die Möglichkeit, sich anhand klarer Kriterien zu entscheiden, wen er unterstützt. Die Knopfaugen zählen, dazu die Drohung: Wenn Du nicht spendest, muß sich dieses Mädchen prostituieren. Vergleichbare Kennzahlen würden zu einer vernunftmäßigen Entscheidung, wo die jeweilige Spende am besten eingesetzt ist, ganz erheblich beitragen, doch nie finden sich in den Briefen und Aufrufen Angaben darüber, wie die Eigenmittelausstattung der jeweiligen Initiative aussieht, wie der konkrete Finanzbedarf, der Verwaltungsaufwand, die Höhe des Fehlbetrags. Meist wird nur darauf verwiesen, daß „jeder Euro hilft“. Und die Verlogenheit der ganzen Sache zeigt sich nun einmal am deutlichsten in der mechanisierten Perfektion, mit der die Melkmaschine an unsere Gutherzigkeit angelegt wird.
Sofern man uns überhaupt noch einen Rest Entscheidungsfreiheit zugesteht. Bei einer ganz besonders gefinkelten Variante des Fundraisings wird der Wille des Geldgebers nicht einmal mehr manipuliert, sondern einfach übergangen: Längst kursieren Handreichungen und Adressenlisten für das „Bußgeldfundraising“. Damit lassen sich anstelle der potentiellen Spender kurzerhand die Behörden abgrasen: Staatsanwaltschaften, Amtsanwaltschaften, Amtsgerichte, Landgerichte und Finanzämter nehmen jeden Tag aufgrund verhängter Bußgelder viel Geld ein, das einem guten Zweck zugeführt werden soll. Wer dort sein Projekt am geschmeidigsten vorstellt, hat gute Aussichten auf hohen Ertrag. Und weil das so aussichtsreich ist, kann es sich die Firma V & M Service GmbH in Konstanz erlauben, 7,50 Euro für den Download des Materials zu verlangen: „Wer Kontakte zu Richterkreisen und Staatsanwälten hat oder die seiner Anwälte nutzen kann, hat schon einen Vorsprung in der Bußgeldakquise: Er weiß mehr über die Zielgruppe und hat ein Feingefühl dafür, wie sie denkt und reagiert. Ob er schon die richtigen Kontakte für die Zuweisung von Geldauflagen hat, wird sich erweisen müssen“, schreibt die Firma auf ihrer Internetseite.15 „Im Zentrum steht die Zielgruppe und die Frage, wie der geeignete Kontakt zu ihr gesucht, aufgebaut und gepflegt werden kann: Es gibt rund dreißigtausend Richter und Staatsanwälten in Amts- und Land- und Oberlandesgerichten sowie den Staatsanwaltschaften bei diesen Gerichten. Die damit erreichbare Zielgruppe ist inhomogen, da sie nicht exakt nach Zivil- und Strafrichtern, die über Bußgelder entscheiden, selektierbar ist. Deshalb empfiehlt sich ein mehrstufiges Vorgehen, um die Kernzielgruppe der Strafrichter bei Amts- und Landgerichten sowie die der Staatsanwälte als echte Interessenten zu gewinnen und als Unterstützer an die Anliegen der Organisation zu binden.“
Auch hier regiert offen die Kunst der Manipulation: „In mehreren Stufen gilt es, die Zielgruppe für das Anliegen der eigenen Organisation aufmerksam zu machen und Zug um Zug die Bereitschaft und tatsächliche Unterstützung zu wekken. Nachdem alle persönlichen Kontakte zu den anzusprechenden Kreisen als Multiplikatoren und Empfehler ausgeschöpft sind, nicht zuletzt, um Denkart und Bereitschaft für Ihre Anliegen zu testen, stellt sich die Entscheidung, ob und wie die Zielgruppe schriftlich anzusprechen ist. Ein geeignetes Instrument dazu ist ein Betreuungsprogramm, das eine Kontaktfrequenz von mehreren Anstößen im Jahr beinhaltet. Der Maßnahmenkatalog beginnt mit einem Schreiben an die Gerichtspräsidenten mit der Bitte um Aufnahme in das Verzeichnis der zu berücksichtigenden Organisationen und anschließender Information zuweisender Richter und Staatsanwälte. Damit kommt der Wunsch der Organisation, bei der Zuweisung von Geldauflagen berücksichtigt zu werden, in Umlauf.“
Die Firma vertreibt 168 Adressen „Staatsanwaltschaften Deutschland“16 (Stand 2007) als Excel-Tabelle, selektierbar nach Postleitzahl, Bundesland und vielen weiteren Kriterien (fünf Seiten, 3,50 Euro) sowie den Ratgeber „Geldauflagen und Bußgelder richtig akquirieren“17 inklusive 847 Adressen „Gerichte Deutschland“ (Stand 2007) als Excel-Tabelle mit Postanschriften, größtenteils mit Telephon, Telefax, Email und Internetseite (sechzehn Seiten, 7,50 Euro). Für vier Euro erfährt man auf fünf Seiten, wer welchen Anteil am Bußgeldfundraising hat und woher die Bußgeldzuwendungen kommen. V & M Service hält aber in seinem Zauberkasten für Spendenakquisiteure noch etliches mehr bereit, zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung zu folgendem Thema: „Was können Dankesbriefe alles bewirken?“ Auf der Internetseite wird erklärt, daß es sich dabei um mehr als eine nette Geste handelt, denn „Dankbriefe wecken die Bereitschaft zur nächsten Spende! Dies kann einerseits in der Argumentation zu einer anderen Form der kontinuierlichen Unterstützung (Einzugsvollmacht zur Dauerspende oder Fördermitgliedschaft), andererseits auch in Form der Motivation zu einer direkten Anschluß-Spende geschehen. Dazu fügt man einen Zahlungsträger bei und begründet den erneuten Spendenwunsch. Der Spenderdank empfiehlt sich für Grading-up-Maßnahmen per Test: Thema und Zweckbindung werden als Anlaß genutzt, um eine weitere, höhere – im Anschreiben an der vorherigen Spende ausgerichteten Betrag – zum gleichen Anlaß zu erzielen.“18
Die „Welt“ berichtete am 22. Dezember 2007 über Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Spendengeldern. In die Kritik des DZI waren unter anderem die „Internationale Kinderhilfe“ und „Children’s Project“ geraten. Danach soll die Internationale Kinderhilfe Werbeschreiben verwendet haben, die als „in der Wort- und Bildauswahl als in hohem Maße bedrängend“ eingeschätzt würden. „Der potentielle Spender wird dadurch daran gehindert, sich unabhängig und sachbezogen zu entscheiden“ wird DZI-Leiter Burkhard Wilke zitiert. Und der Verein Children’s Project soll bis Ende 2006 durch die Art seiner Telephonakquise zahlreiche Beschwerden ausgelöst haben: Die Mitarbeiter haben laut DZI auf bedrängende Weise um Unterstützung für Kinder in Brasilien gebeten und gleich nach der Bankverbindung gefragt. Und ein paar Tage später wurden die Angerufenen schon per Brief als „neue Fördermitglieder“ begrüßt.
Wie die Pawlowschen Hunde durch Konditionierung dazu gebracht wurden, auf einen bestimmten Reiz in bestimmter Weise zu reagieren, so wird der Pawlowsche Spender darauf konditioniert, auf eine manipulative Ansprache hin sein Geld auszuwerfen. Verlogen ist dies deshalb, weil es in letzter Konsequenz den Menschen auf diese Reflexe reduziert und dadurch erniedrigt, zugleich aber vorgibt, etwas für die Menschen zu tun. Bei dieser Konditionierungsarbeit wird keineswegs nur die Peitsche eingesetzt, sondern immer auch viel Zuckerbrot. Von „Fun’dracing“ mit starker Betonung auf „Fun“ ist etwa die Rede, wenn die Firma Warning gigantische Mengen an Plastikenten verkaufen oder vermieten will. Auf der Internetseite www.fundracing.de liest sich das so: „Bei einem Entenrennen werden Tausende kleiner Gummienten bei einem Fundraising-Event auf einem Fluß in ein Rennen geschickt. Die schnellste Schwimmente gewinnt. Vorher können die Gummienten gegen eine Spende käuflich erworben werden. Mit Nummern versehen, werden sie zusammen und gleichzeitig ins Wasser gekippt. Die Enten, die als erstes das Ziel erreichen, haben für ihre stolzen Besitzer einen Sachpreis gewonnen.“ Das Entenrennen ist also eine Art Tombola, bei der „etwas passiert“, laut Entenhändler Warning ist die Sache „spannender, spektakulärer und fesselnder“. Und Warning hat alles, was man braucht: preisgünstige Plastikenten für ein kleineres Entenrennen, eine größere Menge an aufrechtschwimmenden Gummienten, alles kauf- oder mietbar, darüber hinaus gibt es Equipment und Dienstleistungen, Beratung und individuelle Unterstützung. Bernfried Warning, der stolz darauf ist, diese Idee nach Deutschland geholt zu haben, vertreibt neben seinen Wohltätigkeitsenten auch noch lose Kirschkerne sowie Piratenzubehör.
Hier dringt die „Event-Kultur“ geradezu beunruhigend ins Fundraising ein, und sinnvolle Ziele sollen mit offenkundig sinnlosen Mitteln, unter Inkaufnahme fragwürdiger Produktionsbedingungen und erheblicher Mengen von Entenmüll erreicht werden. Solche Veranstaltungen verlangen einen erheblichen logistischen und organisatorischen Aufwand und entsprechende Geldmittel, wenn sie zum Erfolg führen sollen. Während Warnings Rennenten dem Konzept „Sinnvolles durch Sinnloses“ folgen, tritt uns anderswo die sinnentleerte Hülse des reinen, merkantilen Unsinns entgegen, denn vollends zynisch wird die Sache beim Mondland-Verlag in Lübeck. Neben den Mondparzellen, die man dort erwerben kann, gibt es Küken-Patenschaften: „Übernehmen Sie eine Patenschaft für ein Osterküken. Werden Sie Hühnerpate bei Yahuhn. Übernehmen Sie die Patenschaft für eines unserer um Ostern herum geborenen Küken. Der kleine Hof mit einer Schafzucht liegt am Rande der Ortschaft Ermsleben … Ihr Küken wird zwar nicht mit einem Namensschildchen herumlaufen, aber dennoch wird es bestimmt spannend, mal nachzuschauen, was es so macht … Die Hühner wachsen ja auch flugs heran und werden im Laufe des Sommers zu stattlichen Hühnern, welche leckere Eier legen! Holen Sie sich dann Ihr Ei vom eigenen Huhn gleich mit ab. Ihrem Küken geben wir den Namen, den Sie sich wünschen und stellen auf Ihren Namen eine Patenschaftsurkunde aus, welche alle wesentlichen Daten über Ihr Osterküken enthält, wie Geburtstag, Geburtsgewicht und Eltern. Natürlich können Sie Ihr Küken auch jederzeit besuchen. Mit den Patenschaftsunterlagen erhalten Sie eine genaue Anfahrtsbeschreibung zur Farm. Anhand des mitgelieferten Polaroids Ihres Kükens werden Sie es sicher auch schnell erkennen.“19 Daneben gibt es im Mondland-Verlag auch noch Patenschaften für Rebstöcke und Olivenbäume.
5 Schultz, Friederike: Corporate Social Responsibility als wirtschaftliches Evangelium. In: Ruckh; Noll; Bornholdt (Hrsg.): Sozialmarketing als Stakeholder-Management. Grundlagen und Perspektiven für ein beziehungsorientiertes Management von Nonprofit-Organisationen. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 2006, S. 175.
6 Vgl. das Interview in diesem Buch.
7 Haibach, Marita: Individuen als Spenderinnen und Spender. In: Sozialmarketing als Stakeholder-Management. A. a. O., S. 135.
8 http://www.ciwi.eu/ciwi/de/service/DE-CIWI_Fundraising.pdf
9 ebd.
10http://www.kigst.de/produktflyer/context.pdf
11 Keller, Raphaela: Wann wirken Spendenaufrufe? Der Einfluß von Bildauswahl und Argumentationsstruktur. München: R. Fischer, 2008.
12 Focus, 17. Dezember 2007, http://www.focus.de/finanzen/news/tid-8326/missbrauch_aid_229435.html
13 Burkhard Wilke ebd.
14 Munz, Richard: Im Zentrum der Katastrophe. Was es wirklich bedeutet, vor Ort zu helfen. Frankfurt a. M.: Campus-Verl., 2007.
15http://www.npo-info.de/download/default.asp?id=118
16http://www.npo-info.de/download/default.asp?id=119
17http://www.npo-info.de/download/default.asp?id=118
18 Fundraising Magazin 5/2000, S. 18; http://www.npo-info.de/download/Default.asp?id=21
19http://web.archive.org/web/*/http://www.yahuhn.de
Wie wir uns und andere belügen
Die im vorangegangenen Kapitel gezeigten Sonderfälle veranschaulichen, was da mittlerweile auf dem Trittbrett mitfährt. An ihnen tritt schrill in den Vordergrund, was auch anderswo ein wesentliches Mißverhältnis ist – daß nämlich an der Oberfläche die Situation im jeweiligen Zielland das bestimmende Thema ist, die Initiativen aber permanent die Spender überhöhen und in den Mittelpunkt stellen. Besonders deutlich wird das bei Plakaten, die den Paten oder Spender thematisieren. Hier wird das Spenden zur Erlösungslehre: Vollendet und zufrieden, weil wohltätig, ist man erst, wenn man gezahlt hat. Der Freikauf aus der Unvollkommenheit des Normalbürgers einer Industrienation führt übers Spendenkonto. Hier werden Lebensgefühl und Integrität über das Vehikel einer Marke verkauft, genauso wie in der Werbung für Zigaretten oder für ein bestimmtes Parfüm. Die Affekte des Spenders werden geschürt, bedient und ausgebeutet. „Denken Sie daran, daß Ihr Spender im Mittelpunkt steht, und auch daran, daß die Unterstützung an Sie bei Ihm die Befriedigung eines Bedürfnisses darstellt“ – so unverblümt bewirbt die Firma V & M Service GmbH im Internet eine ihrer Handreichungen.20 „Geizen Sie deshalb nicht mit Wertschätzung und Anerkennung. Und nennen Sie neue, dringende Vorhaben und Anliegen, zu denen Sie aktuell Geld benötigen, im Zusammenhang mit der erhaltenen Spende. Geben Sie ihm ein Dankeschön (Postkarte, Ex Libris, Aufkleber) und setzen Sie ihm ein neues Ziel mit einer neuen Aufgabe für seine Bereitschaft, zu spenden.“ Daß es beim Fundraising um die Erfüllung von Bedürfnissen geht, schreibt auch die frühere hessische Politikerin Marita Haibach, die heute gutes Geld mit Management- und Fundraising-Beratung verdient.21 „Öffnen Sie die Herzen, dann das Denken und dann die Scheckbücher“, bringt sie die Taktik aus den Punkt. „Ermutigen Sie Spender zur Identifikation mit Ihrer Organisation, sodaß sie sich als Beteiligte fühlen.“ Die Bauchpinselei zahlt sich aus: „Persönliche Bitten sind am erfolgreichsten.“
Ausgebeutet werden aber auch die Leprakranken, Blinden, Kinder und viele andere Menschen in den Entwicklungsländern, über die wir den heiligen Schirm unserer Fünfeurospende legen. Nur durch uns werden die Zustände dieser Welt geheilt, nur wir haben Mittel und Möglichkeiten, Menschen ein menschenwürdiges Dasein zu geben – durch unsere Spende. Das zeugt von einer Doppelmoral, weil die Politik und Industrie unserer Heimatländer bis heute an der fortgesetzten Ausbeutung der Menschen in den Armutsländern ganz erheblichen Anteil hat und fast jeder von uns irgendwelche Produkte aus den Sonderwirtschaftszonen der Entwicklungs- und Schwellenländer kauft.
Immer häufiger treten uns Produkte entgegen, die mit dem Hinweis verkauft werden, daß ein bestimmter Anteil des Preises an dieses oder jenes Projekt geht. Die Deutsche Bahn hat auf diese Weise Geld für den Umweltschutz besorgt, die Bitburger Brauerei ließ Bolzplätze renovieren, Procter & Gamble förderte über den Verkauf von Zahncreme ein SOS-Kinderdorf, und Volvic kümmerte sich um Trinkwasser für Äthiopien. Das klingt gut und spricht natürlich sehr für den Kauf des jeweiligen Produkts. Oft wird dadurch jedoch verschleiert, daß viele soziale und ökologische Probleme durch Unternehmen – und zuweilen gerade durch jene, die sich da so ostentativ engagieren – verursacht wurden. Die auf diese Weise erzielten Spenden sind im Vergleich zum Produktumsatz nicht besonders hoch und stehen in vielen Fällen weit hinter den zur Propagierung dieser Aktionen verschleuderten Werbeetats zurück. Gelegentlich erscheint die Kombination aus Produkt und Spendenzweck auch nicht besonders stimmig, abgesehen davon, daß auch hier wieder derjenige, von dem das Geld letztlich kommt, ein fertiges Spendenmodell vorgesetzt bekommt, das er nicht mitgestalten kann. Bei dieser hochkommerziellen Methode des Warenabsatzes steht der Umsatz im Vordergrund; der gute Zweck ist lediglich ein Kaufanreiz, der das Unternehmen nicht viel kostet. Auf diese Weise lassen sich die verschiedensten Mißstände vor den Werbekarren spannen.
Wenn davon die Rede war, daß die Elendsschicksale in der Dritten Welt durch das Spendenwesen ausgebeutet werden, dann ist das sowohl im materiellen als auch moralischen Sinne gemeint. Emotionalisierende Bilder und Botschaften werden als Schlüsselreiz eingesetzt, der Spender spendet, und von der Spende finanziert die Initiative womöglich gerade den Marketing-Unterbau künftiger Aktionen. Die Spende bleibt in diesem Fall bei uns in den reichen Ländern und erlaubt dem Fundraiser Müller, sich seine Lebensmittel zu kaufen. Doch auch wenn sich die Spende wirklich in unmittelbare Unterstützung verwandelt, ändert das nichts an der Tatsache, daß sie durch die Instrumentalisierung von Personen, Bildern und Schicksalen gewonnen wurde. Mit Blick auf die bunte Gruppe der Paten wird hierauf noch genauer einzugehen sein. Die Ausbeutung findet aber noch auf einer weiteren Ebene statt, nämlich in der Vereinnahmung. Vor allem christliche Hilfswerke setzen einen deutlichen Akzent darauf, daß sie den Menschen nicht nur Lebensmittel und Schulbildung geben, sondern den rechten Glauben gleich noch dazu: Was sie verteilen, bringen sie sozusagen von Gott, und bei ihnen lebt sich’s besser, wenn man sich auch dem religiösen Programm unterwirft. Vereinnahmung muß aber nicht immer religiös motiviert sein, es kann auch darum gehen, daß eine Initiative unsere Kultur, unsere Lebensart oder sonstige Tugenden exportiert.
Auf Selbsttäuschung läuft es auch hinaus, wenn das Spenden mit einer inneren Distanziertheit einhergeht. Einerseits will man also zur Behebung von Mißständen beitragen, andererseits will man genau dadurch sicherstellen, daß genau diese Probleme nicht ins eigene Land, an die eigene Haustür kommen. Es ist jedenfalls bezeichnend, daß ein Land wie Österreich, dessen Fremdenrecht nun nicht gerade als besonders liberal angesehen werden kann, traditionell immer wieder auf rekordmäßige Spendenfreudigkeit verweisen kann. Durch die Entrichtung der Spende, die in diesem Sinne eine Art Schutzgeld ist, trägt man zur Absicherung des eigenen Wohlstands bei, denn wenn es dem Menschen in Ghana oder Brasilien dort besser geht, wo er ist, wird er mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf den Gedanken kommen, sein Glück in Europa zu versuchen. Wer von den Rekordspendern würde denn mal eine Stunde lang in einem Asylantenheim mit den dort untergebrachten Menschen reden?
Von der Spende kann allerdings auch die kontraproduktive Signalwirkung ausgehen, daß unser Leben hier besonders üppig sein muß, wenn wir unser Geld an Unbekannte auf der anderen Seite der Welt verschenken können. Schon deshalb ist die Verknüpfung des Spendens mit der Anbahnung eines persönlichen Kontakts als problematisch anzusehen, auch wenn sehr viele Spender damit besonders gute und bereichernde Erfahrungen gemacht haben. Damit geht der Blick weiter zum Bereich der Patenschaft. Kein anderes Segment des organisierten Spendens bietet vergleichbare Möglichkeiten der Täuschung und Selbsttäuschung, der Bauchpinselei und des ausgekosteten Gönnertums. Man kann mit Berechtigung einwenden, daß der persönliche Kontakt für das Patenkind wichtig und für den Paten aufschlußreich ist und somit sehr wichtige Funktionen erfüllt. Trotzdem läßt sich beim Bemühen um freundschaftlichen Kontakt eines niemals überwinden, nämlich die Ungleichheit der Briefpartner, aus der heraus man sich anzufreunden versucht. Die Rollen sind doch für beide Seiten für alle Zeiten festgeschrieben: Der Spender ist reich, kann willkürlich entscheiden, lebt in prinzipiell „besseren“ Verhältnissen. Der Bespendete ist Rechenschaft über seine Fortschritte schuldig, denn er weiß um die Entscheidungsfreiheit seines Spenders. Und weil sich Erfahrungen mit Paten und Spendern nun einmal auch in den Zielländern herumsprechen, liegt es nahe, wenn ein Unterschied zwischen dem wirklichen Leben und dem Spendenverhältnis gemacht wird – ganz abgesehen davon, daß der Spendenempfänger diese „Freundschaft“ nicht freiwillig oder aus Sympathie eingeht, sondern aus seiner materiellen Not heraus. Der Pate aber geht davon aus, daß nicht nur seine Spende willkommen ist, sondern auch er selbst. Er hält die pflichtmäßige Dankbarkeit für die Rückmeldung innerhalb eines zwischenmenschlichen Kontakts, der jedoch so gar nicht existiert. Für den Spendenempfänger muß klarerweise die materielle Besserstellung im Vordergrund stehen, während der Pate seine Nase in die persönlichen Lebensumstände seines Schützlings steckt. Auch das zeugt von einer bemerkenswerten Asymmetrie in diesen Verhältnissen.
Auch die Maßlosigkeit vieler Spender, ihre billig eingekaufte Menschenliebe zur Schau zu tragen, ist von starker Selbsttäuschung geprägt. Wie sehr hierbei das Handeln von dem Wunsch diktiert wird, sich mit möglichst allergeringstem Einsatz seine persönliche Scheibe vom Patenschaftssystem abzuschneiden, läßt sich bei einer Aktion besichtigen, die sich unbekümmert im Internet präsentiert. „Wir sind jetzt dreißig Teilpaten und haben eine Patenschaft beantragt!“ heißt es da. „Am 11. August 2005 hatte ich die Idee, ein vom Tsunami betroffenes Kind über CCF-Kinderhilfswerk zu unterstützen. Da ich mir noch eine Patenschaft momentan leider nicht leisten kann, kam die Idee auf, noch sechsundzwanzig andere Leute zu suchen, die auch einem Kind helfen wollen, und eine Sammelpatenschaft zu übernehmen. Eine Patenschaft würde dann nur noch zwölf Euro pro Jahr kosten. Die Briefe werde ich in Wir-Form verfassen, und wenn ein Teilpate eine Frage an das Patenkind hat, oder etwas schreiben will, kann er mir Textbausteine per Email schicken. So ist einem Kind geholfen und ein Euro pro Monat ist ja wirklich entbehrlich.“ Das muß man sich einmal vorstellen: Da wird dieses arme Kind, das ja durch das Tsunami-Schicksal schon genug geschädigt ist, von dreißig geltungsbedürftigen Spendern angesprungen, die nicht nur bei einem Euro pro Monat die Grenze ihrer Wohltätigkeitsbereitschaft ziehen, sondern für diesen für jemanden aus unserem Teil der Welt erbärmlichen Beitrag ganz selbstverständlich auf dieses Schicksal zugreifen. Durch diese Zahlung fühlen sich die „Teilpaten“ berechtigt, die Lebensgeschichte von Shashikala im Internet breitzuwalzen.
Und das liest sich dann so: „Unser Patenkind ist Shashikala aus Sri Lanka geworden. Sie lebt an der Küste Sri Lankas in Hambantota, einem der Gebiete, die besonders stark von der Flutwelle getroffen wurden. Viele Menschen haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren und müssen sich nun mühsam wieder alles aufbauen. Shashikala lebt mit ihren Eltern, einem Bruder und ihrer Großmutter in einem notdürftig eingerichteten gemauerten Häuschen mit einem Zementboden, ohne jeglichen Wohnkomfort. Shashikalas Mutter ist arbeitslos und kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Der Vater arbeietet als Hilfsarbeiter. Die Arbeit ist unregelmäßig und der Lohn sehr gering. Damit ist es ihm nicht möglich, aus eigener Kraft für eine gesunde Ernährung, die medizinische Versorgung und die spätere Ausbildung von Shashikala aufzukommen. Shashikala geht in die Schule. Sie ist in der dritten Klasse. Sie singt und malt sehr gern und spielt gerne verschiedene Ballspiele. Auf dem Foto rechts sind Shashikalas Oma, ihr Bruder Supun Chamara, ihre Mutter und sie selbst zu sehen.“
Da blättert sich wieder der ganze Katalog der gängigen Klischees auf: Arbeitslosigkeit, Unsauberkeit, völliges Fehlen irgendwelcher angenehmer Dinge, als gäbe es dort nie einen Moment der Freude. Nein, die Spendenempfänger hausen immer in elenden Löchern, sind immer ungewaschen und lachen zum ersten Mal in ihrem Leben, wenn endlich die Spende aus Deutschland da ist. Nicht daß die Unterstützung nicht nötig wäre, sie ist es ganz bestimmt. Aber die Märchenromantik, mit der sich dreißig Teilpaten als Retter aufspielen, ist pure Selbstüberhöhung. Und so wird dann auch lang und breit über das Kinderhilfswerk und seine Arbeit schwadroniert. „Unter der Rubrik ‚Ich werde Pate‘ haben Sie dreiundzwanzig Länder zur Auswahl, aus denen Ihnen ein Patenkind vermittelt werden kann“, schreibt das Hilfswerk auf seiner Internetseite. „Sie brauchen nur noch Ihr Wunschland anzuklicken.“22 Der Club der dreißig Weltretter dokumentiert die Fortschritte seiner Arbeit in „Jahresberichten“. Manche Teilpaten gehen noch etwas weiter, im Internet sind unter Überschriften wie „Meine Patenkinder“ zuweilen ganze Listen zu finden. Oder Passagen wie diese hier:
„Auf den folgenden Seiten stelle ich meine Patenkinder vor und berichte über ihre Entwicklung. … Zum Schutz der Kinder und aus Respekt vor den Familien habe ich mich entschlossen, die Seiten über meine Patenkinder durch ein Paßwort zu schützen. Ich freue mich jedoch sehr über Interesse an der Entwicklung meiner Patenkinder und werde jedem, der ein begründetes Interesse angibt, den Zugang gewähren. Bitte füllt dazu das untenstehende Formular aus und schreibt gleichzeitig eine Email, in der ihr den Grund angebt, warum ihr Zugang haben möchtet.“ Wer entscheidet also über den Zugang zu Informationen bei „begründetem Interesse“? Weder Hung aus Vietnam noch Eunice aus Kenia, sondern die Patenmutter, die sich für einen Euro im Monat das Recht nimmt, Shashikalas Geschichte im Internet zu verbreiten oder durch ein Paßwort zu schützen. Hierbei ist besonders bemerkenswert, wie lässig man den Spendenempfängern das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung abspricht.
Auch die Initiativen sind mit der Vereinnahmung von Schicksalen nicht zimperlich. Die deutschen Betreiber eines privaten Kinderheims in Rumänien schreiben auf ihrer Internetseite zu den Namen und Bildern ihrer Schützlinge und voller Adreßangabe Kurzprofile dieser Art:
… Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter ist sehr krank. Wir wurden von Nachbarn der Familie und der Polizei angesprochen und haben die Kinder 2001 bei uns aufgenommen …
… Die Eltern sind Alkoholiker, beide arbeitslos …
… Der Vater ist schwerer Alkoholiker und es kam immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen. Er schlug seine Frau sowie seine drei Kinder. Die Mutter hielt diesem Zustand psychisch nicht stand und erhängte sich …
… Das Haus besteht aus zwei heruntergekommenen Zimmern. Der Vater arbeitet nur ab und zu. Nachdem auch der Großvater und der Bruder des Vaters zu ihnen ziehen, werden wir von Nachbarn angesprochen …
… Beide haben wir aufgenommen, nachdem ein erschreckender Fernsehbericht über sie ausgestrahlt wurde. Die beiden Mädchen lagen mit starken Verbrennungen am ganzen Körper in einem Krankenhaus in … . Sie wurden täglich von der Mutter mit einem Seil verprügelt und mit einem heißen Bügeleisen verbrannt. Bei … hat sie versucht, ihr die Nase abzuschneiden. Die Mädchen bekamen nichts zu essen, wurden im Haus eingesperrt und wurden nicht gewaschen, so daß sie voll mit Flöhen waren. Der Großvater hat sie bedrängt …
… Sie ist etwas zurückgeblieben, und wird daher wohl auch bei uns bleiben …
… Beide Eltern sind Alkoholiker und ließen die Kinder den ganzen Tag allein, ohne Nahrung …
… Der Vater ist Alkoholiker und hat versucht, sie zu mißhandeln. Die Eltern haben sich scheiden lassen …
Beim ersten persönlichen Besuch konnte man dann auch noch erfahren, welcher Junge von seinem Vater vergewaltigt worden ist. Die Plakativität der Schicksalsberichte geht in diesem Fall weit über das hinaus, was über die Arbeit der Initiative mitzuteilen ist. Sie macht die Kinder zum Anschauungsmaterial eines Spendenvoyeurismus, der jede Unbefangenheit der Bekanntschaft verunmöglicht und den Menschen ihr möglicherweise grundlegendstes Persönlichkeitsrecht nimmt – das Recht nämlich, über die Verbreitung der eigenen Schicksalsgeschichte selbst zu entscheiden. Und dazu paßt es dann auch, wenn Paten plötzlich mitüberlegen, ob es richtig ist, daß ein dreizehn- oder vierzehnjähriges Mädchen, das in diesem Heim lebt, einen Freund hat und mit ihm schläft. Zweifellos hat die Heimleitung in diesem Fall eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht, zweifellos hat ein Kinderheim nicht zuletzt erzieherische Funktion. Heimleitung und Erzieher werden deshalb mit aller Berechtigung Regeln aufstellen und ihre Nichtbefolgung sanktionieren. Das ist Teil der von ihnen übernommenen Verantwortung und gehört deshalb zu ihren zentralen Aufgaben. Es ist aber keineswegs Sache der Spender und Paten.
20http://www.npo-info.de/download/Default.asp?id=15
21 Haibach, Marita: Individuen als Spenderinnen und Spender. A. a. O., S. 133.
22http://www.ccf-kinderhilfswerk.de/haeufigefragen.html
Das Innenleben des Turbospenders
Es gibt eine weitverbreitete Spielart des Spendens, in deren Umsetzung sich oft genau das beobachten läßt, was man unter „histrionischer Persönlichkeitsstörung“ versteht. So ist in einer Online-Enzyklopädie23 zu lesen: „Charakteristisch für Histrioniker ist der Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen. Betroffene sind meistens extravertiert, sozial ungezwungen und kontaktfreudig, haben aber nicht selten auch einen Hang zur Aggressivität. In Streßsituationen reagieren sie oft mit Schuldabwehr und Selbstbemitleidung, aber auch mit aggressivem Verhalten. Nicht selten suchen sie in derartigen Situationen zudem nach Selbstbestätigung und zeigen deutlich ein Bedürfnis nach sozialer Unterstützung. Das Selbstwertgefühl ist eher schwach ausgeprägt. Sie können die eigene Bedeutung nur schlecht einschätzen, haben dafür aber ein sehr ausgeprägtes Gespür, wie andere auf ihr Auftreten reagieren. Entsprechend wichtig ist für Histrioniker die Bestätigung durch das Umfeld. Um diese Bestätigung zu erreichen, neigen sie zur exzessiven, oft theatralischen Selbstdarstellung. Histrioniker sind extrem suggestibel. Leicht werden sie durch andere beeinflußt, wobei sie meist nach Übereinstimmung streben und Positionen des Gegenüber übernehmen. Gleichermaßen findet eine Anpassung an das jeweilige Umfeld statt, wobei sich die Persönlichkeit deutlich ändern kann. Die Betroffenen sind sehr leicht zu hypnotisieren und fallen gelegentlich auch allein in Trance. Sie suchen ständig nach Neuem und nach Stimulation. Dadurch können sie sich leicht in gefährliche Situationen begeben. Sie können schnell enthusiastisch Interesse an etwas gewinnen und es ebenso schnell wieder verlieren. Auch sprachlich wechseln sie das Thema wie ein Grashüpfer. Ihr Sprachstil ist dabei oberflächlich, detailarm und zuweilen impressionistisch.“
Ohne auf die Befunde eines Facharztes vorzugreifen, kann man leicht erkennen, wie magnetgleich solche Spender und das ihnen gemäße Wirkungsfeld zusammenfinden. Man braucht dafür nur einige Ausflüge in die bunte Welt der Interessengruppen im Internet zu unternehmen, wie sie sich beispielsweise bei www.yahoogroups.de und anderswo überreichlich tummeln, oder in die Niederungen des Kleinvereinswesens. Immerhin wird die „Bewältigung von Lebenskrisen und aktuellen Problemlagen“ auch von der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestags (2002) zu den drei zentralen Motivstrukturen für freiwilliges Engagement gezählt.24 Man kann leicht den Eindruck gewinnen, die obige Beschreibung habe überhaupt den Prototypen des Retters rumänischer Streunerhunde zum Thema und nicht den Träger eines seelischen Krankheitsbilds. Selbstdarstellung vor einem zustimmenden Umfeld, die Suche nach Aktionsfeldern und Stimulation, die starke Tendenz zu Schuldabwehr und Aggression – all das paßt perfekt zu aktionistischen Mikro-Initiativen, deren größtes Problem wahrscheinlich darin liegt, daß sie keine Supervision in Anspruch nehmen können und durch ihre gefährliche Eigendynamik oft mehr zerstören als aufbauen. Ihr Wirkungsfeld ist nur das Instrument für das Ausleben ihrer Persönlichkeitsstörung. Wer auf diese Menschen und Aktionsgruppen trifft, läßt sich mitunter von dem herrschenden Macht- und Kampfklima beeindrucken, solange er nicht weiß, daß der Grund all dieser atmosphärischen Widrigkeiten allein im psychischen Zustand der Hauptakteure zu finden ist. Die Hilfsinitiative dieses Zuschnitts ist ein Patientenkollektiv, aber leider keine Selbsthilfegruppe, denn die seelischen Defizite und Störungen werden nicht bearbeitet, sondern voll ausgelebt.
Als ich Michaela Kugler25 kennenlernte, hatte ich keinen schlechten Eindruck. Mir fiel lediglich auf, daß sie im Winter nur Sandalen, aber keine Socken trug. Sie engagierte sich extrem für rumänische Straßenhunde und war sowohl motiviert als auch interessiert, wenn es um rumänische Heimkinder ging. Ihre Mikroinitiative holte regelmäßig Tiere von Rumäniens Straßen, um ihnen in Deutschland ein besseres Leben bei netten Leuten zu ermöglichen; sie führte im Internet eine genaue Abrechnung über die Verwendung der an sie gerichteten Spenden, sie sorgte für systematische Impfungen und ausreichend Lebensmittel für die Tiere. Wenn man ihr schrieb, daß man möglicherweise eine Katze aufnehmen könnte, dann schickte sie eine Bekannte, die sich persönlich davon überzeugte, mit welchen Lebensumständen diese Katze dann konfrontiert sein würde. Professionelle Tierschutzvereine könnten sich davon eine Scheibe abschneiden. Fuhr Michaela nach Rumänien, konnte man ihr Spenden mitgeben. Der Kontakt zu ihr war unauffällig, bis ich Kenntnis von den unsäglichen Streitereien unter Hundeschützern bekam, die ihren Weg pflasterten. Als Michaela wußte, daß ich Journalist bin, drehte sie mir von sich aus sechs dicke Aktenordner mit Unterlagen ihres inzwischen stillgelegten Tierschutzvereins an, um mich dadurch zu Enthüllungsreportagen über ihren damaligen Widerpart zu bewegen, der – wie sie, aber vielleicht etwas professioneller – mit einer eigenen Straßenhundeinitiative weitergemacht hat. Ihr Vorwurf war das klassische Killerargument gegen Initiativen: Veruntreuung von Geldern, Selbstfinanzierung durch Spenden, private Nutznießerei. In Situationen wie diesen konnte man ahnen, wie sehr dieses Argument zum Diskreditierungsmittel der Initiativen untereinander verkommen ist.