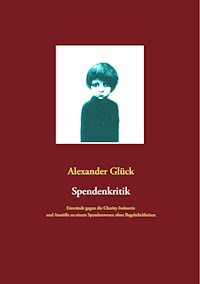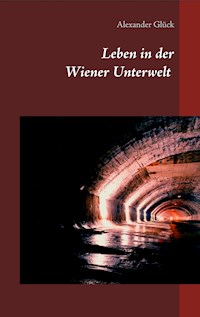Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die in diesem Buch zusammengestellten Gedanken können dreierlei bewirken: Sie können die Reflexion des Lesers über seine Sprache anregen. Sie können Aspekte und Widersprüche des heutigen Sprachgebrauchs und Sprachdesigns aufdecken und dadurch zeigen, warum bestimmte Neuerungen ihrem angeblichen Sinn und Nutzen zuwiderlaufen. Und sie können dem Leser die Sicherheit geben, daß er selbst durch seinen eigenen Sprachgebrauch anstelle seiner Unterwerfung unter immer neue Reglementierungen an der Gestaltung seiner und unserer Sprache mitwirken kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor dankt der
Theo-Münch-Stiftung für die Deutsche Sprache
für die freundliche Unterstützung.
Der Malerin
Katja Mischke
herzlich zugeeignet
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wer seine Sprache abschafft, hat nichts mehr zu sagen
Ist die deutsche Sprache noch zu retten?
Läuft vorschreibende Sprachpflege ins Leere?
Die Abschaffung des Lektorats
Deutsche Stilkunst in überragender Neuausgabe
Wer die Sprache bestimmt, regelt das Denken
Ausstrahlungen der Jägersprache
Im Endeffekt halt eben nicht wirklich!
Beweglicher denn je – Sprache der Jugend
NS-Jargon und Wörterhygiene
Die Inflation der Nazis und die Sprache der Gewalt
Anhang: Gegen das Gendern. Vierzig Argumente
Vorwort
Als Grundschüler entschied ich mich in den siebziger Jahren sehr bewußt, die schon damals etwas altmodischen ph-Schreibweisen in Wörtern wie Elephant, Telephon usw. zu verwenden, und ich verwende sie noch immer. Es war die Zeit, als diese juvenilen, barttragenden Referendare aus dem Gefolge der Achtundsechziger-Bewegung die Bildungseinrichtungen zu überschwemmen begannen, in meinen späteren Schuljahren hatten wir immer jemanden in dieser Art. Wir mochten sie und bemerkten nicht, daß ihre gesellschaftspolitischen Intentionen weit über den Schulstoff hinausgingen. Die Lesebücher enthielten zu einem guten Teil Grotesk-Schriften ohne jede Zier, weil Schulbuchpädagogen glaubten, uns damit das Lesenlernen leichter zu machen. Ich kann mich nicht erinnern, daß mir die deutlich gefälligeren Druck- und die Schreibschriften besondere Schwierigkeiten bereitet hätten, und mir ist auch nie aufgefallen, daß irgendein anderes Schulkind hierdurch besonders frustriert worden wäre.
Im theoretischen Bereich des Faches Deutsch, in dem wir bald darauf – im Kontrast zu all dem Erleichterungsgetue – mit Fachwörtern wie „Partikel“, „Präposition“, „adverbiale Bestimmung“ und weiteren mehr traktiert wurden, war ich schlecht, weil diese Wörter keinen bildhaften Begriff von den Dingen gaben, die sie bezeichneten. Aber ich schrieb sehr gefällige Aufsätze, hatte ein gesundes und verläßliches Sprachgefühl und eine Phantasie, die mir auch ein „Thema verfehlt!“ eintragen konnte.
Jahre später nagte sich das Gespenst der Rechtschreibreform durch das Bildungswesen. Mein Urgroßvater, der Germanist Dr. Hermann Jantzen, setzte die alte Rechtschreibreform zu Beginn des 20. Jahrhunderts direkt um, vielleicht nur aus der Staatsgläubigkeit des Beamten heraus, aber ich hätte es gerne ebenfalls getan, wenn sie durchdacht wäre und wenn man sie auf legitime Weise eingeführt hätte und ohne dafür die Einheitlichkeit der Rechtschreibung zu opfern. Also bewege ich mich weiterhin in dem orthographischen System, das bestens funktioniert, das ich verinnerlicht habe und das mir vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Als thematisch mit Abstand vielseitigster Sachbuchautor im deutschen Sprachraum möchte ich damit auch zeigen, daß man das so machen kann, wenn man es richtig findet, statt vor den Anweisungen tonangebender Personen (mit zahlreich festgestellten falschen Doktortiteln) zu kuschen, wie es gerade wir Deutschen so gerne tun. Das ist nicht nötig, nicht richtig und nicht sinnvoll.
Die tausenderlei guten Argumente, die gegen den Reformpfusch anzuführen sind, kann man anderswo lesen. Dabei geht es hauptsächlich um die Zumutung, daß viele der Reform- oder Kompromißregelungen Fehler in ein Gefüge bringen, das ohne diese Veränderungen differenziert und in sich fast völlig richtig ist. Ja, es gibt wenig sinnvolle Spitzfindigkeiten, aber sie lassen sich glätten. Die zweite oft beklagte Zumutung liegt in der Zerstörung der Einheitlichkeit unserer Rechtschreibung. Diesen beiden Aspekten stehen die weiteren Gründe meiner Ablehnung nicht wesentlich nach: Als ehemaliger Schüler einer vom Hessischen Kultusministerium beaufsichtigten Grundschule nehme ich für mich aus Prinzip in Anspruch, mit einer Rechtschreibung ausgestattet worden zu sein, die kein Ablaufdatum hat. Es ist also nicht meine Angelegenheit, irgendwelche willkürlichen Umstellungen mitzutragen oder hierfür irgendwelche Mittel aufzubringen. Ich habe den erfolgreichen Abschluß meiner Schulbildung schriftlich, und zu ihr gehört (zumindest theoretisch), daß man lesen und schreiben kann. Außerdem laufen diese Regelungen in gröbster Weise meinem Sprachgefühl zuwider, und hier kommen wir ganz schnell von der geschriebenen zur gesprochenen Sprache.
Manche Bestimmungen der Rechtschreibreform haben zu Übergeneralisierungen verleitet, neue Konsonantenregeln können ebenso zu Veränderungen der Aussprache führen wie synthetische Herleitungen. Wörter wie „selbstständig“ wirken ebenfalls auf die Aussprache ein. Amtlich eingeführte, jedoch falsche Volksetymologien, die zu wortgeschichtlich falschen Schreibweisen wie Tollpatsch geführt haben, stellen eine Beleidigung für alle Sprachbenutzer (nicht zuletzt aber auch für ungarische Infanteristen) dar. Es ist kein gewachsener Wandel, sondern künstliche Veränderung im Verordnungsweg. Das besonders Perverse ist dabei, daß man diese wirklichkeitsfremden Kopfgeburten über die Schulen in die Gesellschaft gepreßt hat – mit verheerenden Folgen für die Rechtschreibleistungen der Schulkinder. Ja, man hat in den Schulen Dinge unterrichtet, die es in der Wirklichkeit nicht gab. Und man hat nicht gemerkt, daß man sich damit in eine üble Tradition gestellt hat.
Das hat also unmittelbare Auswirkungen auf die Sprache. Nach den jahrelangen Drangsalierungen mit diesem Reformunsinn, der für sich genommen bereits folgenreich ist, kommen von verschiedenen Seiten weitere Eingriffe und Änderungsversuche: Das Niveau unserer Alltagssprache wird aktiv heruntergefahren, sie wird immer schneller mit Anglizismen durchsetzt und nun durch vorgeblich „geschlechtergerechte“ Formen traktiert. Dabei ist es im Augenblick ohne Belang, wie gut oder schlecht, wie gerecht, sinnvoll, überflüssig oder unangebracht diese Neuerungen sind. Ihre inhaltliche Bewertung ist zwar wichtig, gerade auch hinsichtlich ihrer Präzision bei der Verwendung in Gesetzen, Verordnungen oder Verträgen. Für den Moment geht es jedoch ausschließlich um die Folgen dieser Veränderungen für die Integrität unserer Sprache.
Wenn nämlich bestimmte neue Formen eingesetzt werden, erfolgt dadurch auch eine Bedeutungsverschiebung der bisherigen: Wenn jetzt ein Wörterbuchverlag in seiner Online-Ausgabe „Mieter“ im Widerspruch zur sprachlichen Wirklichkeit präskriptiv als biologisch männlich definiert, dann beeinflußt das gravierend den Bedeutungsgehalt dieses Wortes in früheren Zeiten. Dadurch wird das Verständnis historischer Quellen manipuliert. Mir geht es bei der Reflexion über die Sprache um diese subtile Deformierung und ihre Folgen: Die Art und Weise, wie wir die Sprache verwenden, steht in direkter Beziehung zu unserem Denken und zu unserer Kommunikation miteinander. Wenn die Sprache ihre Komplexität verliert, dann werden auch das Denken und der sprachliche Austausch simpler. Und es geht mir um die Frage, ob hinter diesem Sprachumbau nicht ganz andere Interessen stehen als die vorgeblichen. In welche Richtung entwickelt sich das weiter? Wer steht dahinter, was wird damit bezweckt?
Sicher kam Ihnen meine oben geschilderte Einstellung über die Verläßlichkeit von Grundschulbildung als Übertreibung und Prinzipienreiterei vor. Da stimme ich Ihnen zu, verweise aber auch darauf, daß ich selbst zu bestimmen habe, was mich anficht und was nicht. Darüber hinaus geht es aber doch noch um etwas mehr, und das hat etwas mit dem seit einigen Jahren rasant zunehmenden Realitätsverlust der Deutschen zu tun: Eigentlich sollte doch die wirkliche Sprache deskriptiv verzeichnet und den Kindern als Bildung mitgegeben werden, nicht eine Kunstsprache, die dadurch, daß man sie lehrt, zur Wirklichkeit gemacht werden soll. Und die Sache ist dann auch ein Lehrstück über deutschen Untertanengeist: Hätte sich niemand an die Reformregeln gehalten, wäre die Sache längst vom Tisch. Sprachveränderungen können nur greifen, weil genügend Leute mitmachen. Tatsächlich ist dies auch in der Gemeinschaft der Deutschsprechenden (ungefähr 100 Millionen Menschen) der Fall. Viele tragen diese Veränderungen jedoch nicht aufgrund ihrer tiefen Einsicht in den klugen Ratschluß der Sprachdesigner mit, sondern bestenfalls, weil sie für simple, plakative Begründungen empfänglich sind oder weil sie modern erscheinen wollen oder weil sie glauben, sie müßten mitmachen und hätten andernfalls Nachteile. Sie mögen das gut finden, wenn sie wollen. Ich finde es erbärmlich.
Die in diesem Buch zusammengestellten Gedanken können dreierlei bewirken: Sie können die Reflexion des Lesers über seine Sprache anregen. Sie können Aspekte und Widersprüche des heutigen Sprachgebrauchs und Sprachdesigns aufdecken und dadurch zeigen, warum bestimmte Neuerungen ihrem angeblichen Sinn und Nutzen zuwiderlaufen. Und sie können dem Leser die Sicherheit geben, daß er selbst durch seinen eigenen Sprachgebrauch anstelle seiner Unterwerfung unter immer neue Reglementierungen an der Gestaltung seiner und unserer Sprache mitwirken kann.
Der Verfasser
EINLEITUNG
Wer seine Sprache abschafft, hat nichts mehr zu sagen
ODER: WIE WIR UNSERE WERKZEUGKÄSTEN VERLIEREN
Eines der beiden großen Probleme der Kernkraft liegt neben den kaum zu bändigenden Betriebsgefahren in der Wegschaffung des anfallenden Atommülls. Man gräbt ihn ein – im Vertrauen darauf, daß nichts davon wieder zum Vorschein tritt, solange man selbst auf Erden weilt. Etwas klügere Menschen beziehen in diese Sorge auch die künftigen Generationen ein, aber der Horizont unseres Blickes ist sehr eng. Ungefähr hundert Jahre reicht der Blick in die Geschichte, dahinter wird das Auge trüb.
Das hat mit Sprache und vor allem mit Sprachwandel sehr viel mehr zu tun, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Mit fällt immer wieder ein, was einst ein Professor an der Universität Mainz dazu gesagt hat: Wenn man diesen Atommüll eingräbt, den Zugang verschließt und schließlich ein Schild davor stellt: „Achtung, Atommüll! Gefahr!“, dann wird dieser Hinweis für die Menschen so sein wie für uns das Althochdeutsche. Wahrscheinlich werden die Menschen durch keine Bedenken davon abgehalten werden, diese Räume zu betreten. In den kommenden tausend bis zweihunderttausend Jahren bleibt das allerdings gefährlich.
Das Warnschild kann nicht funktionieren, weil sich die Sprache laufend verändert, im Groben wie im Feinen. Hieß es in einem medizinischen Buch aus dem 16. Jahrhundert, jemand habe „eyn blödes gesycht“, so war damit ein schwaches Sehvermögen gemeint. Wörter und Ausdrücke haben sich in ihrem Bedeutungsgehalt verändert. „Hochachtungsvoll“ war früher ernstgemeint, heute hat es einen beleidigenden Beiklang. Es gibt zahllose Beispiele für diesen lebendigen Wandel, für das Untergehen nicht mehr notwendiger Wörter und für das Entstehen neuer. Das kann man auskosten und auch erforschen, beides setzt aber ein gewisses Mindestmaß an Kenntnissen und eine vorsichtige, unvoreingenommene Beschäftigung mit der Sprache voraus, beflügelt von der Neugier und von der Bereitschaft, sich überraschen zu lassen.
Der orthodoxe Sprachwahrer hat wahrscheinlich nur unter seinesgleichen Freunde. Bebrillte Schulmänner, die den Kindern einst einbläuten, man solle „Gesichtserker“ statt „Nase“ und „Backstein“ statt „Ziegel“ sagen, haben der Erhaltung unserer Sprache womöglich mehr geschadet als genützt, weil ihre Art der Sprachpflege starrsinnig statt überlegt und ihre Absichten von der Überbewertung der eigenen Kultur bestimmt waren. Das stand auch in einem politischen Zusammenhang. Diese Leute haben mit ihrer Pedanterie vielen jungen Menschen die Einsicht in die Notwendigkeit eines achtsamen Umgangs mit der Sprache verbaut und ihnen die Liebe zur eigenen Sprache versalzen. Die heutige Sprachpflege hat es zuweilen schwer, sich von diesem Erbe abzuheben und abzugrenzen. Dabei ist das Anliegen, auf den Zustand der Sprache zu achten, heute wichtiger als früher. Der einstige Einfluß des Französischen, damals auch und gerade aus politischen Gründen bekämpft, erwies sich als Bagatelle: Es sind noch ein paar ganz adrette Wörter dageblieben, sie zeugen von der Tatsache, daß man sich von seinen kulturverliebten Nachbarn gerne eine Scheibe abgeschnitten hat. Die Deutschen haben Wörter aus etlichen europäischen Sprachen geholt, weil es Zeiten gab, in denen sie diese anderen Länder als beispielgebend angesehen haben. Ob das von Selbstbewußtsein oder einem Minderwertigkeitsgefühl zeugt, sei dahingestellt, aber es ist ein Teil der Sprachgeschichte. Und die fiel in anderen Ländern durchaus saugfähiger aus: Das Rumänische ist randvoll mit Begriffen aus fremden Sprachen, meistens den Sprachen fremder Eliten, seine Basis ist ein dermaßen simplifiziertes Latein, daß es jeden Italiener graust, wenn er Rumänisch hört. Dagegen hat sich Deutsch sehr lange sehr intakt erhalten.
Inzwischen geht es aber ans Eingemachte. Nach mehreren Jahrzehnten, in denen die deutsche Sprache mit immer neuen englischen Wörtern sturmreif geschossen wurde, demontiert man derzeit sehr engagiert ihre innere Struktur. Die Zwangsbeglückung mit „geschlechtergerechten“ Mehrfachnennungen, die sich wie eine anale Zwangsfixierung durch die Institutionen, Redaktionen, Fernseh- und Hörfunksender, Ämter und Stadtverwaltungen, Bundesbehörden und Parteien frißt, hat mit Gleichberechtigung und Frauenanliegen weitaus weniger zu tun als mit der Absicht, eine Sprachgemeinschaft sprachlos zu machen. Sie ist nichts anderes als die Abrißbirne einer Kulturrevolution, eines Bildersturms, dessen Ziel die Zertrümmerung sämtlicher bürgerlicher Koordinaten ist.
Aus diesem Grund ist Gendersprache keine Kleinigkeit, sondern hochgefähr-lich: Sie wird die Besitzer und Benutzer der deutschen Sprache zu einem gesichts- und identitätslosen Heer von Stammlern machen. Der Stammler kann seine Wünsche und Ansichten nicht mehr ausdrücken. Mit ihm braucht man sich nicht mehr argumentativ auseinanderzusetzen – wenn er nicht macht, was er machen soll, haut man ihm einfach eine rein.
Sie mögen finden, dies sei eine Übertreibung, und natürlich ist es das auch. Übertreibung dient der Veranschaulichung, die Sprache stellt die Mittel dafür bereit. Jede Verringerung der Präzision des sprachlichen Ausdrucks bedeutet eine Schwächung dieser Mittel und Werkzeuge. Keineswegs steckt dahinter nur der Plan jener finsteren Mächte, die so gerne bemüht werden, wenn sich die Dinge verschlechtern. Ein großer Teil des Niedergangs unserer Sprache geht auf das Konto von Menschen, die sich nicht für ihre Möglichkeiten interessieren und die sich nicht die Mühe machen, ihre Gedanken und Anliegen richtig zu formulieren. Als ich vor einiger Zeit einige Akten der Tramwaybetriebskommission von Biel aus der Zeit der Jahrhundertwende zu transkribieren hatte, fiel mir auf, daß man damals einen Unterschied machte zwischen dem Herrn Stauffer und den Herren Stauffer und Gammenthaler. Einmal Herrn und einmal Herren: So genau hat man sich früher im Schriftdeutsch ausgedrückt. Heute ist bei durchschnittlichen Grundschullehrern die Tatsache vollkommen unbekannt, daß es im Dativ Singular „den Papageien“ heißt und nicht „den Papagei“.
Dieser Verfall der Sprache beschleunigt sich gegenwärtig, er war aber schon vor zwanzig Jahren zu beobachten. Zur damaligen Zeit bestand die wichtigste Gefährdung noch im viel zu häufigen Gebrauch von Anglizismen – sehr oft dort, wo es überhaupt keinen Grund dafür gibt.
Beispiele lassen sich überall aus dem Leben pflücken. Die Neueröffnung eines großen Kaufhauses in Wien nahmen dessen Betreiber seinerzeit zum Anlaß, gleich ein paar weitere Schritte auf dem Weg zur neuen Sprachkultur zu erledigen. Dann war auf den Rolltreppen-Wegweisern die Rede von Kids, Coordinates und manchem trendigen Begriff mehr, und nur noch vereinzelt tauchen Wörter auf, die tatsächlich aus unserer Mutter- und hiesigen Amtssprache stammen. Auch der Österreichische Rundfunk bedient sich durchgehend des Begriffes von den Kids, obwohl er Marktstrategien eigentlich weniger nötig hat als ein Kaufhausbetreiber. Es ist überhaupt nicht erwiesen, daß der stramme Gebrauch englisch klingender Begriffe Marktvorteile bringt. Der Grund dafür muß woanders liegen – wie viele andere vermute auch ich ihn in der Wirkung, die er auf den Verwender (nicht den Adressaten!) hat. Man wählt die Wörter, denen man eine bestimmte Wirkung zuschreibt, ohne daß erwiesen sein muß, daß sie diese Wirkung tatsächlich haben.
Was dabei herauskommt, wenn Kinder und Jugendliche in einer ohnehin reizüberfluteten Welt genau zu der Zeit, in der sich Sprachgefühl und Sprachstil bilden, mit dieser Art von Trendsprache konfrontiert werden, kann man inzwischen besichtigen: Die Bildung von Jugendsprache setzt ja die Kenntnis jener Erwachsenensprache voraus, von der man sich abgrenzen will. Da es hier aber bereits zu schweren Defekten gekommen ist, kann auch bei der Jugendsprache nicht viel anderes herauskommen als ein unverständliches Gemisch aufgeschnappter Begriffe aus Szene- und Randgruppensprachen, verpreßt in mutwillig zerstörtem Satzbau und einer Grammatik, die an Debilität erinnert. Anders gesagt: Weite Teile der nachwachsenden Generation sind überhaupt nicht mehr in der Lage, eine funktionierende Jugendsprache zu etablieren!
Vorboten dieser Entwicklung waren Leute wie Jil Sander, die sich aus ihrer dumpf-deutschen Provinizialität heraus mit dem Nachäffen englischer Versatzstücke als Weltbürger ausgaben: „Mein Leben ist eine giving-story. Ich habe verstanden, daß man contemporary sein muß, das future-Denken haben muß. Meine Idee war, die handtailored Geschichte mit neuen Technologien zu verbinden. Und für den Erfolg war mein coordinated concept entscheidend, die Idee, daß man viele Teile einer collection miteinander combinen kann. Aber die audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewußte Mensch von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitäten mit spirit auch appreciaten. Allerdings geht unser voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladysches will, searcht nicht bei Jil Sander. Man muß Sinn haben für das effortless, das magic meines Stils.“
Sicher haben Sie in diesem Müllberg an schlechter Sprache den falschen Gebrauch des Wortes „Technologie“ übersehen. Es taucht meistens da auf, wo eigentlich von Technik die Rede ist. Leute wie Jil Sander denken bereits englisch und wählen den dort durchaus passenden Begriff „technology“ (Technik), übersetzen ihn aber falsch. Versuchen Sie einmal, das mit irgend jemandem in einer Zeitschriftenredaktion zu besprechen – Sie werden wahrscheinlich auf stupides Unverständnis treffen.
Wenn sich in diesen Zitaten englische Wörter in auffälliger Menge finden, soll damit nicht Position gegen die englische Sprache bezogen werden. Im Gegenteil: Daß es in Österreich englischsprachige Kinos und englischsprachiges Radioprogramm gibt, ist eine Wohltat für all jene, die sich von der fürchterlichen Mischung aus schlechtem Englisch und noch schlechterem Deutsch, das ihnen täglich vorgesetzt wird, erholen möchten. Etwa von Wörtern aus der Textilbranche: „Basics“, „Classics“, „Casual Wear“ oder – als besonderes Beispiel – „Ausstatter-Socks“, womit Strümpfe (englisch: stockings) gemeint sein sollen. Im Fernsehen laufen amerikanische Spielfilme, die sich in der jeweiligen Originalfassung zuweilen durchaus gehobenen englischen Sprachwitzes bedienen, jedoch in einer hochtourigen Synchronisationsmaschine gedankenlos mit jenem miesen Dummdeutsch verkleistert wurden, das sich durch alle Seifenopern und kommerziellen Serien zieht und von dort aus immer weiter in die Gesellschaft ausgreift. Die Alternative zu Englisch ist also offenbar schlechtes Deutsch, doch in der Regel greift man auf der Suche nach flottem „Neudeutsch“ gerne zu Englischem.
Das Gegenteil von „Neudeutsch“, einem Begriff, dessen aufgesetzte Ironie zutiefst zynisch ist, weil er dem Wandel des Deutschen zum Mist einen Namen gibt, ist „altdeutsch“ – damit bezeichnet man landläufig die gebrochenen Schriften, Fraktur und ähnliches. Eigentlich wären diese Schriften als „deutsch“ zu bezeichnen, da sich jedoch seit dem Frakturverbot durch Adolf Hitler jede Menge Deutsche der lateinischen Schriften bedienen, sieht man diese inzwischen als deutsch an. Das ist die normative Kraft des Faktischen, aber geschichtlich korrekt ist die vorangegangene Unterscheidung.
„Deutschland schafft sich ab“, so heißt ein fakten- und zahlenreiches Buch von Thilo Sarrazin, dessen Prognosen inzwischen durch die Wirklichkeit deutlich übertroffen worden sind. Die Deutschen schaffen gleichzeitig ihre Basisausstattung ab: Es gibt schon lange keine deutsche Mode mehr, keine deutsche Schrift, der Begriff „deutsches Volk“ gilt als unbotmäßig, die Staatsangehörigkeit wurde von der Volkszugehörigkeit abgekoppelt, es gibt keine spezifisch deutsche Musik (im Radio wenig und auf dem europäischen Sängerwettstreit schon gar nicht), die Einheitlichkeit der Rechtschreibung wurde durch eine Reihe politischer Willkürakte gesprengt, die Fußballnationalmannschaft heißt nur noch Mannschaft und sieht nicht gerade wie ein Identifikationssymbol aus, und inzwischen existiert auch die deutsche Sprache nur noch in Resten.
Ich will das im Rahmen dieser Darstellung nicht bewerten. Es ist aber sehr auffällig, daß diese Entwicklung einer Auflösung alles Deutschen genau in jene Zeit fällt, in der sich Deutschland wieder zu nationalen Alleingängen, außenpolitischen Seltsamkeiten und dem zenithoch aufgeschwungenen moralischen Zeigefinger gegenüber seinen östlichen Nachbarländern und der ganzen Welt hinreißen läßt. Deutschland rettet das Weltklima. Deutschland rettet die Bedrückten dieser Welt und verteilt sich in Europa (oder wollte es jedenfalls). Deutschland belästigt Ungarn ohne genauere Kenntnis wegen eines dort rechtlich einwandfrei zustande gekommenen Gesetzes penetrant bis in ein Fußballspiel der Europameisterschaft hinein, dabei ist es Viktor Orbán, dem die Schwulen es verdanken, wenn sie heute in Ungarn viel weniger diskriminiert werden als früher. Deutscher Größenwahn ist heute wieder so sichtbar wie schon lange nicht mehr. Er drückt sich aber nicht mehr in jener Sprache aus, der wir unsere einstige Reputation in der Welt zu verdanken haben, restauriert aber auf befremdliche Weise immer wieder Formulierungen aus dem Dritten Reich und der DDR.
Deutscher Größenwahn 2.0 setzt die Negation des Deutschen voraus. Konzerne und Unternehmen wählen Englisch als Arbeitssprache, Universitäten schaffen alte deutsche Grade und Titel ab und unterrichten zunehmend auf Englisch – und wer in seiner deutschen Hausarbeit nicht die sprach- und sinnwidrigen Genderschreibweisen anwendet, bekommt Punktabzug. Was wird damit bezweckt? Was hat man davon, Rundschreiben als Mailings, Arbeitsmaterialien als Handouts, Broschüren als Reader und Unternehmertum als Enterpreneurship zu bezeichnen, wo doch die bekannten und treffenden deutschen Wörter die jeweilige Sache exakt bezeichnen? Vielleicht verbirgt sich hinter der Sprachglobalisierung, wie sie sich derzeit in Mitteleuropa vollzieht, nichts weiter als Einfältigkeit. Vielleicht kamen die Deutschen aber auch auf die Idee, daß sie zunächst einmal nicht mehr deutsch sein sollten, wenn sie es in der Welt noch einmal zu etwas bringen wollen. Das ist nicht ganz dumm gedacht, aber draußen in der Welt wirkt der deutsche Michel damit gleichzeitig lächerlich und beängstigend. Und fürchterlich provinziell wie immer.
Und dann kommen die Schlaumeier und behaupten, es gebe zum Beispiel in der Politikwissenschaft für die von ihr gebrauchten Begriffe policy, polity und politics einfach keine eindeutigen deutschen Wörter, sondern nur absatzlange Erklärungen. Damit geben sie sich den Anstrich, ihre Sprache zu kennen – was man anzweifeln sollte. Außerdem müssen wir differenzieren. Es ist ein Unterschied, ob sich in einer wissenschaftlichen Disziplin ein Begriff weltweit eingeführt hat und verwendet wird, egal ob er lateinisch oder englisch ist, oder ob jemand einfach durch sprachlichen Unfug versucht, sich besonders wichtig zu machen. Längst ist klar, daß die Waschmittel in Wirklichkeit nicht immer besser werden, sondern sich hauptsächlich durch moderne Attribute wie extra, supra, ultra und mega verändern – wobei man raten darf, ob es demnächst hyper oder meta heißen wird. Gerade die Werbeabteilungen offenbaren dabei meistens den größten Unverstand: „Mega“ wird zu der Zeit angeschoben, in der das fast gleichlautende „Neger“ unmöglich gemacht wird. Das fällt keinem mehr auf. Ein Parfüm wird im deutschen Sprachraum allen Ernstes unter dem Namen „Bleu de Chanel“ vermarktet. Man geht in die Parfümerie und sagt: „Haben Sie das blöde Chanel?“ Bemerkt keiner den Blödsinn?