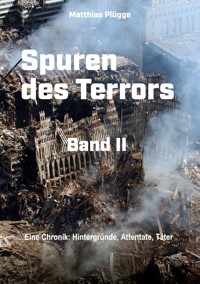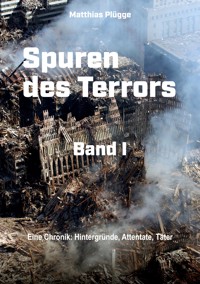
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Spuren des Terrors
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist eine Chronik, die die Terroranschläge seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges dokumentiert und die Hintergründe aufzeigt. Der erste Band beginnt 1946 in Jerusalem und endet in Aden im Jahr 2000 mit dem Anschlag auf die USS Cole.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 855
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Kinder
Astrid und Kai
Carina und Nicolas
Mögen sie niemals zur falschen Zeit
am falschen Ort sein.
Inhalt
Statt einer Einleitung
Berlin, Breitscheidplatz, 19. Dezember 2016
Kapitel 1: Geschichtliche Entwicklung
Von Zeloten und Assassinen zum stalinistischen Terror
Kapitel 2: Nationalismus und Freiheitskriege
Israel, Zypern und Algerien: Drei Beispiele
Kapitel 3: Ethno-nationalistischer Terrorismus I
Die Entwicklung im Nahen Osten
Kapitel 4: Ethno-nationalistischer Terrorismus II
Molukker, Tamil Tigers, PKK, IRA, ETA
Kapitel 5: Sozial-linksrevolutionärer Terrorismus I
RAF, Bewegung 2. Juni, Westdeutscher Terrorismus und die DDR
Kapitel 6: Sozial-linksrevolutionärer Terrorismus II
Angry Brigade, Action Directe, CCC, GRAPO, Brigate Rosse
Kapitel 7: Sozial-linksrevolutionärer Terrorismus III
Japanische Rote Armee, Weathermen Underground, Kanada: FLQ
Kapitel 8: Rassistischer und Rechtsterrorismus I
NSU, Ordine Nuovo, OAS, Popular Front
Kapitel 9: Rassistischer und Rechtsterrorismus II
Combat 18, Anders Breivik, Graue Wölfe, Juden gegen Israel
Kapitel 10: Rassistischer und Rechtsterrorismus III
Ku-Klux-Klan, Aryan Nations, Militias, Alt-Right-Bewegung
Kapitel 11: 1979, ein Jahr der Ereignisse
Islamische Revolution, Anschlag in Mekka, Sowjets in Afghanistan
Kapitel 12: Hisbollah, Hamas und die Intifada
Entwicklungen im Libanon, im Gaza-Streifen und Westjordanland
Kapitel 13: Staatsterror oder Staatsterrorismus I
England, Israel, USA, Russland, Kambodscha, Iran, Frankreich
Kapitel 14: Staatsterror oder Staatsterrorismus II
Libyen als Auftraggeber: Lockerbie und Diskothek „La Belle “
Kapitel 15: Osama bin Laden und al-Qaida
Weltweiter Dschihad, Kampf gegen die USA
Register
Statt einer Einleitung
Berlin, Breitscheidplatz, 19. Dezember 2016
An diesem Tag ereignet sich in Berlin einer der schwersten und tödlichsten Terroranschläge, die je in Deutschland verübt wurden. 12 Menschen sterben und 55 werden teilweise schwer verletzt, als ein Sattelschlepper um 20.02 Uhr auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz durch die Besuchermenge fährt und dabei mehrere Verkaufsstände zerstört.
Auch nach vier Jahren und einem Untersuchungsausschuss sind die Ereignisse immer noch nicht restlos geklärt: Es gibt mehr offene Fragen als überzeugende Antworten. Wie kann der Tunesier Anis Amri, eine von den Behörden als „Gefährder“ eingestufte Person, diesen Anschlag durchführen und dann auch noch unbehelligt den Tatort verlassen?
MONTAG, 19. DEZEMBER
09.00 Uhr
Ein polnischer Sattelschlepper biegt in das Friedrich-Krause-Ufer im Berliner Stadtteil Moabit ein, eine ruhige Straße im Nordhafen, Standort der Firma Thyssenkrupp. Der Wagen kann nicht entladen werden, da er einen Tag zu früh angekommen ist. Dem Fahrer wird gesagt, er möge am nächsten Tag wiederkommen. So parkt er den Sattelschlepper unweit des Firmengeländes – und damit auch in der Nähe der Fussilet-Moschee.
14.15 Uhr
Anis Amri verlässt seine Wohnung und trifft sich in Berlin-Wedding mit zwei Bekannten zum Essen. Danach fahren die drei Männer mit der U-Bahn nach Neukölln, in den Süden der Stadt. Während Amris Begleiter früher aussteigen, fährt dieser bis zur Endstation und dann wieder zurück. Was er in Neukölln wollte oder gemacht hat, ist bisher ungeklärt.
15.44 Uhr
Jemand versucht, den LKW zu starten, so die spätere GPS-Analyse der Spedition.
16.32 Uhr
Der LKW wird gestartet und bis 17.34 Uhr läuft der Motor. Danach wird das Fahrzeug noch mehrmals gestartet und kurz bewegt, so die GPS-Analyse.
18.37 Uhr
Amri betritt die Fussilet-Moschee und trifft dort eine Person, die auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist, aber nicht identifiziert werden kann. Diese Person spricht 12 Minuten mit Amri und verlässt um 18.49 Uhr die Moschee.
19.06 Uhr
Amri verlässt die Gebetsräume und begibt sich zum Friedrich-Krause-Ufer.
19.34 Uhr
Amri schreibt an seinen Mentor der Terrormiliz Islamischer Staat (IS): „Mein Bruder, alles in Ordnung, so Gott will. Ich bin jetzt im Auto, bete für mich, mein Bruder, bete.“ Er macht ein Selfie und verschickt es an Gesinnungsgenossen in Berlin und im Ruhrgebiet.
19.37 Uhr
Der Sattelschlepper wird gestartet und fährt langsam in Richtung Stadtzentrum. Vorbei am Berliner Tiergarten, auf mehrspurigen Straßen und durch dichten Verkehr. Für einen Fahranfänger schwer vorstellbar. Wurde der Fahrer gezwungen, den Wagen zu steuern? Was in der Fahrerkabine geschah, bleibt wohl ungeklärt.
20.02 Uhr
Der Sattelschlepper mit seinem Auflieger steuert, von der Hardenbergstraße kommend, auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitschatzplatz an der Berliner Gedächtniskirche nahe dem Bahnhof Zoo zu. Er fährt 60 bis 80 Meter quer durch eine Gasse zwischen den Marktbuden hindurch, durchbricht die Budenreihe, zerstört eine vollständig und kommt auf der Budapester Straße am Fuße der Gedächtniskirche zum Stehen. Es werden 11 Menschen getötet, 45 verletzt, 30 davon schwer. Eine 12. Person wird tot auf dem Beifahrersitz gefunden; es ist der polnische Fahrer. Ein Zeuge will gesehen haben, wie in der LKW-Kabine ein stehender Mann von der Beifahrerseite aus dem Fahrer
ins Lenkrad greift. Zwei Immobilienmakler beobachten aus dem 20. Stock des Waldorf-Astoria-Gebäudes, wie der LKW zum Stehen kommt, ein Mann aus dem Fahrerhaus springt, am Auflieger entlang nach hinten geht, wieder zurückkommt und unter den LKW schaut. Dann sei er über die Mittelinsel auf die andere Straßenseite gegangen.
20.04 Uhr
Bei der Berliner Feuerwehr geht der erste Notruf ein: Die ersten Krankenwagen fahren los. Die Polizei sperrt den Breitscheidplatz weiträumig ab.
20.05 Uhr
In die Kamera in der Unterführung des U-Bahnhofs Zoo hinein, nur ein paar hundert Meter vom Breitschatzplatz entfernt, zeigt Amri den islamischen Tauhid-Gruß. Danach verliert sich seine Spur.
20.56 Uhr
An der Siegessäule nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest, der die Tat beim Verhör bestreitet. Mögliche Fluchtwege wie der Zentrale Omnibusbahnhof oder die Flughäfen werden erst Stunden später überwacht.
DIENSTAG, 20. DEZEMBER
15.10 Uhr
Im Führerhaus des Sattelschleppers finden die Ermittler eine Geldbörse und die Duldungsbescheinigung von „Ahmed Elmasri“, der als Tunesier Anis Amri identifiziert werden kann. Kurz nach Mitternacht, also am Mittwoch, dem 21. Dezember, wird Anis Amri bundes- und europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.
18.54 Uhr
Der festgenommene Verdächtige, der behauptet, er habe nicht im Führerhaus gesessen, wird entlassen.
20.13 Uhr
Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nimmt den Anschlag für sich in Anspruch, berichtet die Agentur Amak. Der Täter sei Soldat des IS gewesen.
Die Route des Lastwagens und seine Zerstörung der Weihnachtsmarktstände
Der Attentäter, der Tunesier Anis Amri, war infolge des „Arabischen Frühlings“ mit weiteren Flüchtlingen in einem Boot auf die Insel Lampedusa gelangt. Am 5. April 2011 wurde er von der Polizei auf Sizilien registriert, wobei er ein falsches Alter angab. Nachdem er – zusammen mit anderen – Feuer in seiner Unterkunft gelegt hatte, um gegen die Verpflegung zu protestieren, wurde er im Oktober 2011 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt; in diesen Jahren radikalisierte er sich.
Am 17. Juni 2015 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Wegen fehlender Papiere konnte er nicht nach Tunesien ausgewiesen werden, musste Italien jedoch innerhalb einer Woche verlassen. Illegal hielt er sich zunächst in der Schweiz auf, wo er – so wird vermutet – Kontakt zu Salafisten mit Verbindungen nach Hildesheim aufnahm. Im Juli 2015, während der sogenannten Flüchtlingskrise, wechselte er in die Bundesrepublik und meldete sich in Freiburg unter dem Namen Amir an, nicht Amri. Durch diesen Buchstabendreher war die Warnung der Italiener, dass er ein Gewalttäter sei, nicht im Computer auffindbar.
Am 28. Juli erhielt er die Bescheinigung als Asylsuchender (BÜMA), trotzdem meldete er sich in verschiedenen Städten des Ruhrgebietes, wie auch in Berlin, mit unterschiedlichen Namen weiterhin als Asylsuchender an. Außerdem beantragte er Sozialleistungen. Letztendlich war die Ausländerbehörde Kleve für ihn zuständig und schickte ihn als „Mohammed Hassa“ in die Flüchtlingsunterkunft Emmerich.
Im Oktober 2015 informierte die Ausländerbehörde Kleve die Polizei über eine Meldung eines Mitbewohners von Amri alias „Mohammed Hassa“, dass dieser auf seinem Mobiltelefon Fotos von schwarz gekleideten Männern habe, die mit Kalaschnikows bewaffnet seien. Daraufhin leitete die Polizei einen Prüffall „Islamismus“ ein, brachte aber „Mohammed Hassa“ nicht mit Amri in Verbindung.
Kontakt zu salafistischem Netzwerk
Schon kurz nach seiner Ankunft in Deutschland hatte er erneut Kontakt zum Netzwerk des salafistischen Predigers Abu Walaa in Hildesheim aufgenommen. Walaa, der über den „Deutschsprachigen Islamkreis Hildesheim e.V.“ operierte, galt den Sicherheitsbehörden als zentrale Figur des IS-Rekrutierungs-Netzwerkes und wurde 2015 als Gefährder in NRW eingestuft, auch der Generalbundesanwalt ermittelte gegen ihn. Amri gehörte zunächst einer Gruppe an, die sich für den Kampf des IS in Syrien ausbilden ließ. Eigentlich wollte auch er als Kämpfer für den IS nach Syrien. Da aber Anschläge in Deutschland vorgezogen wurden, entschied sich Amri zu bleiben und hier einen Anschlag durchzuführen, wofür ihn anscheinend ein IS-Kontakt rekrutierte. Im November 2015 berichtete ein Informant des LKA NRW, dass ein gewisser „Anis“ etwas in Deutschland machen wolle. Ab Dezember wurde Amris Telekommunikation bis zum 26. Mai 2016 überwacht. Nach LKA-Dokumenten, aus denen der Sender NTV im Dezember 2017 zitierte, habe Anis Amri persönlichen Kontakt zu Abu Walaa gehabt. „Der Tunesier sei über Weihnachten 2015 von dem islamischen Prediger zu einer dreißigminütigen Privataudienz empfangen worden und habe eine exklusive Beziehung zu dem Prediger gehabt.“ Während eines Aufenthaltes in Dortmund vom 22. Januar bis zum 12. Februar 2016 soll Amri in einigen Moscheen als Vorbeter aufgetreten sein. Das Polizeipräsidium stufte ihn im Februar als „Gefährder NRW“ ein; ab März wurde er verdeckt observiert. Da er sich aber vornehmlich in Berlin aufhielt, wurde die Überwachung von den Berliner Behörden übernommen.
Abgelehnter Asylantrag
Unter dem Namen „Ahmed Almasri“ stellte Anis Amri am 28. April 2016 in Dortmund einen Asylantrag und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Dieser Asylantrag wurde am 30. Mai des Jahres als unbegründet abgelehnt. Zwei Monate später wurde er bei einem Versuch, mit einem gefälschten Pass in die Schweiz zu reisen, in Friedrichshafen verhaftet. In der Schweiz wollte er eine zum Islam konvertierte Schweizerin heiraten, um seine Abschiebung zu verhindern. Er verbrachte eine Nacht in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg und wurde am nächsten Tag – nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde Kleve – freigelassen, da er wegen noch fehlender Papiere nicht sofort ausgewiesen werden konnte. Die Ausländerbehörde gewährte ihm eine Aufenthaltsduldung bis zum 16. September 2016 und die Observierung von Amri wurde eingestellt, da keine Hinweise auf eine schwere Straftat vorlagen. Eine Verlängerung der Überwachung wurde zwar beantragt, auch richterlich genehmigt, aber trotzdem nicht mehr durchgeführt. Noch im September und erneut im Oktober warnte der marokkanische Geheimdienst DGST den BND und das BKA vor Amri: Er habe Kontakte zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und sei bereit, einen Anschlag durchzuführen.
Am 8. November 2016 wurden der Prediger Abu Walaa und vier seiner Mitarbeiter wegen der Bildung eines salafistischen Anwerbe-Netzwerkes verhaftet. Da Amri nicht zum engeren Kreis gezählt wurde, blieb er unbehelligt. Vom LKA Berlin und dem Bundesinnenministerium wurde er als harmlos eingestuft: reduzierte islamische Aktivität, dafür aber Drogenhandel und Kleinkriminalität. Im Gegensatz zu dieser Einstufung erhielt Amri per Mail eine IS-Dokumentation mit dem Titel „Die Frohe Botschaft […] für Märtyrer-Operationen“. In diesem 143-seitigen Papier wird der Dschihad gerechtfertigt.
Kurz zuvor, am 31. Oktober oder 1. November 2016, hatte Anis Amri in Berlin ein Video aufgenommen, in dem er Abu Bakr al-Baghdadi, dem Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat, die Treue schwor und Muslime zum Dschihad aufrief. Dieses Video wurde vom IS nach dem Berliner Anschlag im Internet veröffentlicht. Vom 22. November 2016 an suchte Amri den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Berliner Gedächtniskirche siebenmal auf.
Am Abend des 19. Dezember, kurz nach dem Anschlag, wurde Amri am Bahnhof Zoo von einer Videokamera gefilmt, wie er mit dem sogenannten Tauhid-Finger posierte – einem erhobenen Zeigefinger, dem Zeichen des Islamischen Staates. Danach verlor sich seine Spur. Am folgenden Nachmittag loggte sich jemand auf Facebook ein und löschte das Profil von Amri; von offizieller Seite wurde vermutet, dass er es selbst gewesen war.
Tod in Mailand
Wieder einen Tag später, am 21. Dezember, wurde Amri um 11.30 Uhr am Bahnhof des holländischen Nimwegen von einer Überwachungskamera gefilmt, um 13.20 Uhr dann in Amsterdam und gegen 19.00 Uhr am Bahnhof Brüssel-Nord. Am 22. Dezember erfasste ihn eine Kamera im Lyoner Bahnhof Part-Dieu; nach Angaben der französischen Polizei kaufte Amri dort gegen 13.00 Uhr ein Zugticket nach Mailand.
Der nächste Kamerakontakt fand um 22.14 Uhr in Turin im Bahnhof Porta Nuova statt, als er in den Zug nach Mailand stieg. Dort wurde er am 23. Dezember um 0.58 Uhr gefilmt, als er Richtung Ausgang ging. Zwei Stunden später wurde er im Vorstadtbahnhof Sesto San Giovanni von zwei Polizisten angehalten, die seine Papiere sehen wollten. Sofort griff Amri zu seiner Pistole, schoss und traf einen der Polizisten. Der zweite erwiderte das Feuer und traf Anis Amri tödlich. Anhand seiner Fingerabdrücke wurde er identifiziert. Damit endete die Flucht nach 77 Stunden.
Vier Tage lang – vom 19. bis zum 23. Dezember – galt dem Täter und der terroristischen Gewalt die Aufmerksamkeit der Nation. Die deutschen Fernsehanstalten ARD, ZDF und RTL berichteten live vom Breitscheidplatz, spekulierend, ob es ein Anschlag gewesen sei oder nicht. An jeder Straßenecke rund um den Weihnachtsmarkt standen die Reporter, die jeden möglichen Augenzeugen befragten, während in den Sendestudios die spärlich vorhandenenen Fakten ausgiebig von Fachleuten analysiert wurden. Nur die Polizei hielt sich zurück, bis sie schließlich bestätigte, dass es ein Terroranschlag gewesen sei.
Wie konnte es so weit kommen? Die Versäumnisse der Behörden waren zahllos. Wie so oft gab es rechtzeitig Informationen, doch die wurden nicht gebündelt, niemand hatte einen Überblick. Auch wenn nach Ansicht der Bundesanwaltschaft Anis Amri bei dem Anschlag keine weitere Person zur Unterstützung hatte, so war er doch kein Einzeltäter: Bis kurz vor der Tat hatte er Kontakt zu einem IS-Mentor im Ausland, der ihn wohl von der Rekrutierung bis zum Anschlag führte.
Deutschland ist zwar von Anschlägen mit zahlreichen Opfern, wie in Paris im November 2015 mit 130 Toten und mehr als 350 Verletzten, oder in Nizza im Juli 2016 mit 86 Toten und mehr als 400 Verletzten oder in Brüssel im März 2016 mit 35 Toten und mehr als 300 Verletzten, bisher verschont geblieben, doch die Bedrohung durch den Terror war und ist immer vorhanden. Die deutschen Sicherheitsbehörden konnten in den letzten Jahren immer wieder die Meldung verbreiten: Anschlag verhindert, Verdächtige inhaftiert – wie etwa Anfang Juni 2016: Drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat wurden in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Baden-Württemberg festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten sie gemeinsam mit einem in Frankreich inhaftierten vierten Attentäter einen Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt geplant. Zwei sollten sich demnach mit Sprengstoffwesten in die Luft sprengen, während die beiden anderen möglichst viele Menschen erschießen sollten. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung veränderte sich während des Jahres 2016 wesentlich, und zwar durch den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Die Bedrohung durch den Terror blieb und bleibt im Bewusstsein vieler vorhanden als eine Realität, die jeden treffen kann.
Gewalt als Botschaft
Terrorismus ist Gewalt. Nackte Gewalt, die als „Zeichen“ oder „Botschaft“ verstanden werden soll. Die Medien sind dabei ein Mittel zu terroristischem Zweck: Allein durch ihre Berichterstattung verbreiten sie die Botschaft. Inzwischen sind die Medien Bestandteil des terroristischen Kalküls. Verweigern sie sich, so brechen das Kalkül und die dahinterliegende Strategie in sich zusammen. Die heutigen Massenmedien bilden laut dem Fachjournalisten Franz Wördemann den „Übersetzungsmechanismus“ zwischen der einzelnen Tat und ihren sozialpsychologischen Auswirkungen. Diese enge Verbindung zwischen Terrorismus und den Medien war und ist immer wieder Anlass zur Kritik. Walter Laqueur, ein Pionier der Terrorismusforschung, bezeichnet die Medien als „beste Freunde“ des Terrorismus. Terroristische Anschläge erfüllen alle Voraussetzungen für eine interessante Nachricht, besonders wenn sie als „Breaking News“ angekündigt werden. Laut der britischen Premierministerin Margaret Thatcher liefern die Medien den Terroristen den Sauerstoff, ohne den sie nicht leben könnten. Andere bezeichnen die Verbindung zwischen den Terroristen und den Massenmedien – gemeint sind die Boulevardpresse und das Fernsehen – als eine symbiotische Beziehung.
Der sogenannte Islamische Staat inszeniert seine Anschläge und die Massenmedien transportieren seine Botschaften unter dem Begriff der Aktualität. Jeder Anschlag ist eine Botschaft, um dem Angegriffenen seine Verwundbarkeit vor Augen zu führen und um weitere Mitglieder zu rekrutieren. Wie immer nach terroristischen Anschlägen fordern die Politiker öffentlich verschärfte Gesetze, um der Bevölkerung eine gewisse Sicherheit zu bieten. Dabei wird meistens vergessen, dass die bestehenden Gesetze ausreichen, sie müssten nur konsequent angewendet werden.
Eine alternative Möglichkeit könnte darin bestehen, die Propaganda des IS oder einer anderen Terrororganisation zu boykottieren oder sie einfach zu ignorieren. Keine Sondersendungen und keine Leitartikel mit großen Fotos der Attentäter – dies wäre eine Alternative, die sogar funktionieren kann, wie die Erfahrungen mit Amokläufern an Schulen gezeigt haben, wo die Gefahr von Nachahmungstaten besonders groß ist. In Frankreich wird dieser Weg bereits diskutiert: Nach der Ermordung des 86-jährigen Priesters in der Kirche von Saint-Etienne-du-Rouvray am 26. Juli 2016 durch zwei Islamisten forderte der französische Philosoph Bernard-Henry Lévi die Medien dazu auf, weder Namen noch Bilder noch biografische Daten von Dschihadisten zu veröffentlichen. Als erster erklärte Jérome Fernogli, Chefredakteur von Le Monde, seine Zeitung wolle eine „posthume Glorifizierung“ der Attentäter verhindern und keine Fotos publizieren. Die katholische Tageszeitung La Croix nennt nur noch den Vornamen und das Initial des Nachnamens, der Fernsehsender Europe I gibt überhaupt keine Namen mehr preis, und beide verzichten auf Bilder.
Beispiel Russland
Russland, das am 3. April 2017 einen Selbstmordanschlag in der U-Bahn von St. Petersburg erleben musste, bei dem 14 Fahrgäste getötet und 45 verletzt wurden, verfügt über eine gesetzliche Regelung. Im Zusammenhang mit dem russischen Terrorismusbekämpfungsgesetz wurde durch das Mediengesetz die Berichterstattung über antiterroristische Operationen begrenzt, um zu verhindern, wie es heißt, dass Informationen an die Terroristen gelangen. Darüber hinaus wird überlegt, ob nicht weitergehende Beschränkungen der Pressefreiheit bei der Berichterstattung über terroristische Aktionen notwendig sind. Das Argument lautet, Terrorismus sei eine „kommunikative Strategie“, die erst durch die Berichterstattung in den Medien ihr Ziel erreiche, Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten.
Terrorismus wird letztlich nicht durch die Aktionen selbst als vielmehr durch deren Zielsetzung charakterisiert. „Terror ist nur eine Taktik, eine Methode willkürlicher Gewaltanwendung, die ebenso von einem Geistesgestörten wie von einem Staat angewendet werden kann. Doch Terrorismus ist die unverwechselbare Form einer modernen politischen Vorgehensweise, die es darauf anlegt, die Fähigkeiten eines Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, zu gefährden.“ (Townshend, Terrorismus, S. →) Es ist die Publizität, mit der die Terroristen versuchen, ein Druckmittel oder Einfluss zu erlangen, um auf regionaler oder internationaler Ebene politische Ziele zu erreichen.
Quellen: Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt
A: Bücher
Moser, Thomas, Der AMRI KOMPLEX, ein Terroranschlag, 12 Tote und die Verstrickungen des Staates, Frankfurt a. M. 2021
Townshend, Charles, Terrorismus, Stuttgart 2005
Waldmann, Peter, Terrorismus, Provokation der Macht, Hamburg 2005
Wördemann, Franz, Terrorismus, Motive, Täter, Strategien, Frankfurt a. M. 1979
B: Zeitungen, Zeitschriften
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-anis-amri-spurensuche-in-europa-a-1127090.html
[Abruf 16.02.2022]
https://www.zeit.de/2020/48/anschlag-berlin-weihnachtsmarkt-breitscheidplatz-verfassungsschutz-schwerin?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
[Abruf 16.02.2022]
https://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-auf-berliner-weihnachtsmarkt-lampedusa-berlin-mailand-1.3309131
[Abruf 16.02.2022]
https://taz.de/Terroranschlag-auf-dem-Breitscheidplatz/!5734300/
[Abruf 16.02.2022]
https://www.n-tv.de/politik/Abu-Walaa-soll-Anschlag-autorisiert-haben-article20178204.html
[Abruf 16.02.2022]
https://www.tagesspiegel.de/berlin/zwoelf-minuten-im-salafistentreffpunkt-mit-wem-traf-sich-anis-amri-kurzvor-dem-anschlag/25835014.html
[Abruf 16.02.2022]
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw31-bilanz-ua-breitscheidplatz-650574
[Abruf 16.02.2022]
https://www.gruene-bundestag.de/themen/innenpolitik/grosse-zweifel-an-der-alleintaeterschaft-amris-1
[Abruf 16.02.2022]
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Der-Fall-Amri-und-Mecklenburg-Vorpommern,amri152.html
[Abruf 16.02.2022]
http://www.heute.de/nach-terroranschlag-auf-weihnachtsmarkt-neue-details-der-ermittlungen-der-bundesanwaltschaft-amri-ist-der-taeter-46248610.html
[Abruf 16.02.2022]
https://www.spiegel.de/politik/ausland/anis-amri-stationen-seiner-flucht-durch-europa-a-1128683.html
[Abruf 16.02.2022]
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anis-amri-und-der-anschlag-in-berlin-versaeumnisse-im-anti-terrorkampf-a-1127376.html
[Abruf 16.02.2022]
http://diepresse.com/home/kultur/medien/5059291/Medien_Feind-des-Terrors-und-Werkzeug-zugleich
[Abruf 16.02.2022]
http://www.rundschau-online.de/24463440
(c) 2017 [Abruf 16.02.2022]
Kapitel 1
Geschichtliche Entwicklung
Terror, wie viele andere Worte auch, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Angst“ und „Schrecken“. Wann dieses Wort entstand, ist kaum zu ermitteln, aber es wurde im Zusammenhang mit der Seeräuberei oder Piraterie von den antiken Römern benutzt.
Piraterie gab es seit dem 14. Jahrhundert v. Chr. im östlichen Mittelmeer. Die zahlreichen Inseln und die zerklüfteten Küsten mit ihren Buchten boten den Piraten eine Vielzahl von Zufluchtsmöglichkeiten. Zunächst waren es Küstenpiraten, die mit Ruderbooten die Küstenorte erreichten und dort plünderten. Erst im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde es möglich, durch die Entwicklung der Triere auch auf hoher See Piraterie zu betreiben; denn diese von zahlreichen Ruderern angetriebenen Schiffe waren so schnell, dass der Gegner kaum eine Chance hatte zu entkommen.
Im 3. Jahrhundert v. Chr. stießen die Römer im Zuge der Ausweitung ihres Herrschaftsbereiches auf die Piraten und ihre Raubzüge. Da sich die Feinde Roms mit den Piraten verbündeten, wurden diese im Laufe der folgenden beiden Jahrhunderte ein immer größeres Problem, vor allem, weil sich durch die Piratenangriffe in Rom die Versorgung mit Getreide aus Ägypten verschlechterte. Im Jahr 67 v. Chr. überfielen die Piraten auch mehrere italienische Hafenstädte; in Ostia, der römischen Hafenstadt, zerstörten sie Teile der römische Flotte. Mit allen Vollmachten ausgestattet, ließ der römische Feldherr Gnaeus Pompeius aufrüsten: Es wurde eine neue Flotte von 500 Schiffen gebaut und 20 Legionen mit jeweils 6.000 Mann wurden aufgestellt. Pompeius hatte eine Strategie entwickelt: Von der Flotte ließ er die Häfen, die sich in der Hand der Piraten befanden, blockieren. Gleichzeitig griffen die Legionen von Land heran und zerstörten die Häfen. In dieser Zeit des römischen Seeräuberkrieges wurde wohl der lateinische Begriff Terror geprägt.
Zeloten und Sikarier (6 bis 73 n. Chr.)
Die Verbindung zwischen Religion und Terrorismus ist nichts Neues: Bereits vor 2.000 Jahren wurden von religiösen Fanatikern Anschläge durchgeführt, die man heute als terroristische Akte bezeichnen würde. Einige Begriffe, die heute genutzt werden, um Terrorismus zu beschreiben, leiten sich von den Namen jüdischer, hinduistischer und muslimischer Gruppen ab, die vor langer Zeit terroristisch aktiv waren. Eines der Beispiele sind die Sikarier, eine Splittergruppe unter den Zeloten in Judäa. Die Zeloten waren eine jüdische Sekte, die von der Endzeiterwartung geprägt war. Außerdem erkannten sie keine staatliche Autorität an; nur Gott allein dürfe man sich beugen und fügen. Der Begriff Zelot stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Eiferer“. Der schon erwähnte Gnaeus Pompeius hatte 63 v. Chr. Judäa besetzt und zu einer römischen Provinz gemacht. Es waren die Zeloten, die einen gewaltsamen Aufstand gegen Rom anstrebten, wobei die Gruppe der Sikarier einen rücksichtslosen Feldzug gegen die Römer und jüdische Kollaborateure begannen. Sikarier bedeutet „Dolchträger“ oder „Messerstecher“, nach dem lateinischen sica („Dolch“). Diese Männer tauchten aus der Anonymität eines belebten Marktplatzes auf und schnitten, für alle Anwesenden sichtbar, ihrem Opfer die Kehle durch. Auch Geiselnahme und Gefangenenmord zählten zu ihren grausamen Praktiken. Sie scheuten dabei weder die heiligen Stätten noch die heiligen Tage: Gezielt legten sie ihre Attentate auf einen Sabbat oder einen Feiertag. Diese öffentlichen Morde zielten – wie auch die Anschläge der heutigen Terroristen – auf eine psychologische Wirkung ab, die weit über den Kreis der Opfer und der Zeugen hinausging. Es war eine eindeutige Botschaft an die römischen Besatzer und die jüdischen Kollaborateure.
Das Drama von Masada
Zu Beginn des Jüdischen Krieges im Jahr 66 nahmen die Sikarier Jerusalem ein; sie zerstörten die Nahrungsmittelvorräte, um die Bevölkerung zum Kampf gegen die römische Besetzung zu zwingen. Erst im Herbst 70 konnten die Römer die Belagerung von Jerusalem beenden und die Stadt erobern, wobei sie den Jerusalemer Tempel in Brand steckten. Die Stadt selber war so zerstört, dass sie in den folgenden Jahrzehnten nicht mehr bewohnbar war. Inzwischen, im Jahr 66, hatten die Sikarier auch die Festung Masada erstürmt und die dort stationierten 700 römischen Legionäre abgeschlachtet, obwohl sie den Soldaten freien waffenlosen Abzug zugesichert hatten. Bis 73 konnten die Sikarier Masada gegen die römische Belagerung halten. Doch als sie keinen Ausweg mehr sahen, begingen sie – rund 1.000 Juden mit Frauen und Kindern – gemeinsam Selbstmord, um nicht von den Römern gefangen genommen zu werden.
Die Assassinen (1000 bis 1250)
Rund 1.000 Jahre später: Die Assassinen, auch Haschaschinen genannt, waren ein radikaler Zweig der muslimisch-schiitischen Ismaeliten-Sekte, die zwischen dem Ende des 11. Jahrhunderts und der Mitte des 13. Jahrhunderts in Persien und Syrien ansässig waren. Sie waren bekannt für ihre Mordattentate – mit dem Dolch und durch Gift –, mit denen sie politische Widersacher wie auch Andersgläubige ausschalteten und dadurch Angst und Schrecken verbreiteten. Das Wort Assassin kommt aus dem Arabischen und bedeutet „Haschischesser“. Die Attentäter wurden als „Opferbereite“ bezeichnet, weil sie bei den Attentaten meistens den Tod fanden.
Marco Polo berichtete, dass die jungen Männer vor den Attentaten mit Opium betäubt und in eine Gartenanlage gebracht wurden. Bei guter Bewirtung und Betreuung durch Frauen erging es ihnen wie im vom Propheten Mohammed versprochenen Paradies. Nur durch einen heldenhaften Tod konnten sie endgültig dorthin kommen. Die Gewalt stellte für die Assassinen eine Art sakrale Handlung dar, eine gottgegebene Pflicht, die in den religiösen Texten gefordert und von den geistlichen Führern befohlen wurde. In Persien endete die Herrschaft der Assassinen durch die Mongolen 1256, die viele Mitglieder der Sekte ermordeten. In Syrien war es der Mameluken-Sultan Baibars, der 1271 die Herrschaft der Assassinen beendete. Ihr Name jedoch lebt in vielen Sprachen fort, als Synonym für Auftragsmörder: Assassin, während ihr Ethos des Selbstopfers und des Martyriums heute auch bei vielen islamistischen terroristischen Organisationen zu finden ist.
Propaganda der Tat (1850)
Die Französische Revolution bewirkte und förderte in Europa eine antimonarchische Stimmung. Das „Gottesgnadentum“, dass den Herrschern ihre Macht von Gott gegeben sei – und nicht vom Volk – wurde in wachsendem Maße in Frage gestellt. Und so entstand im 19. Jahrhundert eine neue Art des Terrorismus, die viele revolutionäre und staatsfeindliche Aspekte enthielt und teilweise heute noch wirksam ist. Einer der wichtigsten Köpfe dieser Entwicklung war der italienische Extremist Carlo Pisacane, der sich für die italienischen Einigungsbestrebungen und die Bildung einer Republik, das „Risorgimento“, einsetzte und dafür kämpfte. Pisacane wird die Theorie der „Propaganda der Tat“ zugeschrieben. Er hatte erkannt, dass die „Zurückgebliebenheit“ der italienischen Arbeiter und Bauern und deren fehlendes politisches Bewusstsein ein Hindernis für die Errichtung einer Republik seien. In seinem „Politischen Testament“ schrieb er 1857: „Ideen gehen aus Taten hervor und nicht umgekehrt, und das Volk wird nicht frei durch Bildung, sondern gebildet in der Freiheit. Gewalttätigkeit ist nicht nur notwendig, um Aufmerksamkeit zu erregen oder öffentliches Interesse für ein Anliegen zu erwecken, sondern um zu informieren, zu bilden und schließlich die Massen für die Ziele der Revolution zusammenzuführen. Der lehrende Zweck der Gewalt kann niemals durch Kampfschriften, Plakate oder Veranstaltungen ersetzt werden.“ Der hohe Anteil von Analphabeten im 19. Jahrhundert setzte der traditionellen Propaganda enge Grenzen. Die Propaganda der Tat, so Paul Brousse 1877, „sei in der Lage, den müden und trägen Massen […] das, was sie nicht lesen können, zu zeigen. Sie lehrt sie den Sozialismus in der Praxis, macht ihn sichtbar, greifbar, konkret“.
Damit wird deutlich, dass die Attentate primär als eine Form der Kommunikation zu betrachten waren. Die Strategie der „Propaganda der Tat“ bedeutet ein gewisses Gleichgewicht der beiden Begriffe „Tat“ und „Propaganda“. Durch die „Tat“ sollte eine Botschaft – eine politische Zielsetzung oder ideologische Überzeugung – einem breiten Publikum nahegebracht werden. Die „Tat“ war die „Propaganda“. An dieser Erkenntnis aus der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich bis heute nichts geändert, wenn man an die inszenierten Anschläge des „Islamischen Staates“ denkt. So ist es auch kein Zufall, dass der moderne Terrorismus fast gleichzeitig mit der modernen Massenpresse, aber auch mit der Erfindung des Dynamits, entstand. Zu den Ersten, die die potenzielle Wirkkraft dieser Mittel erkannten und systematisch für ihre Zwecke nutzten, zählten die Anarchisten.
Tyrannenmord und Anarchisten
Auch der Entwicklungsstrang über Tyrannenmord und Anarchismus führt zum Terrorismus. Nach Walter Laqueur wurde Terrorismus schon immer als Mittel des Widerstandes gegen die Gewaltherrschaft gerechtfertigt und ließe sich als solcher bis in die Antike zurückverfolgen. Schon in der Antike wurde philosophiert, ob der Tyrannenmord ein legitimes Mittel zur Befreiung der Bürger sei. Die Frage lautete: Was ist schwerer zu verantworten – Unterdrückung, Gewalt oder gar Tod durch den Tyrannen oder die Schuld eines Mordes durch ein Attentat auf den Tyrannen. Der erste bekannte Tyrannenmord ereignete sich 514 v. Chr. in Griechenland: Bei diesem Attentat auf die Tyrannenbrüder Hippias und Hipparchos wurde Hipparchos getötet. Den beiden Attentätern wurde von den Athenern ein Denkmal errichtet, denn dieser Anschlag gilt auch als Geburtsstunde der Demokratie in Athen. Der Tyrannenmord an Hipparchos soll Cicero zufolge bis zu dem an Julius Cäsar in aller Munde gewesen sein. In seiner Moralschrift „De officiis“ verteidigte Cicero den Tyrannenmord als politisch nützlich. Der Mord an Cäsar, dem Liquidator der römischen Republik am 15. März 44 v. Chr. ist wohl der bekannteste Tyrannenmord der Geschichte: „Auch Du, mein Sohn Brutus“ dürfte wohl einer der bekanntesten Sätze aus dieser Zeit sein. Das Neue Testament weist die alten Ideen, auf denen die Thesen Platos und Ciceros beruhten, zurück. Der Tyrannenmord ist mit dem neutestamentlichen Konzept der „Feindesliebe“ unvereinbar. Das frühe Christentum kannte statt des heldenhaften Tyrannenmörders nur den Märtyrer, denn jede Obrigkeit kam von Gott und war deshalb unantastbar. Erst die Französische Revolution beendete diese Sichtweise.
Die „Philosophie der Bombe“
Die politische Gewalt im traditionellen Sinn, vor allem der Attentate, änderte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Dies betraf die Täter, die Opfer und die Art der Anschläge: Bei den Tätern begann eine Entwicklung von Einzelnen hin zu einer anonymen Verschwörergruppe oder -organisation. Auch das Spektrum der Opfer dehnte sich aus. Vor 1800 hatten sich politische Attentate vornehmlich gegen den jeweiligen Monarchen oder andere politische Schlüsselfiguren gerichtet. Die Anschläge richteten sich nun auch immer mehr gegen die Vertreter des jeweiligen Machtapparates, seien es Minister, Generäle oder Polizeipräsidenten. Und auch bei den Attentatsmitteln gab es gravierende Veränderungen. Der Dolch, die typische Waffe des Tyrannenmordes, wurde zunehmend durch die Bombe verdrängt. Auslöser war die Erfindung des Dynamits durch Alfred Nobel im Jahr 1867. Durch die „Propaganda der Tat“ wurde die anarchistische Bewegung im 19. Jahrhundert bekannt. Es war eine Kommunikationsstrategie, die besonders heute von den terroristischen Organisationen wie dem „Islamischen Staat“ wieder genutzt wird. Der bayerische Anarchist Johann Most legte in den 1880er-Jahren in dem Traktat „Philosophie der Bombe“ seine Hauptthesen dar:
Extreme Gewalt wird von der Fantasie der Öffentlichkeit Besitz ergreifen.
So kann die Öffentlichkeit für politische Fragen sensibilisiert werden.
Gewalt verleiht von sich aus Stärke und wirkt als eine „reinigende Kraft“.
Gewalt kann den Staat bedrohen und ihn zu unrechtmäßigen Reaktionen verleiten.
Diesem „Leitfaden“ entsprechend erfolgte ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine steigende Attentatsserie gegen führende Vertreter der europäischen Herrschaftshäuser. Die Mehrzahl der teils erfolgreichen, teils fehlgeschlagenen Anschläge blieb zunächst das Werk von Einzeltätern, obwohl es bereits zahlreiche Geheimgesellschaften gab. Es begann 1861 mit einem fehlgeschlagenen Anschlag auf den König Wilhelm I. von Preußen, 1878 folgten zwei Attentate auf den deutschen Kaiser Wilhelm I. in Berlin, außerdem Mordversuche am spanischen König Alfons XII. in Madrid und auch am italienischen König Umberto I. in Neapel. 1881 wurde Zar Alexander II. von Russland ermordet, 1894 der französische Staatspräsident Carnot in Lyon und 1897 der spanische Premierminister del Castillo in den Kuranlagen von Mondragon. Ein Jahr später fiel Kaiserin Elisabeth von Österreich einem Attentat zum Opfer, 1900 in Italien der König Umberto I und 1901 der Präsident der USA, William McKinley. Auf den ersten Blick erschienen die Ereignisse als eine große Verschwörung, die darauf gerichtet war, die bestehende Ordnung zu vernichten. Dabei waren diese Ereignisse eine Aneinanderreihung von Einzelattentaten, die nicht miteinander verbunden waren.
Narodnaja Wolja (1878)
Die erste Organisation, die das Prinzip der „Propaganda der Tat“ umzusetzen versuchte, war die russische Narodnaja Wolja („Volkswille“ oder „Volksfreiheit“), die 1878 gegründet wurde. Das war eine sozialrevolutionäre Vereinigung, die mit Mitteln des Terrors für demokratische Ziele in Russland kämpfte. Ihre Ziele waren der Sturz des Zaren, freie und allgemeine Wahlen sowie Meinungs-Presse- und Gewissensfreiheit. Wegen der Apathie der russischen Massen sahen die Mitglieder der Narodnaja Wolja kaum eine andere Möglichkeit, als mit wagemutigen Gewaltaktionen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu erreichen. So ergriffen sie eine extreme Maßnahme und planten die Ermordung Zar Alexanders II. Acht Versuche schlugen fehl. Deshalb setzte man beim neunten Versuch vier Attentäter mit vier Bomben in zwei Gruppen ein. Am 1. März 1881 kamen sie dann zum Ziel. Nachdem der erste Attentäter gescheitert war, tötete der zweite den Zaren und sich selbst.
Trotzdem zeigte die Narodnaja Wolja für eine terroristische Organisation ein zwiespältiges Verhältnis zu der Gewalt, die sie ausübte. Sie definierte „Propaganda der Tat“ als eine Selektion von Persönlichkeiten des autokratischen Unterdrückerstaates. Aus diesem Grund wurden ihre Opfer – der Zar, führende Angehörige der kaiserlichen Familie und hohe Regierungsbeamte – nach ihrer symbolischen Bedeutung für das System ausgewählt. Bei der Verfolgung dieser Ziele sollte kein fremdes Blut vergossen werden; das war allgemeiner Konsens in der Organisation. Aufgrund dieses Verhaltens bildete sich in der Öffentlichkeit der Mythos von „tugendhaften Mördern“. Die Bereitschaft der Attentäter, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen – die Gefangennahme und Hinrichtung waren ihnen sicher –, führte in der Bevölkerung zu einer Mischung aus Faszination, Bewunderung und Entsetzen: so wie ein Jahrhundert später, als die ersten Selbstmordattentäter auftauchten.
Nach dem Mord am Zaren verhaftete die Geheimpolizei die meisten Verschwörer. Es wurde ihnen der Prozess gemacht und sie wurden gehängt. 1883 – zwei Jahre nach dem Attentat – wurde auch das letzte Mitglied des Exekutivkomitees verhaftet. Damit war die erste Generation der Terroristen der Narodnaja Wolja tot oder im Gefängnis. Die Auswirkungen des Attentats auf die Zarenherrschaft waren zu jener Zeit sicherlich nicht absehbar, doch es war der Beginn ihres Endes.
Krise der russischen Gesellschaft
Die Anschläge der Narodnaja Wolja unterschieden sich wesentlich von den Attentaten in anderen Teilen Europas, die von isolierten Einzelpersonen mit teilweise obskuren Idealen durchgeführt wurden. Der russische Terrorismus war ein Aspekt der im Entstehen begriffenen sozialistischen Bewegung wie auch Symptom einer allgemeinen Krise der russischen Gesellschaft. Doch erst Ende 1901 wurde schließlich eine sozialrevolutionäre Partei aus linken Gruppierungen gebildet – darunter waren auch ehemalige Mitglieder der Narodnaja Wolja. Die Ermordung des russischen Innenministers Sipjagin im Jahr 1902 bildete den Auftakt zu einer neuen Terrorwelle. Die Partei vertrat die Ansicht, dass Terrorismus nötig sei. Der Kampf der Massen sollte dadurch ergänzt werden. Systematischer Terror, Hand in Hand mit anderen Formen des offenen Kampfes, wie Arbeiterunruhen, Bauernaufstände und Demonstrationen, sollten zur Desorganisation des Feindes führen.
Marx und Engels hatten den Begriff Terror oft gleichgesetzt mit Macht oder Gewalt im Allgemeinen. Marx ging anscheinend von dieser Vorstellung aus, als er sagte, revolutionärer Terrorismus sei die einzige Möglichkeit, den Todeskampf der alten Gesellschaft und die Geburtswehen der neuen zu verkürzen. Lenin war sehr viel vorsichtiger und lieferte eine Definition des Terrorismus als Einzelkampf im Gegensatz zur Massenaktion. Er bezeichnete terroristische Kampagnen als unsinnig, weil solche individuellen Gewaltakte nichts mit der Masse des Volkes zu tun hätten.
Hingegen lieferte die anarchistische Bewegung in Europa die Strategie der „Propaganda der Tat“, wie sie die Narodnaja Wolja praktiziert hatte. Das war eine Vorlage, die als äußerst nachahmenswert galt. Vier Monate nach dem Zarenmord fand in London ein Anarchistenkongress statt, auf dem das Attentat öffentlich bejubelt und der Tyrannenmord als Mittel des revolutionären Wandels gepriesen wurde. Doch letztendlich hatte der Anarchismus – trotz einer bemerkenswerten Serie von Morden und Bombenanschlägen auf Staatsoberhäupter – kaum merkliche Auswirkungen auf die Innen- und Außenpolitik der betroffenen Länder.
Clan na Gael (1873)
Neben dem Prinzip „Propaganda der Tat“ begann in den USA eine Entwicklung, die großen Einfluss auf die zukünftige Strategie und Taktik von Terroristen haben sollte. Die britische Herrschaft über Irland hatte eine lange Geschichte des Widerstandes und der Rebellion gezeitigt, und Mitte des 19. Jahrhunderts dehnten sich die revolutionären Aktionen von Irland auf die USA aus. In den irischen Organisationen in den USA entwickelte sich ein irisches Nationalbewusstsein, das durch die großen Einwandererzahlen noch gesteigert wurde. Nachdem 1858 die Irish Republican Brotherhood (IRB) in Dublin gegründet worden war, entstand in New York eine Schwesterorganisation: die Fenian Brotherhood, die für die Radikalisierung der irischen Einwanderer verantwortlich war. Sie glaubten an die Fähigkeit einer kleinen bewaffneten Vorhut, die das Volk in Irland aufrütteln und zu einem Aufstand führen könnte. Beide Organisationen waren entschlossen, aber ebenso ungeduldig wie unfähig. Sie forderten: „Revolution jetzt!“ Dem entsprachen ihre unausgereiften Pläne: Entführung des Prinzen von Wales, Eroberung Kanadas und Ausrufung eines Volksaufstands in Irland. 1865 wurde die IRB in Dublin von der Polizei aufgelöst, die Fenians gerieten in Vergessenheit.
Im Jahr 1873 übernahm in den USA eine neugegründete Organisation namens Clan na Gael („Vereinigte Iren“) die Aufgaben der Fenian Brotherhood. Treibende Kraft der neuen Organisation war Jeremiah O‘Donovan Rossa, der von den Briten ausgewiesen worden war. Unterstützung fand O‘Donovan bei Patrick Ford, dem Herausgeber der Zeitschrift Irish World. Die beiden entwickelten eine neue Strategie für die irische republikanische Bewegung. Für einen Aufstand sei es zu früh, doch ständige Scharmützel seien für die irische Sache sehr nützlich. Eine kleine Gruppe von Männern solle deshalb einen Guerillakrieg gegen die Briten beginnen. Als Skirmishers („Scharmützler“) sollten die Männer als unsichtbare Wesen bald in Irland, bald in Indien, bald in England zuschlagen.
O‘Donovan Rossa und Ford bewiesen ein ungewöhnliches Gespür für die Dynamik des Terrors: Beide erkannten, dass die Durchführung einer Terrorkampagne einer soliden finanziellen Grundlage bedürfe, um Erfolg zu haben. Bald erschienen denn auch Anzeigen, die um Spenden für einen „Skirmisher Fond“ warben. Rund ein Jahr später belief sich das Spendenaufkommen auf über 23.000 US-Dollar – nach heutigem Wert rund eine halbe Million Dollar.
Die Skirmishers
Die Skirmishers begannen am 14. Januar 1881 mit einem Bombenanschlag auf die Salford Infantry Barracks in Manchester. Bei diesem Anschlag wurde ein Kind getötet, drei Personen wurden verletzt. Es war nicht die Absicht der Skirmishers, unschuldige Menschen zu töten oder zu verletzen, aber die Iren nahmen es in Kauf, um ihr Ziel, der britischen Wirtschaft zu schaden, zu erreichen. Die sogenannte Dynamitkampagne – wie sie damals genannt wurde – traf London, Liverpool und Glasgow. Sie begann 1881, dauerte bis 1885 und war eine Art asymmetrischer Krieg, der sich gegen die britische Infrastruktur richtete. Es wurden nicht nur Bombenanschläge auf Regierungsgebäude, Kasernen oder Polizeistationen durchgeführt, sondern zum ersten Mal auch auf das Londoner U-Bahnnetz. Am 30. Oktober 1883 explodierten in den Stationen Paddington und Westminster Bridge jeweils Bomben, die insgesamt 70 Personen verletzten.
Die irischen Terroristen hatten erkannt, dass man eine Basis im Ausland haben muss, um sich dem Zugriff des Gegners zu entziehen. Eine ausländische Basis erleichterte und sicherte außerdem die Planung, die Logistik, die Propaganda und nicht zuletzt die Beschaffung finanzieller Mittel.
Sarajevo 1914: Ein Attentat, das die Welt veränderte
Die Ereignisse in Bosnien, die zum Ersten Weltkrieg führten, sind bekannt und aufgeklärt. Der terroristische Nationalismus hatte sich Ende des 19. Jahrhunderts in Europa entwickelt, wobei das Osmanische Reich und die Habsburger Doppelmonarchie besonders betroffen waren. Der Grundsatz der nationalen Selbstbestimmung, die Vorstellung, dass Nationen politisch souverän sein sollen, um ihre kulturellen Eigenarten zu verwirklichen, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Dieses Ziel der Nationalisten, sei es nun die Befreiung oder die Einigung einer Nation, ist nicht einfacher zu verwirklichen als ein revolutionärer Traum. Doch diese Idee hat die moderne Politik nachhaltig geprägt, wie auch das folgenreiche Attentat von Sarajevo im Jahr 1914 zeigt.
13. 7. 1894
Gavrilo Princip wird als eines von neun Kindern in Obljaj, Vilâyet Bosnien, geboren. Sein Vater ist ein bosnischer Serbe, der bei der Post arbeitet. Gavrilo ist klein und schwächlich, aber er gilt als intelligent. In Sarajevo besucht er das Gymnasium und wird Mitglied der Bewegung Mlada Bosna („Junges Bosnien“). Ziel der Bewegung ist es, das 1908 von Österreich-Ungarn annektierte Bosnien-Herzegowina zu befreien und dadurch die Bildung eines slawischen Staates zu erreichen.
Frühjahr 1912
Princip wird der Schule verwiesen, da er an einer regierungsfeindlichen Demonstration teilgenommen hat. Er zieht nach Belgrad, um dort die Schule zu beenden und anschließend zu
studieren. Während des Studiums, das er durch Hilfsarbeiten finanziert, gerät er an die 1908 gegründete serbische Nationalistenorganisation Narodna Odbrana, die Jugendliche für Attentate rekrutiert und finanziell sowie ideologisch „betreut“. Gavrilo und seine späteren Mitattentäter berauschen sich am Nationalismus. Ihr Vorbild ist der Student Bogdan Zerajic, der nach einem gescheiterten Attentat auf den Statthalter Österreich-Ungarns in Sarajevo am 15. Juni 1910 Selbstmord beging. Vojislav Tankosic, serbischer Offizier und Mitglied der Geheimorganisation Schwarze Hand, übernimmt Princips Betreuung.
Herbst 1912
Der Jugendliche meldet sich als Freiwilliger zum Balkankrieg, doch er wird wegen seiner schwachen Konstitution abgelehnt. Er beginnt nun Attentatspläne zu schmieden. Als Princip erfährt, dass Erzherzog Franz Ferdinand, österreichisch-ungarischer Thronfolger, nach den k.u.k.-Sommermanövern auch Sarajevo besuchen werde, entschließt er sich zum Attentat und kann drei seiner Freunde zum Mitmachen bewegen. Ein Untergebener seines Betreuers Vojislav Tankosic, wird Führungsoffizier der jugendlichen Verschwörer. In Belgrad werden sie für den Anschlag ausgebildet. Princip gilt als der beste Schütze.
26. 5. 1914
Mit vier Browning-Pistolen bewaffnet reisen die Verschwörer auf Umwegen nach Sarajevo. Dort stoßen vier weitere Verschwörer zu ihnen, die die Spuren der Attentäter verwischen sollen. Auch Mitglieder der Mlada Bosna sind als Helfer an dem geplanten Attentat beteiligt.
28. 6. 1914
Am Morgen – es ist sonnig – säumen zahlreiche Schaulustige die Fahrstrecke von Erzherzog Franz Ferdinand, die am Appel-Kai entlangführt. Rund 150 Polizisten sichern den Weg des Autokonvois; der Erzherzog fährt mit offenem Verdeck zum Empfang im Rathaus. Die sechs Attentäter haben sich einzeln entlang der Fahrroute postiert, die sie aus der Zeitung kennen.
10.26 Uhr
Der Autokorso erreicht den ersten Attentäter, der ihn aber ungehindert passieren lässt. Dem Attentäter zwei versagen die Nerven, er reagiert nicht. Attentäter drei zeigt sich kaltblütiger: Nedeljko Cabrinovic, ein Freund aus Princips Anfangszeit in Belgrad, schlägt die Zündkapsel seiner Bombe ab und wirft sie auf den dritten Wagen des Konvois. Doch die Bombe explodiert hinter dem Wagen – es gibt zwar einige Verletzte, doch der Erzherzog bleibt unverletzt. Er steigt aus und betrachtet den Anschlagsort.
10.30 Uhr
Der Konvoi fährt weiter zum Rathaus. Zurück bleiben die Attentäter, die nun ihre Pläne als gescheitert betrachten. Aus Sicherheitsgründen wird auf der Rückfahrt die Fahrtstrecke des Konvois geändert, doch erreichen diese Informationen die Fahrer nicht: Sie folgen der alten Route.
Das Zentrum von Sarajevo mit der Fahrtroute des Konvois und dem Ort des Anschlags
10.50 Uhr
Der Konvoi hält vor dem Feinkostgeschäft Moritz an und will wenden, um der neuen Route zu folgen. Ausgerechnet in diesem Geschäft will sich Princip eine Stärkung kaufen, als er plötzlich den Erzherzog auf der Straße erblickt. Kurzentschlossen zieht er die Pistole und schießt. Er trifft den Erzherzog in den Hals, seine Frau Sophie mit einem tödlichen Schuss in den Unterleib.
11.00 Uhr
Der österreichisch-ungarische Thronfolger stirbt.
Staatsterrorismus
Wie schon erwähnt, kommt der Begriff „Terror“ aus dem Lateinischen und bedeutet „Furcht, Angst, Schrecken“. Das heißt, der Begriff bezieht sich weniger auf die Gewaltanwendung selbst als eher auf die psychische Wirkung. Im 18. Jahrhundert findet der Begriff „Terror“ dann Eingang in die Umgangssprache und in den deutschen Sprachgebrauch. Damit bezeichnete man ganz konkret die Terrorherrschaft der Jakobiner in Frankreich. Diese Schreckensherrschaft, Régime de la Terreur oder kurz La Terreur genannt, war eine Periode der Französischen Revolution von Juni 1793 bis Ende Juli 1794. Um die konterrevolutionären Aufstände und Aktivitäten im Lande zu unterbinden, beschloss der Konvent am 5. September 1793 Terrormaßnahmen. Die Terrorherrschaft wurde vom sogenannten Wohlfahrtsausschuss geleitet, einem Gremium von zwölf Männern, geführt zunächst von Georges Danton und danach zunehmend von Maximilien de Robespierre. Dieser rechtfertigte den Terror, indem er dem Ziel diene, „das Volk durch Vernunft zu leiten und die Feinde des Volkes durch Terror zu beherrschen“. Vor dem Nationalkonvent erklärte er am 5. Februar 1794: „Der Terror ist nichts Anderes als unmittelbare, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit; er ist also Ausfluss der Tugend; er ist weniger ein besonderes Prinzip als die Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie in seiner Anwendung auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes.“
La Terreur forderte 35.000 bis 40.000 Todesopfer, die zumeist durch die Guillotine hingerichtet wurden. Nachdem Robespierre den Rückhalt in der Pariser Bevölkerung verloren hatte, wurde er verhaftet und am 27. Juli 1794 selbst hingerichtet. Damit endete in dieser Phase der Französischen Revolution auch die Terrorherrschaft. Ursprünglich hing der Terror also scheinbar mit den Idealen der Tugend und der Demokratie zusammen. Doch die politische Realität machte ihn zu einem Begriff, der mit dem Missbrauch von Macht eng verknüpft war.
Das faschistische Italien
Nach dem Ersten Weltkrieg war in Europa die Hinwendung zu einem autoritären Regierungssystem nichts Außergewöhnliches, denn während der sozialen Umbrüche der Nachkriegszeit sehnten sich die Bürger vieler Staaten nach einer starken Führungspersönlichkeit.
Die Faschisten in Italien verdanken ihren Aufstieg vorwiegend dem Terror der sogenannten Schwarzhemden, den faschistischen Kampfverbänden, die auch als Squadristi bekannt sind. Ziel ihrer Angriffe waren zunächst vornehmlich Sozialisten, die verprügelt oder auch erschlagen wurden; später besetzten die Schwarzhemden im Rahmen von Strafaktionen ganze Ortschaften. Der italienische Faschismus setzte ganz offen auf Gewalt, um das parlamentarische System zu stürzen und die Macht im Staat zu ergreifen – und zu sichern. Doch die Faschisten stritten ab, dass diese Gewalt Terrorismus sei. Sergio Panunzio, der führende italienische Ideologe, der nach 1922 wichtige Teile der faschistischen Staatslehre formuliert hatte, unterschied sorgfältig zwischen erlaubter und nicht erlaubter Gewalt: Erlaubt war die Gewalt, die für die Durchsetzung revolutionärer Ziele notwendig war. Entsprechend wurde Gewalt nur gegen Feinde des Faschismus eingesetzt. Die potenziellen Opfer konnten der Gewalt ausweichen, indem sie ihre politische Haltung änderten: Gewalt sollte einschüchtern und nicht erdrücken. Panunzio definierte Terrorismus als Gewalt, die sich gegen Unschuldige richtet, und solch eine willkürliche Gewaltanwendung sei nicht gestattet. Denn die Opfer hätten keine Möglichkeit, ihr Verhalten zu ändern, um der Gewalt zu entgehen. Diese Definition wurde nach der Machtübernahme der italienischen Faschisten im Großen und Ganzen auch eingehalten.
Das nationalsozialistische Deutschland
Auch Hitlers Machtübernahme wurde – wie in Italien – von Straßenkämpfen durch Schlägertrupps befördert. In Deutschland waren es die Braunhemden, wie man die Sturmabteilung (SA) der nationalsozialistischen Partei nannte. Von anderen diktatorischen Systemen unterschieden sich die Nationalsozialisten durch die Vehemenz und die Brutalität, mit der sie ihren Machtanspruch durchsetzen. In kurzer Zeit gelang es ihnen, durch das Zusammenspiel von Terror und Propaganda die angestrebte Diktatur zu errichten. Politisch Andersdenkende wie auch Personen, die dem sogenannten „Rasseideal“ nicht entsprachen, wurden verfolgt, gefoltert und in die ab März 1933 gegründeten Konzentrationslager geschickt. Einen Tag nach dem Reichstagsbrand wurde eine Notverordnung in Kraft gesetzt, die die Grundrechte aussetzten und eine unbegrenzte „Schutzhaft“ legalisierte. Von staatlicher Seite wurde ein System der Furcht und des Zwanges geschaffen: Krawalle, Straßenkämpfe, die Verfolgung von Kommunisten, Juden und anderen Menschen, die man zu Staatsfeinden erklärt hatte, waren die Mittel, mit denen man eine vollständige Unterwerfung unter die Ideologie erreichen wollte.
Trotzdem ist es fraglich, ob die Aktionen der Nationalsozialisten gegen die Juden als terroristisch bezeichnet werden können, obwohl sich dies mit dem Argument eingebürgert hat, Hitler habe die Juden terrorisiert, um sie zu unterwerfen. Doch das Problem eines jüdischen Widerstandes gab es für Hitler gar nicht, und aufgrund der NS-Gesetze hatten die Juden auch keine Möglichkeit, sich dem System anzupassen. Den Nationalsozialisten ging es nicht um eine politische, religiöse oder ideologische Konformität, sondern um das NS-Rassenideal, die „Reinheit der Arischen Rasse“. Diesem Ideal zu entsprechen war den Juden aus biologischen Gründen verwehrt. Deshalb war das Ziel der Nationalsozialisten ihre Vernichtung.
Die Sowjetunion unter Stalin
Der von Stalin inszenierte Große Terror erreichte 1937/38 seinen Höhepunkt: Mehr als 1,5 Millionen Menschen wurden verhaftet, 750.000 von ihnen hingerichtet. Wohl von Hitler inspiriert, formte er in ähnlicher Weise die von ihm geführte Partei in ein Instrument nach seinem Willen um: Staatspolizei und Sicherheitsapparat wurden folgsame Organe der Zwangsherrschaft und der Unterdrückung. Der Terror gegen Andersdenkende hatte aber schon bald nach der russischen Revolution 1917 begonnen. Lenin empfahl in seinem berüchtigten Dekret „Über den Terror“ vom 5. September 1918 systematische Terrormaßnahmen gegen den Klassenfeind. Konzentrations- und Straflager für politisch Andersdenkende, die rücksichtslos verfolgt, verhaftet, gefoltert und getötet wurden, richtete man schon zu Lebzeiten Lenins ein.
Es war dann Stalin, der den Terrorapparat in einen Vernichtungsapparat umwandelte. Als „Säuberungsmaßnahmen“ bezeichneten die Stalinisten die Verfolgung und Liquidierung von Bauern, unbotmäßigen und renitenten Parteikadern, Teilen der Roten Armee und ethnischen Minderheiten. Der Terror hatte Stalin zum unumschränkten Alleinherrscher über Russland gemacht. Seine Säuberungen wurden nicht in einer Krisenzeit, einer Revolution oder während eines Krieges eingeleitet, sondern in einer für die Sowjetunion relativ ruhigen Periode. Das ist der Unterschied zum Staatsterrorismus des Terreur während der Französischen Revolution. Die Terrormaßnahmen Stalins dienten zur Sicherung der totalen Macht; dies führte für Millionen zur Gefangenschaft, zur Zwangsarbeit, zum Exil und zum Tod. Diese Repression oder Unterdrückung gilt als der Höhepunkt in einer Kette von stalinistischen Säuberungsaktionen.
Quellen: Geschichtliche Entwicklung
A: Bücher
Hoffman, Bruce, Terrorismus, der unerklärte Krieg, Frankfurt a. M. 2001
Laqueur, Walter, The Age of Terrorism, Boston, Mass. 1982
Townshend, Charles, Terrorismus, Stuttgart 2005
Waldmann, Peter, Terrorismus, Provokation der Macht, Hamburg 2011
B: Zeitungen, Zeitschriften
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/147468/benito-mussolini-kommt-an-die-macht-30-10-2012
[Abruf 17.02.2022]
http://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime
[Abruf 17.02.2022]
http://www.planet-wissen.de/geschichte/diktatoren/stalin_der_rote_diktator/pwiedergrosseterror100.html
[Abruf 17.02.2022]
Kapitel 2
Nationalismus und Freiheitskriege
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff Terrorismus weltweit vornehmlich für gewaltsame Aufstände benutzt, die von einheimischen nationalistischen oder antikolonialistischen Gruppen initiiert wurden. Diese Aufstände zogen sich – vor allem in den 1940er- und 1950er-Jahren – vom Nahen Osten über Afrika bis nach Asien und richteten sich gegen die europäischen Kolonialmächte, in der Hauptsache gegen Großbritannien und Frankreich. Die unterschiedlichsten Länder, wie etwa Israel, Zypern oder Algerien, verdanken ihre Unabhängigkeit zumindest teilweise nationalistischen politischen Bewegungen, die den Terrorismus gegen die Kolonialmächte einsetzten.
Viele der Aufstände entwickelten sich zu Befreiungskriegen. Terroristen wurden die Aufständischen allgemein nicht genannt: Als politisch korrekte Bezeichnung setzte sich der Begriff Freiheitskämpfer für solche Gruppen durch. „Der Unterschied zwischen dem Revolutionär und dem Terroristen“, so Jassir Arafat, der Präsident der PLO vor der UN-Vollversammlung im November 1974, „liegt in dem Grund, warum er kämpft. Denn wer immer sich für eine gerechte Sache und für die Befreiung seines Landes von Eindringlingen, von Siedlern und Kolonisten einsetzt, kann unmöglich als Terrorist bezeichnet werden.“ (Hoffman, Terrorismus, der unerklärte Krieg, S. →)
Israel (1931 bis 1948): Kampf um eine nationale Heimstätte
Das britische Mandatsgebiet Palästina 1920
Im Jahr 1920 erhielt Großbritannien ein Völkerbundmandat über die Palästina genannte Region, die es im Ersten Weltkrieg dem untergehenden Osmanischen Reich abgenommen hatte. Die internationale Organisation der Zionisten wie auch die Mehrheit der damals in Palästina lebenden jüdischen Gemeinschaften verließ sich auf Großbritannien, das 1917 in der Balfour-Deklaration zugesichert hatte, sich für die Errichtung einer nationalen Heimstätte für die Juden in Palästina einzusetzen. In letzter Konsequenz waren sich die Briten wohl weder des Ausmaßes der damit verbundenen Folgen noch der bevorstehenden Schwierigkeiten bewusst.
1920 begannen arabische Angriffe auf jüdische Siedlungen, die dazu führten, dass eine Verteidigungsarmee aufgestellt wurde, die Haganah. Die Alternative hieß: Entweder das Projekt einer nationalen Heimat aufgeben oder es mit Gewalt verwirklichen. Die britische Politik, trotz der Ermordung von Millionen europäischer Juden nur eine begrenzte Einreise in das Mandatsgebiet zuzulassen, führte bei der Mehrheit der Zionisten zu der Auffassung, man müsse sich für die Option „Gewalt“ entscheiden.
Aufstände gegen die Briten
In Palästina brachen Aufstände gegen die britische Mandatsmacht aus. Zunächst war es einer von arabischer Seite, der von September 1937 bis Januar 1939 andauerte. Während dieses Aufstandes hängten die Briten über 100 Araber und sprengten deren Häuser. Weitere Aktionen wurden von einer Gruppe Zionisten organisiert, die die Haganah mehr als britische Hilfspolizei sah und sich daher 1931 abgespalten hatte und als Irgun Z‘vai Leumi („Nationale Militärorganisation“) Operationen gegen Araber und Briten durchführte. 1940 spaltete sich eine Gruppe von der Irgun ab, die Lochamei Cherut Israel („Kämpfer für die Freiheit“), kurz Lechi. Die Lechi, nach ihrem Gründer Avraham Stern auch Stern-Gang genannt, führten nur Anschläge gegen die britische Mandatsverwaltung durch. Die Taten der Irgun und der Lechi gelten als Beispiele für wirkungsvollen Terrorismus, d. h. für einen Terrorismus, der seine politischen Ziele erreicht.
Die Bezeichnung Terrorist wurde von den Lechi akzeptiert. Sie erklärten, dass Terror Teil der aktuellen Kriegführung sei, obwohl man sich der Möglichkeiten und der Grenzen bewusst war. In ihrer Untergrundzeitschrift HeChazit war 1943 zu lesen: „Falls die Frage lautet: Kann Terror die Befreiung bringen? So heißt die Antwort: Nein! Falls die Frage lautet: Bringen uns diese Aktionen der Befreiung näher? So heißt die Antwort: Ja!“ Auch die Funktion des Terrors wird erläutert: „Er richtet sich nicht gegen Individuen, sondern gegen Repräsentanten, und bezieht daraus seine Wirkung. Und wenn er außerdem noch die Bevölkerung aus ihrer Selbstzufriedenheit aufrüttelt, dann umso besser.“ (Townshend, Eine kurze Einführung, S. → f.)
Der Anschlag auf das King David Hotel
Im Dezember 1943 übernahm Menachem Begin – er wurde 1977 Ministerpräsident Israels – die Untergrundorganisation Irgun und beschloss, den Aufstand gegen die Briten fortzusetzen. Nach der britischen Kriegserklärung vom 3. September 1939 an Deutschland stellte die Irgun alle Aktionen gegen britische Ziele ein. Erst im Februar 1944 begann sie wieder mit Angriffen auf Regierungsund Verwaltungseinrichtungen, die die britische Herrschaft über Palästina symbolisierten. In den drei Städten Jerusalem, Tel Aviv und Haifa erfolgten gleichzeitig Bombenanschläge auf die Einwanderungsbehörden. Die nächsten Bombenanschläge richteten sich gegen die Grundbuchämter und anschließend gegen die Finanzämter. Anlass für diese konzertierte Aktion war das im Mai 1939 veröffentlichte britische Weißbuch, gemäß dem nur noch 15.000 Juden jährlich in den folgenden fünf Jahren einreisen dürften. Außerdem sei die illegale Einwanderung zu verhindern und der Landverkauf zu verbieten. Die Bombenattentate sollten die im Weißbuch geforderten Maßnahmen unterlaufen. Am 6. November 1944 ermordeten zwei Mitglieder der Lechi in Kairo den britischen Militärgouverneur Lord Moyne. Die Täter wurden 1945 zum Tode verurteilt und hingerichtet. 1946 erfolgte dann der wohl spektakulärste Anschlag der Irgun auf das King David Hotel in Jerusalem.
Juni 1946
Das King David Hotel in Jerusalem gehört zu den berühmtesten Hotels der Welt. Die Bars und Salons werden von Diplomaten, britischen Offizieren, amerikanischen Politikern und Vertretern der zionistischen Jewish Agency wie auch von Arabern und Waffenhändlern frequentiert. Die Lounge soll an biblische Zeiten erinnern: Marmor-Ornamente, riesige Holztüren und eckige Lederstühle nach dem Vorbild von Hethiter-Thronsesseln. Nachmittags spielt dort ein europäisches Streichquartett, Kellner in sudanesischer Tracht servieren Tee. Im Südflügel des Hotels befinden sich die Diensträume der Royal Signals, des militärischen Hauptquartiers der Briten. Der Anschlag auf das Hotel mit dem Codenamen „Unternehmen Chick“ ist eine Reaktion auf die britische Operation Agatha gegen die Jewish Agency, bei der am sogenannten „Schwarzen Sonntag“ kompromittierende Dokumente beschlagnahmt wurden. Die Haganah, die dem Anschlag zunächst zugestimmt hat, hat ihre Zustimmung widerrufen, doch Begin ist lediglich bereit, den Angriff von 11.00 Uhr auf 12.00 Uhr zu verschieben. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Als Araber verkleidet sollen die Irgun-Kämpfer durch den Personaleingang im Untergeschoss den Sprengstoff, der in Milchkannen versteckt ist, zu den Hauptstützpfeilern des Südflügels bringen. Diese Pfeiler befinden sich ebenfalls im Untergeschoss, im Nachtclub Régence.
22. Juli 1946 07.00 Uhr
Die neun Attentäter treffen sich. Erst jetzt erfahren sie den Zielort und erhalten Waffen. Die sogenannte „Trägergruppe“ fährt mit dem Bus zu dem Hotel und wartet am Personaleingang. Mit einem Kleinlaster werden 350 kg Sprengstoff, auf sieben Milchkannen verteilt, zum Hotel gebracht. In dem Laster sitzt auch der Leiter der Operation, als Hotelkellner verkleidet.
Bei dem Transport der Milchkannen durch das Hotel müssen die Attentäter an den Diensträumen der Royal Signals vorbei. Durch den Lärm angelockt, tritt ein Soldat auf den Flur und wird sofort von einem Attentäter niedergeschossen, wie auch ein Polizist, der zu Hilfe eilen will. Die Attentäter bringen die Milchkannen zu den entsprechenden Stützpfeilern, der Zeitzünder wird auf 30 Minuten eingestellt. Bei ihrem Rückzug werden zwei Attentäter angeschossen, einer von ihnen erliegt seinen Schussverletzungen später. Bei Verlassen des Hotels zünden die Attentäter auf einer Straße eine kleine Bombe, um Gäste aus dem Hotel zu locken.
12.00 Uhr
Etwa eine halbe Stunde vor dem Anschlag sind die Briten, das Hotel und auch die Zeitung Palestine Post telefonisch vor einem Bombenattentat gewarnt worden. Die Briten ignorieren die Warnung, doch der Hotelmanager lässt einen großen Teil des Personals evakuieren.
12.37 Uhr
Die Bomben detonieren. Der westliche Teil des Südflügels stürzt ein. 91 Menschen sterben, 46 werden verletzt. Die hohe Anzahl von Toten ist nach einem Polizeibericht darauf zurückzuführen, dass die Ablenkungsbombe, die Hotelgäste anlocken sollte und auch anlockte, an der Südwestecke des Hotels gezündet wurde – in unmittelbarer Nähe der Hauptexplosion.
Anders als bei vielen terroristischen Gruppen der Gegenwart zählte es nicht zu den strategischen Zielen der Irgun, bewusst auf Zivilisten zu zielen und diesen Schaden zuzufügen. Gleichzeitig jedoch können die Behauptungen von Begin und anderen Mitstreitern, es seien Warnungen ergangen, die dazu aufforderten, das Hotel vor der Sprengung zu räumen, weder die Gruppe noch den Kommandeur von der Verantwortung für den Tod von 91 Menschen und 45 Verwundeten freisprechen: Männer und Frauen, Araber, Juden und Briten gleichermaßen. Welche nichttödlichen Absichten die Irgun auch gehabt haben mag, es bleibt eine Tatsache, dass sich im King David Hotel eine Tragödie von beinahe einzigartigem Umfang ereignete, sodass dieser Bombenanschlag bis heute in dem zweifelhaften Ruf steht, einer der verheerendsten Einzelanschläge von Terroristen im 20. Jahrhundert gewesen zu sein.
Die Briten reagierten drastisch: Für Jerusalem verhängten sie den Ausnahmezustand, und während der viertägigen Razzien wurden etwa 800 Juden verhaftet; doch keiner gehörte der Irgun an oder war an dem Attentat beteiligt. Zwischen der Irgun und der Haganah kam es zum Bruch: Die Haganah stoppte alle Angriffe auf die Briten und konzentrierte sich auf die Organisation der (illegalen) Einwanderung von Juden nach Palästina. Die Irgun dagegen verübte weiterhin Terroranschlä-ge auf die Briten, aber auch auf Araber. So kam es am 9. April 1948 in dem arabischen Dorf Deir Yasin unweit von Jerusalem zu einem Massaker.
Angriff auf Deir Yasin
Der Angriff auf die Ortschaft Deir Yasin, bei dem Mitglieder der Irgun und der Lechi die einheimische Bevölkerung niedermetzelten, muss im Zusammenhang mit dem israelisch-arabischen Bürgerkrieg gesehen werden. Am 29. November 1947 hatte die UN-Vollversammlung mit Zweidrittelmehrheit die Teilung des britischen Mandatsgebiets beschlossen: Es sollte in einen jüdischen und einen arabischen Staat aufgeteilt werden. Den 1,3 Millionen Arabern wurden etwa 43 Prozent und den etwa 600.000 Juden gut 56 Prozent des Landes zugeteilt. Die jüdische Bevölkerung nahm den Plan an, die im Mandatsgebiet ansässigen Araber und die arabischen Staaten lehnten ihn ab.
Verbände der Haganah starteten am 5. April 1948 die Operation Nachschon, mit der die arabische Blockade Jerusalems beendet werden sollte. Deir Yasin war zwar durch seine Nähe zu Jerusalem und seine erhöhte Lage ein strategisch günstiger Ort, spielte aber für den Kampf um Jerusalem keine Rolle. Der Angriff auf das Dorf erfolgte denn auch nicht durch die Haganah, sondern durch etwa 120 militärisch ungeschulte und schlecht bewaffnete Kämpfer der Irgun und der Lechi. Die Bevölkerung wurde gewarnt, ein Fluchtkorridor offengelassen; doch nur 200 der 600 Bewohner nutzten diese Möglichkeit. Aus den Häusern wurde das Feuer auf die vordringenden jüdischen Untergrundkämpfer eröffnet, und diese warfen Handgranaten durch die Fenster. Die Aktion dauerte mehrere Stunden. Es sollen 254 Dorfbewohner getötet worden sein; die genaue Anzahl konnte nicht ermittelt werden. Israelische wie auch palästinensische Historiker gehen heute von 100 bis 120 toten Dorfbewohnern aus. Nachdem es zuvor schon in Kissas und Sassa zu Gräueltaten gekommen war, liegt die Vermutung nahe, dass diese Angriffe eine Zwangsumsiedlung auslösen sollten. Heute wird auch von jüdischen Autoren der Standpunkt vertreten, dass der jüdisch-arabische Bürgerkrieg durchaus mit der systematischen Vertreibung der arabischen Bevölkerung verbunden war.
Gründung Israels
Am Freitag, den 14. Mai 1948, endete um Mitternacht das britische Mandat über Palästina. Acht Stunden zuvor, um 16.00 Uhr, war der Jüdische Nationalrat zusammengetreten. David Ben-Gurion, Vorsitzender der Volksverwaltung und designierter erster Ministerpräsident, verkündete die Unabhängigkeit und Gründung des Staates Israel, kraft des natürlichen und historischen Rechts des jüdischen Volkes auf dieses Land und aufgrund des Beschlusses der UN-Vollversammlung. Am folgenden Tag griffen Truppen aus dem Libanon, Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Irak Israel an: Der erste israelisch-arabische Krieg, der Erste Palästinakrieg, hatte begonnen.
Hat der Terror der Irgun unter Menachem Begin die Gründung des Staates Israel herbeigebombt? Wohl nicht in dieser Absolutheit, aber es war Begin gelungen, das Prestige der Briten in Palästina zu schwächen, und sein Kalkül, Großbritannien zu demoralisieren, ging auf. Seine Strategie erläuterte er folgendermaßen: „Bereits die bloße Existenz eines Untergrunds muss am Ende das Prestige einer Kolonialmacht unterminieren, das von der Legende seiner Allmacht lebt.“ (Hoffman, Terrorismus, der unerklärte Krieg, S. →)
Begin war der Meinung, der Irgun habe die Kampfmethoden der Städtischen Guerilla geschaffen und die Engländer aus dem Lande gejagt. Doch das Hauptmotiv für den britischen Rückzug aus Palästina wird aus offiziellen Dokumenten deutlich, die in den 1970er-Jahren in London veröffentlicht wurden. Der Rückzug, so das britische Außenministerium, sei erfolgt, um Englands strategische und politische Allianz mit den USA nicht zu gefährden – und Amerika wünschte nun einmal die Bildung eines unabhängigen jüdischen Staates. Das war eine innenpolitische Entscheidung der Amerikaner, und besonders Präsident Trumans. Im Herbst 1948 standen Präsidentschaftswahlen an, und Truman wollte wiedergewählt werden. Es ging einerseits darum, die 4,6 Millionen jüdischen Stimmen zu gewinnen, und andererseits die jüdische Einwanderung in die USA zu verringern, da es im Lande starke anti-jüdische Strömungen gab.
Zypern (1951 bis 1960): Unabhängigkeit statt Vereinigung
Der Terror der Irgun hatte ein Muster geschaffen, das bei späteren antikolonialen Aufständen erfolgreich genutzt werden konnte. Die erfolgreichsten Unabhängigkeitskämpfe oder -kriege der Nachkriegszeit folgten der Strategie von Begin – sicherlich nicht bewusst, sondern wohl eher intuitiv. Es gibt keine Hinweise, dass der zypriotische General Grivas oder auch der Algerier Ben Bella jemals Begins Buch The Revolt gelesen hatten. Ob nun EOKA, die Nationale Organisation zypriotischer Kämpfer, in Zypern oder FLN, die Nationale Befreiungsfront in Algerien – beide Gruppierungen versuchten, die internationale Öffentlichkeit zu erreichen, um Aufmerksamkeit und auch Sympathien auf sich zu ziehen. Grivas wollte die „Augen der Welt auf Zypern lenken“, und die FLN nannte als eines ihrer Hauptziele, die „Internationalisierung der algerischen Frage“.