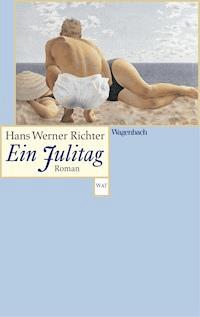Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hinstorff
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Chronist Deutschlands: Hans Werner Richter Als Gründer der einflussreichen Gruppe 47 ist Hans Werner Richter aus der deutschen Literaturgeschichte nicht wegzudenken. Nun sind zwei Werke wieder lieferbar, die seinen engen Bezug zu Vorpommern, wo er geboren wurde, zeigen. 'Spuren im Sand' aus dem Jahr 1953 erzählt, weitgehend autobiografisch, die Geschichte einer Jugend auf Usedom. 'Mag die Zeit, von der der Autor erzählt, auch vorbei sein, verloren ist sie keineswegs', schreibt Siegfried Lenz in seinem Nachwort. Im 1990 erschienenen Band 'Deutschland deine Pommern' macht sich Hans Werner Richter auf die humorvolle Suche nach 'den' Pommern und spürt Erlebnisse, Anekdoten und erdachte Gespräche auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Werner Richter wurde 1908 in Bansin auf Usedom geboren. Er absolvierte eine Buchhändlerlehre und arbeitete als Buchhändler und für Verlage. Als Soldat der Wehrmacht verbrachte er mehrere Jahre in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. 1947 gründete sich die Gruppe 47, das wichtigste literarische Forum Westdeutschlands, das er dreißig Jahre lang leitete. Er veröffentlichte u. a. die Romane Die Geschlagenen, Sie fielen aus Gottes Hand, Du sollst nicht töten und Bestandsaufnahme. Hans Werner Richter starb 1993 in München.
Spurenim Sand
Hans WernerRichter
Roman einer Jugend
Meiner Mutter
Inhalt
Spuren im Sand
Nachwort von Siegfried Lenz
Als ich geboren wurde, machte der Kaiser noch seine Nordlandfahrten, trugen die Männer des Dorfes, in dem ich den ersten Schrei ausstieß, den Es-ist-erreicht-Schnurrbart, gab es noch die klingenden Taler und das goldene Zwanzigmarkstück. Der Ort war ein aufblühendes Seebad, und wenn der Kaiser Ende August, nicht weit davon entfernt, von seiner kaiserlichen Jacht an Land stieg (damals stieg man noch an Land), versäumte er es nie, unseren Ort zu besuchen und sich huldvoll seinen Untertanen zu zeigen. »Der Kaiser kommt!« hieß es dann, und alles lief auf die Straße. »Ta-tü-tata«, schrie die kaiserliche Autohupe, wobei »ta« »der«, »tu« »Kaiser« und »tata« »kommt« hieß.
Damals stand meine Mutter noch an einem Waschzuber und wusch Tag für Tag die feine Leinenwäsche der adligen Gäste unseres Ortes; mein Vater war Bademeister und rettete in jedem Sommer ein oder zwei leichtsinnige Personen, meist weiblichen Geschlechts, vor dem Tod des Ertrinkens. Der Tod des Ertrinkens war die einzige Art des Todes, die ich damals kennenlernte, und jahrelang schien es mir so, als könne man nur ertrinkend ums Leben kommen. Zwar jagte mein Vater mich immer davon, wenn er gerade wieder einen Halbtoten an den Strand zog; aber es gelang mir fast immer, zwischen seine Beine zu kriechen, um von dort aus einen Blick auf das grün und blau angeschwollene Gesicht des Halbertrunkenen zu werfen.
Mein Vater hatte bei den Ulanen in Prenzlau gestanden, und auch er trug den wachsgezwirbelten kaiserlichen Schnurrbart, dessen zitternde Spitzen bis an die Augenwinkel reichten. Er hielt sich stramm, wie sich alle damals stramm hielten, mit durchgedrücktem Kreuz und stolzem, geradeaus gerichtetem Blick. Etwas von dem Stolz und der Macht des Kaiserreichs war um ihn. Er konnte nicht schwimmen und war doch Bademeister – aber was machte das schon, angesichts von soviel Haltung und Würde, die damals überall zum Ausdruck kam. Mit aufgekrempelten Hosen stand er barfuß auf der Treppe der Badeanstalt, eine Art Autohupe in der linken Hand, und sah aufs Meer hinaus. Wenn jemand zu weit hinausschwamm, führte er die Hupe an den Schnurrbart, plusterte die Backen auf und gab einen schauerlichen Ton von sich. Mir erschien es dann, als beruhige sich das Meer unter diesem gewaltsamen, herrischen Ton meines Vaters augenblicklich.
Damals war das Meer, das heißt ein Stück des Meeres, noch für die Badenden abgezäunt und mit Stacheldraht und Planken begrenzt, so dass eigentlich niemand weit hinausschwimmen konnte; aber es war anscheinend eine Zeit der verbotenen Wege, und so gelang es immer einigen Verwegenen, das offene Meer zu erreichen. Meinem Vater missfielen diese Leute außerordentlich, denn er hatte nun einmal bei den Ulanen in Prenzlau gestanden und das Gehorchen gelernt. Er amtierte in einem Familienbad. Es gab außerdem noch ein Herren- und ein Damenbad, denn damals wurden die Geschlechter noch säuberlich voneinander getrennt.
Das war mein Vater. Er hatte, wie die meisten Väter im Ort, acht Kinder, und einige hatten zehn oder zwölf. Es war eine Zeit des Überflusses. Der Kaiser ging mit einem gesunden Geburtenüberschuß voran – und alle, alle folgten ihm. Es herrschte Ruhe und Ordnung, und auch in unserem Ort gab es eine feststehende Hierarchie, die mit dem Gemeindevorsteher und Feuerwehrhauptmann begann und mit dem ärmsten Waldarbeiter endete.
Eines Nachmittags, und dieser Nachmittag gehört zu meinen ersten unklaren Erinnerungen, saß ich zu Füßen meiner Mutter, die an einem Plättbrett stand und bügelte, als eine Frau mit einem hochgeschnürten Busen eintrat und mit meiner Mutter ein Gespräch begann.
»Anna«, sagte sie, »was ist denn nun mit Richard?«
»Was soll schon mit Richard sein?«
»Der Großherzog ist doch dagewesen?«
»Du meinst den Großherzog von Mecklenburg?«
»Ja … und die Tochter … ?«
»Die …«, sagte meine Mutter, »… die hatte zu viel Wasser geschluckt, und Richard hat sie rausgeholt.«
»Na, nun werdet ihr ja reich werden.«
»Einen Taler hat er bekommen«, sagte meine Mutter, zuckte die Schultern und stellte das Bügeleisen auf einen Teller.
»Ach Rosa«, begann sie wieder, »jetzt bin ich mal wieder soweit.«
»Was ist denn?«
»Na ja, du weißt doch, die Männer lassen einen nicht in Ruh’.«
»Was«, sagte die hochgeschnürte Rosa, »schon wieder? Seit wann denn?«
»Im dritten Monat«, sagte meine Mutter.
So erfuhr ich, dass es einen Großherzog von Mecklenburg gab, dessen Tochter mein Vater für drei Mark gerettet hatte, dass die Männer die Frauen nicht in Ruhe lassen und dass man im dritten Monat sein konnte. Jene hochgeschnürte Frau namens Rosa hieß School mit Nachnamen, und ihr Mann Heinrich hatte nicht weit von uns einen Kolonialwarenladen und fast eben so viel Söhne und Töchter wie mein Vater.
Der Ort lag am Meer, in einer weitgeschwungenen Bucht, mit Steilküsten, Buchen- und Tannenwäldern, und einer, wie im Badeprospekt stand, ozonreichen Luft. Es war ein kleiner Ort, mit etwa 500 Einwohnern, und seine Häuser, am Strand noch drei- und vierstöckig, wurden etwa einen Kilometer landeinwärts immer kleiner, bis hin zu den armseligen Hütten der Fischer. Die Sozialdemokratie, damals noch eine revolutionäre Partei, war noch nicht bis ans Meer gedrungen. Mein Vater war noch stolz darauf, herrschaftlicher Diener auf einem Gut in Hinterpommern gewesen zu sein, und meine Mutter wusch mit Hingabe die Unterwäsche der Baroninnen und Komtessen, die im Sommer kamen, um sich unter der Aufsicht meines Vaters und seiner Kollegen ins salzhaltige Ostseewasser zu begeben. Damals gab es noch keine Strandkörbe, sondern nur Badehütten, und der Strand war deshalb nur spärlich beflaggt. Aber auf den drei Bädern – schlossähnlichen Bretterbauten mit Zinnen und Türmen – wehte die schwarzweißrote Flagge und die Reichskriegsflagge. Sie kündeten von der kaiserlichen Macht und von der Ruhe und Ordnung im Lande, und oft kam es mir vor, als ständen sie ebenso wachssteif im Wind wie der Schnurrbart meines Vaters, der jeden Morgen vor dem Spiegel balsamiert und hochgezwirbelt wurde.
An jenem Nachmittag nun, an dem ich erfahren hatte, dass man im dritten Monat sein konnte und dass der Großherzog von Mecklenburg meinem Vater einen Taler für die Errettung aus Badenot gegeben hatte, erschien auch unser Gemeindevorsteher, ein ehemaliger Offizier niederen Ranges, und gratulierte meinem Vater, der dabei verlegen an seinen Schnurrbartenden zupfte. »Sie haben sich um das Reich verdient gemacht«, sagte der Gemeindevorsteher, wobei seine Lippen unter dem Bart feucht wurden. Er trug einen anderen, anscheinend älteren Bart als mein Vater. Er spross an den Backen entlang und nannte sich noch nach Kaiser Wilhelm dem Ersten. Nachdem der Gemeindevorsteher gegangen war, zog mein Vater sich die Feuerwehrlitewka an und wollte hinausgehen.
»Wo willst du hin?« fragte meine Mutter, die immer noch am Plättbrett stand und bügelte.
»Mal sehen«, antwortete mein Vater, »ist ja ein großer Tag heute.«
»Wieso großer Tag? Für einen Taler hast du die aus dem Wasser gezogen – und jetzt auch noch feiern?«
»Lass man, Anna, war ja auch die Tochter des Großherzogs. So ein Glück, was? Ganz weiß war sie wie die Wand.«
»So hochgeboren«, sagte meine Mutter, »und so geizig.«
»Geizig?«
»Na, ist das nicht geizig, das ganze Leben für einen Taler?«
Aber mein Vater ließ sich nicht beirren. Er ging hinaus, die Kellertreppe empor, und ich sah ihn an unserem Hause entlangschreiten, aufgerichtet, mit durchgedrücktem Kreuz, ein Bademeister und Ulan vom Scheitel bis zur Sohle.
»Lass ihn gehen«, sagte meine Mutter, »er wird sich schon noch die Hörner abrennen.«
Ich merkte, dass sie traurig war, und versuchte deshalb, von unten in ihr Gesicht zu sehen, aber ich konnte es nicht erkennen. Vor mir hing, von dem Plättbrett herab, ein Damenbeinkleid, mit Spitzen und Rüschen reich besetzt, und es sah wie eine lange, ornamentierte Röhre aus. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen, als dass es der Tochter des Großherzogs gehöre. Ich zupfte an dem Rock meiner Mutter und sagte:
»Gehört das der Tochter des Großherzogs, Mutti?«
»Ich weiß nicht«, antwortete sie, »irgend so einer wird es schon gehören, irgendeinem von diesen Dämchen, die sich für drei Mark aus dem Wasser ziehen lassen und die hochgeborenen Augen verdrehen, als ob sie etwas Besonderes wären. Aber sie sind gar nichts Besonderes; sie kriegen auch Kinder, sind dann auch im dritten Monat und schreien genauso wie wir dabei.«
Meine Mutter hatte anscheinend vergessen, dass ich unter dem Plättbrett saß. Sie sprach wie zu sich selbst und setzte dabei das Bügeleisen hart und energisch auf das Damenbeinkleid.
Es mag ein Jahr später gewesen sein, als Rosa School mit wogendem Busen und hochgeröteten Backen in das Hinterzimmer ihres Kolonialwarenladens trat. Ich saß weinend neben ihrem jüngsten Sohn Willi, der mir hinterlistig eine Strähne aus meinem Haar geschnitten hatte. Das Sofa, auf dem wir saßen, roch nach Thymian, Petersilie und Bohnenkraut, und auf der Lehne lag ein schwarzweißrot gesticktes Kissen. Heinrich, Rosas Mann, lang und hager und fast immer mit einem glänzenden Tropfen an der Nasenspitze, saß an einem Tisch und rechnete. Rosa blieb vor ihm stehen und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich erinnere mich, dass es eine fleischige, wulstige Hand war und dass der Ehering auf dem Ringfinger tief eingekerbt, wie überwachsen, im Fleisch saß.
»Was ist mir dir, Rosa?«
»Es ist soweit, Heinrich«, sagte Rosa, und sie nahm die Hand von der Schulter und legte sie auf seinen Scheitel.
Wir beide, Willi und ich, begannen noch lauter zu weinen, aber Rosa ließ sich dadurch nicht beirren.
»Ach, Heinrich«, sagte sie, »unser armer Kaiser.«
»Was ist mit unserem Kaiser?«
»Es geht los, Heinrich, die Franzosen, dieses Pack …«
»Wie?« sagte Heinrich.
»Die Franzosen!« schrie Rosa plötzlich und begann ebenfalls zu weinen.
»Was ist mit den Franzosen, Rosa?«
»Sie wollen unseren armen Kaiser nicht leben lassen. Sie sind neidisch auf uns, Heinrich, sie wollen uns vernichten.«
»Wie?« fragte Heinrich, der sich anscheinend nicht vorstellen konnte, wie die Franzosen seinen Kolonialwarenladen vernichten wollten.
»Es gibt Krieg, Heinrich.«
Nun sprang auch Heinrich auf. »Krieg!« schrie er, reckte sich, riss seine Frau in seine Arme, und ich sah, wie sich die Lippen der beiden aufeinander zubewegten.
»Raus, Kinder«, sagte Rosa, »los, raus mit euch.«
Ich verstand nicht, warum wir raus mussten, aber ich brachte es mit den sich aufeinander zubewegenden Lippen in Zusammenhang und auch mit jenem dritten Monat, von dem meine Mutter mit Rosa gesprochen hatte.
»Dann muss ja auch Hoogie weg«, hörte ich Heinrich sagen.
»Hoogie ist noch zu jung; er kann sich höchstens freiwillig melden.«
»Freiwillig?«
»Natürlich«, sagte Rosa, »für Kaiser und Reich, für unseren armen Kaiser«, und sie begann wieder zu weinen. Hoogie war der älteste Sohn der Familie School, hieß eigentlich Robert und war von Rosa für die Marinelaufbahn vorgesehen.
»Nun aber raus mit euch, was steht ihr da herum?« schrie sie uns an, und ich nahm Willi, den Jüngsten, an die Hand und schlich mit ihm durch den Kolonialwarenladen auf die Straße.
Draußen flimmerte die Sonne. Es war ein hochsommerlicher Tag. Von der Promenade her kamen die Klänge der Kurkapelle. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was sie spielte, aber es müssen wohl Militärmärsche gewesen sein. Ein paar heisere Stimmen schrien irgendwo hurra. Ich ließ den weinenden Willi, der immerfort »Krieg, Krieg« rief, stehen und rannte, so schnell mich meine Beine trugen, nach Hause. Es war mir absolut unklar, was eigentlich vorging, aber das Wort »Krieg« hatte auch mich elektrisiert.
Meine Mutter stand auf dem Hof und wrang mit meiner ältesten Schwester Wäsche aus. Sie drehten ein Wäschestück, jede an einem Ende und jede in entgegengesetzter Richtung, hochrot im Gesicht.
»Wo kommst denn du her?« fragte meine Mutter.
»Krieg«, stotterte ich.
»Was ?«
»Frau School hat es gesagt.«
»Rosa?«
»Rosa«, sagte ich und nickte verständnisinnig mit dem Kopf.
»Sie sollte so etwas nicht sagen«, sagte meine Mutter, »sie hat genug mit ihrem Heinrich zu tun.«
In diesem Augenblick kam mein Vater auf dem Bürgersteig heran. Er ging sehr schnell und aufgeregt. Er hatte die Hosen noch hochgekrempelt, und seine Füße waren nackt.
»Was treibt der sich denn hier herum?« sagte meine Mutter, »der hat doch in der Badeanstalt zu sein!«
Sicher ist wieder jemand ertrunken, dachte ich, eine Großherzogin oder die Tochter eines Großherzogs, denn seit jener Rettungstat meines Vaters ertranken für mich nur noch Großherzoginnen und deren Töchter.
»Anna«, schrie mein Vater und rannte geradewegs auf meine Mutter zu.
»Bist du verrückt?« sagte meine Mutter.
»Es ist Krieg, Anna, jetzt geht’s los.«
»Um Gottes willen!«
»In sechs Wochen sind wir wieder hier! Oder in Paris! Ich muss mich stellen, gleich!«
Und er rannte barfuß, wie er war, die Kellertreppe hinunter, ohne meine Mutter weiter zu beachten. Meine Mutter bückte sich und legte das auf den Boden gefallene Wäschestück in den Korb. Ich stand daneben und weinte. Ich wusste nicht, warum ich weinte, aber die Tränen liefen mir die Backen hinunter, und nun begann auch meine Schwester zu weinen. Sie war schon sechzehn Jahre alt und hatte eigentlich kein Recht, so loszuheulen; aber sie tat es.
»Heult euch man richtig aus«, sagte meine Mutter, »es ist traurig genug.«
Sie nahm den Wäschekorb und ging meinem Vater nach, die Kellertreppe hinunter. Ich wunderte mich, dass meine Mutter nicht von dem armen Kaiser sprach, wie Rosa School es getan hatte, und auch nichts von meinem ältesten Bruder sagte, der doch schon fünfzehn war und sich vielleicht freiwillig hätte melden können. Ich schlich meiner Mutter nach in den Keller. Dort stand mein Vater mit nacktem Oberkörper, über eine Waschschüssel gebeugt, und rieb sich mit beiden Händen den Hals mit Seife ein.
»Ich leg’ dir alles zurecht«, sagte meine Mutter und warf ihm ein sauberes Handtuch über die Schulter.
»Ja, tu das, beim Kommiss kommt’s auf Sauberkeit an.«
»Bei mir auch«, sagte meine Mutter und verschwand in die Plättstube. Mein Vater war nicht sehr groß, aber ich bewunderte seinen nackten, massigen Oberkörper. Ich hatte ihn noch nie so gesehen, und es kam mir vor, als würde er ganz allein den Krieg gewinnen, von dem alle sprachen.
Mein Vater verschwand, und die Gäste reisten Hals über Kopf ab. Der kleine Landungssteg wurde gesprengt, wegen der Russengefahr, und Rosa School kam, wogenden Busens, jeden Tag zu meiner Mutter und sprach von Spionen, die mit Gold nach Russland unterwegs seien. Ich träumte von einem Spion, der mit einem Boot voll Gold übers Meer kam und den ich einfing, als er gerade landen wollte. »Ach du«, sagte der Spion, aber ich hatte ihm schon das Gold abgenommen und trieb ihn vor mir her, dem Kaiser zu, der auf der Promenade vor seinem Wagen stand und mich mit den Worten »Nun, mein Sohn« empfing. In diesem Augenblick erwachte ich; schweißgebadet und voller Angst kroch ich unter die Bettdecke, denn draußen heulten die Herbststürme.
Ulanen und Husaren ritten an unserem Haus vorbei, die Ulanen mit eingelegten Lanzen, an denen bunte Wimpel hingen, und die Husaren mit roten Jacken und krummen Säbeln, die gegen ihre Schäfte schlugen. In den Dünen zwischen unserem Ort und dem nächsten wurden Schützengräben ausgehoben, von denen niemand wusste, gegen wen sie gerichtet waren, und die wir später benutzten, wenn wir die Schule schwänzten.
Der Ort veränderte sich von Grund auf. Ruhe, Stabilität und die Ordnung, in der seine Bewohner fast fünfzig Jahre gelebt hatten und deren Veränderung sich niemand mehr vorstellen konnte, schienen sich aufzulösen. Die männliche Bevölkerung verschwand, und nur einzelne kamen zeitweise in Uniform zurück, auf Urlaub, und die Gäste, nicht mehr so zahlreich wie zuvor, waren immer häufiger weiblichen Geschlechts.
In dieser Zeit gebar Rosa School ihre Tochter Ilse. Meine Mutter kam in der Nacht zurück, knotete ihr Kopftuch auf und schüttelte ihr strähniges, mattblondes Haar.
»Was die zusammenschreit«, sagte sie, »und dabei ist es doch schon ihr viertes.«
Es wurden viele Söhne und Töchter in diesen Wochen, genau neun Monate nach Beginn des Kriegs, in dem Ort geboren.
Auf dem Sofakissen der Familie School prangte jetzt ein Eisernes Kreuz, und an der Wand hing ein Bild des ältesten Sohnes Hoogie in einer strahlenden Marineuniform. Hoogie, der sich freiwillig gemeldet hatte, diente auf einem Schlachtschiff und hatte seiner Mutter Rosa geschrieben: »Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser« – einen Wahlspruch seines Kaisers, dessen Geburtstag wir eben feierten.
»Antreten«, schrie der Lehrer. »In drei Reihen! Die Großen nach vorn, die Kleinen nach hinten.«
Ich stand ganz hinten und fror. Meine Mutter hatte mir einen weißen Matrosenanzug mit blauem Kragen angezogen, und sie hatte gesagt:
»Wenn du ihn dreckig machst, gibt’s ein paar hinter die Ohren.«
Ich dachte an meine Mutter und versuchte mir gleichzeitig den Kaiser vorzustellen, wie er in seinem Hauptquartier stand und seine siegreichen Armeen dirigierte. »Ohne Tritt, marsch«, schrie der Lehrer.
Vorne über den Großen flatterte an einer Bambusstange die Reichskriegsflagge, und wir sangen »Zu Straßburg auf der Schanz« und dann »Es braust ein Ruf wie Donnerhall«. Wir marschierten an den leeren Schützengräben entlang, die man zu Beginn des Krieges in den Dünen ausgehoben hatte, und der Lehrer schrie:
»Eins-zwei-drei, eins-zwei-drei.«
Die Feier fand in dem Schulgebäude des nächsten Ortes statt. Ein Schulrat sprach von dem unvergänglichen Ruhm des Kaisers, und wir brachen in ein donnerndes Hurra auf diesen Ruhm aus. Dann sangen wir mehrstimmig »Heil dir im Siegeskranz«, und der Schulrat sagte anschließend mit tiefer, überzeugender Bassstimme: »Gott strafe England.«
Auf dem Nachhauseweg lösten wir die Reihen auf, rannten in die leeren, wartenden Schützengräben und begannen, Krieg zu spielen. Aus Strandsand bauten wir ein Panzerschiff, sammelten trockenes Strandhafergras und zündeten ein mächtiges Feuer unter dem Kessel des Schiffes an, der ein alter Kochtopf war. Dichter, dunkler Rauch zog über den Strand aufs Meer hinaus. Willi School stand auf dem Vordersteven des Schiffes und schrie immerfort »Volldampf voraus«, ein paar Jungens riefen »Gott strafe England«, und ich heizte in meinem weißen Matrosenanzug den Kessel des Schiffes.
»Geschütze klar zum Gefecht«, schrie Willi School, aber in diesem Augenblick fing mein Matrosenanzug Feuer, und ich brach in ein wildes Geschrei aus. »Feuer«, schrie Willi School, »Feuer im Schiff«, aber es war bereits zu spät. Ich rannte zum Wasser hinunter und warf mich in die Wellen, die langsam und monoton auf den Strand liefen. Die Jungen kamen alle hinter mir her und standen mit betretenen Gesichtern um mich herum. Langsam erhob ich mich aus dem kalten Wasser.
Der Matrosenanzug war auf der Brust versengt und an den Ärmeln halb verkohlt.
»Was wird meine Mutter sagen«, flüsterte ich.
»Es ist Krieg«, sagte Willi School, »und im Krieg passiert so etwas alle Tage.«
»Ja«, sagte ich, »Gott strafe England.«
»Er strafe es«, sagte einer der Jungen.
Immer noch zog der dichte Rauch des Panzerschiffes über den Strand. Das Wasser lief an meinem Matrosenanzug hinunter, und ich begann zu frieren. Langsam ging ich nach Hause. Das Meer rauschte hinter mir, und Willi School schrie: »Wir brauchen einen neuen Heizer, wer macht den Heizer, freiwillig?«, und ich dachte: England ist an allem schuld.
»Wie siehst du denn aus?« sagte meine Mutter, als ich in der Tür stand.
»Wir haben Krieg gespielt, Mutti.«
»Was habt ihr gespielt?«
»Krieg.«
Meine Mutter stand langsam auf und kam mir entgegen.
»Eigentlich solltest du Ohrfeigen haben«, sagte sie.
»Ja«, flüsterte ich, »aber es ist Kaisers Geburtstag.«
»Das ist mir egal. Ihr sollt nicht Krieg spielen. Dieser Krieg ist schlimm genug.«
Und ich begriff, dass meine Mutter diesen Krieg nicht mochte und dass ihr auch der Kaiser nicht viel bedeutete. Schweigend zog ich den ehemals weißen und jetzt braun versengten Matrosenanzug aus, während meine Mutter sagte:
»Zieh den Dreck aus und scher dich ins Bett.«
Mein Vater kam nur einmal auf Urlaub. Er stand, wie man damals sagte, in Russland, trug einen feldgrauen Rock und braune, hohe Kavalleriestiefel. Statt des hochgezwirbelten Es-ist-erreicht-Schnurrbarts trug er jetzt einen schwarzen Spitzbart. Ich erkannte ihn nicht wieder, aber er versicherte mir mehrmals, er sei mein Vater, bis ich es schließlich glaubte.
Er priemte noch immer und legte den Priem vor dem Essen auf den äußersten Rand seines Tellers, nachdem er ihn vorher umständlich aus den Zähnen gezogen hatte. Dieser Vorgang erregte stets aufs neue den Unwillen meiner Mutter. »Leg deinen Priem woanders hin«, pflegte sie zu sagen, worauf mein Vater den Priem vom Rand des Tellers nahm und ihn an die Kommode klebte.
Ich weiß nicht, wann mein Vater wieder verschwand, aber er verschwand, wie er gekommen war. Einige Monate später hörte ich ein ähnliches Gespräch zwischen Rosa School und meiner Mutter wie damals vor dem Krieg.
»Du hast doch jetzt genug Gören«, sagte Rosa School, »wozu denn das noch?«
»Sag das denen mal, die kümmern sich doch nicht darum«, antwortete meine Mutter und begann zu weinen.
›Ja, die Männer«, sagte Rosa und stieß einen Seufzer aus, während sie die Hände demütig vor dem Bauch faltete.
Zu dieser Zeit meldete sich mein ältester Bruder, der auf einer Präparandenanstalt als Lehrer ausgebildet werden sollte, freiwillig. Er würde sich erhängen, schrieb er, wenn er sich nicht freiwillig melden dürfe, und meine Mutter schrieb ihm zurück, er solle sich erhängen. Ein Jahr später schrieb er von der Westfront, er würde sich erhängen, wenn er nicht sofort von der Front wegkäme und den grauen Rock an den Nagel hängen könne, und meine Mutter schrieb ihm zurück, er solle sich nicht erhängen, denn der Krieg ginge bald zu Ende.
In diesen Tagen sprach man bei uns viel von der Skagerrakschlacht. Einige behaupteten sogar, sie hätten den Geschützdonner in der Nacht gehört, aber andere sagten, in der Nacht könne man auf See nicht schießen. In dem Kolonialwarenladen der Familie School ging es während dieser Tage aufgeregt zu.
»Mein Hoogie ist dabei«, sagte Rosa jedem Kunden, der es hören oder nicht hören wollte, und griff sich an ihren hochgeschnürten Busen.
»Er wird schon durchkommen«, antwortete meine Mutter und legte Rosa die Hand auf den Unterarm.
»Mein Junge«, seufzte Rosa, »ach Gott, mein Junge.«
Sie sagte nichts mehr von dem armen Kaiser, doch in ihren etwas feuchten Augen war immer noch der Stolz der Unbesiegbaren. Wenige Tage später lief ihr Hoogie auf einem halbzerstörten Schlachtschiff in den benachbarten Hafen ein und kam als Held auf Urlaub. Er war von gedrungener Gestalt, mit einem hochroten, gutmütigen Gesicht und etwas abstehenden Ohren.
»Denen haben wir’s gegeben«, sagte er bei jeder Gelegenheit, und die Einwohner des Ortes standen um ihn herum und nickten mit den Köpfen.
An einem Nachmittag, ich spielte bei Willi School auf dem Boden, saß er mit meiner Schwester auf dem nach Thymian riechenden Sofa im Hinterzimmer des Kolonialwarenladens. Meine Schwester hatte das Kissen mit dem gestickten Eisernen Kreuz, auf dem »Im Felde unbesiegt« stand, auf den Knien, und Hoogie hatte den Arm um sie gelegt. Meine Schwester trug wollene Strümpfe, und ihr Rock war etwas zu kurz. Hoogie saß da wie ein Held, mit offener Matrosenbluse, so dass die Brusthaare sichtbar waren. Sie sangen zweistimmig »Annemarie« und dann »Mein Sohn heißt Waldemar«. Sie lachten jedes mal bei dem Refrain, sahen sich in die Augen und wiederholten ihn, meine Schwester mit hoher Falsettstimme und Hoogie im Bariton. Plötzlich versuchte Hoogie, meine Schwester zu küssen, er beugte sich vor, hielt ihren Kopf fest und drückte seine Lippen auf ihren Mund.
»Da«, sagte Willi School und stieß mich in die Seite, »da guck mal.«
In diesem Augenblick hob meine Schwester das schwarz-weiß rote Kissen und schlug Hoogie damit über den Kopf. Als er sie losließ, drückte sie das Kissen in sein Gesicht, und zwar so heftig, dass wir Hoogie schnaufen hören konnten.
»Da«, sagte sie, »da, du Held vom Skagerrak.«
Dann sprang sie auf und lief mit ihrem zu kurzen Rock durch den Kolonialwarenladen hinaus. Hoogie warf das Kissen beiseite, starrte uns beide einen Augenblick an und sagte:
»Deine Schwester ist eine Kuh.«
Ich blieb ruhig sitzen. Hoogie jedoch sprang auf, zog seine Matrosenjacke herunter und schlug die Tür hinter sich zu. Nach einer Weile kam er mit einem anderen Mädchen zurück. Es war Irma, die Pflegetochter des Fuhrwerksbesitzers Hermann Mai, dem das Haus gehörte, in dem sich der Kolonialwarenladen befand. Sie setzten sich ebenfalls auf das Sofa und unterhielten sich flüsternd. Nur einmal hörte ich Hoogie sagen:
»Irma, was macht das schon. Als wir am Skagerrak lagen, habe ich oft an dich gedacht. Wenn man so im Feuer der schweren Schiffsgeschütze liegt, denkt man an manches.«
»An mich hast du gedacht?« fragte Irma.
»An wen denn sonst?« sagte Hoogie.
»Wirklich an mich?«
»Natürlich«, sagte Hoogie, und dann begannen auch sie zweistimmig »Annemarie« und dann »Weil es im Walde war« zu singen; und einmal hörte ich Irma sagen: »Eigentlich ist das unanständig«, aber Hoogie lachte, und Irma sagte: »Die beiden Kleinen könnten sich rausscheren.« Aber wir beide blieben sitzen, als hätten wir nichts gehört. Ich fand Irmas Stimme viel schöner als die meiner Schwester. Es war eine weiche, seidige Stimme, und während Hoogie laut und brummend sang, flüsterte sie fast. Ich saß auf dem Boden und starrte sie immerfort an. Auch sie hatte das schwarzweißrote Kissen auf den Knien, aber sie stützte ihre Ellbogen darauf und saß, etwas vorgebeugt, mir zugewandt. Sie hatte große, ovale Augen, ihr braungelocktes Haar fiel über ihre Hände, und der Ansatz ihrer Brust schimmerte weiß im Ausschnitt ihres Kleides.
»Was starrst du mich so an«, flüsterte sie nach einer Weile.
»Solche Jungs«, sagte Hoogie, »als ob die auch schon etwas davon verstehen.«
»Schick sie raus«, sagte Irma.
»Willst du mit mir allein sein?« fragte Hoogie.
»Das nicht gerade, aber …«
»Aber?«
»Ich weiß nicht, Hoogie, schick sie raus.«
Ich stand auf und ging bis zur Tür. An der Tür drehte ich mich um und sah Hoogie ins Gesicht. Er sah noch röter aus als sonst.
»Warum heißt der Sohn Waldemar, Hoogie?«
»Was?«
»Warum der Sohn Waldemar heißt?«
»Raus«, schrie Hoogie, »jetzt aber raus mit dir!« Er warf das schwarzweißrote Kissen, das er Irma vom Schoß gerissen hatte, hinter mir her, und ich hörte Irma lachen. Es war ein helles Lachen, und mir schien es wie der Ton einer Spieluhr, die ich in einem Uhrmacherladen auf der Promenade gehört hatte.
In der Nacht träumte ich von Irma und von Hoogie. Hoogie war sehr viel größer als sonst, fast ein Riese. Er stand auf unserer Landungsbrücke und hatte Irma auf dem Arm, die er langsam hochhob und dann ins Meer warf. Ich schrie nach meinem Vater, der sie retten sollte, aber mein Vater stand auf seinem Badesteg in grauer Uniform, nahm seinen Priem aus dem Mund und sagte:
»Er war bei Skagerrak.«
In der Schule feierten wir jeden Tag Siege und lernten die Schlachten des Krieges auswendig. Zwar sagte meine Mutter: »Ihr solltet lieber etwas Vernünftiges lernen«, doch wir sangen jeden Morgen »Steh’ ich in finstrer Mitternacht« und »O Deutschland, hoch in Ehren« und »Lieb Vaterland, magst ruhig sein«. Aber es schien, als ob das liebe Vaterland immer unruhiger wurde, obwohl wir jeden Morgen so einsam auf der Wacht standen und unsere Armeen, nach den Worten unseres Lehrers, fast alles geschlagen hatten, was es in der Welt zu schlagen gab.
Mein Bruder schrieb verzweifelte Briefe von der Westfront, meine Mutter weinte oft, mein Vater stand in Russland, und mein Zweitältester Bruder kam nach Spandau in die Munitionsfabrik. Die schwarzen Witwenschleier im Ort mehrten sich; und eines Tages fiel Hermann Friedrich. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Krieg etwas Unheimliches, Gefährliches, Tödliches sei. Es presste mir die Brust zusammen, und ich weinte, wie viele an diesem Tag in unserem Ort weinten.
Ich saß auf dem Rollwagen des Fuhrwerkbesitzers Hermann Mai. Da es an Männern fehlte, schirrte Irma den etwas heruntergekommenen Schimmel an. Ich liebte diesen Schimmel, der sehr alt war, rotunterlaufene, tränende Augen hatte und Knochen, die spitz nach allen Seiten abstanden. Es war eigentlich mehr das Gerippe eines Pferdes als ein Pferd. Mais besaßen ihn noch nicht lange, sie hatten ihn von der Armee bekommen, denn es war ein alter, u.k.-gestellter Kriegsgaul. Meine Mutter sagte von ihm »Der Gaul sieht aus wie dieser ganze Krieg«, worüber ich mich ärgerte; aber meine Mutter sagte oft Dinge, die im Widerspruch zum allgemeinen Hochgefühl standen. An diesem Tag also schirrte Irma den Schimmel an, schob ihn langsam in die Deichsel, und der Schimmel sah sich dabei zu mir um, mit wehmütigen Augen, als wolle er »Hafer, Hafer« oder »Hunger, Hunger« sagen. Ich hatte großes Mitgefühl mit ihm, aber Irma schrie:
»Los, du alte Mähre, geh schon.«
»Du musst ihn nicht schlagen, Irma«, sagte ich.
»Halt deinen Mund, dämlicher Bengel«, sagte sie und trat dem Schimmel vor das Bein. Ich musste an Hoogie denken, er sie sicherlich geküsst hatte, wie er meine Schwester küssen wollte, und ich ärgerte mich darüber. Ich streckte die Zunge heraus und lallte: »Mein Sohn heißt Waldemar!«
»Ich kleb’ dir gleich eine«, sagte sie.
»Tu’s doch«, antwortete ich, »tu’s doch. Ich sag’ es Mutti.«
»Du sagst nichts, verstanden, und schon gar nichts von Hoogie.«
Ich wurde rot, und Irma, die den Gaul inzwischen angeschirrt hatte, stieg auf den Wagen. Sie setzte das rechte Bein auf die Radnabe, wobei ich ihre schwarzweißroten Strumpfbänder sehen konnte, die fest um ihre Schenkel lagen, und schwang sich neben mich auf den Sitz.
»Hü«, sagte sie und dann: »Der Hoogie ist jetzt wieder draußen auf See, weißt du, auf einem Torpedoboot. Er hat das Eiserne Kreuz bekommen für die Schlacht am Skagerrak.«
Sie zog die Leine an, nahm die Peitsche aus dem hinteren Wagenteil und ließ sie über dem hageren Kopf des Schimmels tanzen.
»Du sagst nichts von Hoogie, hörst du, wir haben doch nur zusammen gesungen.«
»Du hast so schön gesungen, Irma!«
»Ja«, sagte sie, »ich müsste Sängerin werden, aber Hoogie wird es wohl nicht wollen.«
Wir fuhren langsam aus dem Hof hinaus. Der Schimmel ging Schritt für Schritt. Auf der rechten Kruppe trug er im Fell zwei große eingekerbte Buchstaben.
Als wir auf der Straße zum Bahnhof waren und an unserem Haus vorbeikamen, hörten wir ein Geschrei. Es war ein langgezogenes, leises Heulen, das anschwoll, nachließ und dann wieder stärker wurde. Es kam aus dem Schulgebäude jenseits der Straße.
»Was ist das?« flüsterte Irma, »es sind doch Ferien.«
Sie zog an der Leine und hielt den Schimmel an, der ebenfalls den Kopf hob und zum Schulgebäude hinübersah. Das Schulgebäude lag einsam und verlassen in dem klaren Sommervormittag. Nur im oberen Stockwerk war ein Fenster halb geöffnet, aus dem das Heulen kam. Ich begann zu frieren.
»Warum zitterst du?« fragte Irma.
»Ich zittere doch nicht.«
»Doch.«
»Nein«, schluckte ich, aber in diesem Augenblick verstärkte sich das Heulen zu einem langgezogenen Schrei. Es war, als bliebe der Schrei in der Sommerluft stehen, als stände er über dem Ort für immer.
»Es ist Frau Friedrich«, flüsterte Irma.
»Frau Friedrich«, wiederholte ich.
»Was mag sie haben? Vielleicht hat ihr Mann sie geschlagen?«
Aber das glaubte ich nicht. Ich griff nach Irmas Hand und hielt sie fest. Es war eine warme, schmale Hand, die zwischen den langen Fingern die Leine hielt und nun unter meiner Berührung zusammenzuckte und die Leine anzog. Der Schimmel hob den Vorderhuf und stand plötzlich quer über der Straße. Er schüttelte unruhig den Kopf, wie eine alte Schlachtmähre, und tat, als wolle auch er zu schreien beginnen. Der Schrei aus dem Schulfenster zerbrach und löste sich in tausend kleine, spitze Laute auf. Es war, als fiele ein Regen von Glasscherben auf uns herab. Ich sah meine Mutter die Kellertreppe heraufrennen und auf uns zukommen.
»Was ist denn los? Kinder, was ist denn los? Wer schreit denn da so?«
»Es ist Frau Friedrich«, sagte Irma.
»Mein Gott, es wird doch nichts mit ihrem Hermann passiert sein.«
Und ich sah, wie sie die Röcke hob und quer über die Felder auf das Schulgebäude zulief. Irma saß vornübergebeugt neben mir und sagte:
»Hermann, weißt du, Hermann war ein feiner Kerl.«
Ich hatte Hermann nur einmal gesehen, aber Irma kannte ihn besser. Ich hatte ihn gesehen, als er als Malerlehrling mit seinen Farbtöpfen und seiner Leiter die Straße heraufkam. Aber das war schon lange her.
Es fielen noch viele in diesem Jahr. Ich hörte noch viele Mütter schreien. Ich sah rotgeweinte Augen, und ich wusste, dass meine Mutter kaum noch schlief. Trauer senkte sich über den Ort, die Verzweiflung in den Augen der Frauen wuchs, und Angst stand in den Gesichtern der wenigen Männer.
Auch Irma weinte jetzt oft. Sie ließ manchmal während des Anschirrens den Kopf an den Hals des Schimmels fallen, so wie ich es auf Postkarten gesehen hatte: ein schöner Mädchenkopf am blütenweißen Hals eines Schimmels. Ich saß dann still auf dem Bock des Rollwagens und sah ihr zu. Zwar war sie weniger schön als die Mädchen auf den Postkarten, und auch der Hals des Schimmels war keineswegs blütenweiß, sondern grau und schmutzig, aber ich konnte nicht wegsehen, wenn die großen Tränen aus ihren Augen kamen und über ihr Gesicht liefen.
»Sie hat sich etwas eingebrockt«, sagte meine Mutter, »nun muss sie sehen, wie sie es auslöffelt.«
»Mit Hoogie?« fragte ich, und ich wusste nicht, warum ich so fragte, es war mir nur plötzlich in den Kopf gekommen. Meine Mutter hob den Kopf, warf den Pfannkuchen in der Pfanne herum und sah mich erstaunt an.
»Was weißt du denn davon?«
»Sie hat so schön gesungen mit Hoogie, damals nach der Schlacht am Skagerrak.«
»Gesungen?«
»Ja. ›Mein Sohn heißt Waldemar‹.«
»Na«, sagte meine Mutter, und sie schob die Pfanne wieder auf den Herd, »vom Singen allein wird’s ja nicht gekommen sein.«
Was konnte nicht allein vom Singen gekommen sein? Und was konnte bei Irma kommen? Aber meine Mutter war offensichtlich schlechter Laune, und sie brach das Gespräch mit mir ab.
»Scher dich auf den Hof«, sagte sie.
Ich lief die Kellertreppe hinauf und über die Wiesen. Irma stand im Stall neben dem Schimmel und lockerte mit einer Forke die Streu auf. Der Schimmel war noch magerer geworden und sah aus wie ein Sägebock. Er war schon zweimal auf dem Weg zum Bahnhof zusammengebrochen, und es hatte jedes mal viel Mühe gekostet, ihn wieder auf die Beine zu bringen. Sie hatten ihm Gurte unter dem Bauch durchgeschoben; und dann hatten wir ihn jedesmal mit vereinten Kräften hochgehievt, Irma, der alte Mai, ein paar Halbwüchsige und ich. »Hochgehievt« nannte das der alte Mai, und er sagte jedesmal: »Ich glaube, der ist schon bei Gravelotte dabei gewesen«, denn Mai hatte den Krieg der Jahre 1870/71 mitgemacht. Ich hatte die Aufgabe gehabt, den Kopf des Schimmels zu halten; die Traurigkeit in den großen, alten Pferdeaugen brachte mich dem Weinen nahe.
Irma drehte sich zu mir um, als ich in den Stall trat.
»Na«, sagte sie, »was willst du schon wieder?«
»Was kommt nicht vom Singen allein, Irma?«
»Vom Singen? Was kommt vom Singen?«
»Mutti hat gesagt, vom Singen allein wird’s ja nicht gekommen sein.«
»Was?«
»Ich weiß nicht, was kann denn kommen?«
»Du hast gepetzt«, sagte Irma.
Und sie kam ganz dicht auf mich zu und gab mir eine Ohrfeige. Da ich nicht sehr sicher auf meinen Beinen stand, setzte ich mich verdutzt auf die von Irma aufgelockerte Streu.
»Was hast du erzählt?«
»Nur dass ihr damals gesungen habt, nach der Schlacht am Skagerrak.«
»Dir werd’ ich bei Skagerrak!« sagte Irma, und sie gab mir noch eine Ohrfeige, diesmal auf die andere Backe. Ich sprang auf und lief auf sie zu.
»Irma«, rief ich weinend, »Irma, was kann denn kommen?«
»Vielleicht genauso ein Dummkopf wie du«, sagte sie, »Gott bewahre mich davor.«
Ich hatte sie mit meinen Armen umschlungen und presste meinen Kopf unterhalb ihrer Brust gegen ihren Leib. Es war weich und warm und roch ein wenig nach dem Stall und dem Schimmel und dem ganzen Fuhrwerksunternehmen. Sie trug einen grün und schwarz gestrickten Pullover, unter dem sich ihre Brust abzeichnete.
Meine Stirn berührte jetzt die Brust, und sie legte plötzlich ihre Hände hinter meinen Kopf, beugte sich etwas zu mir herab und drückte meine Stirn zwischen ihre Brüste.
»Du Dummkopf«, sagte sie, und dann ließ sie mich los, und ich sah, dass der Schimmel seinen Kopf von der Krippe weggewandt hatte und uns anblickte. Er fletschte seine stockigen gelben Zähne.
»Geh nach Hause«, sagte Irma, und sie sah mich jetzt nicht mehr an, sondern nahm die Forke auf und begann, wieder die Streu aufzulockern. Ich wusste nicht, ob ich gehen sollte oder nicht. Auf meinen Backen brannten die Ohrfeigen. Es war sehr still im Stall, so still, dass ich Irmas Atem hören konnte. Der Schimmel sah mich immer noch an, und seine Augen waren so traurig, als würde er gleich wieder zusammenbrechen. Gravelotte, dachte ich, er war in Gravelotte dabei, und ich dachte an den Trompeter von Vionville, denn das hatte ich in der Schule gelernt. Aber von dem, was mit Irma vor sich ging, hatte ich nichts gelernt. Ich schämte mich und schlich still aus dem Stall. Irma sah sich nicht nach mir um. Ihr Gesicht glühte rosarot, so als sei ihr alles Blut in den Kopf gestiegen. Ich ging langsam über die Wiese, und plötzlich begann ich zu weinen.
»Warum weinst du denn?« fragte meine Mutter, als ich die Kellertreppe herunterkam, »warst wohl wieder bei Irma?«
»Ja.«
»Ihr sollt da nicht immer rübergehen. Die drüben haben es auch ohne euch schwer genug.«
Am nächsten Abend hörte ich meine Mutter zu meiner ältesten Schwester sagen:
»Was wird denn nun mit Irma?«
»Ich weiß es nicht, Mutti.«
»Hilft ihr denn niemand?«
»Wer soll ihr helfen! Es weiß doch keiner.«
»Hm«, machte meine Mutter.
Dann stand sie auf, schraubte die Petroleumlampe etwas herunter und sagte:
»Das dämliche Zeug blakt schon wieder.«
»Wo willst du hin, Mutti?« fragte meine älteste Schwester.
»Das geht dich nichts an. Pass auf die Kleinen auf.«
Sie band sich ihr Kopftuch um und ging durch die Küchentür in den dämmrigen Abend hinaus.
In diesen Tagen erklärten uns die Amerikaner den Krieg. Sie hatten ihn uns erklärt, ohne, wie meine Mutter sagte, unseren Gemeindevorsteher vorher zu fragen.
Ich sah den Gemeindevorsteher vor mir, der Ex hieß, wie er den Spazierstock schwenkte, seinen Bauch vor sich her trug und sich in nationaler Verzweiflung an den Bart griff. Auch er trug jetzt einen Spitzbart wie mein Vater, der von Russland an die Westfront gekommen war, um die Franzosen, Engländer, Australier, Kanadier, Inder, Brasilianer und jetzt auch noch die Amerikaner zu besiegen. Nach der Rede unseres Lehrers, die er am Tage der amerikanischen Kriegserklärung hielt, bestand kein Zweifel daran, dass er es schaffen würde.
»Viel Feind, viel Ehr’«, rief der Lehrer aus, und wir sangen stehend »Jeder Schuss ein Russ, jeder Klaps ein Japs, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit«. Einen Reim auf die Amerikaner hatten wir noch nicht, aber mein Bruder, es war der drittälteste, fünf Jahre älter als ich und kurz vor der Konfirmation, schlug vor »Jeder Schlag mit dem Banner ein Amerikaner«, worauf er von dem Lehrer einen Verweis erhielt und sich eine halbe Stunde mit dem Gesicht zur Wand stellen musste.
»Auch du, mein Sohn«, sagte der Lehrer, »wirst bald in den Krieg ziehen und für unseren glorreichen Kaiser kämpfen und siegen.«
Aber statt dessen zog mein Bruder mit mir in den Wald, um Bäume zu stehlen, und wir schleppten das Holz nachts nach Hause, um nicht zu frieren. Rosa School kam an diesem Tag zu uns und sprach statt von den Amerikanern immer von den »Amerikonnern«, sie stellte sich anscheinend rothäutige Indianer darunter vor, und sie sagte: »Wir werden es schon noch schaffen; mein Hoogie ist ja jetzt auch wieder auf See.« Und der Bauer Barnheide kam zu meiner Mutter und sagte:
»Die kriegen auch noch den Mors voll.«
»Von dir?« fragte meine Mutter.
»Von mir nicht, aber von unseren Soldaten.«
»Die werden immer weniger«, sagte meine Mutter, »jetzt holen sie ja schon die Kinder. Die sollten man Schluss machen mit dem Quatsch.«
»Aber Anna, was soll denn unser Kaiser machen?«
»Das interessiert mich nicht. Mich interessieren meine Kinder, und dass sie gesund nach Hause kommen, weiter interessiert mich nichts.«
»Du redest ja wie eine Rote.«
»Was für Rote? Ich interessiere mich nicht für Politik, aber ihr seid ja alle nicht mehr normal.«
Kopfschüttelnd verließ der Bauer Barnheide mit seiner dicken, gefütterten Joppe meine Mutter. Ich stand daneben und schüttelte ebenfalls den Kopf. Ich begriff meine Mutter nicht, denn ich kam aus der Schule, und wir hatten gerade erfahren, dass es eine Ehre sei, viele Feinde zu haben.
In dieser Zeit ging es mit meiner Familie bergab. Wir hatten kein Geld mehr und nichts mehr zu essen, meine Mutter fegte die Straßen, die Kurpromenade und die Parkanlagen unseres Ortes, und mein Bruder begann für die spärlichen Gäste, die noch kamen, Fische zu räuchern. Er hieß Max und versuchte, die Familie auf seine Art zu ernähren. Er saß den ganzen Tag über vor seinem selbstgebauten Räucherofen und blies mit einem Blasebalg ins glimmende Feuer. Nebenbei spielte er mit mir Sechsundsechzig, und wenn eine Flunder halbgar von der Stange fiel, aßen wir sie heißhungrig auf.
Wenn die Gäste kamen, um ihre Fische abzuholen, sagte er, »es waren nur dreizehn Flundern«, statt vierzehn, oder »es waren nur acht Aale«, statt neun oder zehn. Er war ein großartiger Lügner. Er bemogelte mich beim Sechsundsechzig, kochte gleichzeitig für meinen jüngsten Bruder einen undefinierbaren Haferbrei, erzog meine jüngste Schwester mit Ohrfeigen, stahl den Bauern ihre Kartoffeln, räucherte, las Indianerschmöker, hatte immer Geld und ernährte die Familie.
Meine älteste Schwester war inzwischen ebenfalls in die Munitionsfabrik nach Spandau gegangen. Mein Bruder schrieb von der Westfront, er sei am Ende, und auch Irma war seit einigen Monaten spurlos verschwunden. Der Schimmel wurde jetzt von dem alten Mai geführt, und es hatte oft den Anschein, als würden beide eines Tages gleichzeitig auf der Straße zusammenbrechen. Aber sie brachen nicht zusammen. Es war, als hätte die Durch-halteparole auch sie erfasst. »Durchhalten … durchhalten«, sagte Rosa School. »Durchhalten um jeden Preis«, sagte der Bauer Barnheide. »Durchhalten bis zum Sieg«, sagte der Bäckermeister Kinzel, dessen Brot bereits aus Kleie, Kleister, alten Kartoffeln und Lehm bestand. Und alle hielten durch.
Alle hielten so lange durch, bis es nichts mehr durchzuhalten gab. Zu dieser Zeit hatte ich das erste ernsthafte Gespräch mit meiner Mutter. Es war an einem Nachmittag. Dichter Schnee lag vor den Fenstern, und ein kalter, zugiger Ostwind kam über das Meer. Ich war aus der Schule gekommen, hatte meine Mappe auf das Sofa geworfen und »Gott strafe England!« geschrien, weil ich eine schlechte Zensur für einen Aufsatz mit der Überschrift »Der Kaiser in seinem Hauptquartier« bekommen hatte. Meine Mutter saß an dem Tisch vor einer Kohlrübensuppe. Sie hielt den Löffel in der Hand und sah mich eine Weile aus ihren grauen, weichen Augen aufmerksam an.
»Was sagst du da?«
»›Gott strafe England‹, Mutti.«
»Der wird dir was in die Mütze tun.«
»Wird er es nicht strafen?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht wird er alle strafen, denn die Engländer schreien wohl auch ›Gott strafe Deutschland‹, und alle schreien zu ihm, er möge die anderen strafen.«
»Ach«, sagte ich, »aber er ist doch der liebe Gott.«
»Ja«, antwortete sie, »er hat es nicht leicht in solchen Zeiten.«
»Aber er ist doch allmächtig?«
»Eben deshalb«, sagte meine Mutter, und sie blies gleichgültig in die heiße Kohlrübensuppe auf ihrem Löffel. Ich sah auf ihre große, gebogene Nase, die sie selbst einen »Lötkolben« oder einen »Zinken« nannte. »Danke Gott«, sagte sie oft, »dass du nicht einen solchen Zinken hast wie ich«, und ich ging dann jedes mal vor den Spiegel und sah auf meine gerade Nase, die so gar keine Ähnlichkeit mit dem Nasengebirge meiner Mutter hatte. Ich sah also auf ihre Nase, und sie sagte:
»Du solltest mal rüber zu Irma gehen. Sie ist wieder zurück.«
»Wo war sie denn, Mutti?«
»In der Stadt«, sagte meine Mutter, »sie musste kochen und nähen lernen.«
»Für Hoogie?«
»Frag nicht so dumm, geh lieber rüber und sag ihr guten Tag.«
»Ob sie im Stall ist?«
»Ich weiß nicht. Du wirst sie schon finden«, sagte meine Mutter, und damit war das Gespräch beendet.
Nach dem Essen stapfte ich durch den hohen Schnee über die Wiesen. Ich sah Irma. Sie stand nicht weit von dem Stall entfernt und schippte die Wege vom Schnee frei. Sie stand gebeugt, und ich sah die Schippe sich gleichmäßig auf und ab bewegen und den Schnee zur Seite werfen.
»Tag, Irma«, sagte ich.
Sie sah auf und blickte mich an. Ihr Gesicht war gerötet von dem harten Ostwind, es war schmaler geworden, und in ihren Augen war etwas von der Traurigkeit des alten Schimmels. Ich fühlte mein Herz klopfen und merkte, dass ich rot wurde. Ich ärgerte mich darüber und sah deshalb zu Boden auf die verrostete Fläche ihrer Schippe, die sie zu ihren Füßen abgestellt hatte.
»Du«, sagte sie, »wo kommst du denn her?«
»Mutti hat mich geschickt.«
»Mutti?«
»Ja, sie hat gesagt, du seist zurück.«
»Ja«, sagte sie, »ich bin zurück.«
Sie nahm die Schippe auf und stellte sie an die Wand des Stalles.
»Komm«, sagte sie, »es ist zu kalt hier draußen.«
Ich ging hinter ihr her in den Stall. Der Schimmel stand wie damals mit hängendem Kopf vor seiner Krippe und sah sich nicht nach mir um. Irma setzte sich auf die Deichsel des Wagens, der abseits neben dem Schimmel stand. Sie zog ihren Rock dabei hoch, und ich sah, dass sie nicht mehr die schwarz, weiß, roten Strumpfbänder, sondern einfache schwarze trug, die gleich oberhalb ihrer Knie saßen.
Irma musste bemerkt haben, dass ich auf ihre Knie starrte, sie zog den Rock etwas herunter und sagte:
»Komm doch näher.«
Ich ging ganz dicht zu ihr heran, so dass sie mir ihre Hände auf die Schultern legen konnte.
»Es ist nett, dass du kommst«, sagte sie.
»Warum, Irma?«
»Ach«, sagte sie, »ich bin so allein, und keiner will mehr etwas von mir wissen.«
»Wer denn, Irma, Hoogie?«
»Hoogie«, sagte sie, und sie lachte plötzlich, aber ihr Lachen erschien mir bitter und kalt wie der Ostwind, der draußen um den Stall pfiff. Ich hätte gerne geweint, aber auch ich fühlte mich als Soldat, der durchzuhalten hat, und unterdrückte die Tränen.
»Weißt du«, sagte sie und zog mich dabei noch enger an sich heran, »wenn man so eine Geschichte gehabt hat …, so eine dämliche Geschichte …«, aber dann stockte sie plötzlich, bog meinen Kopf zurück und sagte:
»Ach du lieber Gott, du bist ja noch ein Kind, das hätte ich fast vergessen.«
»Ein Kind?« stammelte ich.
»Jaja«, flüsterte sie, »starrst auf meine Strumpfbänder und weißt nicht warum. Aber du wirst es auch noch lernen, früh genug. Und dann wirst du genauso sein wie alle, wie Hoogie und alle andern.«
»Nein«, sagte ich, »niemals.«
»Ach«, sagte sie, »ihr seid doch alle gleich.«
»Ich will nicht so werden wie Hoogie, ich nicht«, ich stampfte mit dem Fuß auf, »ich werde nicht singen und mit der Schlacht vom Skagerrak prahlen.«
»Skagerrak«, sie lachte, »Skagerrak – eine verlorene Schlacht …« Sie nahm mich wieder in die Arme und drückte mich an sich. Ich spürte, dass ihr Busen stärker geworden war, so viel stärker, dass ich plötzlich Angst bekam, sie könne mich erdrücken. Ich konnte die Tränen jetzt nicht mehr zurückhalten.
»Sind sie wirklich alle gleich?« stammelte ich.
»Ja«, sagte sie, »alle Männer, alle sind gleich.«
Und sie küsste mich auf die Stirn, auf die Nase und auf die Backen. Als sich ihre Lippen meinem Mund näherten, stieß ich sie mit meinen Händen vor die Brust.
»Ich muss nach Hause«, stammelte ich.
Sie ließ mich los, und ihre Hände glitten langsam von meinen Schultern, über meinen Rücken, und fielen dann wie geschlagen und kraftlos auf ihre Knie.
»Geh nur«, sagte sie.
Ihre Augen schimmerten feucht, und ich sah, wie ihr die Tränen kamen und langsam unter den Augen, entlang an den Nasenflügeln, in ihren Mund liefen.
»Irma«, sagte ich.
Aber sie erhob sich von der Wagendeichsel und schob mich heftig und schnell zur Stalltür hinaus.
»Geh nur«, sagte sie wieder, »es wird Zeit für dich.«
Ich stand draußen in dem Schneetreiben, und ich hörte, wie sie den Riegel hinter mir vor die Tür schob. Ich lief, so schnell ich konnte, durch den hohen Schnee auf die Tür unseres Hauses zu. Erst als ich meine Mutter sah, wurde ich ruhiger.
»Na, hast du Irma guten Tag gesagt?«
»Ja, Mutti«, stotterte ich.
»Seit wann stotterst du denn?«
Ich antwortete nicht. Ich lief zur Tür hinaus auf den Boden und warf mich dort auf das Bett meines Bruders, der draußen im Wald war und Bäume stahl.
Der Krieg neigte sich dem Ende zu. Wir sangen fast kaum noch vaterländische Lieder in der Schule; statt dessen beteten wir wieder »Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm’«, wobei wir gar keine Neigung hatten, schon jetzt in den Himmel zu kommen. Wir leierten das Gebet herunter, mit gefalteten Händen, stehend, und klapperten dabei unter den Bänken mit unseren Holzpantoffeln. Wir trugen jetzt alle Holzpantoffel, denn Schuhe, lederne, richtige Schuhe gab es nicht mehr. Der Heroismus hatte seinen Höhepunkt überschritten.
Der Lehrer nannte jetzt England nur noch das perfide England, weil es Tanks eingesetzt habe, eine unfaire Waffe, und mein Bruder hatte seine Räucherei inzwischen zu einem kleinen Fabrikunternehmen entwickelt. Er hatte jetzt drei Räucheröfen, die in jeweils zwei Meter Abstand nebeneinanderstanden, und er lief zwischen den Öfen hin und her, sang dabei »Püppchen, du bist mein Augenstern« und »Im Argonner Wald«, spielte jetzt Siebzehnundvier mit dem Sohn des Kapellmeisters Moeves, der drei Häuser hinter uns wohnte, und betrog ihn genau so, wie er mich im Sechsundsechzig betrogen hatte.
Die Gäste waren fast immer empört, wenn sie ihre Fische abholten, aber mein Bruder verteidigte sich mit der Behauptung, die Fische litten ebenso entsetzlich unter dem Krieg wie die Menschen, ihr Fleisch sei mager, weich und wässrig, und sie fielen bei jeder Gelegenheit von der Stange. Meine Mutter fegte immer noch die Straßen, doch sie wusch und plättete nebenbei, denn es war Sommer, der letzte Sommer dieses Krieges.
Die Gäste kamen spärlich, aber es waren immer noch einige, mehr Frauen als Männer, und viele waren sehr elegant.
Eines Abends stand meine Mutter neben dem Wäschekorb, in dem säuberlich aufgeschichtet Damenunterbeinkleider, mit Spitzen besetzte Blusen, weiße, seidig schimmernde Nachthemden und andere Damenbekleidungsstücke lagen, und sagte:
»Komm, du musst mit anfassen, wir gehen zur Schwester des Kaisers.«
»Zur Schwester des Kaisers, Mutti?«
»Ja, sie wohnt im Dünenschloss, und das da im Wäschekorb gehört ihr.«
Ich hob den Korb mit hoch, und wir gingen beide, den Korb zwischen uns, über die Wiesen und dann durch den Wald. Ich war sehr aufgeregt, denn ich sah die Schwester des Kaisers vor mir, eine Prinzessin, königliche Hoheit, und ich sah, wie sie sich zu mir neigte, mir die Hand gab und fragte: Nun, wirst du auch für deinen Kaiser kämpfen und siegen? Ich überlegte angestrengt, was ich darauf antworten sollte, und dachte an den Satz unseres Lehrers: England ist perfide, Majestät. Aber ich war doch unsicher und fragte meine Mutter danach.
»Quatsch«, sagte sie, »gar nichts wirst du sagen, und außerdem werden wir sie gar nicht sehen.«
»Aber wenn wir sie sehen, Mutti.«
»Dann sagst du gar nichts.«
»Aber wenn sie mich fragt?«
»Sie wird dich nicht fragen. So hochgestellte Personen sprechen nicht mit uns.«
»Warum, Mutti, warum sprechen sie denn nicht mit uns?«
»Weil«, sagte meine Mutter, sie setzte den Weidenkorb ab und sah mich an, »weil sie so hochgestellt sind. Und weil du ein dummer Junge bist.«
»Dumm?« wiederholte ich, und ich war jetzt ärgerlich auf sie, und sie sah mich immer noch an und sagte:
»Für die wirst du immer dumm sein, und wenn du der klügste Mensch auf der Erde wärst.«
»Dann sind sie also sehr klug, so klug wie der liebe Gott?«
»Nein«, sagte meine Mutter, und sie nahm den Wäschekorb wieder auf und zwang damit auch mich, nach dem Griff zu fassen und den Korb hochzuheben. »Nein, ich glaube, sie sind sogar sehr dumm. Wenn man sich das alles so ansieht, müssen sie dumm sein.«
Wir gingen schweigend weiter durch den Wald, auf das Haus Dünenschloss zu, das unmittelbar am Meer lag und dessen Hauptaufgang von der Strandpromenade heraufkam, einer großen Freitreppe ähnlich, die in ein wirkliches Schloss führte. Wir aber gingen den Hinteraufgang hinauf, über dessen Eingangstür »Für Dienstboten« stand, und ich dachte: Mutti ist ein Dienstbote, und ich bin auch einer.
Ein Mädchen mit einer Spitzenhaube empfing uns oben und sagte zu meiner Mutter:
»Zählen Sie mir die Wäsche vor.«
Meine Mutter bückte sich, nahm die Wäsche aus dem Korb und begann, sie dem Mädchen vorzuzählen.
»Drei Nachthemden«, sagte meine Mutter.
»Waren es nicht vier?«
»Nein, drei.«
»Hier steht doch: vier.«
»Es waren nur drei«, sagte meine Mutter, und ich sah, wie sie rot anlief.
»Nanu«, sagte das Mädchen, »ich habe mich doch nicht geirrt.«
Meine Mutter richtete sich auf, legte mir die Hand auf die Schulter und drückte mich an sich.
»Ich brauche Ihre Nachthemden nicht«, sagte sie. »Wir tragen so was nicht.«
»Werden Sie nicht unverschämt«, antwortete das Mädchen, »nun werden Sie man ja nicht unverschämt.«
»Ich bin nicht unverschämt. Sie sind es. Ich brauche Ihre Nachthemden nicht.«
»Es sind nicht meine Nachthemden. Es sind die Nachthemden der Königlichen Hoheit.«
»Das ist mir egal«, sagte meine Mutter, »die brauche ich erst recht nicht.«
»Das ist Ihnen egal? Königliche Hoheit ist Ihnen egal? So eine Frechheit.«
Und sie begann laut zu zetern und schrie: »So ein unverschämtes Pack!« Meine Mutter drückte mich noch fester an sich.
»So feine Nachthemden«, sagte sie, »sind nichts für uns. Die können Sie sich auf den Hintern ziehen.«
»Raus«, schrie das Mädchen, aber meine Mutter bückte sich ruhig und nahm auch die andere Wäsche aus dem Korb, zählte sie und legte sie auf den Tisch.
»Sechs Damenbeinkleider«, sagte sie.
»Ich habe gesagt, Sie sollen sich rausscheren.«
»Ich muss die Wäsche abliefern, und damit basta«, sagte meine Mutter. In diesem Augenblick kam eine Frau herein. Sie kam aus einem Nebenzimmer. Ich sah, wie sich die Türklinke bewegte, und dann sah ich nur noch Blau, einen blanken seidigen Kleidernebel, der vor meinen Augen verschwamm. Ich drückte mein Gesicht in den Rock meiner Mutter und verschwand fast hinter ihrem Rücken.
»Was ist denn hier los, Helma? Welch ein Geschrei!«
»Die Frau wird frech«, schluckte das Mädchen, »sie wird frech, Königliche Hoheit.«
»Dann weisen Sie sie hinaus.«
»Sie sagt, ich soll mir die Nachthemden, die Nachthemden der Königlichen Hoheit …, oh …« schrie das Mädchen, setzte sich auf einen Stuhl und begann hysterisch zu weinen.
»Was ist mit meinen Nachthemden?«
»Sie sagt, ich soll mir die Nachthemden auf …, nein …, ich kann es nicht sagen …, es ist zu gemein …«
»Auf den Hintern ziehen«, sagte meine Mutter, »das habe ich gesagt. Und jetzt will ich nur noch mein Geld und weiter nichts.«
»Geben Sie ihr das Geld«, sagte die Frau, und vor meinen Augen schwebte der blaue Kleidernebel vorüber, und eine Wolke von Parfüm, wie ich es noch nie gerochen hatte, zog in meine Nase. Ich war wie betäubt und dachte, das ist die Schwester des Kaisers, und ich wäre am liebsten unter die Röcke meiner Mutter gekrochen. Aber meine Mutter stand aufrecht neben ihrem Wäschekorb und sagte:
»Es stimmt alles und die Rechnung liegt obenauf.«
»Geben Sie ihr endlich das Geld, Helma, und beenden Sie diese peinliche Szene. Mein Gott – überall Renitenz …«
Der blaue Kleidernebel verschwand hinter der Tür, und das Mädchen sprang auf und gab meiner Mutter das Geld.
»So ein freches Frauenzimmer«, sagte sie dabei, »Ohrfeigen müssten Sie haben!« Aber meine Mutter sagte nichts mehr. Sie hob nur die Hand und sah hinein. Es war eine schwielige, vom Waschen und Arbeiten harte Hand. Sie nahm das Geld, steckte es in ihr Portemonnaie, sagte »danke« und ging mit mir hinaus.
Wir gingen durch den Wald zurück. Es war Hochsommer. Die Buchen dufteten, das Meer rauschte hinter uns, und die Schatten des Abends krochen durch den Wald.
»Das war die Schwester des Kaisers«, sagte meine Mutter, »hast du sie dir genau angesehen?«
»Ja«, sagte ich beklommen, »aber du warst gar nicht nett zu ihr.«
»Wie du mir, so ich dir«, sagte meine Mutter, »jedem das Seine.«
»Warum sollte sie sich denn das Hemd auf den Hintern ziehen, Mutti?«
»Wer?«
»Das Mädchen, die Helma.«
»Ach«, sagte meine Mutter, »die haben ja gar keinen Hintern, die haben nur ein Gesäß.«
Gesäß, dachte ich, und mir fiel mein Lehrer ein, der jeden Tag mindestens einmal sagte: »Dafür bekommst du fünf Hiebe aufs Gesäß«, und es war mir nicht klar, ob ich mit einem Gesäß oder mit einem Hintern ausgestattet war, und ich fragte meine Mutter danach.
»Quatsch«, antwortete sie, »du gehörst nicht zu den feinen Leuten.«
Sie warf sich den leeren Wäschekorb auf den Rücken und nahm mich an der Hand.
»Wer weiß, was du noch alles vor dir hast«, sagte sie, und ich merkte, dass sie nicht mehr hart, sondern zärtlich gestimmt war. Da wurde ich ärgerlich auf das Mädchen Helma, das sich nicht die Nachthemden der Königlichen Hoheit über ihren Hintern ziehen wollte.
In diesen Wochen ging es auch mit dem Schimmel endgültig bergab. Er hatte anscheinend genug von dem ewigen Durchhalten, und er gab es als erster in unserem kleinen Ort auf.
Es war an einem Nachmittag, als die Sonne schien, die Stare schon über die Felder zogen und die letzten Gäste zum Bahnhof gingen. Er sollte mit Irma einige Koffer zum Bahnhof bringen, aber er tat es nicht.
»Ja«, sagte der alte Hermann Mai, »nun will er nicht mehr. Er war gewohnt zu siegen, aber nun verlieren wir ja. Nun will er nicht mehr.«
Aber er sagte nicht, dass er für den Schimmel nichts mehr zu fressen hatte und dass es der Hunger war, der die knochigen Beine des Schimmels schwach werden ließ. Es war an einem frühen Nachmittag, und der Schimmel kam aus dem Stall. Irma stand vor dem Wagen und legte das Geschirr für ihn zurecht, und der alte Mai schrie:
»Hü, nun geh schon, hü!«
Aber der Schimmel blieb in der Tür des Stalles stehen, senkte den Kopf und hob ihn wieder, und ich sah, dass seine rotunterlaufenen Augen noch röter waren als sonst und helles Wasser aus seinen Augen lief.
»Irma«, sagte ich, »der Schimmel ist krank.«
»Rede doch nicht«, sagte Irma, »der lebt noch hundert Jahre.«
»Ach, Irma, sieh doch.«
»Was ist denn?«
»Er weint! Sieh, wie er weint.«
»Schimmel können nicht weinen«, sagte Irma, und sie warf das Geschirr auf den Bock, auf dem ich saß. Ich kletterte schnell von dem Bock herunter und stotterte:
»Da der Schimmel – !«
Nun drehte auch Irma sich um, aber der alte Mai schrie immer noch: »Geh schon, Schimmel, geh!«
In diesem Augenblick kniete sich der Schimmel auf seine Vorderbeine. Er tat es langsam und vorsichtig, als wüsste er, dass er sonst fallen und nie mehr aufstehen würde. Er zog die Lippen von seinen eckigen Zähnen, und es sah aus, als lache er über alles, was ihn umgab. Aber aus seinen Augen liefen jetzt die Tränen wie kleine Bäche.
»Er macht schlapp«, sagte Irma, »er macht wirklich schlapp.«
»Verdammtes Mistvieh«, schrie der alte Mai und schlug den Schimmel mit der Peitsche von hinten über den Hals. Der Schimmel hob noch einmal den Kopf, und er sah Irma an und dann mich.
»Armer Schimmel«, sagte ich.
»Red nicht so weinerlich daher«, sagte Irma, aber sie blieb neben mir stehen und ging nicht auf den Schimmel zu. Ich fühlte, wie sie nach meiner Hand griff. Des Schimmels Augen waren jetzt groß und schwarz, und ich sah die entsetzliche Traurigkeit darin.
»Er wird doch nicht sterben«, flüsterte Irma, aber des Schimmels Bauch war trommelartig aufgedunsen, und sein Hals begann jetzt zu zittern, stärker und stärker, als käme eine große Kälte aus seinem Leib herauf.
»Hol den Schlächter«, schrie der alte Mai, »es geht mit ihm zu Ende, wir müssen ihn schlachten, bevor es zu spät ist.«
Irma ließ meine Hand los und rannte davon. Ich sah ihr nicht nach, ich sah nur den Schimmel an, dessen traurige Augen mich nicht losließen. Er versuchte, sich noch einmal zu erheben, aber er hatte nicht mehr die Kraft dazu. Dann glitten seine Hinterbeine aus, und er fiel seitwärts in den Sand des Hofes. Er wieherte leise, als schäme er sich, streckte den Hals aus und legte den Kopf auf den Boden. »Stirbt er?« flüsterte ich.