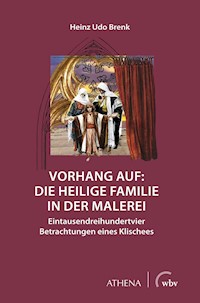Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf der Schwelle zwischen Historismus und Moderne. Eine Kirche als Spiegel gesellschaftlicher, lokaler, architekturgeschichtlicher, liturgischer und kunstgeschichtlicher Strömungen der Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
EINLEITUNG
ST.-KARL-BORROMÄUS – EIN VIRTUELLER RUNDGANG
Beschreibung des Kirchengebäudes
Außenansicht
Innenansicht
Bildseite 1: Innen-und Außenansichten
Bildseite 2: Bauzeichnungen – Längsschnitt und Grundriss
VON DER NOTKIRCHE BIS ZUR KIRCHWEIH
Die Baugeschichte
Bauvorbereitungen
Architekturbüro Flerus & Konert
Tabelle 1: Wettbewerbsbeiträge Flerus & Konert
Tabelle 2: Auswahl ausgeführter Projekte von Flerus & Konert bis 1934
Finanzierung
Baubeginn
Tabelle 3: Firmen und Handwerker, die am Bau der Kirche beteiligt waren
Zeugnis für die Abnahme der neuen Glocken für die katholische Pfarrgemeinde Dortmund-Dorstfeld (Kolonie)
Fertigstellung und Kirchweih
Nachwirkungen
Tabelle 4: Honorarabrechnung Flerus & Konert
Abb. : Aus der Bauphase der Karl-Borromäus-Kirche
Abb. : Einweihungsurkunde
Abb.: Projekte des Architekturbüros Flerus & Konert
FARBIGE FENSTER UND GROSSE ORGELN
Die Ausstattung der Karl-Borromäus-Kirche
Glasfenster in der Sakralarchitektur
Die Wiederbelebung der Glasmalerei im 19. Jahrhundert
Die Glasmalerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Ludwig Preckel
Glaskunst in Dortmund
Tabelle 5: Glasfenster in Dortmunder Sakralarchitektur
Die Glasfenster in der Karl-Borromäus-Kirche
Tabelle 6: Die Glasfenster von Ludwig Preckel in der Karl-Borromäus-Kirche
Die Orgel und weitere Ausstattungsmerkmale
Tabelle 7: Disposition der Orgel in St.-Karl-Borromäus
Tabelle 8: Ausstattung der Kirche
Bildseite 6: Glasfenster in der Karl-Borromäus-Kirche und von Thorn Prikker
VON DORSTIDFELDE BIS ZUR FINE-FRAU-GEMEINDE
Die Geschichte Dorstfelds und der Entstehung der katholischen Gemeinde
Frühe Geschichte des Ortes
Vom Dorf zur Industriestadt
Zeche und Zechensiedlung in Dorstfeld
Tabelle 9: Entwicklung der Einwohnerzahlen Dorstfelds
Tabelle 10: Wahlergebnisse der Reichstagswahl vom 6.11.1932 in Dorstfeld
Kirche in Dorstfeld
Abb.: Zur Geschichte der Gemeinde
GARTENSTADT UND BERGARBEITERSIEDLUNGEN
Siedlungsbau in Dortmund-Dorstfeld
Frühe Siedlungen
Otto Rudolf Salvisberg in Dorstfeld
Hans Strobel und Vermutungen über Gründe für Salvisbergs Engagement in Dorstfeld
Graphik: Beziehungsgeflecht, das zu Salvisbergs Engagement in Dorstfeld geführt haben kann
Abb.: Salvisbergs Siedlungsplan mit projektierter Kirche
VORSCHRIFTEN, ENTWICKLUNGEN, TENDENZEN
Sakralbau in der Diözese Paderborn zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Von Güldenpfennigs Gotik bis zum „Fuchsbau“
Vorschriften und Tendenzen – Die Haltung der Diözese und Meinungen aus Kunst und Architektur
Entwicklungen im Bereich der Profanarchitektur
Die Liturgische Bewegung und ihre Auswirkungen auf die Sakralarchitektur
Beispiele für Sakralbauten zwischen der Jahrhundertwende und dem Zweiten Weltkrieg
Abb.: Porträts von Fuchs und Matern, Fotographien zweier vorbildhafter Kirchen
DENKMALSCHUTZ, UMWIDMUNG, KIRCHENFLUCHT
Gedanken zur Zukunft der Karl-Borromäus-Kirche
Begründung für die Denkmalwürdigkeit der Karl-Borromäus-Kirche
Erhaltung muss finanziert werden
Modelle für zukünftige Nutzung überflüssiger Kirchengebäude
Tabelle 11: Beispiele für Abriss und Umnutzung von Kirchen
Abb.: Drei Beispiele für Kirchenumnutzungen bzw. (Petrikirche) erweiterte kirchliche Nutzung in Dortmund
RESÜMEE
QUELLEN
Artikel in der Dortmunder Tageszeitung Tremonia vom 7.6.1928
Artikel in der Dortmunder Tageszeitung Tremonia vom 14.7.1929
Artikel in der Dortmunder Tageszeitung Tremonia vom 26.5.1929
Zwei Artikel im Kirchlicher Anzeiger vom 21.7.1929 und 28.7.1929
Kurzer Erläuterungsbericht von J. Konert
ANHANG
Literatur
Aufsätze
Internetadressen
Zeitschriften
Archive
Interviews
Bildnachweis
VORWORT
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2014/15 von der Fakultät für Kunst- und Sportwissenschaften der Technischen Universität Dortmund als Dissertationsschrift angenommen. Für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe Dortmunder Schriften zur Kunst – Studien zur Kunstgeschichte bin ich den Herausgebern, Herrn Dr. Niklas Gliesmann und Frau Prof. Dr. Barbara Welzel (Dortmund), sehr dankbar.
Die im Untertitel formulierte These, dass die Karl-Borromäus-Kirche in Dortmund-Dorstfeld Zeugnis ablege für die politischen, gesellschaftlichen, lokalen, liturgischen und kunstgeschichtlichen Bedingungen der Zeit ihrer Entstehung, ist nicht neu. Jedes Kunstwerk, hier verstanden als ein sehr weit gefasster Begriff, der die Architektur selbstverständlich mit einschließt, vermittelt zwischen sehr vielen Aspekten und wirkt umgekehrt auch wieder auf vielen Ebenen auf seine Umgebung zurück. Diese Gegenseitigkeit von Abhängigkeiten veranlasste Horst Bredekamp zu seiner Folgerung: „Es ist eine Illusion, zu glauben, dass man Bildwissenschaft betreiben könnte ohne Bildforschung.“1 Er vertritt die Meinung, dass die Kunst ihrem Wesen nach keine von äußeren Einflüssen unabhängige Kraft sei und man sie daher auch als „ästhetische Kundgebungen ökonomischer Bedürfnisse“ interpretieren könne. Daraus schließt er, dass die Impulse, die von außen auf das Kunstwerk gewirkt haben, dieses wieder zurückwirken lasse. Damit komme es einer Kraft gleich, die keine andere Geschichtsquelle habe.2
Lange vor Bredekamp hat Günter Bandmann diese Auffassung vertreten und in Bezug auf Architektur des Mittelalters untersucht.3 In einem Gedenkband zum Tod von Bandmann stellt sein Schüler Werner Busch damit übereinstimmend fest, dass Bauwerke in einem sehr umfassenden Sinn als Geschichtsquellen zu deuten seien, denn: „Bei der Wahl des Typus sind Fakten der Menschheitsgeschichte, religiöse, politische, soziologische und andere entscheidend.“4 Damit seien Kunstwerke – und hier kommt er zum gleichen Schluss wie Bredekamp – unersetzbare Dokumente, die nicht nur andere, sondern auch umfassendere und tiefere Auskünfte über Geschichte geben können als jede schriftliche Überlieferung.
Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, geleitet von einer Kunstauffassung, wie sie von den oben genannten Kunsthistorikern vertreten wird, sich einer Vorortkirche als Bedeutungsträger zu nähern und sie deshalb aus verschiedenen Blickrichtungen zu beleuchten. Wenn dieser Ansatz allgemeingültig ist, muss er übertragbar sein auf jedes Kunstwerk im oben erwähnten umfassenden Sinn. Zu zahlreichen Werken auch der Dortmunder Architektur gibt es dazu wertvolle Beiträge, insbesondere zu den mittelalterlichen Kirchen des Stadtgebietes. Bisher noch weniger bearbeitet worden sind Kirchen des vergangenen Jahrhunderts oder gar der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest nicht in Form von Untersuchungen einzelner Bauwerke.5
Noch viel weniger ist bekannt über die vielen Vorortkirchen des Ruhrgebietes, wenn sie nicht bereits seit Jahrhunderten ihren Platz eingenommen haben, wie das in Dortmund etwa für die mittelalterlichen Kirchen in Brechten, Kurl, Huckarde, Kirchlinde, Mengede und Wellinghofen gilt. Ein kleiner Baustein, um diese Lücke zu schließen, wird im Folgenden geliefert.
Im Text werden die Begriffe „Pfarrer“ und „Pastor“ nahezu gleichrangig verwendet. Die katholische Kirche verwendet die Bezeichnung „Pastor“ für alle im Gemeindedienst tätigen Geistlichen, während der „Pfarrer“ der Leiter einer Gemeinde ist. In der evangelischen Kirche ist die Bezeichnung „Pfarrer“ nur an die abgeschlossene theologische Ausbildung geknüpft. Ein „Priester“ hat in der katholischen Kirche die Weihe empfangen und darf die Sakramente spenden, muss aber nicht in einer Gemeinde tätig sein. Zudem gibt es regionale Unterschiede in der Verwendung der Begriffe, auf die in diesem Zusammenhang keine Rücksicht genommen werden muss.
Dass diese Arbeit fertiggestellt werden konnte, habe ich auch vielen Menschen zu verdanken, die mir mit ihren Hilfestellungen, ihrer Unterstützung und ihren Ratschlägen weitergeholfen haben. An erster Stelle und in besonderer Weise hervorzuheben ist Frau Prof. Dr. Barbara Welzel, meine Doktormutter, deren Kritik immer konstruktiv war und die mir viele Gelegenheiten bot, mit ihr im Gespräch die Arbeit voranzubringen. Ich bin ihr dafür sehr dankbar und auch dafür, dass unsere Zusammenarbeit sich bereits in anderen Projekten fortsetzt. Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. Wolfgang Sonne, der die Aufgabe der Zweitkorrektur übernommen hat und mir wertvolle Anstöße gab.
Der Pfarrer der Karl-Borromäus-Gemeinde, Herr Christian Conrad, mittlerweile verantwortlich für den Pastoralverbund Dortmund Süd/West, hat in mehreren Treffen alle meine Fragen bereitwillig beantwortet, mich ohne jede Zeitbegrenzung im Archiv der Gemeinde arbeiten lassen und bis in die dunkelsten Ecken des Gebäudes geführt. Ihm und der Gemeindesekretärin, Frau Susanne Steinhoff, sei Dank dafür, dass sie mir so viel Zeit geschenkt haben. Auch die ehemaligen Pfarrer der Gemeinde, die Herren Hubert Zobel und Johannes Aust, haben mir mit ihren Erinnerungen helfen können.
Unterstützung erhielt ich auch von Herrn Michael Ortwald, dem Leiter des Pastoralraumes Am Revierpark und damit zuständig für St.-Karl-Borromäus, genauso wie vom Leiter des Paderborner Diözesanmuseums, Herrn Prof. Dr. Christoph Stiegemann, und Herrn Dr. Norbert Aleweld, dessen Veröffentlichungen zum Sakralbau vor allem des 19. Jahrhunderts eine Fülle von Forschungsgrundlagen bieten. Alle drei waren bereit, sich mit mir zu treffen und mich mit Auskünften und Materialien zu versorgen.
Vom Denkmalamt des LWL in Münster erfuhr ich durch Frau Dr. Eva Dietrich jede gewünschte Unterstützung und der Sohn des Architekten, Jean Flerus jun., ebenfalls Architekt i.R., konnte mir mit Informationen über seinen Vater weiterhelfen.
Ich möchte mich bedanken bei dem leider im letzten Jahr verstorbenen Dr. Fritz Hofmann, der sich sehr für den Fortschritt dieser Arbeit interessiert hat und in so manchem Gespräch auf seiner Gartenterrasse seine Ansichten deutlich machte, die in der einen oder anderen Form Eingang in meine Überlegungen fanden.
Dank an Dr. Detlef von Elsenau, der mich ermutigt hat, einen Weg einzuschlagen, von dem weder er noch ich wussten, dass er mich zu dieser Veröffentlichung führen würde.
Viele Menschen muss ich um Nachsicht bitten dafür, dass ich mich so sehr in Büchern und Archiven eingegraben habe und ihnen nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken konnte. Mein Dank dafür gebührt vor allem Anna Pappert.
Meine Eltern und Großeltern sind leider verstorben, sie wären sicherlich sehr stolz gewesen und daher widme ich ihnen diese Arbeit. Nicht zuletzt dank meines Großvaters, der selber noch mit Spatenstichen beim Bau von St.-Karl-Borromäus geholfen hat und später viele Jahre Mitglied des Kirchenvorstandes war, darf die Gemeinde sich ihres bemerkenswerten Kirchengebäudes erfreuen.
1 Horst Bredekamp in einem Interview mit Die Zeit, Jahrgang 2005, Ausgabe 15 (www.zeit.de/2005/15/Interv_Bredekamp).
2 Bredekamp, Horst: Kunst als Medium sozialer Konflikte, Frankfurt a.M. 1975, S. 331.
3 Bandmann, Günter: Mittelalterliche Kunst als Bedeutungsträger, Berlin 1959. Bandmann, Günter: Das Kunstwerk als Geschichtsquelle, in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 24/1950, S. 454–469.
4 Busch, Werner: Vorwort zu: Busch, W./Haussherr, R./Trier, E. (Hrsg.): Kunst als Bedeutungsträger – Gedenkschrift für Günter Bandmann, Berlin 1978, S. XI/XII. Busch hat diesen Gedanken weiterverfolgt und 1985/86 eine Funkkollegreihe betreut und herausgegeben, in der er vier Funktionen herausstellte, nämlich die religiöse, die ästhetische, die politische und die abbildende Funktion der Kunst. (Busch, W. (Hrsg.): Funkkolleg Kunst, Band 1 und 2, München 1987.) Dazu wurde ein Vortrag veröffentlicht: Funktionsgeschichte als kunsthistorisches Paradigma – Zum Problem der Vermittlung einer Geschichte der Kunst in den Mitteilungen des Österreichischen Kunsthistorikerverbandes, Skreiner, W. (Hrsg.): Kunsthistoriker, Jg. 3, 1986, Nr. 3/4, S. 12–16.
5 Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es Untersuchungen zur Sakralarchitektur der Zeit ab 1900 gibt. Insbesondere sind hervorzuheben: 1. Grabowsky, I./Kroos, P./Schmalöer, R. und BDA (Hrsg.): Kirchen der Nachkriegszeit, Dortmund 2010. 2. Otten, H.: Der Kirchenbau im Erzbistum Paderborn 1930–1975, Paderborn 2009. 3. Parent, T./Stachelhaus, T.: Kirchen im Ruhrrevier 1850–1935, Münster 1993. 4. Montag, P./Tillmann, E./Spieker, B./Höltershinken, D. (Hrsg.): Die katholische Kirche in Dortmund, Paderborn 2006.
EINLEITUNG
Das über viele Jahre im Wesentlichen unveränderte Bild der Stadt Dortmund wurde geprägt von den Türmen der Stadtkirchen. So fand man es schon in den ersten überlieferten Bildern von Franz Mulher vor, so ist es auf dem linken Seitenflügel des Altarretabels in der Propsteikirche St.-Johann-Baptist wiedergegeben. Und so blieb die Erscheinung der Stadt dem sich den Stadtmauern Nähernden erhalten bis tief in das 19. Jahrhundert. Wie andere Städte der Region wuchs Dortmund mit dem Beginn der Industrialisierung weit über die Grenzen der Stadtmauern hinaus und verschluckte etliche bis dahin selbständige Gemeinden der Umgebung. Das bewirkte einen enormen Zuwachs der Einwohnerzahl, massiv verstärkt durch eine hohe Zuwanderung an dringend benötigten Arbeitskräften für den Kohlebergbau und die Stahlindustrie. Ebenso vergrößerte sich die Fläche des bebauten Stadtgebietes nicht allein durch die Eingemeindungen. Für die zugewanderten Neueinwohner musste in erheblichem Umfang Wohnraum geschaffen werden. Sehr bald entstand, nach anfänglichem Wildwuchs, bei den verantwortlichen Stadtplanern – einem Amtsbereich, dessen Notwendigkeit erst im 19. Jahrhundert gesehen wurde und der sich in Dortmund nur besonders mühsam durchsetzen konnte –, aber auch bei den Arbeitgebern ein Bewusstsein dafür, dass neben der ordnenden Hand im Bereich des Siedlungsbaues auch die Förderung des gesamten Wohnumfeldes sehr wohl im übergeordneten Interesse lag, schon um die Motivation und die erwünschte Heimatverbundenheit und damit Standorttreue der Arbeiterschaft zu fördern. So wurden gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften gegründet, ebenso begannen die Unternehmer bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganze Wohnviertel (in Eving, Kemminghausen, Asseln etc.) zu errichten. Darüber hinaus unterstützten sie Baumaßnahmen, die kulturellen, sozialen und religiösen Ansprüchen nachkamen. Das Denkmal in Hohensyburg ist ein Beispiel dafür. Es entstand mit Unterstützung des Bergbauunternehmers Kirberg nicht zuletzt mit dem Ziel, das Nationalbewusstsein seiner Arbeiterschaft zu fördern. Der Bau von Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Krankenhäusern, Theatern und Museen erfuhr großzügige finanzielle Hilfe durch Bergbauunternehmer und Stahlbarone, ebenso wie auch die Gemeinden Geld für den Kirchenbau erhielten. Und neue Kirchen wurden in großer Zahl gebraucht.6
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wandelte sich somit das Bild der Ruhrgebietsstädte und damit auch Dortmunds, wie dies in einem Reisebericht H. Hausers auftaucht: „Auffallend ein starker Gegensatz: neue riesenhafte Kirchen, gebaut in ganz ungewöhnlich modernem Stil, und alte Bahnhöfe, verräuchert, häßlich und unzweckmäßig.“7 Eine Vielzahl von Kirchtürmen bildete neben den vielen Fördertürmen der Zechen Markierungspunkte in der Landschaft. Für die Menschen in den Vororten, in den Gemeinden waren sie nicht nur Architektur, es waren ihre Kirchen, identifikationsstiftend und gemeinschaftsbildend sogar über die jeweiligen Konfessionen hinaus.
Dorstfeld ist eine der Gemeinden rings um die alten Stadtmauern Dortmunds, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts (im Falle Dorstfelds am 5.1.1913) eingemeindet wurden, dessen ungeachtet aber ebenso wie z.B. Hörde, Eving, Lütgendortmund und viele andere im Bewusstsein der Bevölkerung immer einen hohen Grad an Eigenständigkeit behielten. Für Dorstfeld gilt dies in doppelter Weise, denn für die Bürger des Stadtteils gab es zwei Vororte dieses Namens. Den alten, um den Hellweg entstandenen Kern an der Dorstfelder Brücke mit Markt und, ab 1894, eigener katholischer Kirche (ab 1905 auch einer evangelischen Kirche), und der neuere Teil, notwendig geworden mit dem enormen Bevölkerungsanstieg ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, die sogenannte „Kolonie“, künstlich geschaffen um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert, zwischen den Toren der beiden Bergwerksschächte Dorstfeld 1/4 und Dorstfeld 2/3 mit Siedlungsbauten für viele hundert Bergarbeiter und ihre Familien, zunächst entlang der Wittener Straße, dem alten Verbindungsweg zwischen Dorstfeld und Witten. Unterdorstfeld und Oberdorstfeld waren die Bezeichnungen, mit denen die Bürger die beiden Gebiete voneinander unterschieden.
Oberdorstfeld wuchs kontinuierlich, schließlich unterbrach der Erste Weltkrieg den Siedlungsbau, der aber in den 1920er Jahren wiederaufgenommen wurde. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges, von denen Dorstfeld nicht im gleichen Maße betroffen war wie andere Vororte oder gar das Stadtzentrum, gab es neben dem Wiederaufbau für mehrere Jahre nur geringes neues Wachstum. Erst mit dem einsetzenden „Wirtschaftswunder“ erfolgte auch ein neuer Schub im Siedlungsbau.
So konnte die Silhouette Oberdorstfelds lange Zeit, bis in die 1970er Jahre, ohne große Veränderungen bestehen bleiben. Es gab keinen alten Kern wie in Unterdorstfeld, keinen Markt und keinen Straßenbahnanschluss. Eine eigene Kirche gab es erst mit der Fertigstellung von St.-Karl-Borromäus 1929 (abgesehen von der hölzernen Notkirche), einen „Neumarkt“ erst in den späten 1950er Jahren und die evangelischen Christen mussten lange auf ihr Gemeindezentrum in der Fine-Frau-Straße warten, das von Wilhelm Lindner 1956/57 fertiggestellt wurde (Glockenturm 1966 ergänzt), wenn sie nicht die Unterdorstfelder Kirche in der Hochstraße (1903/05, Arno Eugen Fritsche, 2013 entwidmet) besuchen wollten. Der Bahnhof lag natürlich in Unterdorstfeld, eine Buslinie fuhr entlang der Wittener Straße, alle anderen Bereiche Oberdorstfelds waren nicht an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen.
Dieses Bild der „Kolonie“, das sich bis weit in die 1950er Jahre seinen Bürgern einprägte, wurde ganz wesentlich bestimmt von den Kirchtürmen der Karl-Borromäus-Kirche und den fünf Fördertürmen der drei Schächte der Dorstfelder Zeche. Direkt hinter der Chorwand der Kirche lag mit Schacht 5 die kleinste dieser Anlagen. Zwischen ihm und Dorstfeld 2/3 verkehrte eine Seilbahn, an der Loren aus dem Untertagebau direkt angehängt werden konnten und die dann wie in einer unendlichen Kette über Dorstfeld schwebten und den Rhythmus des Ortes mitbestimmten. Auf alten Bildern vom Borromäusbau und der Kirchweih sieht man die Bahn im Hintergrund, die als Folge der Krisen im Bergbau der 1960er Jahre abgebaut wurde.
Die Loren wurden geliefert vom zweiten großen Arbeitgeber in Dorstfeld, der Firma Orenstein & Koppel, die ihr Firmengelände entlang der Eisenbahnverbindung Bochum/Dortmund aufgebaut hatte und damit für viele Dorstfelder auf der Grenze zwischen Ober- und Unterdorstfeld lag.
Wenn Pastor Jünemann, der die Karl-Borromäus-Gemeinde von 1925 bis zu seinem Tod 1952 betreute, oder sein Nachfolger Tillmann zur Fronleichnamsprozession riefen – und kaum ein Katholik der Gemeinde hätte sich dieser Einladung entzogen –, so führte der lange Weg von der Kirche durch die Felder zum ummauerten Gelände von Schacht V, wo es den ersten Halt mit einer Andacht gab, weiter zum Hof des örtlichen, von der Zeche bestellten Bauern, auf dessen Schweinewiese (!) die zweite Andacht zelebriert wurde, über die Martener Straße bis zur Seilbahnquerung an der Kreuzung Martener Straße/Lange Fuhr mit der dritten Andacht und zurück zur Kirche. Dies stellte zwar für viele Schulkinder und Messdiener eine echte Herausforderung dar, zeigte aber durch Umfang und Wegführung, wie sehr die Kirche im Ort verwachsen war und die örtlichen Gegebenheiten auch intensiv einzubeziehen verstand. Das gilt auch in umgekehrter Richtung, und damit ist ein Grundgedanke der folgenden Arbeit skizziert. Genau wie Karl-Borromäus, wenn auch nicht mehr so stark wie 1928/29, in die Gemeinde und die Siedlung hineinwirkte und -wirkt, kann umgekehrt das Gebäude nicht verstanden werden, ohne den Ort, seine Entwicklung und die Entstehung einer eigenen katholischen Gemeinde in Oberdorstfeld mit einzubeziehen. Dies ist, im Vorgriff auf ein weiteres, das letzte Kapitel, auch eine Voraussetzung zur Beurteilung von Fragen nach der Zukunft des Kirchengebäudes. „Zur Vermeidung von Beurteilungen nach persönlichem Geschmack ist hohe kunsthistorische und lokalgeschichtliche Kompetenz erforderlich.“8 Das Kapitel „Von Dorstidfelde bis zur Fine-Frau-Gemeinde“ versucht, diesen Bereich abzudecken und die Entwicklung sowohl des Ortes wie auch der Gemeinde bis zum Bau der Karl-Borromäus-Kirche nachzuzeichnen.
Die von P. Kroos angegebene große Zahl von Kirchenneubauten in der Weimarer Zeit in Dortmund ist überschaubar: Von 1870 bis 1939 wurden in der Stadt 61 neue Kirchen gebaut, davon in der Zeit von 1920 bis 1939 insgesamt 11.
Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es auch im Bereich des Kirchenbaus massive Veränderungen, wie P. Kroos feststellt: „Im Sakralbau war die Abkehr vom Historismus in den 1920er Jahren in Deutschland besonders zu spüren. Neue Formen und Materialien vermittelten auch ein vollkommen neues Gefühl von Spiritualität und Liturgie.“9 Der Weg von der Ursprungsgemeinde St. Barbara in Unterdorstfeld zur katholischen Kirche in Oberdorstfeld macht dies deutlich. Während Barbara noch gänzlich außen wie innen im Historismus verhaftet ist, werden bei St.-Karl-Borromäus Ideen und Einflüsse sichtbar, die sowohl mit Entwicklungen in der Architektur zusammenfielen, aber auch mit theologisch-liturgischen Neuerungen einhergingen.
Das Wechselspiel zwischen Fragen des Zeitgeschmacks, den Ansprüchen der Diözese, der Funktion des Baus, den Forderungen der Gemeinde, der Stadtplanung usw. ist das Arbeitsfeld, in dem der Architekt sich positionieren muss. Seine Vorstellungen sind geprägt durch seinen Werdegang, seine Lehrzeit, andere Entwürfe oder Ausführungen. Damit rückt das Gesamtwerk des Büros Flerus & Konert bis 1928/29 in den Bereich der Voraussetzungen für die Art und Weise, in der die Dorstfelder Kirche entstanden ist. Erstaunlicherweise werden aber auch die Ansprüche der Diözese in hohem Maße geprägt von den Personen, die sie erheben, was notwendig macht, sich mit diesem Personenkreis zu befassen. So hat sich die Karl-Borromäus-Kirche zu einem Stein gewordenen Zeugnis „Vorschriften, Entwicklungen, Tendenzen“ im Sakralbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt, wie im so überschriebenen Kapitel ausgeführt wird.
Eine besondere Eigenart des Dorstfelder Kirchengebäudes ist, dass es als Teil einer neuen Siedlung geplant wurde, für deren Errichtung mit O.R. Salvisberg ein Architekt von besonderem Ruf gewonnen werden konnte. Auch wenn die Kirche schließlich nicht nach seinen Plänen gebaut worden ist, kann sie doch ohne die sie umgebende Bebauung nicht gedacht werden. Daher befasst sich der Abschnitt „Gartenstadt und Bergarbeitersiedlung“ mit Fragen des Siedlungsbaus in Dorstfeld und den Verbindungen zwischen Personen, die für den Ort, den Siedlungsbau und schließlich die Errichtung der Kirche von Bedeutung sind.
Von der Idee bis zur Vollendung ist ein weiter Weg zurückzulegen. Das gilt für den Bau einer Kirche immer, in der schwierigen Zeit, geprägt von Inflation, Arbeitskämpfen, politischen Unruhen, in der Karl-Borromäus entstand, aber in besonderer Weise. Eine Vielzahl von Firmen, Handwerkern, freiwilligen Helfern und Künstlern war beteiligt und nicht mit allen verlief das Auftragsverhältnis problemfrei. Immer blieb auch die Frage im Hintergrund, wie die Finanzierung zu realisieren sei. Der Versuch, dieses Knäuel aus Briefen, Rechnungen, Prozessunterlagen, Finanzierungsmodellen, Bauplänen und Akten aufzulösen und damit die Bauphase zu rekonstruieren, wird im Kapitel „Von der Notkirche bis zur Kirchweih“ unternommen.
Wenn der Baukörper Zeugnis ablegt für die Zeit seiner Entstehung und umgekehrt mit seiner reinen Existenz in die Zeit, die Gemeinde, die Menschen, die Stadt und das Stadtbild hineinwirkt, dann gilt dies bezogen auf St.-Karl-Borromäus in besonderer Weise für die Ausstattung. Die Schlichtheit der Ausführung, das Fehlen herausragender, kunsthistorisch bedeutender Einzelstücke, geben dem Innenraum seine Ruhe, seine Nüchternheit, verleihen ihm die besondere Atmosphäre. Von besonderem Rang sind dabei die Fenster und die Orgel. Ihre Einordnung in Entwicklungen der Zeit und ihre außerordentliche und einzigartige Bedeutung darzustellen ist Inhalt des Abschnittes „Farbige Fenster und große Orgeln“.
Schließt man sich heute der eingangs erwähnten Fronleichnamsprozession an, so wird man das Kirchengrundstück kaum mehr verlassen. Das liegt nicht daran, dass es keine Gemeindemitglieder mehr gäbe oder (Ober-)Dorstfeld an Einwohnerzahl verlöre. Seit der Zechenschließung von 1963 hat sich der Ort sehr verändert. Es sind aber nach dem Verlust der Arbeitsplätze im Bergbau auch viele neue Möglichkeiten für den Lebenserwerb und damit neue Siedlungen entstanden. Dort, wo der Schacht Dorstfeld 2/3 mit seiner Kokerei stand und sich noch bis in die 1960er Jahre riesige Kohlen- und Kokshalden bis zur B1 türmten, steht heute der „Hannibal“ mit seiner Umbauung, ein großes, umstrittenes Wohngebiet im Einzugsbereich der Kirche. Die DASA und die Technische Universität Dortmund, der Technologiepark und das Industriegelände zwischen Fine-Frau-Straße und Hellweg haben das Umfeld völlig neu geprägt. Es gibt noch Zeugnisse der Vergangenheit, etwa das alte Eingangsgebäude von Schacht 2/3 an der Wittener Straße, Mauerreste der Einfriedung von Schacht 5 und einige Häuser aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, darunter die auch für die Geschichte der Kirche nicht unwichtigen ehemaligen Gaststätten „Bergschänke“ und „Bielsticker/Kaffsack“. Die Kirche und die Gemeinde haben aber auch viele Wandlungen erlebt, außen wie innen, und das „Innen“ bezieht sich nicht nur auf den Raum, sondern auch auf das Gemeindeleben. So hat etwa das II. Vatikanische Konzil für die Dorstfelder Katholiken zu erheblicher Unruhe geführt, weil die Mitglieder des Kirchenvorstandes, Familienkreise und Kirchgänger den Aufbruch zu mehr Demokratie und Mitsprache ernst nahmen und zwischen Pfarrer und Gemeinde eine tiefe Kluft entstand, die schließlich sogar zur Versetzung des Geistlichen führte. Wie vielerorts in Deutschland hat die Karl-Borromäus-Gemeinde heute mit mancherlei Problemen zu kämpfen, die zu Fragen nach der Zukunft der Gemeinde und des Gebäudes führen. Nachdem der Bau den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet überstanden hat, ist es nun einerseits den Spätfolgen des Bergbaus ausgesetzt, andererseits führt die Krise der katholischen Kirche dazu, dass die Perspektive für die Dorstfelder Kirche unklar ist. Damit wiederholt sich eine Entwicklung, die beim Baubeginn zu beobachten war: „Es war das erklärte Ziel der Architekturmoderne, sich von der Vergangenheit abzusetzen – nun, da sie selbst Vergangenheit geworden ist, droht ihr eben jenes Schicksal, welches sie ihren Vorgängern zugedacht hatte.“10
In Dortmund gibt es über 60 römisch-katholische Kirchen, davon stehen 24 unter Denkmalschutz.11 St.-Karl-Borromäus zählt seit 1983 dazu, ebenso ein Teil der zu ihrem Einzugsbereich gehörenden Siedlung.12 Mit einem Blick in die Zukunft wird im Kapitel „Denkmalschutz, Umwidmung, Kirchenflucht“ umrissen, welchen Problemen sich die Dorstfelder Kirche in den nächsten Jahren stellen muss und welche Denkmodelle in Betracht kommen.
Die katholische Kirche in Oberdorstfeld steht noch genau so auf dem höchsten Punkt der Siedlung, wie sie 1928/29 gebaut worden ist, gegenüber der Schule und dem Sportgelände. Wenngleich ihr Innenraum mehrfach renoviert wurde und einigen kleinen Veränderungen unterworfen war, vermittelt er immer noch die gleiche Stimmung wie vor fast einhundert Jahren. Der Besuch lohnt sich, möglich leider nur zu den Öffnungszeiten, wenn zum Gottesdienst geladen wird. Eine Beschreibung kann diesen Besuch nicht ersetzen, aber trotzdem muss ein Rundgang durch das Gebäude, auch durch die normalerweise nicht zugänglichen Gebäudeteile, allen anderen Kapiteln vorangestellt werden. Deshalb beginnt diese Arbeit mit dem Kapitel „St.-Karl-Borromäus – ein virtueller Rundgang“.
6 „Insgesamt ist die Anzahl der Kirchen, die in der Weimarer Republik in Dortmund gebaut wurden, recht groß…“ Kroos, Peter: Die goldenen 1920er Jahre, Bauten der Weimarer Republik in Dortmund, Bönen 2013, S. 25.
7 Hauser, Heinrich: Schwarzes Revier, Originalauflage Berlin 1930, Neuauflage Essen 2011,S. 7.
8 Umnutzung von Kirchen – Beurteilungskriterien und Arbeitshilfen, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2003, www.liturgie.de/liturgie/pub/op/dok/download/ah175.pdf (Stand: 6.7.2014).
9 Kroos, Peter: Die goldenen 1920er Jahre – Bauten der Weimarer Republik in Dortmund, Bönen 2013, S. 25.
10 Schmalöer, Richard: Die Entdeckung der Moderne, in: Kroos, Peter: Die goldenen 1920er Jahre, Bauten der Weimarer Republik in Dortmund, Bönen 2013, S. 7–10, hier S. 8.
11 Es sind dies: St. Anna (1912/13); St. Albertus Magnus (1933/34, 2007 profaniert); Antonius von Padua (1907/08); St. Aposteln (1899/1900); St. Barbara Dorstfeld (1894/96); St. Barbara Eving (1891/1905–1920); Bonifatius (1953/55); St. Clara (1863/65); St. Clemens (1870/71); Heilige Familie Marten (1898/99); St. Gertrudis (1927/28); Herz Jesu (1912/14); Johann Baptist Innenstadt (1331); Johann Baptist Kurl (1733/38); St. Joseph Asseln (1892); St. Joseph Kirchlinde (1904/06); Karl Borromäus (1928/29); Heilig Kreuz (1914/16); Liborius (1904/05); Liebfrauen (1880/83); St. Magdalena (1892); St. Michael Lanstrop (1912); St. Michael Nordstadt (1912/14); Urbanus (1200/1899). Darüber hinaus gibt es 42 evangelische Kirchen, darunter 16 denkmalgeschützte, 29 neuapostolische, vier Freikirchen, vier orthodoxe und ein apostolisches Kirchengebäude, eine Synagoge, 32 Moscheen und einen thailändisch-buddhistischen Tempel (Stand 2013).
12 Der von O. Schwer erbaute Teil der Siedlung südlich der Wittener Straße ist geschützt. Erstaunlicherweise gilt dies noch nicht für das von Salvisberg geplante und zumindest im ersten Bauabschnitt auch ausgeführte Gebiet.
ST.- KARL- BORROMÄUS
EIN VIRTUELLER RUNDGANG
BESCHREIBUNG DES KIRCHENGEBÄUDES
Die St.-Karl-Borromäus-Kirche in der Fine-Frau-Straße 47, dem höchsten Punkt der Siedlung Oberdorstfeld, die nach einer der dortigen Zechen auch Karlsglücksiedlung genannt wird, ist noch fast vollständig in ihrem Originalzustand von 1928/29 erhalten.13 Deshalb kann die Beschreibung des heutigen Zustandes auch nahezu in Gänze auf den Zustand von 1929 übertragen werden. Wenn es Veränderungen gab, wird darauf jeweils ein Hinweis gegeben.
AUSSENANSICHT
Die Kirche ist ausgerichtet vom Eingangsbereich mit den beiden Türmen im Südosten zur Chorabschlusswand im Nordwesten, also nicht, wie üblicherweise für katholische Kirchen gefordert, geostet.14 Die Ausrichtung ergibt sich durch die der Straßenseite und dem gegenüberliegenden offenen Platz, der als Marktplatz und Siedlungszentrum gedacht war, zugewandte mächtige Fassade, die durchbrochen ist von zwei mehrfach abgestuften Rundbögen von einer äußeren Breite von 3,40 m und Höhe von 4 m, durch die Stufung auf 2,40 m Breite und 3,50 m Höhe verjüngt, durch die man durch zwei noch im Original vorhandene Holztüren ins Innere der Kirche geradezu hineingezogen wird. Noch in der unteren Hälfte der Fassade liegt zentral über den Türen ein Rundfenster von 2,60 m Durchmesser, dessen Laibung ebenso abgestuft ist wie die Türlaibungen.15 In den Fensterkreis ist ein Kreuz eingemauert, wie es auch in der Bemalung des Innenraumes mehrfach auftaucht. Leider ist mit der Schutzverglasung, die im Jahre 2001 erneuert wurde, dieses gestalterische Element weitgehend unsichtbar gemacht worden. Zu beiden Seiten des Rundfensters sind der Fassade vollplastische, mit etwa 3,00 m Höhe überlebensgroße Figuren der Heiligen Barbara als Schutzpatronin der Bergleute und des Heiligen Karl Borromäus, des Patrons der Gemeinde, aus hellem Muschelkalk auf schlichten Konsolen aus dem gleichen Stein vorgestellt.16
Die 18,50 m hohe Fassadenwand ist mit einem um 15° geneigten Satteldach versehen, das den First auf 19,60 m erhöht. Direkt unterhalb des Giebels, zentral und symmetrisch angeordnet, durchbrechen sieben gleichgroße Schalllöcher, die jeweils durch schräggestellte Querlamellen gegen Vogelflug gesichert sind, in Form von Rundbögen von 1,50 m Höhe die Fassade. Unterhalb des mittleren befindet sich ein weiterer, nur 0,30 m schmaler, rechteckiger und ebenfalls 1,50 m hoher buntverglaster Fensterschlitz.
Die gesamte riesige Fassadenwand ist, wie alle Außenwände der Kirche, mit rotem Klinker verkleidet. Aufgelockert wird die große Fläche durch die Verwendung von Ziegeln unterschiedlicher Brennungen, damit unterschiedlicher Tönungen oder auch Fehlbrände. In völlig unregelmäßigen Abständen stehen einzelne oder mehrere Steine etwas aus der Wand hervor, manchmal vereinzelt, manchmal in Reihung und manchmal ein Kreuz bildend. An einigen Stellen tauchen außerdem in Rundbögen gemauerte Ziegel in der ansonsten im Verband gemauerten Wand auf, was ebenso der Optik wie der Stabilisierung dient.
Zu beiden Seiten wird die imposante Fassade flankiert von Türmen quadratischen Grundrisses mit 3,75 m Seitenlänge, die um 1,50 m nach hinten versetzt und um die Stärke der Außenmauer von 0,77 cm in die Fassade eingezogen sind. Mit 23,30 m Höhe überragen sie den First um weniger als 4 m. Sie werden jeweils abgeschlossen durch ein um 30° geneigtes, walzbleigedecktes Spitzdach. Die Turmwände sind unterhalb der Dachlinie nach allen vier Seiten von je drei gleichgroßen und 1 m hohen Rundbögen durchbrochen, die wie Schalllöcher wirken, aber keine Funktion haben. Die Wendeltreppe im Inneren des östlichen Turmes erhält Licht durch kleine, jeweils doppelte Rundbogenfenster, die zur Straßenseite und zur der Kirche abgewandten Seite in fünf gleichmäßigen Höhenabständen eingebaut sind, auf der West- und Ostseite ist das oberste Fensterpaar jeweils ersetzt durch ein größeres, 1,50 m hohes Schallloch mit Lamellen. Für die kleinen Doppelfenster wurde im Betonkern der Kirchenwand nur jeweils ein Rundbogen von 0,60 m Breite und 0,60 m Höhe ausgespart, die Unterteilung in zwei kleine Fenster von je 0,20 m Breite und 0,45 m Höhe wird erst durch die Verklinkerung vorgenommen. Die untersten Doppelfenster sind jeweils deutlich größer (0,35 m breit, 0,95 m hoch), weil sie im Westturm der Kapelle Licht spenden sollen. Auf der dem Schiff zugewandten Rückseite der Türme sind nur je zwei dieser Doppelfenster eingelassen.
Das Hauptschiff ist mit 15,50 m Firsthöhe deutlich niedriger als der Fassadenvorbau. Dadurch entsteht auf der Rückseite der Fassade eine Wand, die genau wie die Vorderseite von sieben Rundbogenschalllöchern mit Lamellen unterhalb der Giebellinie durchbrochen wird.
Die gegenüberliegende Chorseite ist völlig schmucklos gehalten. Sie ist mit 8,70 m Breite deutlich schmaler als die vordere Fassade. Die Wand wird gestaltet von je vier voll vermauerten Blendfenstern in drei übereinanderliegenden Reihen. Das darüber mittig zu findende Rundfenster ist ein Windauge und dient der Entlüftung des Dachstuhls.17 Im Kellerbereich lassen zwei runde Fenster Licht ins Innere, also den Keller unter dem Chor, dazwischen befindet sich ein Lüftungsschacht.
Die Seitenwände der Kirche sind fast völlig gleich gestaltet. Sie lassen deutlich die unterschiedlichen Höhen der 4,50 m hohen, mit 5° Neigung fast flach gedeckten Seitenschiffe und des 12 m hohen und mit einem Satteldach mit 30° Neigung gedeckten Mittelschiffes erkennen. Alle Dächer sind heute mit schlichten Bitumendachbahnen ausgelegt. Die Originalabdeckung erfolgte mit Schieferplatten im Dach des Mittelschiffes, wohingegen die Betondächer der Seitenschiffe schon immer nur provisorisch abgedeckt und mit einem wasserabweisenden Dursitanstrich versehen waren.18
Im Bereich der Seitenschiffe sind die Wände unterteilt in sechs gleichbreite Segmente, womit sie die Pfeilerabstände des Innenraumes aufnehmen. Das zweite und fünfte Segment ist jeweils um 1 m nach außen gezogen. Zur Ostseite entstand so im zweiten, dem Turm zugewandten Segment ein Nebeneingang mit einer Türgestaltung wie zur Straßenseite, wenn auch etwas schmaler (2,25 m breit, 3,60 m hoch), im fünften Segment wurde der zusätzlich geschaffene Raum für einen Beichtstuhl genutzt. Jedes Segment, natürlich mit Ausnahme des Seitentürsegments, enthält eine Dreiergruppe gleichgroßer Rundbogenfenster, die in der Größe denen der untersten Stufe der Türme entsprechen. Zur Westseite gibt es keinen Seiteneingang, hier waren beide hervortretenden Segmente ursprünglich mit Beichtstühlen ausgefüllt.
In den hohen Seitenwänden des Mittelschiffes finden sich auf jeder Seite je sechs gleichgroße hohe Rundbogenfenster (0,90 m Breite, 5,15 m Höhe). Die Seitenwände des Chores erhalten Licht durch je ein Rundbogenfenster, mit 1,20 m etwas breiter und mit 5,05 m etwas weniger hoch als im Mittelschiff.
Zu beiden Seiten des Chores schließen sich zwei Räume an, die als Sakristei bzw. Paramentenraum vorgesehen waren und auch nur die Höhe der Seitenschiffe erreichen. Von der Sakristei auf der östlichen Seite des Chores aus gelangt man in das Pfarrhaus, das mit der Kirche und dem ursprünglich symmetrisch dazu nach Westen geplanten Schwesternhaus, das nie gebaut wurde, eine Baueinheit bilden sollte. Der unter dem westlichen Paramentenraum gelegene Kellerraum hatte einen separaten Ausgang zur Rückseite der Kirche, der heute zugemauert ist. Die Kellerräume rechts und links des Chores haben unterschiedliche Verwendung gefunden. Der Raum unterhalb der Sakristei blieb seit Beginn ein Vorratsraum und beherbergt auch das Archiv der Gemeinde. Der Raum auf der anderen Seite wurde für insgesamt 3100,- RM zu einem Jugendraum ausgebaut und erst 1958 zu einer Krypta/Kapelle mit Eingang vom Kirchenraum aus umgebaut.
Ein Wetterhahn auf dem Ostturm, ein Kreuz auf dem Westturm, ein weiteres Kreuz vor dem Fassadenfirst und die beiden Kirchturmuhren bilden den einzigen Schmuck nach außen. Die beiden Uhren sind angebracht an der Süd- und Ostwand des Ostturmes, jeweils zwischen dem Dreifachfenster und dem Schallloch. Sie wurden erst drei Jahre nach der Fertigstellung des Gebäudes im Jahre 1932 angebracht. In den Zeichnungen des Architekten J. Flerus tauchen die Uhren noch um eine Fensterreihe nach unten versetzt auf, allerdings war auch noch kein als Schallloch vergrößertes Fenster auf der Ostseite vorgesehen.19
INNENANSICHT
Durch die schweren, noch originalen, wenn auch heute heller als im Ursprungszustand gebeizten Holztüren gelangt man in den 10,20 m breiten und zum Bauzeitpunkt 4 m hohen Vorraum.20 Von dort öffnen sich drei Rundbögen zum Hauptschiff, die heute durch Glastüren verschlossen sind.21 Über dem Vorraum befindet sich die Orgel- und Kirchenchorempore, die ihr Licht von dem großen Rundfenster erhalten sollte, das aber zu einem Teil von der Orgel verdeckt wird. Die Empore ragte bei der Einweihung rechteckig mit einer Breite von 6,92 m um 1,15 m in das Mittelschiff hinein. Im Jahr 1990 wurde die Orgelempore erweitert, nämlich um nun 2,76 m in den Kirchenraum vorgezogen. Dadurch verdeckt sie das erste Fenster des Mittelschiffes. Außerdem mussten aus statischen Gründen Stahlträger eingezogen werden, die sich durch die gesamte Vorhalle bis zur Außenwand erstrecken. Die Träger wurden verdeckt, indem in der Vorhalle die Decke auf 3,70 m herabgesenkt wurde. Die nötige Öffnung zur Empore zwischen Mittelschiff und Fassadenvorbau wird mit einem Durchbruch über die gesamte Emporenbreite erreicht, der in 3 m Höhe von einem halbrunden Bogen abgeschlossen wird und damit nahezu ebenso hoch wie breit ist. Von der Empore aus ist ein Speicherraum im Westturm über der Kapelle zugänglich.
Auf der linken Seite des Vorraums findet sich ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges aus der Gemeinde. Es besteht aus einer Pietà, rechts und links flankiert von Tafeln mit den Namen der Gefallenen. Dieses Denkmal ist erst etwa 1955 errichtet worden.22 Auf der östlichen Seite befinden sich zwei Türen, eine zu einer kleinen Toilette, die zweite führt in den östlichen Turm, wo man über eine Wendeltreppe zur Empore und bis zu den Glocken gelangt. Über der Orgelempore befindet sich ein Raum, der ohne Funktion ist und als Speicher dient. Eine Öffnung in der Decke zeigt, dass das Glockenseil einmal in diesen Raum herabhing und die Glocken von hier aus geläutet werden konnten. Von diesem Raum aus, der sein Licht durch das schmale Buntglasfenster erhält, kommt man auch in den ebenfalls leerstehenden Raum auf dieser Höhe im Westturm. Im Speicherraum steht eine Stahlleiter zu einer Dachluke, durch die man in den Glockenraum aufsteigen kann. Ebenso kann man mit Hilfe einer Stahlleiter die Spitze des östlichen Turmes etwa für notwendige Instandsetzungen an den Uhren erreichen.
Die Kapelle im westlichen Turm ist nicht von der Vorhalle, sondern nur vom Seitenschiff aus zugänglich. Sie ist heute ganz schlicht mit einer Kniebank und mit Kerzenständer für die Andacht ausgestattet. Der Raum wurde 1954–55 nach Plänen des Bildhauers Josef Baron aus Unna-Hemmerde zu einer Taufkapelle umgestaltet. Baron selber schuf das Weihwassergefäß, das heute vor der Kapelle steht, und den Stein für das Taufbecken, das nun vor dem Chor steht. Weiter beteiligt an dieser verloren gegangenen Gestaltung waren die Kunstschmiede Karl Andrä aus Vaersthausen bei Unna sowie Hermann Thiele aus Holzwickede, der Goldschmied Wilhelm Winkelmann aus Langenberg/Rheinland und der Paderborner Glasmaler Enrico Zappini. Die vorher vorhandenen farbigen Glasfenster wurden einfach entsorgt, nur ein Teilstück ist in privatem Besitz erhalten geblieben, weil es von einem Gemeindemitglied aus dem ausgebauten Schutt gerettet wurde.23
Beim Eintritt in das Mittelschiff wird deutlich, dass die Gesamtanlage mit Seitenschiffen und höherem Mittelschiff mit eigenem Licht im Obergaden dem Typus einer Basilika angelehnt ist. Die Wände sind flach verputzt und gelb gestrichen, abgesehen von der Orgelseite und der Chorseite, die weiß bemalt sind. Die flache Abschlusswand nimmt das Gelb wieder auf. Diese heutige Farbwahl entspricht der ursprünglich einheitlich gelben Wandgestaltung also nur teilweise.
Für die Deckengestaltung wurde eine sehr kostengünstige Lösung gefunden. Die flache Decke wird getragen von sieben Betonquerbalken, die die Dachfläche in sechs gleichgroße, über die ganze Breite des Mittelschiffes reichende Felder unterteilen. Jedes dieser Felder ist wiederum unterteilt in sechs gleichgroße Segmente, die alle in Form eines Segmentbogens schwach gewölbt sind, was der großen Fläche eine überraschende Leichtigkeit gibt. Damit greift der Architekt zurück auf die „preußische Kappe“, die als Dachgestaltung um die Jahrhundertwende oft Verwendung fand, wenn auch üblicherweise mit Stahlträgern. Ursprünglich blau, sind diese „Himmelswölbungen“ heute weiß mit graublauem Rahmen.
Die Betonquerbalken selbst sind heute wieder, wie auch zum Zeitpunkt der Einweihung, rot. Bei dem Versuch aus dem Jahre 1990, die ursprüngliche Bemalung wiederherzustellen, hat man auch alle Bogeninnenseiten, sowohl beim Triumphbogen wie bei den Bögen zu den Seitenschiffen wie über der Orgelempore mit dieser roten Farbe bemalt, leider auch die Fensterlaibungen, was die Wirkung der Farbfenster für den Raum beeinträchtigt, aber auch thermische Auswirkungen auf die Bleiverglasung hat.
Den sechs Feldern der Decke entsprechend finden sich unterhalb der Querbalken Pfeiler, die sechs Rundbögen tragen. Dadurch wird die Verbindung zu den Seitenschiffen hergestellt. Der Fußboden des gesamten Kircheninnenraums mit Ausnahme des Chorbereiches war ausgelegt mit roten Steinplatten.24 Heute finden wir nach der großen Renovierung und Heizungsinstallation vom 25.4.1990 bis zum 18.6.1990 helle, sandfarbene Steinfliesen im gesamten Innenraum.
Das Mittelschiff ist mit 24 m Länge, 10,50 m Breite und 12 m Höhe um 4 m breiter als der Triumphbogen, der den Chor mit dem Kirchenschiff verbindet. Dadurch entstehen rechts und links des Chores je 2 m breite Wandflächen, die im Ursprungszustand für zwei Seitenaltäre genutzt wurden und heute schlicht mit einer Ikone bzw. einer Marienfigur geschmückt sind.
Die auch nicht mehr erhaltenen originalen Kirchenbänke waren, wie auch die Beichtstühle, von denen es drei gab, und die Kanzel, die sich 1929 am ersten Pfeiler links vor dem Chor befand, aus dem gleichen, dunkel gebeizten Holz gefertigt. Der einzige heute vorhandene Beichtstuhl im rechten Seitenschiff vorne ist, wie die heutigen Bänke, aus hellem Holz.25 Die Kanzel wurde 1957/58 entfernt, stattdessen entstand eine gemauerte Kanzel auf Höhe des Chores mit geschmiedetem Geländer dort, wo vorher der linke Seitenaltar zu finden war.26 Auch diese Kanzel musste als Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils schließlich weichen. Heute nimmt diesen Platz der von Josef Baron 1954 geschaffene Taufstein ein.
Die beiden freigebliebenen Nischen in den Seitenschiffen, die einmal die Beichtstühle aufgenommen hatten, dienen heute der Präsentation von Heiligenfiguren, einmal einer Christophorusfigur und weiter vorne einem Relief von Karl Borromäus in einem hohen Holzrahmen. Die vom linken Seitenschiff an der Chorseite zur Krypta hinabführende Treppe ist erst mit der Steinkanzel 1958 angelegt und mit einem schmiedeeisernen Geländer versehen worden. Erst seitdem dient dieser Kellerraum unterhalb des linken Paramentenraums, den man nur vom Chor aus erreichen kann und der heute ein reiner Vorratsraum ist, als Versammlungsraum und Kapelle. Auf der gegenüberliegenden Seite, am Ende des anderen Seitenschiffes, führt eine Treppe hinauf zur Sakristei, die wiederum auch vom Chor aus zugänglich ist und einen dritten Ausgang zum Pfarrhaus besitzt. Sakristei und Paramentenraum besaßen den gleichen Grundriss und die gleiche Höhe. 1929 wurde das Mittelschiff durch einen Mittelgang in zwei Bereiche unterteilt, die streng nach Geschlechtern getrennt genutzt wurden.27 Zum Chor war dieser Laienbezirk abgetrennt durch eine Kommunionbank aus demselben Stein, aus dem auch die Seitenaltäre und der Hauptaltar gefertigt waren. Die Bank ist gänzlich verschwunden, ebenso wie die Stufe, um die der Bereich zwischen Kommunionbank und Chor erhöht war. Von diesem, den Priestern, Diakonen und Messdienern vorbehaltenen Bereich, führten sechs Stufen hoch bis zu der Linie, wo der Triumphbogen den Zugang zum Chor überspannt. Der Triumphbogen wiederholt sich bis zur Chorabschlusswand noch dreimal, dadurch ergibt sich für den Chor eine Fläche von 6 m Tiefe und einer Breite von 7,54 m bzw. 6,52 m, je nachdem, ob man zwischen den Bögen oder in den dazwischenliegenden Nischen misst. In der Mitte des Chores gab es noch einmal eine Fläche, zu der von drei Seiten drei Stufen hinaufführten zum Altarbereich. Die oberste Fläche maß 3 m x 2,25 m, an der untersten Stufe waren es 4,50 m x 3 m. Zwischen diesem Altarpodest und der Chorrückwand gab es, ohne Stufung, einen 1 m breiten Zwischenraum.28 Der gesamte Chorbereich einschließlich der dort hinaufführenden Stufen sowie des Altarpodestes war ausgelegt mit Solnhofener Platten in deutsch-gelb.29
Der Altar stand an der hintersten Kante des obersten Podestes, war ebenso breit wie dieses und war, wie Kommunionbank und Seitenaltäre, hergestellt aus einem Steinsockel, der verkleidet war mit Marmorplatten in Napoleon fleuri mit Intarsien in Ungarischrot in Form des Zeichens Christi. Die Abdeckplatten (Mensae) bestanden bei allen Altären und der Kommunionbank aus belgischem Granit.30 In der Mitte befand sich der Tabernakel, der sich folglich nicht direkt an der Wand befand, und noch einmal von einem hohen Gehäuse umgeben war.
Altar und Tabernakel wurden entfernt, der alte Tabernakel wurde in die Wand der heutigen Krypta eingelassen, leider aber auch mit Bronze übermalt. Die Reliquien wurden in den neuen Altar überführt. Die Stufung ist heute eine völlig andere, auch dies eine Spätfolge der Neuerungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil.31 Nur noch drei Stufen führen zum Chorbereich, in dem das dreistufige Podest gänzlich entfernt wurde. Diese Absenkung des gesamten Chorbereichs führte dazu, dass zum linken Paramentenraum heute drei Stufen hochführen, weil er als einziger seine ursprüngliche Höhe behalten hat, die Sakristei wurde mit abgesenkt. Das machte im Übrigen weitere Absenkungen beim Übergang von der Sakristei zum Pfarrhaus notwendig, heute leicht erkennbar, weil das Geländer an den Stufen zum Pfarrhaus dafür gekürzt werden musste und dafür kurzerhand ein Stück herausgeschweißt wurde. Diese bauliche Maßnahme wurde gleichzeitig mit der Gesamtrenovierung und Erweiterung der Orgelempore im Jahre 1990 durchgeführt und, da die Kirche zu diesem Zeitpunkt bereits unter Denkmalschutz stand, beim LWL in Münster beantragt und dort genehmigt, weil die Planungen dazu als liturgische Notwendigkeiten begründet wurden.
In die flache, fensterlose Abschlusswand des Chores, wie A. Fuchs es für Kirchenneubauten seiner Diözese gefordert hatte (vgl.: Kapitel „Vorschriften, Entwicklungen, Tendenzen“), war ein über die gesamte Höhe reichendes Kreuz mit goldenem Kern und roter Umrandung eingelassen. Im Jahr 1955/56 wurden auf Veranlassung des damaligen Pfarrers Heinrich Tillmann in die durch das Kreuz entstandenen Felder Mosaiken, ergänzt durch Wandmalerei von zwei Engeln oben sowie Maria und König David unten eingefügt (Fertigstellung am 28.8.1956). 1974 ließ Pfarrer Aust diese Gestaltung überdecken.32 Da diese Abdeckung mit Gipsplatten auf Dachverlattung vorgenommen wurde, durch die die Verlattung heute bereits wieder sichtbar wird, ist zu vermuten, dass die alte Wandgestaltung darunter noch erhalten ist. Seit 1987 wird die große Fläche gestaltet durch ein Kreuz mit überlebensgroßem Corpus, das vorher im Triumphbogen hing und vom Bildhauer Bernd Hartmann geschaffen wurde. Darunter befinden sich drei Ikonen, in der Mitte Christus als Weltenherrscher, zu beiden Seiten Ikonentafeln mit je sechs Heiligen. Diese und weitere Tafeln, die unter anderem in der Turmkapelle zu sehen sind, wurden der Gemeinde in den 1980er Jahren vom Dorstfelder Kunsthändler Lehmann geschenkt.33
Festzuhalten ist also der erfreuliche Umstand, dass das Gebäude im Großen und Ganzen auch heute noch in seinem ursprünglichen Zustand zu besichtigen ist, selbst der verheerende Zweite Weltkrieg hat kaum Spuren hinterlassen. Das gilt glücklicherweise auch für die bemerkenswerten Glasfenster, auf die im Rahmen der Beschreibung der Innenausstattung eingegangen wird. Erst die Spätfolgen des Bergbaus mit ihren Bergsenkungen zeigen heute Wirkung, die man in den Rissen an mehreren Stellen der Wände sieht.34 Schließlich hatten auch Renovierungsarbeiten z.B. am Dach des östlichen Seitenschiffes teilweise fatale Auswirkungen. Die beiden Seitenschiffe wirken heute, betrachtet von der Chorseite aus, unterschiedlich hoch. Der Grund ist eine Dachkonstruktion über dem alten Dach im Westteil, die aber nicht auf den Rundbögen, sondern auf einem Stahlstützbalken an der Außenwand aufliegt. Eine nicht zu lokalisierende Undichtigkeit lässt Feuchtigkeit zwischen die beiden Dächer gelangen, die sich ihren Weg in die Kirche bahnt und an den Pfeilern abläuft.
Das im Rundfenster der Eingangsfassade auftauchende Motiv des aus je drei Stäben gebildeten Kreuzes die sich in der Überschneidung verschlingen, wird im Innenraum mehrfach zitiert. Zunächst in der Decke viermal, im zweiten und fünften Feld, jeweils im zweiten und fünften Segment. Laut Abrechnung des Stuckgeschäftes Carl Brodrick, Dortmund, wurden sie als Entlüftungsrosetten geliefert und den Wünschen des Pastors entsprechend gestaltet.35 Heute haben sie ihre Funktion verloren, sind nach oben hin verschlossen und wohl nur aus dekorativen Zwecken beibehalten worden. Außerdem taucht es als aufgemaltes Zeichen an jedem Pfeiler zwischen Mittelschiff und Seitenschiffen auf.
Nur vorübergehend, als es nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil den Versuch gab, den Längsbau in einen Zentralbau umzuwandeln, wurde der Altar während der 1970er Jahre kurzerhand für einige Zeit ins Mittelschiff, in die Mitte der rechten Wand vor die Rundbögen zum Seitenschiff versetzt. Dafür musste eigens ein Holzpodest errichtet werden. Schon 1972 hatte die Kirche dann mit der Einweihung des neuen Altars, der sich nun direkt hinter den Stufen des Chorraumes befand und so dem Pfarrer die Möglichkeit gab, die Messe den Gottesdienstbesuchern zugewandt zu zelebrieren, wieder die ursprüngliche Ausrichtung des Gebäudes angenommen.
Es kann also zusammengefasst werden: In der Außenansicht mit der Verwendung des im Ort gebrannten Klinkersteins sowie dem Bezug auf den Standort und den gegenüberliegenden Schulbau, ebenso aber auch mit dem einfachen Dursitanstrich als Feuchtigkeitsschutz, der schlichten Gestaltung und dem fast völligen Fehlen jeglichen Außenschmuckes wird die Beziehung zwischen Kirchenbau und Ort sowie Gemeinde deutlich. Insbesondere die Wahl einer Figur der Hl. Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, als gestaltendes Fassadenelement war der sich überwiegend aus Bergleuten zusammensetzenden Gemeinde geschuldet.
Auch im Innenbereich wurden die Schlichtheit der Gestaltung und die Verwendung zeitgenössischer, einfacher Baumaterialien wiederholt. Im Rückgriff auf Materialien und Bauweise erkennt man das örtliche Handwerk.
Abb.: Karl-Borromäus, Ansicht von Osten
Abb.: Karl-Borromäus, Frontseite, Krypta, Dachstuhl, Blick in den Chor, Choraußenseite
Abb.: Bauzeichnungen: Längsschnitt und Grundriss
13 Noch vor Fertigstellung des Kirchenbaus hat Pastor Jünemann in Paderborn ein Gutachten erbeten. Daraufhin erhielt er auf der Grundlage der Planungen des Büros Flerus & Konert einen „Erläuterungsbericht“, der nicht mit Datum versehen als Abschrift in der Akte „Baukorrespondenz“ im Archiv der Kirche zu finden ist. Am 7.6.1928 wurde er wortwörtlich in der Dortmunder Tageszeitung Tremonia abgedruckt. Der Wortlaut ist im Anhang unter dem Titel Artikel in der Dortmunder Tageszeitung Tremonia vom 7.6.1928 wiedergegeben. In dem Artikel wird Dr. Aloys Dieckmann als Referenz erwähnt. A. Dieckmann lehrte Kunstgeschichte an der Universität Münster und hat mehrfach zu diesem Thema veröffentlicht, u.a. in „Christliche Kunst“, Jg. 25, 1928/29. Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Schulleiter des Münsteraner Schlaun-Gymnasiums. Zur Fertigstellung der Dorstfelder Kirche wurde er um eine „Begutachtung“ gebeten, die er verfasste und die ebenfalls in Tremonia am 14.7.1929 veröffentlicht wurde. Ob er die Karl-Borromäus-Kirche jemals gesehen hat, darf bezweifelt werden. Auch dieser Text ist im Anhang unter Artikel in der Dortmunder Tageszeitung Tremonia vom 14.7.1929 abgedruckt. Eine dritte Beschreibung gab es kurz vor der Fertigstellung am 29.5.1929, natürlich auch in der Tremonia, und ebenfalls im Anhang nachzulesen unter Artikel in der Dortmunder Tageszeitung Tremonia vom 26.5.1929 (Ankündigung der Fertigstellung). Hier ist der Verfasser unbekannt. Ein Vergleich der Texte lässt aber die Vermutung zu, dass Dieckmann sich auf Bauzeichnungen und Unterlagen verlassen hat und die anderen beiden Texte möglicherweise von Flerus & Konert selbst verfasst worden sind.
14 Es gab dafür nie eine vom Vatikan formulierte Vorschrift, lediglich in der Ostkirche hat sich diese Ausrichtung als die allgemein übliche ausgebildet, die von vielen westlichen Gemeinden übernommen wurde und eine Art „Gewohnheitsausrichtung“ ergab.
15 Das Fenster hat eine bunte Bleiverglasung, die von außen kaum noch sichtbar ist, weil es später eine zweite Schutzverglasung erhalten hat, was den originalen Außeneindruck der Fassade erheblich beeinträchtigt. In dieser Verglasung taucht das Motiv des aus je drei Stäben gebildeten Kreuzes auf, das im Inneren der Kirche mehrfach zitiert wird.
16 Dieses Maß wie alle in diesem Kapitel folgenden Abmessungen sind entnommen den Bauzeichnungen, die im Archiv der Kirche als nicht bezeichnete Rollen liegen, sowie der entsprechenden Akte „Fine-Frau 47–49“ in der Hausaktenverwaltung der Stadt Dortmund. So weit möglich, sind die Maße mit einem Infrarotmessgerät am 28.9.2013 und am 2.11.2013 überprüft worden.
17 Ein interessanter sprachlicher Aspekt: Das Wort Windauge stammt vom isländisch/gotischen Wort „vindauga“ und ist die Wurzel des englischen Begriffs „window“. So kam die Gotik doch auch zumindest semantisch in dieses Kirchengebäude.
18 Vgl.: Rechnung des Dachdeckermeisters Josef Ester, Bauabrechnungen, Archiv der Karl-Borromäus-Kirche.
19 Vgl.: Tremonia, 7.6.1928, Abdruck im Anhang.
20 Diese farbliche Umgestaltung aller Holzeinbauten wurde 1955 durch die Firma Aloys Bittner, Dortmund-Dorstfeld, Wittener Str. 55 vorgenommen und kostete die Gemeinde 1987,50 DM (Rechnung vom 22.2.1955, Gemeindearchiv, Akte 311 Kirchenschiff ).
21 Diese Bögen waren im Neubau noch offen. Die erste Schutzmaßnahme gegen Witterungseinflüsse durch die offenen Kirchentüren war der Einbau schwerer Vorhänge im Jahr 1955 durch den Dekorateur Wilhelm Finke, Dortmund-Dorstfeld, Martener Str. 43 (Gemeindearchiv, Akte 311 Kirchenschiff ).
22 In den Gemeindeakten ist nur ein Kostenvoranschlag der Firma Winkelmann über 1 200,- DM vom 27.4.1955 erhalten, die Rechnung fehlt. Daher ist der genaue Termin der Errichtung nicht zu ermitteln. Die zwischen den Platten mit den Namen der Gefallenen eingebaute Pieta stammt vom Bildhauer H. Püts aus Wiedenbrück.
23 Die Umgestaltung kostete die Gemeinde 2 025,- DM, nicht darin enthalten ist das Honorar für Josef Baron. Dessen Abrechnung ist leider verloren gegangen (Gemeindearchiv, Akte 3110 Taufkapelle).
24