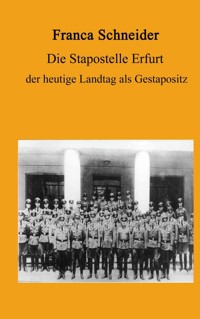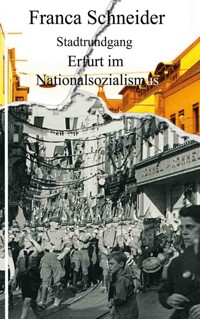
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch Stadtrundgang Erfurt im Nationalsozialismus ist ein Projekt des DGB-BWT in Erfurt. Als Forschung zur Lokalgeschichte hat es über 20 Jahre bis zur aktuellen Veröffentlichung gebraucht. Mit dem Buch kann man durch die Stadt Erfurt gehen und sich die einzelnen Stationen mit dem Buch ansehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Überblick zu Stadtplanung und Bauten 1933
-45 in Erfurt
Politische Verhältnisse in Erfurt und der Aufstieg der NSDAP
Station 1: KZ Feldstrasse
Station 2: Das Tivoli
Station 3: Turnhalle
Station 4: Erfurter Verkehrs- Aktioengesellschaft (EVAG)
Station 5: Kaufhaus „Römischer Kaiser“
Station 6: Angermuseum
Station 7: Schlösserstr. 8
Station 8: Stadtsparkasse
Station 9: Rathaus
Station 10: Nationalsozialistischer Lehrerbund Geschäftsführung Anger 26 (jetzt Geschäft NewYorker)
Station 11: Neuwerkstr. 7 und Beitrag Frauen im Nationalsozialismus
Station 12: Domplatz
Station 13: Landgericht Erfurt - Zwangsterilisation
Station 14: Petersberg
Station 15: Hotel „Hohe Lilie“
Station 16: Tribüne - Zeitung der Sozialdemokratischen Partei für den Regierungsbezirk Erfurt und das Land Thüringen
Station 17: Das Polizeipräsidium - Geschichte der Polizei im NS
Station 18: Der Weltdienst
Station 19: Herderstr. 17
Station 20: Mitteldeutsche Kampfbahn/Steigerwaldstation
Station 21: Die Firma Topf und Söhne
Erfurt im Nationalsozialismus - Literaturliste
Einleitung
Die NS-Geschichte wird heute nicht tabuisiert, da es eine juristische Verpflichtung gibt, zu den Vorgängen und Tätern des Dritten Reichs Untersuchungen von Personen die eine Ausbildung und Studium im Bereich der Geschichts-, Rechts- und Staatswissenschaften durchzuführen. Es finden öffentliche Debatten statt, seit 1997 ist der 27. Januar offizieller Gedenktag zur Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, in Berlin beginnt der Bau für das nationale Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Der Bezug zur NS-Geschichte erfolgt teilweise offensiv, z. B. wurde der NATO-Krieg gegen Jugoslawien von deutscher Seite mit Verweis auf Auschwitz gerechtfertigt. In Erfurt wurde im November 1998 die Begegnungsstätte Kleine Synagoge eröffnet und seit einigen Jahren werden ehemalige jüdische BürgerInnen der Stadt von dieser eingeladen. Dennoch ist der Nationalsozialismus ein Problem der Geschichts- und Stadtgeschichtsschreibung. Dieter Rebentisch bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: „Von Hitler reden oder die Verbrechen des Dritten Reiches und das Phänomen des ‚Faschismus‘ verurteilen, fällt im allgemeinen verhältnismäßig leicht, weil es sich letztlich um abstrakte Größen handelt. Je intensiver jedoch die Betrachtung der nationalsozialistischen Vergangenheit die persönlichen Lebensbereiche und die eigene Biographie berührt, um so schwieriger wird ihre Darstellung. Nicht zufällig neigen selbst große mehrbändige Stadtgeschichten dazu, die umstrittene Epoche nur marginal zu streifen und damit das überhaupt zentrale Problem der neueren deutschen Geschichte aus dem Bewußtsein zu verdrängen, obgleich die politische Existenz und das Selbstverständnis der jetzt lebenden Generationen noch für absehbare Zeiten entscheidend davon bestimmt werden.“1 Was Rebentisch für die westdeutschen Umgang mit Stadtgeschichte im Jahr 1981 sagte, gilt fast ebenso für die Stadt Erfurt im Jahre 2001. In den neuen großen Buchhäusern in der Erfurter Innenstadt findet man beispielsweise umfangreiche Text- und Bildbänder zur Stadtgeschichte. Und man findet darin nur sehr wenige Informationen zur Zeit des Nationalsozialismus. In einigen Büchern gibt es gesonderte Kapitel zur Zeit 1933 – 1945, die den Eindruck vermitteln, man habe es mit einem Sonderkapitel ohne Vor- und Nachgeschichte zu tun. In einigen Büchern findet eine moralische Verurteilung statt, die alle Zusammenhänge im Dunkeln beläßt. Und in einigen Büchern findet der Nationalsozialismus schlicht gar nicht statt. Die Internet-Chronik der Stadt hat zwar ein Kapitel „Im Zeichen des Hakenkreuzes“, dort aber erfährt man – mit Ausnahme der Zerstörung der Synagoge am 9. November 1938 – nur etwas über das Leiden der Stadtbevölkerung – die Bombenangriffe – nicht über ihre Taten. Viele öffentliche Erklärungen begünstigen mit ihrer Zentrierung auf die Opfer ein Geschichtsbild, das die Verantwortlichkeit für die deutsche Geschichte pauschal „den Nationalsozialisten“ oder „dem Regime“ und damit anonymen Mächten anlastet2. Aber wer war „das Regime“ in Erfurt und wie hat es funktioniert? Einige ForscherInnen und AutorInnen widmen sich dieser Frage, auch in Erfurt. Auf ihre Arbeit und Quellen können wir uns in diesem Stadtrundgang teilweise stützen. Erfurt ist besonders interessant, da es Hauptstadt des neuen Dritten Reichs nach dem Krieg werden sollte, weshalb umfangreiche Umbaumassnahmen in der Innenstadt geplant waren. Hitler hatte in einigen Städten gewaltige Änderungen im Umbau geplant, so z.B. auch in Linz in Österreich, was sein Alterswohnsitz und Ort seines Grabes werden sollte. Hier sehen wir uns aber nur die regionale Hochburg Erfurt an.
1 Dieter Rebentisch, Der Nationalsozialismus als Problem der Stadtgeschichtsschreibung, in: Deutsches Institut für Urbanistik, Probleme der Stadtgeschichtsschreibung, IMS Beiheft 1, 1981
Überblick zu Stadtplanung und Bauten 1933-45 in Erfurt
Die Architektur ist enger als andere Kunstsparten mit Gesellschafts- und Politikgeschichte verbunden. Sie dient der Repräsentation, Inszenierung und Legitimation bestehender Verhältnisse. Das gilt natürlich für alle Zeiten und ist keine Besonderheit der Architektur im Dritten Reich. Zu dem wenigen, was wirklich spezifisch ist für das damalige Planen und Bauen, gehören sicher die maßlosen Übertreibungen. Hier zeigt sich die Architektur als Spiegel ihrer Zeit. „Hitler, der sich als verhinderter Baumeister“ fühlte, wollte aus Berlin nichts Geringeres als die „Welthauptstadt Germania“ machen. München sollte zur „Stadt der Bewegung“ und Nürnberg zur „Stadt der Parteitage“ umgebaut werden. Allerdings ist dann Erfurt, erstmal nur theoretisch, zur Hauptstadt des Deutschen Dritten Reiches aufgerutscht und eingeplant worden. Das 1937 erlassene Gesetz zur „Neugestaltung deutscher Städte“ bot die rechtliche Grundlage für die Planung und Durchführung der meist mit erheblichen Abrissen verbundenen Stadtumgestaltungen. 1942 lagen in cirka 40 Städten derartige Planungen vor bzw. befanden sich bereits in der Ausführung. Oft nahmen sie sich die Reichhauptstadt zum Vorbild und übertrugen deren markante Planungselemente auf die jeweilige städtebauliche Situation. Politiker und Stadtplaner größerer Städte wetteiferten bei der Dimensionierung breiter, für Aufmärsche geeigneter Magistralen oder Ringstraßen, die sie über die Stadtpläne legten. In den Gauhauptstädten waren die sogenannten Gauforen „Mittelpunkt aller städtebaulichen Überlegungen“. Sie hatten in der Regel den Sitz des Reichsstatthalters, die Bauten der NSDAP, eine Gauhalle, einen Kundgebungsplatz und einen Glockenturm zu vereinen. Die großspurigen Projekte entstanden häufig „fernab jeglicher Realisierungsmöglichkeiten“. Das Zurückbleiben des Baugeschehens hinter den Verlautbarungen ist im Übrigen auch typisch für alle andere Bereiche des Bauens des „größenwahnsinnigen Reichs“. In der thüringischen Landes- und Gauhauptstadt Weimar begann man sehr früh mit dem Bau eines solchen Gebäudekomplexes (1936), so daß dort bis 1945 wesentliche Teile fertiggestellt waren. Die für die NS-Repräsentationsbauten typische Monumentalarchitektur äußerte sich in dieser Wucht und Eindinglichkeit kein zweites Mal in Thüringen. Vergleichsweise bescheiden stellt sich das „Behördenhaus“ dar, das der preußische Staat hier (in Erfurt) errichtete. Als preußische (Regierungs-)Bezirksstadt stand die Großstadt vor allem seit der thüringischen Landesgründung 1920 im Schatten Weimars. Obwohl es nicht an Eingliederungsbemühungen des NSDAP-Gauleiters und Reichsstatthaltes Fritz Sauckels mangelte, blieb Erfurt in preußischer Hand. Bereits 1933 hatte Hermann Göring, der preußische Ministerpräsident, in Erfurt klar gestellt, daß er „kein Fußbreit preußischen Bodens abtreten werde.“ Vor dem Hintergrund dieser Rivalität zwischen Preußen und Thüringen mußte der Bau des „Behördenhauses“ 1936-39 fast zwangsläufig zu einer Manifestation des preußischen Machanspruchs in Erfurt werden. Klaus-Jürgen Winkler hat belegt, daß sich die in Berlin und Erfurt arbeitenden Architekten an den Bauten von Friedrich Gilly, Heinrich Gentz, Karl Friedrich Schinkel u.a. orientierten. Das Äußere besticht, dem Stilvorbild entsprechend, durch seine kräftige horizontale Zonierung und die wuchtige Pfeilerhalle in der Mittelachse. Die bis ins Detail verfolgten „Formen eines strengen Klassizismus’ verleihen „der Komposition ... [so Winkler] eine ernste Monumentalität.“ Das Gebäude, das nur den ersten Bauabschnitt eines wesentlich größeren vierflügeligen Komplexes darstellt, wurde an ein einem Standort errichtet, der schon in den 20er Jahren für die Anlage eines sogenannten Verwaltungsforums ausgewählt worden war und nach 1933 weiterentwickelt werden sollte. Die Oberpostdirektion (1929/30, auf der Ostseite des Beethovenplatzes) und dem „Behördenhaus-Komplex“ sollte ursprünglich als südlicher Abschluß ein Stadthallenbau folgen. Das ehrgeizige Vorhaben der Stadtverwaltung ließ sich gut in die auf ‚Gemeinschaft’ fixierte Propaganda einbeziehen. Viele Jahre verharrte das Stadthallenprojekt im Planungsstadium, bis es 1939 mit dem Baubeginn der „Thüringenhalle“ durch das Bürgerschützenkorps obsolet geworden war. Der Bau eines geradezu gigantisch anmutenden Reichbahndirektionsgebäude wurde zwar zu Anfang der 40er Jahre begonnen, kam aber nicht über die Keller hinaus. Ein Blick auf die Standorte der wenigen verwirklichten Repräsentationsbauten aus dem Nationalsozialismus (das Behördenhaus, das „Justizgebäude“ - heute Polizei - in der Andreasstraße, aber auch die Wohnbebauung, hier an der Arnstädter Straße) lassen schnell eine Hauptidee der damaligen Stadtplanung deutlich werden. Gemeint ist die sogenannte Nord-Süd-Magistrale, die einerseits eine natürliche und mit dem Autobahnbau sich noch mehr aufdrängende Verkehrsachse für Erfurt war, sich aber andererseits mit den für sie erdachten Bauprojekten als zeittypische Achsenplanung a la Berlin und anderen Städten zu erkennen gab. Hierzu gehörte neben dem erwähnten „Justizgebäude“ in der Andreasstraße, die Bebauung der Domplatz-Nordseite, ein Verwaltungsgebäude an dem zum Platz des SA umbenannten Hirschgarten (an der Stelle des späteren „Schiffshebewerks“) und die beidseitige Bebauung der stadteinwärtsführenden Hindenburgstraße einschließlich eines gebührenden Pendants für das Behördenhaus. Tatsächlich blieb das Behördenhaus bis in die 50er Jahre das einzige Gebäude in diesem Straßenabschnitt. Erst durch den Bau des „Haus der Jugend“, des Kali-Verwaltungsgebäude und der „Wohnbebauung Tscheikowskistraße“ wurden die Lücken zum bebauten Stadtbereich mit neuen Bauplänen geschlossen. Andere Teile der Achsenplanung haben dagegen nach 1945 durchaus ihre Gültigkeit behalten: so z.B. das Projekt für die Domplatzbebauung oder das des Verwaltungsgebäudes an der Joh.-Sebastian-Bach-Straße. Beide wurden in der zweiten Hälfte der 40er Jahre von der Stadtverwaltung als Beispiele für das Erweiterungspotential der Stadt präsentiert. Noch nicht vorhandene neue Konzepte waren hier sicherlich ein Grund, andererseits sind aber auch ‚personelle Kontinuitäten’ in der Verwaltung nicht zu übersehen. In das Behördenhaus, damals Hindenburgstraße 7, zog 1939 nur ein Teil des preußischen Regierungspräsidiums ein. Wichtige Abteilungen und der Regierungspräsident Dr. Weber selbst ‚residierten’ weiterhin in der ehem. Kurmainzischen Statthalterei (Regierungsstraße 73). Im Behördenhaus war neben der „Landwirtschafts-Abteilung“ u.a. die „Staatspolizeistelle Erfurt“ untergebracht.
2 Rebentisch
Politische Verhältnisse in Erfurt und der Aufstieg der NSDAP
Die Wahlen von 1919
Sowohl bei den Wahlen zur Nationalversammlung als auch zur Stadtverordnetenversammlung läßt sich eine breite Zustimmung zur neuen Republik ausmachen. Auf Seiten der Arbeiterparteien wurde die USPD bei allen drei Wahlen des Jahres 1919 klar stärkste Partei und erhielt stets über 37% der Stimmen, die Mehrheitssozialdemokraten blieben in Erfurt fast die ganze Weimarer Republik über in der Minderheit und kamen bei den ersten Wahlen auf Werte zwischen 15 und 21%. Mit 31 von 60 Sitzen hatten die Arbeiterparteien eine hauchdünne Mehrheit in der ersten Stadtverordnetenversammlung. Im bürgerlichen Lager wurde die linksliberale und reformorientierte DDP mit jeweils über 20% im ersten Wahljahr die stärkste Kraft. Insgesamt zeigten sich also über 2/3 der Erfurter und auch die erstmals wahrberechtigten Erfurterinnen mit den politischen Veränderungen einverstanden.
Die Wahlen von 1924
1924 kam es zu einem Sieg der bürgerlichen Parteien. Zentrum, DDP und DVP hatten sich zur "Bürgerlichen Vereinigung" (BV) zusammengeschlossen, die allerdings nur 15% und damit 8 Sitze auf sich vereinigen konnte, später kam die DNVP mit ihren 7 Sitzen noch hinzu. Die bürgerlichen Traditionsparteien hatten damit nur 15 Sitze von 51 Sitzen errungen. Innerhalb der Bürgerparteien war es zu einer Rechtsverschiebung gekommen, die linksliberale DDP war von ihren ehemals über 20% bei der im gleichen Jahr stattfindenden Reichstagswahl auf 3,9% abgesunken, diese Wähler stimmten nun für die die Republik sehr viel skeptischer betrachtenden bürgerlichen Rechtsparteien. Das sozialistische hatte sich fast halbiert und erhielt insgesamt ebenfalls 15 Sitze, wobei die KPD mit 20% und 10 Sitzen die stärkste Fraktion von allen stellte. Auffallendstes Ergebnis der Wahl von 1924 ist die Tatsache, daß viele Erfurterinnen und Erfurter sich von den alten Parteien abwanden, denn der erkleckliche Rest der Stimmen entfiel auf lokale Vereinigungen wie die "Volkswohlfahrt", in der sich der Mieterverein engagierte, die "Wirtschaftsliste Ullrich", die überwiegend aus dem Hausbesitzerverein bestand, die "Arbeitnehmerpartei" sowie den "Berufstätigen Frauen", die sich nach der Wahl der BV anschlossen. Der "Völkisch-Soziale Block" erhielt mit knapp 10% fünf Sitze, und errang damit einen ersten Achtungserfolg für die Völkischen.
Der Durchbruch der NSDAP 1929-1933
Gelang der NSDAP in vielen Regionen Deutschlands schon 1929 der Durchbruch, so kam sie in Erfurt bei den Stadtverordnetenwahlen vom 17.11.1929 nur auf magere 3,3% und einen Sitz. Ursache dafür war das Auftreten des politischen 'Entfants terribles' Adolf Schmalix, der mit seiner Großdeutschen Volkspartei mit 10 Sitzen die stärkste Fraktion stellte und im Wahlkampf neben seinen antisemitischen Äußerungen vor allem durch sein provokantes Auftreten gegen das lokale politische Establishment aufgefallen war (vgl. Ronald Barnabas Schill). Schmalix stellte mit seiner völkischen und extrem antisemitischen Lokalpartei, die vor allem für bestimmte Teile des Kleinbürgertums attraktiv war, reichsweit keinen Einzelfall dar, auch wenn die lokale Presse wie etwa das führende bürgerliche Blatt TAZ unter der Überschrift "Erfurt begeht moralischen Selbstmord" die Besonderheit der Erfurter Wahl betonte3. In Erfurt stellten sich sowohl die Arbeiterparteien als auch die bürgerliche Elite gegen Schmalix, der seine Wählerinnen und Wähler zum einen von den traditionellen Bürgerparteien, zum anderen aus dem Kreis der lokalen Interessenvertretung erhielt. Festzuhalten bleibt, daß nicht erst die (wirtschaftlichen) Krisenphase von 1930-33 Auslöser für die Wählerwanderungen nach rechts darstellte, sondern das Feld für die NSDAP bereits vorher bestellt war. Von einer Zustimmung zu einer linksliberalen, zur Zusammenarbeit mit der SPD bereiten, bürgerlichen Politik, wie es das Wahlergebnis von 1919 widerspiegelte, verschoben sich die Gewichte auf Seiten der bürgerlichen Wähler weiter nach rechts. Nach der Wahl büßte Schmalix jedoch rasch große Teile seiner Popularität ein, da er einerseits hauptsächlich durch politische Skandale in Erscheinung trat, andererseits seine radikaloppositionelle Haltung in einigen Kernpunkten seines Programms aufgab (Beispiel: Warenhausfrage, in der er eine kommunale Sondersteuer für die großen Kaufhäuser gefordert hatte), und so für bestimmte (Protest-)Wählerkreise an Attraktivität verlor. Hitler und die NSDAP erschienen zunehmend als die konsequentere Option. Ungeachtet der programmatischen Nähe gab es eine gegenseitige scharfe Abgrenzung von Schmalix und der NSDAP, denn beide beanspruchten das völkisch-nationalistische Alleinvertretungsmonopol für sich. Trotz dieser Abgrenzung kann Schmalix als Wegbereiter der NSDAP angesehen werden. Der Niedergang der 'Schmalix-Partei' zeigte sich bereits bei den Reichstagswahlen von 1930, bei der sie vergeblich versuchte, überregional anzutreten, doch selbst in Erfurt nur noch 3% erhielt. Erstmals konnte die NSDAP mit knapp 17% einen nennenswerten Wahlerfolg in der Stadt erzielen, wenngleich die äußerste Rechte zusammengenommen sogar leicht verlor und die NSDAP hinter den Ergebnissen in der Region (Weimar: 28%, Gotha 25%) zurückblieb. Insgesamt blieb das klassische Parteienspektrum in Erfurt bei der Reichstagswahl 1930 noch einmal weitgehend erhalten.
Soziales Fundament und gesellschaftliche Position der NSDAP
Trotz des beachtlichen Stimmenanteils bei den Wahlen 1930 blieb die organisatorische Basis der NSDAP bis zur Machterlangung in Erfurt relativ schwach. Sie rekrutierte sich im Wesentlichen aus dem sozial bedrohten Mittelstand, der vorher durch die lokalen Interessenparteien politisch repräsentiert worden war. Kleine und mittlere Angestellte sowie Beamte mit einem Schwerpunkt bei Post und Bahn gehörten zum Klientel der Nazis. Die Partei zählte jedoch trotz des Wahrerfolges im September 1930 in Erfurt nur rund 150 Mitglieder, und damit in etwas soviel wie in der Kleinstadt Apolda. Im Gegensatz zu anderen Städten gelang es ihr in Erfurt auch nicht, konservative Persönlichkeiten des städtischen Lebens für sich einzunehmen. Wichtige Positionen in Politik und Vereinsleben blieben in der Hand der alten, schon im Kaiserreich bestimmenden bürgerlichen Honoratioren, deren Spektrum von der liberalen DDP bis zur DNVP reichte und die verschiedene Interessensgruppen des Wirtschafts- und Bildungsbürgertums vertraten. Zwar war es seit 1924 zu einer Abspaltung mittelständischer Interessensgruppen gekommen, die sich durch die Interessenparteien vertreten ließen. Doch diese wurden im Unterschied zur NSDAP immer noch von 'ehrbaren Bürgern' geführt, die sich trotz ökonomischer Differenzen in einem bürgerlichen Grundkonsens mit den etablierten Parteien und ihren Vertretern befanden. Die Etablierung von Vorfeldorganisationen wie dem NSBO oder anderen Vereinen mißlang mit Ausnahme der SA weitgehend, es kam auch zu keinem nennenswerten Vordringen in das sozialistische Arbeitermilieu. Auch auf propagandistisch-organisatorischer Ebene zeigte sich die Schwäche der 'Bewegung' in der Stadt. So gelang es ihr trotz des pluralen Pressespektrums in Erfurt bis 1933 nicht, eine eigene Tages- oder Wochenzeitung zu etablieren. Die Stadtverordnetenversammlung konnte ihr ebenfalls nicht als propagandistische Plattform dienen, da sie dort nur mit einem Abgeordneten vertreten war. Redner für publikumswirksame Versammlungen mußten von außen geholt werden (Frick, Sauckel, auch Goebbels). Durch die reale Machtlosigkeit fiel auch der 'Faktor Karriere' in Erfurt weg, der im benachbarten Thüringen durchaus zu Übertritten aus dem bürgerlichen Lager geführt hatte, eine Parteimitgliedschaft war bis zum 'Preußenschlag' im Juli 1932 eher hinderlich, denn die preußische Regierung ging gegen die NSDAP und ihre Organisationen mit Verboten vor (Redeverbot für Hitler und andere Nazigrößen).
Diskreditierung der bürgerlichen Rechtsparteien – der Youngplan
Der Aufstieg der NSDAP ist weniger im lokalen, als vielmehr im nationalen und internationalen Rahmen begründet. Vor allem die Kampagne gegen den Young-Plan und die Ermordung des Außenministers Stresemanns führten zu einer Polarisierung im bürgerlichen Lager. Die gemeinsam mit der NSDAP geforderte und polemisch vorgetragene Ablehnung des Youngplans durch die Rechtsparteien spaltete sie von den rechtsliberalen Kreisen ab, die mit ihrer widerwilligen Zustimmung erneut Teile ihrer Anhängerschaft verloren. Vorfeldorganisationen wie der Stahlhelm warfen ihr ganzen Gewicht für ein Volksbegehren gegen den Youngplan in die Waagschale. In Ihren Veranstaltungen – etwa am 29. September 1929 auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz mit Fackelzug und Feldgottesdienst – wurden neben der Beschwörung der Nation vor allem an die Proletarisierungsängste des Mittelstandes appelliert. Zentrale Bedeutung kommt der Kampagne gegen den Youngplan deshalb zu, weil die NSDAP von den anderen beteiligten Organisatoren erstmals als gleichwertiger Partner anerkannt wurde – ein nicht zu unterschätzender Prestigegewinn. Zudem ermöglichten die gemeinsamen Veranstaltungen (zentrale Kundgebung am 23.10.1929 im Alten Ratskeller) , die weitestgehend von den anderen Organisationen bezahlt wurden, den Nationalsozialisten, breitere Bevölkerungsschichten zu erreichen. Es stellte sich heraus, daß die einzige Gewinnerin der Anti-Youngplan-Kampagne die NSDAP war. Auf Kosten von DVP und DNVP konnte sich als 'unverbrauchte' und nicht in das 'System vom Weimar' verstrickte Alternative präsentieren. In der Folgezeit versuchte die lokale DNVP darauf zu reagieren, indem sie sich wieder stärker von den Nazis abgrenzte und die Vorbehalte des alten Bürgertums gegen den wildgewordenen Mittelstand aktivierte. Dennoch konnte die breitere Akzeptanz der NSDAP auch im Erfurter Bürgertum als ein Ergebnis der Kampagne gegen den Youngplan nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Die SA als antikommunistische 'Bürgerwehr'Mit Verschärfung der Lage gerieten die Kommunisten zunehmend wieder in die das Bürgertum einende Rolle der 'roten Gefahr', die sie bereits Anfang der 20er Jahre innehatten. Die SA bot sich als 'Bürgerwehr' an, die den Kommunisten Paroli bot – nicht selten in blutigen Saal- und Straßenschlachten. Waffenfunde bei Erfurter KPD-Mitgliedern verstärkten das selektive Wahrnehmungmuster der Kommunisten als Aggressor. Die mindestens genauso brutal agierende SA wurde nicht zuletzt durch die entsprechende Presseberichterstattung als defensiv empfunden, was sich auch in den milden Urteilen der Justiz und dem teilweise parteiischen Vorgehen der Polizei niederschlug. In gewissem Widerspruch dazu stand die aggressive Vorgehensweise der NSDAP seit 1931, die auf die Eroberung der Straße abzielte. Mit provokanten Umzügen durch Erfurts Norden konnte sie sich gegen die gewalttätigen Kommunisten profilieren. Die anderen rechten Organisationen einschließlich des Stahlhelms erscheinen vielen zunehmend als zu passiv, die liberalen Parteien und Organisationen wie die DDP waren in der Bedeutungslosigkeit versunken (Die DDP erhielt bei den Reichstagswahlen 1932 in Erfurt weniger als 1% der Stimmen)
Weltwirtschaftskrise und Agonie der kommunalen Selbstverwaltung
Die Weltwirtschaftskrise schlug sich auch in Erfurt stark nieder und führte zu einer stetigen Zahl von Arbeitslosen: Waren im Sommer 1929 rund 6.000 Menschen arbeitslos gemeldet, waren es im Sommer 1930 bereits knapp 9.000 Personen. 1931 stieg die Zahl auf rund 14.000 Beschäftigungslose, den Höhepunkt erreichte sie im Sommer 1932, als die Quote mit rund 20.000 Arbeitslosen auf 36,5% anstieg. Ende des gleichen Jahres konnten 43.000 Personen und damit 30% der Gesamtbevölkerung der Stadt ihren Lebensunterhalt nur durch öffentliche Zuwendungen sichern, die jedoch sehr spärlich ausfiel. Neben der Industrie war auch der Mittelstand betroffen. Brünings Deflationspolitik brachte zudem eine Schlechterstellung der Beamten mit sich. Eines der lokalen Symbole für den Niedergang war die 1932 verfügte Schließung der Pädagogischen Akademie, die erst 1929 errichtet worden war und von dem sich die Bürgerschaft viel, nicht zuletzt ein Anknüpfen an die alte Erfurter Hochschultradition, erhofft hatte. Selbst das Stadttheater als kulturelles Flaggschiff stand auf dem finanziellen Prüfstand. Die psychologischen Auswirkungen dieser sozioökonomischen Krise gepaart mit der vermeintlichen Tatenlosigkeit des 'Weimarer Systems' führten zu einer Hinwendung breiter Schichten zur NSDAP. Die Krise hatte auch Auswirkungen auf die Kommunalpolitik, die in zunehmendem Maße von Steuerausfällen und steigenden Wohlfahrtsausgaben bestimmt wurde. Die unterschiedlichen Interessen im Bürgerblock kamen nun stärker zum Vorschein und verhinderten trotz der sich zuspitzenden Lage eine erneute Einigung der bürgerlichen Parteien. Im Juni 1931 betrug das städtische Defizit bereits 2 Millionen Reichsmark, nachdem man 1930 letztmalig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnte. Die unvermeidlichen drastischen Steuererhöhungen bedingt durch die preußische Sparverordnung wurde von vielen als Verlust der kommunalen Selbstverwaltung empfunden. Die lokalen Honoratioren und ihre Organisationen verloren an Boden, sie versuchten vergeblich durch das Appellieren an alte bürgerliche Werte den Vormarsch der NSDAP einzudämmen. Die Stimmung schlug auch in Erfurt zugunsten des 'Retters Hitler' um. Zudem lassen sich in der zunehmenden Begeisterung für die Nationalsozialisten deutliche Generationenunterschiede erkennen. Vor allem jugendliche Angehörige des Mittelstandes, aber auch aus gutbürgerlichen Kreisen, fanden hier eine über das Politische hinausgehende Bewegung, die Ihnen ein umfassendes Gemeinschaftsgefühl bot und für die Zeit nach der Machterlangung ein Aufgehen in der Volksgemeinschaft versprach.
Wechsel der politischen Elite
Im Vergleich zu Region und Reich zeitlich leicht verzögert, wurde die NSDAP auch in Erfurt zu einer Massenbewegung. Sie entfaltete in den letzten Jahren der Republik mit tatkräftiger Unterstützung von außen einen ungeheuren Aktionismus mit zahlreichen Versammlungen, Demonstrationen und Kundgebungen, deren wichtigste neben dem Besuch des offen für die NSDAP eintretenden Hohenzollernprinzen August Wilhelm im April 1932 Hitlers erster Besuch in der Stadt am 26. Juli 1932 im Rahmen seines Deutschlandfluges war. Die Beteiligung von über 60.000 Menschen in der Mitteldeutschen Kampfbahn dokumentiert die Begeisterung, die mittlerweile breite Kreise erfaßt hatte. Generell war die Kritik an den Nationalsozialisten in der bürgerlichen Presse leiser geworden, in grundlegenden Fragen stimmte man mit Hitler überein. Wie weit die Wählerschichten sich 1932 bereits nach rechts gewandt hatten zeigen die Präsidentenwahlen, bei denen Hitler in Erfurt trotz eines von vielen bürgerlichern Prominenten der Stadt getragenen Wahlaufrufes für Hindenburg und im Gegensatz zum reichsweiten Ausgang die relative Mehrheit gewann. Berücksichtigt man noch die Tatsache, daß die SPD-Wählerschaft überwiegend für Hindenburg gestimmt haben dürfte, fällt die Präferenz des bürgerlichen Lagers für Hitler noch eindeutiger aus, und das ungeachtet des hohen Ansehens, das Hindenburg als Person gerade im Bürgertum noch immer genoß. Die etablierte lokale Führungsschicht hatte ihre Anhängerschaft weitestgehend verloren. Zwar kam es bei der Novemberwahl 1932 noch einmal zu einer gewissen Wählerwanderung von der NSDAP hin zur DNVP, doch dies stellte nur ein retardierendes Moment auf dem Weg der Nationalsozialisten zur Machtübertragung dar. Zudem war die DNVP mittlerweile von einer demokratischen Partei weit entfernt und forderte ebenfalls unverhohlen die nationale Diktatur und ein Ende von 'Parlamentarismus und Bonzenherrschaft'. Im Reichstag besaßen NSDAP und KPD durch den Wahlausgang eine Sperrmajorität, wodurch eine parlamentarische Regierungsbildung verunmöglicht wurde. Als Hitler schließlich am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt worden war, wurde dies von großen Teilen des Erfurter Bürgertums und auch von großen Teilen der Honoratiorenschaft freudig und erwartungsvoll begrüßt. Während die kleinbürgerlichen Kreise auf eine Umsetzung des nationalsozialistischen Programms glaubten, hoffte die bürgerliche Führungsschicht auf ein starkes konservatives Element und die Abnutzung der NSDAP.
Bürgerliches Milieu nach 1933
Ein nationales Weltbild und eine Frontstellung gegen das sozialistische Lager ließen weite Teile des Bürgertums ebenso hinter der NS-Politik stehen wie die Kulturpolitik, die mit der