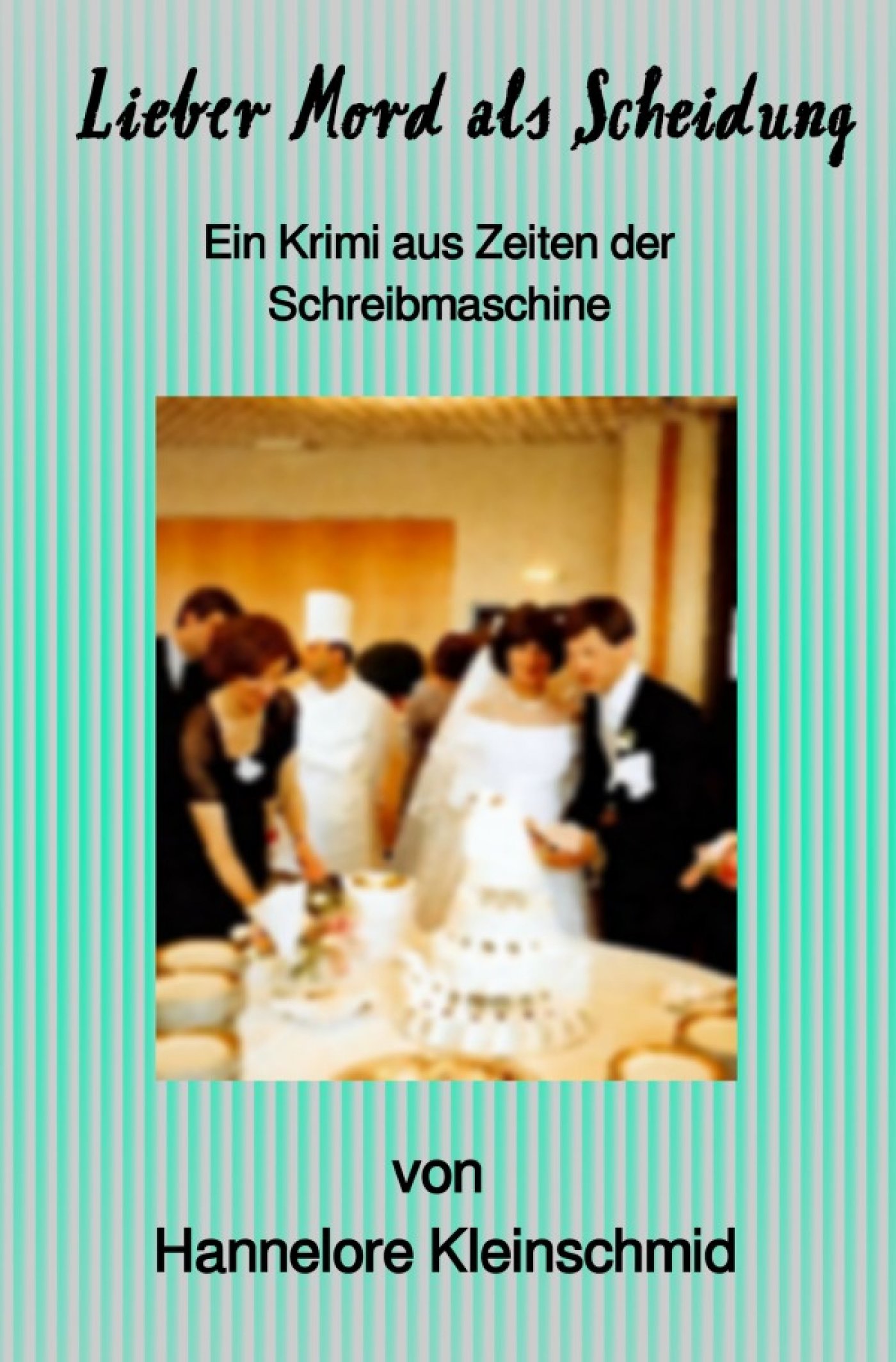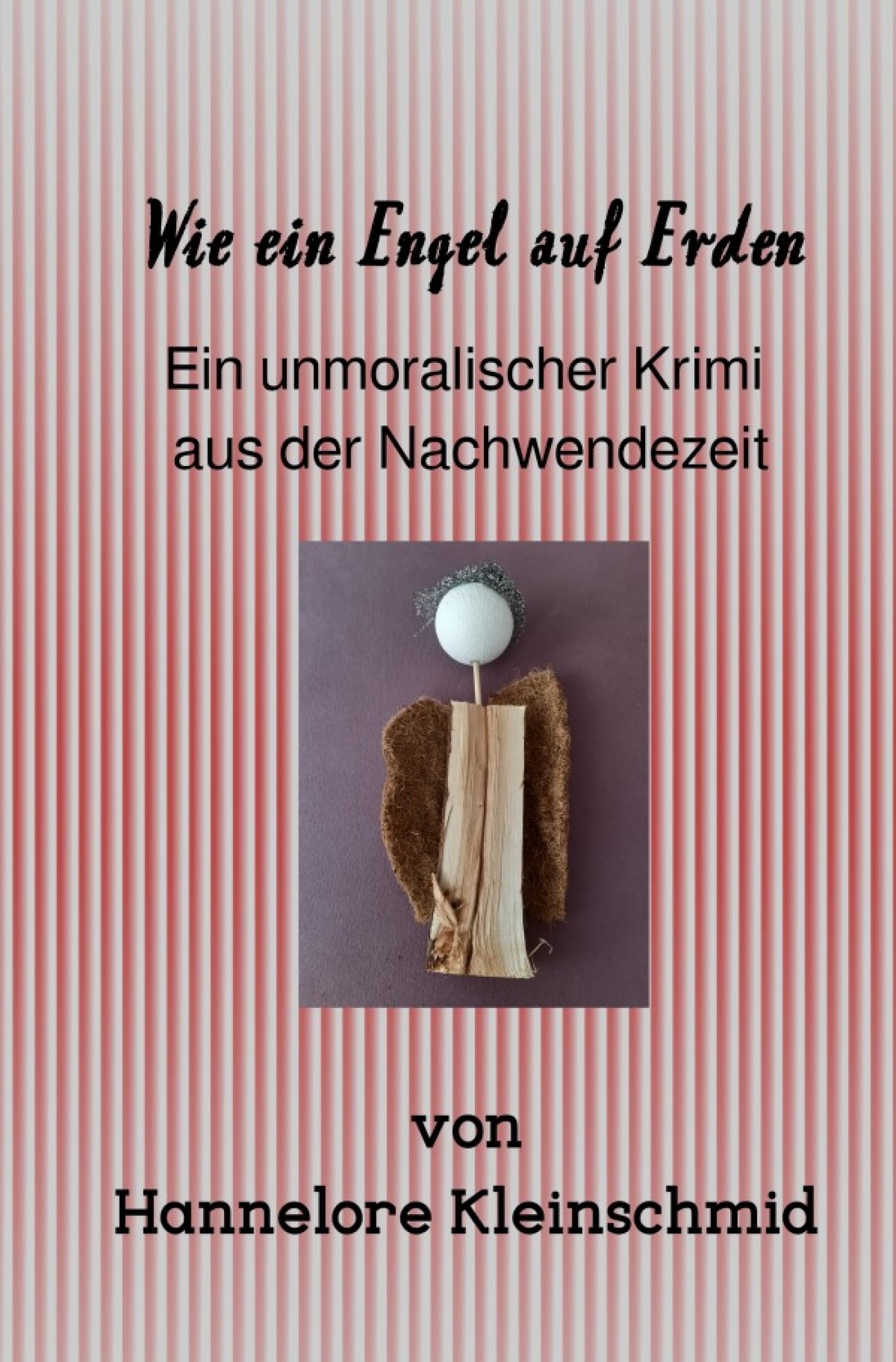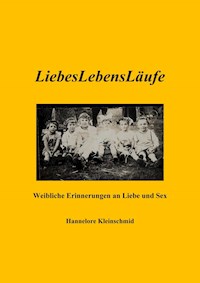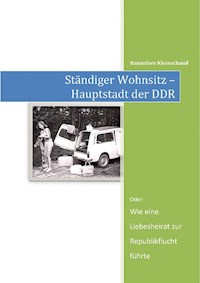
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie lebte es sich vor einem halben Jahrhundert in einem inzwischen untergegangenen Land? Mittlerweile gehört die DDR ja schon beinahe in den Bereich der Geschichten von früher, als alles viel besser war - oder viel grauer und böser? Wie eine Liebesheirat zur Rekpublikflucht führte... 10 Tage nach dem Mauerbau kommt eine junge Frau aus der Provinz als Studentin nach Ost-Berlin und verliebt sich in einen dort lebenden Österreicher. Der Heiratswunsch der beiden bringt die DDR-Behörden in Konflikte. Sie genehmigen zwar die Heirat, verweigern der Frau aber die Ausreise ebenso wie dem tödlich erkrankten Kind der beiden eine Operation in Bonn, also im Westen. Die Konsequenz: Organisation einer Republikflucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ständiger Wohnsitz:
Hauptstadt der DDR
1. Zweimal umsteigen
Es war eine Fahrt ins Ungewisse. Hanne und ihre Eltern hatten keine Ahnung vom Leben in Berlin. Sie kannten den Alltag in ihrer kleinen Stadt, in der Hanne das Abitur als Beste der einzigen Erweiterten Oberschule bestanden hatte. Kein Wunder, dass sie von allen als Streberin angesehen wurde. Genauer gesagt als Streberleiche.
Die DDR war ein sehr geordnetes Land. Jedes Abenteuer wurde von vornherein ausgeschlossen, weil sich der Staat um die Bewohner kümmerte, egal, ob sie das wollten oder nicht. Nachdem Hanne den Bescheid erhalten hatte, sie dürfe Germanistik studieren, wurde ein Platz im Studentenheim bereitgestellt. In Berlin würde sich ein Bett finden. Selbst wenn es das fünfte oder sechste Bett in einem Vier-Bett-Zimmer und die Matratze durchgelegen war. Oder direkt auf dem Boden lag. Niemand musste im Sozialismus unter der Brücke schlafen. Sorge um den Menschen werde groß geschrieben, sagten die Funktionäre.
Hanne hatte sich den Abschied aus ihrer thüringischen Heimatstadt tränenreich ausgemalt. Vorm Einschlafen hatte sie den Sommer über jeden Abend gedacht, wie unendlich traurig ihre Mutter Annemarie sein würde, wenn das einzige Kind mit gerade 18 Jahren von zu Hause weg ging. In die Fremde, bis nach Berlin, über 500 Kilometer entfernt. Wie sie aus Sehnsucht geweint habe, würde Annemarie schreiben. Diese Nachricht würde Hanne zu Tränen rühren. Also schriebe sie nach Hause, dass auch sie vor Heimweh Tränen vergossen habe. Erneut würde die Mutter weinen.
Der traurige Abschied stand kurz bevor, als Hanne mit den Eltern auf dem Bahnhof wartete. Der Geruch der qualmenden Lokomotiven, in denen billige Braunkohle verfeuert wurde, verband sich von nun an mit dem Aufbruch ins Studentenleben. Noch Jahre später wunderte sie sich, wieso die Eltern ihr Goldkind mutter- und vaterseelenallein in die unbekannte Ferne reisen ließen. Offensichtlich vertrauten sie der umfassenden Sicherheit, derer sich die DDR rühmte. Oder sie fühlten sich der ungewohnten Lage nicht gewachsen.
Bis kurz vor der Abreise hatte Hanne das Kofferpacken aufgeschoben, weil ihr davor graute. Die Mutter schepperte in der Küche mit Töpfen und Tellern herum, als gehe sie das alles nichts an. Hanne überlegte, welche Sachen sie unbedingt in Berlin brauchen werde, und warf sie aufs Bett. Als sie sich mühte, den Berg, der sich angehäuft hatte, in den grau gestreiften Stoffkoffer mit Kanten aus Kunstleder und die karierte Reisetasche zu zwingen, klemmte ein Reißverschluss. Vor Wut heulte sie auf. Vater Willi schrie ins Zimmer, es sei höchste Zeit für den Aufbruch. Hanne brüllte zurück, er solle sie gefälligst in Ruhe lassen. Daraufhin erschien der kleine Mann, der von der Tochter um einen halben Kopf überragt wurde, auf der Schwelle, überblickte die dramatische Lage und kritisierte viel zu laut, wie man nur so ungeschickt sein könne. Hanne raste wutschnaubend aus dem Zimmer. Umgehend beschimpfte nun die Mutter den Vater als unsensibel und Elefant im Porzellanladen. Er erwiderte wenig freundlich:
„Wenn du mitgehen willst, solltest du dich schleunigst anziehen. In der ältesten aller Kittelschürzen kannst du deine Tochter nicht zum Bahnhof begleiten. Ein Büstenhalter wäre auch angebracht.“ fügte er hinzu. Es klang irgendwie unfreundlich.
Die familiäre Harmonie war mehr als gefährdet. Das kam übrigens ziemlich oft vor. Zoff dieser Art war bei Grimms nichts Seltenes.
Schließlich hatte Willi Koffer und Tasche so gepackt, dass er beide Stücke schließen konnte. Stolz tat er es, wenn auch unter Ächzen. Vorsichtshalber schob Hanne den Gedanken weit von sich, wie sie den ganzen Kram jemals wieder in den beiden Behältnissen verstauen könnte. Hätte sie geahnt, dass das schon in wenigen Tagen der Fall sein würde, wäre ihr noch mulmiger zumute gewesen. Obgleich Koffer und Tasche eher klein waren, schienen sie Steine zu enthalten. Es verbesserte ihre Stimmung nicht, als sie sich vorstellte, wie sie diese beiden Felsbrocken über endlose Berliner Straßen schleppte. Dabei hätte sie die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd strahlen müssen, weil sie einen sehr begehrten Studienplatz erobert hatte. Wie sich bald herausstellte, war sie die Jüngste in der Seminargruppe. Eine Seminargruppe war die Schulklasse in der sozialistischen Universität.
Die Fahrt nach Berlin dauerte mindestens acht Stunden. Zweimal musste man umsteigen, wovor Hanne graute. Nur wenn der Zug pünktlich war, bekam man den Anschluss. Das geschah selten bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Also brauchten die Reisenden meistens viel oder sogar sehr viel Zeit, bis sie ihr Ziel erreichten. Doch die Reichsbahn dachte positiv und nannte ihren Zug nach Berlin Städteschnellverkehr.
Während die Waggons schaukelnd über die Gleise ratterten, kam Hanne ins Gespräch mit einer Mitreisenden, die in Berlin lebte. Wie sich herausstellte, vermietete ihre Mutter unweit der Schönhauser Allee ein Zimmer an Studenten. Wenn das kein Wink des Schicksals war. Die Frau besaß sogar ein Telefon. Hanne schrieb sich die Nummer auf. Sie würde anrufen und nach dem Zimmer fragen. Vielleicht war ihr das Glück hold. So kann es gehen mit dem Zufall im Leben.
Aber erst einmal galt es, auf dem Ostbahnhof die S-Bahn nach Biesdorf zu finden, bevor die Arme, die Koffer und Tasche trugen, sich auf die doppelte Länge ausgedehnt hatten und abfielen. Wie das Mädchen vom Lande fühlte sie sich, als sie, am Zielbahnhof angekommen, verschwitzt, klebrig und schmutzig anderen jungen Leuten mit Koffern und Taschen hinterher trabte. Besser gesagt: sie schleppte sich und das Gepäck mühsam vorwärts. Damals trug man es noch am Griff, die Rollen unter den Koffern waren noch nicht erfunden. Glücklicherweise trog ihre Ahnung nicht, dass die Anderen ebenfalls Studenten waren, und so landete sie noch vor Einbruch der Dunkelheit, die ja sommers lange auf sich warten lässt, zuerst in einem Büro und danach als Fünfte in einem Vierbettzimmer. Der nicht mehr ganz neue Neubau des Studentenheimes verströmte den Charme der DDR-Zweckbauten aus den fünfziger Jahren. Grauer Putz über Beton, Korridore mit grauem Linoleumboden, die intensiv nach Lysol rochen. Zwei Mädchen sahen die Neue skeptisch an. Sie stellten sich als weise ältere Semester heraus. Während Hanne neben dem Bett stand, das sie ihr zuteilten, und sich schrecklich verloren fühlte, bequemte sich die eine, ihr zu erklären, wo sie Decke, Kissen und Bettwäsche abholen müsse. Die Zweite ratterte herunter, welches ihr Schrankfach sei und wo sie Essen fassen, sich duschen und andere dringende Bedürfnisse erledigen könne. Abschließend sagte sie: „Hoffentlich nistest du dich nicht hier ein. Du siehst ja, wie eng es schon für vier Leute ist, viel zu eng.“
2. Einen Wunsch hat jeder frei
Am nächsten Morgen stand ein feierlicher Akt bevor: die sozialistische Immatrikulation.
Hanne war sicher, dass sie die ganze Nacht kein Auge zugetan, sondern auf die Geräusche im Zimmer geachtet hatte, als würde sie von einem Wach- und Abhördienst bezahlt. Unheimlich laut knallten die Türen im ganzen Haus. Geheimnisse unter den Studenten gab es nicht, ging man von der Hellhörigkeit des Gebäudes aus. Noch bevor die vier Zimmergenossinnen richtig aufwachten, machte sich die Neue davon. Da es ihr zu kompliziert erschien, in der Mensa des Studentenheimes Frühstück aufzutreiben, trank sie aus dem Wasserhahn im Duschraum und aß auf dem Weg zum S-Bahnhof die letzte von der Mutter mit viel Liebe und noch mehr Leberwurst zurecht gemachte Schnitte. Als Provinzlerin wusste sie nicht, wie lange sie bis in die Humboldt-Universität unterwegs sein würde. Der Gedanke quälte sie, an diesem Tag unpünktlich zu sein oder sich womöglich gar nicht hinzufinden. Aber der Mensch wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben, und so nahm sie die Hürden der Großstadt und durchschritt nach gut einer Stunde, also viel zu zeitig, das Foyer der Uni. Für einen kurzen Augenblick war das ein erhebendes Gefühl. Sie drang ein in die Hallen, die der echten Wissenschaft geweiht waren. Allerdings bestimmten die Blauhemden der Freien Deutschen Jugend das Farbbild im größten Raum des Gebäudes und wiesen darauf hin, dass es nicht allein um Wissenschaft gehen würde. Der Sozialismus spielte immer mit. Übrigens trug auch Hanne brav ihr Blauhemd und beobachtete interessiert, wie andere aus Taschen die blauen Blusen hervorkramten und lediglich für die sozialistische Zeremonie überzogen, um sie alsbald wieder in die Tiefen der Behältnisse zu stopfen und sich ganz zivil zu bewegen. Wieder kam sich das Mädchen aus der kleinen Stadt trottelig vor, weil es den Rest des Tages FDJ-Zugehörigkeit demonstrieren musste, denn unter dem blauen Hemd trug es nur den Büstenhalter. Man lernt aus der Betrachtung der Mitmenschen.
Um einen Studienplatz zu bekommen, reichten gute Leistungen in der Schule nicht aus. Gesellschaftliche Aktivitäten hieß das Zauberwort. Dabei handelte es sich um Aufgaben, die man ehrenamtlich übernahm, allerdings nicht unbedingt aus Leidenschaft, sondern um eben diese gesellschaftliche Aktivitäten nach- und vorweisen zu können. Eine sozialistische Persönlichkeit entwickelte sich am sichtbarsten als Funktionär in einer Massenorganisation. Das Amt des Kassierers bei der Deutsch-Sowjetischen Freundschaftsgesellschaft war besonders begehrt, weil jeder wusste, dass es kaum Mühe machte, von Mitschülern oder Kollegen monatlich zehn Pfennige Beitrag einzusammeln. Darüber hinaus wurden kaum Aktivitäten bei der DSF augenscheinlich.
Hanne war ein Junger Pionier gewesen. Fast alle ABC-Schützen gingen zu den Pionieren. Ein sechsjähriges Kind will so sein wie die anderen. Die meisten Eltern kamen aus der Hitlerzeit und überlegten zweimal, ob sie Nein sagten zur kommunistischen Kinderorganisation und womöglich Unbilden auf sich nahmen.
Mit zehn Jahren wurden die Jungpioniere in einer Feierstunden zu Thälmann-Pionieren erklärt, benannt nach dem Kommunisten, Ernst Thälmann, der im faschistischen Zuchthaus umgekommen war.
In der 8. Klasse wurden sie allesamt wiederum pauschal mit einer Zeremonie in die Freie Deutsche Jugend, die sozialistische Jugendorganisation FDJ, übernommen.
Schon beim Nachwuchs wurde das Ja als selbstverständlich vorausgesetzt. So wurde das Nein zum mutigen Schritt des Einzelnen, man sagte es stets allein und im Bewusstsein möglicher Schwierigkeiten. Dieses Nein musste man persönlich erklären und war dabei immer dem Verdacht ausgesetzt, ein Gegner der DDR, ein Feind des Sozialismus zu sein.
Hanne neigte dazu, stets die Beste sein zu wollen. Später reimte sie sich in Küchenpsychologie zusammen, warum da so war: Zwischen Mutter und Vater flogen nicht selten laute Worte hin und her, und das Kind meinte, es sei schuld daran. Also mühte es sich nach Kräften, reibungslos zu funktionieren. Deswegen grämte sich Tochter Grimm, wenn sie in der Schule eine Zwei bekam und keine Eins. Zwar versprachen ihr die Eltern fünf Mark für jede Drei oder noch schlechtere Zensur, doch der pädagogische Trick klappte nicht, wie alle drei Familienmitglieder von vornherein wussten.
Eines Tages brachte sie tatsächlich eine Fünf nach Hause. Sie ärgerte sich mächtig über diese Ungerechtigkeit. Es geschah im Unterricht in der Produktion, der während ihrer Oberschulzeit eingeführt wurde, um die Schüler an die sozialistische Produktion und die siegreiche Arbeiterklasse heranzuführen. Der Beschluss von oben musste umgehend in die Praxis umgesetzt werden. Da spielte es keine Rolle, dass vielerorts die praktischen Voraussetzungen fehlten. So wurde die Schulklasse beauftragt, einen Sandhaufen vermittels Schaufeln von A zu einem etwa 20 Meter entfernten B zu befördern. Inspiriert von dem westdeutschen Spielfilm „Das Spukschloss im Spessart“, der in den sozialistischen Kinos lief, bildeten die Schüler unter Hannes Regie eine Kette, und der erste legte den Sand von seiner Schaufel vorsichtig auf die Schaufel des nächsten und so weiter und so fort.
„Skandal! Skandal!“ hieß es, nachdem das unwürdige Verhalten entdeckt wurde.
Da alle Titel, Berufsbezeichnungen und Titulierungen in der DDR männlich waren, wurde Hanne zum Rädelsführer eines Anschlags auf den Sozialistischen Unterrichtstag in der Produktion. Das hatte einen Elternabend zur Folge, der wenig gute Haare an ihrem Pferdeschwanz ließ, und eine Fünf. Beides geschah allerdings vorübergehend. Schon auf dem Zeugnis schien die Welt in Ordnung:
“Auch im Betrieb war sie eifrig und gewissenhaft bei der Sache.“ befand die Klassenlehrerin. Ein Jahr später war aus dem Rädelsführer wieder der „Typus eines verantwortungsbewussten, zielstrebigen FDJ-Funktionärs“ erstanden, wie auf dem Zeugnis verlautete, nachdem der Sandhaufen verschwunden und durch das millimetergenaue Feilen eines Metallstücks ersetzt worden war.
Hanne litt darunter, dass sie nicht als Typ für Partys aller Art begehrt wurde. Sie war neidisch auf die Schönen und Flotten in ihrer Klasse, die von Jungen umschwärmt waren. Im Vergleich zu ihnen hielt sie sich für eine graue Maus mit großer Nase und kleinen Augen. In diesem Punkt widersprach die Mutter nicht. So kam die Tochter nicht auf die Idee, es könnte den Jungen einfach zu anstrengend sein, sich mit einer einzulassen, die alles besser wusste.
„Du musst doch wissen, was du willst“, verlangte der Vater, als sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie Medizin oder Germanistik studieren wollte. Annemarie hätte sie liebend gern als Ärztin gesehen, hielt sich aber zurück, das laut zu sagen. In Bukarest oder Budapest hätte Hanne sofort mit dem Medizinstudium beginnen können, weil sie Klassenbeste und eine fleißige FDJ-Funktionärin war. Aber die rumänische oder die ungarische Hauptstadt lagen noch viel weiter von zu Hause weg als die Hauptstadt der DDR. Schmutzwäsche heim zu bringen und thüringische Wurst mitzunehmen, wurde bei dieser Entfernung unmöglich. Obwohl die Mutter ihre Tochter am liebsten als Frau Doktor in der Poliklinik konsultiert hätte, wollte sie sie doch nicht in so weiter Ferne wissen.
Hanne sah sich zwar gern als helfender Engel im weißen Kittel, doch gleichzeitig erinnerte sie sich gut daran, wie sie zweimal ohnmächtig vom Stuhl gekippt war, nachdem sie ihren Finger versehentlich geritzt und zwei Tropfen Blut entdeckt hatte. So beriet sie sich mit dem bewunderten Deutschlehrer und bewarb sich anschließend für Germanistik. Nach der angemessenen Frist kam auf einer kleinen grauen Postkarte die Nachricht, ein Studienplatz für Wirtschaftswissenschaften stehe sofort zur Verfügung. Es war das Wesen der staatlichen Lenkung, dass fast jedem ein Ausbildungsplatz zugewiesen wurde, allerdings wenigen der, den sie angestrebt hatten.
„Soll ich abhauen in den Westen?“ fragte Hanne daraufhin tief enttäuscht ihren Vater.
Sie war nie in Westberlin gewesen und nur zweimal als Kind mit dem Vater in seine alte Heimat, nach Nürnberg, gereist. Mitschüler erzählten hinter vorgehaltener Hand als großes Geheimnis, dass es sehr einfach war, von Ostberlin aus in den Goldenen Westen zu gelangen. Man stieg dazu in eine S-Bahn, die in den Westteil der Stadt fuhr, mit einer S-Bahn-Karte für zwanzig Ostpfennige. Die Menschen ließen ihr Hab und Gut in den ostdeutschen Wohnungen sowie bei Verwandten und Bekannten zurück, bis auf ein oder zwei Koffer, die bei Reisenden nicht weiter auffielen. Damit fuhren sie nach Berlin und dort weiter mit der S-Bahn. In Westberlin verließen sie den rotgelben Zug und meldeten sich im Aufnahmelager Marienfelde als DDR-Flüchtlinge, um in ein neues Leben zu starten, das nicht so grau und arm war wie in der von den Sowjets beherrschten Ostzone und ohne die dort geforderten gesellschaftliche Aktivitäten. Viele Leute stellten Anträge, als Flüchtling anerkannt zu werden, denn das brachte eine finanzielle Starthilfe in das neue Leben. Viele kamen anfangs bei Verwandten unter. Hannes Tante, die Schwester des Vaters in Nürnberg, war jedoch von abweisender Art. Annemarie schimpfte sie einen Geizkragen. Weder Hilfe noch Geld konnte man von ihr erwarten.
Im Sommer nach Hannes Abitur ergoss sich der Flüchtlingsstrom wie eine große Welle in den Westen. Oder wie eine Lawine, die anschwoll, weil sie immer größere Massen mit sich riss. Der westliche Rundfunk brachte in jeder Nachrichtensendung Zahlen, wie viele Menschen am gestrigen Tag, in der vergangenen Woche, im letzten Monat und seit Beginn der deutschen Teilung abgehauen waren. Republikflucht hieß dieses Verbrechen in der DDR. Jeder fünfte Bewohner suchte bis zum August 1961 die Freiheit im Westen und ließ die kommunistischen Machthaber im Osten zurück. In den Augusttagen bis zum 13. waren es 47-tausend Menschen, die flüchteten. Jeder kannte jemanden, der nicht in seine Wohnung zurückkehren würde. Aus jeder Straße in jedem Ort des Landes fehlten Bürger. Hanne sann darüber nach, ob man nicht nachmachen müsse, was so viele taten. Also fragte sie ihren Vater. Statt einer vernünftigen Antwort schimpfte er, sie sei von den Kapitalisten und von ihrem Großvater verhetzt worden. Beim zweiten Versuch, einige Tage später, reagierte er ruhiger und bemühte sich um eine ernsthafte Antwort.
Auf keinen Fall wollte Hanne sozialistische Wirtschaft studieren. Das begriff ihr Vater. Er sah es sogar ein. Also erklärte er ihr, im Osten wie im Westen sehe er Gutes und Schlechtes. „Meiner Meinung nach“ sagte er, „gilt es abzuwägen, wo das Gute überwiegt.“
Nach einer Pause fügte er hinzu: „Noch immer sehe ich die DDR als den besseren Staat, auch wenn es wahrscheinlich nur ein bisschen besser und gerechter zugeht im Sozialismus als im Kapitalismus, nur ein bisschen.“ Er atmete tief: „Weißt du, das muss jeder selbst herausfinden und entscheiden.“
Das schien Hanne ein aufrichtiges Bekenntnis zu sein, aber es ließ sie allein mit ihren Zweifeln. Sie musste sich ganz allein entscheiden.
In politischen Fragen hatte sich der Vater selten gelassen geäußert. Mit dem Großvater stritt er immer sehr laut. Die Lautstärke beruhte auf Gegenseitigkeit, und Mutter und Großmutter sagten dann nur: „Jetzt politisieren sie wieder.“
Hinter dem Rücken des Vaters half ihr die Mutter. Gemeinsam verfassten beide einen Brief an den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Die Leute in der DDR witzelten hinter vorgehaltener Hand, einen Wunsch habe jeder Bürger beim Spitzbart frei. Also tippte die Mutter in die Schreibmaschine, was für ein tüchtiges und intelligentes Mädchen Hanne sei und dass sie das Abitur als beste der Schule und damit der ganzen Stadt M. abgelegt habe. Und auch gesellschaftlich sei sie aktiv. Als Belohnung dafür müsse doch der gewünschte Studienplatz bereit stehen. Annemarie wagte es, parteilos wie sie im Gegensatz zu Willi, dem Genossen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, war und Hausfrau noch dazu, zu erwähnen, wie wenig es verwundere, wenn junge Menschen in den Westen gingen, die so vor den Kopf gestoßen würden. Wirtschaftswissenschaften statt Germanistik!
Gut, dass der Vater nichts von dieser leichtsinnigen Äußerung wusste, die ein misstrauischer Mensch als feindlich gegenüber dem sozialistischen Staat hätte auslegen können! Den Brief zeigten die beiden Verschwörerinnen ihm erst, als nach der zweizeiligen Nachricht aus dem Büro des Staatsratsvorsitzenden, die Sache würde bearbeitet, zwei Wochen später wieder eine kleine graue Postkarte eintraf. Sie enthielt nichts als die Nachricht, Hanne G. würde zum Germanistikstudium zugelassen und am 23. August 1961 immatrikuliert.
Sie hatte großes Glück gehabt. Oder war es historisch gesehen eher Pech? Jedenfalls wurde sie auf ein Gleis gelenkt, das sie nach Ostberlin und in die Humboldt-Universität führte.
Hätte sie anstelle der Zu- eine Absage erhalten, hätte sie sich womöglich gen Westen aufgemacht und ihr ganzes weiteres Leben wäre anders verlaufen. Vielleicht aber hätte sie es gar nicht mehr bis in den Westen geschafft, weil der 13. August 1961 ihr dazwischen gekommen wäre.
An diesem Tag startete die DDR eine weltweit einmalige Aktion. Sie mauerte sich ein, indem sie eine Mauer baute, die auf sozialistisch fortan "antifaschistischer Schutzwall" hieß. Westberlin war wie eine Insel rundum von der DDR umgeben. Um diesen größeren Teil der Stadt Berlin wurde in einer Nacht- und Nebel-Aktion eine Trennwand hochgezogen und in den folgenden Jahren mit viel schöpferischer Phantasie und militärischen Mitteln nahezu unüberwindlich gemacht. Auch an der Grenze zu Westdeutschland wurde eine Mauer errichtet.
Für Menschen wie Hanne wandelte sich der Staat vom 12. auf den 13. August zu einem Gefängnis, Zwar war das Gefängnis so groß wie die DDR, aber eine Flucht aus dieser Haftanstalt wurde so schwierig und lebensgefährlich wie aus jedem Hochsicherheitstrakt. Wer das Land verlassen wollte, begab sich von nun an in Lebensgefahr. Auf Flüchtlinge wurde geschossen.
Das alles geschah neun Tage, bevor Hanne zum Studium nach Berlin fuhr. Als im Radio gemeldet wurde, die DDR baue eine Mauer, ging Hanne in M. mit Freunden spazieren. Anstatt sich voneinander zu verabschieden, stritten sie erregt darüber, ob von nun an innerhalb der DDR mehr Freiheit herrschen würde. Die Menschen konnten nicht mehr wegrennen. Das könnte allerdings auch zur Folge haben, meinte Hanne, dass die Kommunisten jetzt tun und lassen, was sie wollen. Schließlich gab es keine Alternative mehr zur DDR und ihrer Sozialistischen Einheitspartei. Hanne begann vor Empörung zu weinen, als sie diesen Gedanken dachte. Klaus, ein Schulkamerad, mit dem sie nichts hatte und auch nicht viel zu tun haben wollte, sah die Sache ganz anders und erklärte sie zu einer Heulsuse, die keine Ahnung habe. Der Sozialismus sei nämlich von den neidischen und Macht gierigen Imperialisten bedroht worden, die die DDR unterwandert hätten und ausbluten lassen wollten. Sie hätten ihr die Menschen geraubt, indem sie sie mit falscher Propaganda lockten, was nun endgültig zu Ende sei. Außerdem hätten sie die DDR leer gekauft, die billigen sozialistischen Waren weggeschleppt. „Das ist nun vorbei, endgültig!“ freute sich Klaus.
„Glaubst du wirklich, dass die Rundfunkwellen jetzt an der Schutzmauer abprallen?“ fragte Hanne mit gehässigem Unterton. Mit plötzlich aufkommender Furcht fügte sie hinzu: „Und wenn die Amerikaner sich das nicht gefallen lassen? Dann haben wir den dritten Weltkrieg! Und Atombomben noch dazu! „
Klaus übersah ihre Angst: „Die fangen doch keinen Krieg gegen die Sowjetunion an. Wegen ein paar Mauersteinen und Westberlin!“
3. „Das geloben wir“
Wenn sich Hanne in Berlin ausgekannt hätte, wäre sie der Mauer schon am zweiten Tag begegnet. So aber eilte sie vom Bahnhof Friedrichstraße zur Humboldt-Universität, ohne sich darum zu kümmern, wie das Brandenburger Tor hinter der Mauer aussah. Ihr war nicht bewusst, dass sie weniger als zwei Kilometer unter den „Linden“ hätte entlang gehen müssen, um zu sehen und zu fühlen, wie es ist, eingemauert zu sein. Da sie das Studium eben erst begann, sollte sie noch viele Gelegenheiten bekommen, von der Mauer gestoppt zu werden. Sie würde noch oft genug fühlen, wie sie mit dem Kopf dagegen stieß.
Doch erstmal ging es um ein hehres sozialistischen Gefühl: die Immatrikulation. Die Neulinge wurden gemeinsam auf die DDR eingeschworen. Alle zusammen sprachen den Text nach, der ihnen im Audimax der Humboldt-Universität vorgesprochen wurde. Ein Satz aus diesem Gelöbnis beunruhigte Hanne, so dass ihr darüber ein Teil der erhabenen Zeremonie entging. Im Chor sagten alle nach, sie würden nach dem Studium dorthin gehen, wo der sozialistische Staat sie brauche. Schwurfinger nach unten in Richtung Fußboden zu halten, damit das Versprechen geerdet und ungültig würde, galt vermutlich nicht. Hanne tat das zwar, glaubte aber nicht so recht an die Wirkung. Doch wenn sie sich vorstellte, wie ein Funktionär von ihr als Diplomgermanistin verlangte, in der sozialistischen Landwirtschaft Schweine zu hüten, weil das der Revolution und dem Sieg des Kommunismus dienen würde, war ihr mulmig zu Mute.
Hanne war nicht prinzipiell gegen den Kommunismus. Die Losung, dass in einer glücklichen Zukunft jeder nach seinen Bedürfnissen leben könne, erschien ihr menschenfreundlich. Mit 16 Jahren hatte sie sich in ihrer tiefroten Phase befunden und war den FDJ-Funktionären beinahe auf den Leim gegangen.
So schrieb sie in der 10. Klasse ohne jede Aufforderung einen Brief an die monatlich erscheinende „Junge Generation“, weil es ihr nicht gefiel, dass viele anders redeten, als sie handelten. Rote Parolen aufzusagen, um gute Zensuren zu bekommen, hielt sie schlicht und einfach für unehrlich. Und beschwerte sich darüber. Den Propagandisten kam der Brief des Mädchens aus der Provinz gerade recht. Die Zeitschrift der Freien Deutschen Jugend druckte ihn umgehend ab und lud Hanne ein, mit dem Flugzeug nach Berlin zu kommen, ins Haus des Zentralrates der FDJ an der Prachtstraße Unter den Linden. So war sie also doch vor dem Mauerbau schon einmal ein paar Stunden in Berlin gewesen, auch damals ganz allein. Zum ersten Mal in ihrem Leben bestieg Hanne in Erfurt ein Flugzeug. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde sie wirklich als Erwachsene behandelt. Die Funktionäre in den Blauhemden schmeichelten ihr. Sie bewunderten ihren Durchblick genau wie ihr Talent zu schreiben. Ernsthaft schlugen sie ihr vor, ein Praktikum bei der „Jungen Generation“ zu beginnen und damit eine politische Karriere beim Jugendverband zu starten. Das Abitur sei in ihrem Falle pure Zeitverschwendung. Hanne schwebte in einem blau und rot gefärbten siebten Himmel. Nach ihrer Rückkehr lernte sie ganz schnell die Kehrseite der Medaille kennen. Sie hatte ihre Mitschüler beleidigt. Die ganze Schule fühlte sich an den Pranger gestellt. Ähnlich verwundert wie bei der Berliner Lobpreisung, aber zunehmend verletzt, musste sie erkennen, dass sich alle dagegen wehrten, verleumdet worden zu sein. Sie selbst handele doppelzüngig, wurde ihr vorgeworfen. Sie selbst rede rot und trage westlich-dekadentes Blau.
Hanne hatte einen Jeansrock aus dem Westen bekommen, als Jeans in den Augen der Sozialisten noch Teufelswerk darstellten. Zu Nietenhosen gab der Vater seine Zustimmung nicht, aber einen Rock durfte sie tragen. Doch bissige Bemerkungen verleideten der „roten Hanne“ den Jeansrock. Auch die Verteidigung, Jeans seien die Bekleidung der amerikanischen Arbeiterklasse, half wenig. Sie hatte sich gegen ihre Mitschüler gestellt, und es brauchte einige Zeit, bis dieser Fehltritt vergessen wurde. Dabei war sie nach ihrem eigenen Gefühl doch nur um mehr Ehrlichkeit bemüht gewesen. Das hatte ihr eine Lebenserfahrung eingetragen.
Willis Tochter galt in der DDR als Arbeiterkind. Zwar war der Vater Berufsschullehrer für Bäcker, aber er hatte erst nach dem Krieg in einem Schnellstudium diesen Beruf erlernt. Zuvor war er ein Bäckergeselle gewesen, der wegen des langen Arms der Wehrmacht seine Meisterprüfung nicht hatte machen können. Drei Tage vor der Prüfung wurde er eingezogen. Und so wurde Hanne zum Arbeiterkind. Das war ein Status, der im SED-Land Vorteile brachte. Zum Beispiel 60 Mark mehr Stipendium monatlich.
Der Großvater mütterlicherseits war tatsächlich Arbeiter gewesen. Er hatte als Dreher geschuftet und dennoch jede Woche zu wenig Geld für die Familie nach Hause gebracht. Freitags konnte er oft nicht zum Frisör gehen, weil die Pfennige für den Haarschnitt fehlten und er erst am Sonnabend wieder Lohn erhielt. Bücher gab es in der Wohnung unter dem Dach nicht. So konnten keine nicht verbrennen, als das Haus gegen Ende des Krieges im großen Bombenangriff auf Nordhausen in Schutt und Asche fiel. Die Wohnung der Großeltern, in der Hanne die ersten zwei Jahre ihres Lebens verbrachte, war ein schlicht ausgebauter Dachboden ohne Wasseranschluss. In der selten benutzten guten Stube fingen die Fenster direkt am Fußboden an. Es handelte sich aber nicht um eine Glasfront mit Aussicht auf die Stadt, sondern die beiden Fenster endeten da, wo sich normalerweise Fensterbänke befanden. Hanne wusste später nie, ob sie sich wirklich erinnern konnte oder die Erzählungen des Großvaters ihr Bild geprägt hatten. Jedenfalls sah sie sich zum Fenster krabbeln.
Da es keine Bücher aus der Vorkriegszeit im Grimmschen Haushalt gab, las Hanne fast jedes Kinderbuch, das in der DDR gedruckt wurde. In den Sessel gekauert, dessen Holzlehnen sie mit ihren Knien zu sprengen drohte, fing sie sofort an zu lesen und hörte erst bei der letzten Seite auf, während die Mutter jammerte, dass sie an der frischen Luft spielen solle. Dabei war die Luft in den kalten Monaten Braunkohle geschwängert und kratzte im Hals.
Die Nachbarn besaßen elf Bände Karl May, die sie mit anderen Besitzern dieser kostbaren Vorkriegsware tauschten. Willi verzog zwar die Mundwinkel abfällig, weil der berühmte Autor aus Radebeul nie einen Fuß in die Länder gesetzt hat, die er beschrieb, aber wenn die Tochter es nicht sah, informierte er sich lieber selbst, was sie da so las.
Besonders schnell überflog sie die Seiten mit Old Shatterhands und Kara Ben Nemsis Abenteuern, wenn die Nachbarn abends das Buch zurück verlangten. Die geborgten Bände lasen sie nach Feierabend selbst. So blieben Hanne nur die Nachmittagsstunden unter den kritischen Blicken der Mutter, die als Hausfrau für die Tochter sorgte. „Nur-Hausfrau“ hieß das in der DDR, und es war ein wenig geachteter Job. Als der Staat sein Ende erlebte, war nur jede zehnte Frau nicht berufstätig.
In der ersten Zeit an der Uni bestand Hannes Problem darin, dass sie viel zu oft nur Bahnhof verstand. Deswegen kam sie sich ziemlich provinziell vor. Sie hatte kaum Westbeziehungen, vor allem keine intellektuellen. Die geizige Schwester des Vaters in Bayern verwaltete das wenige Westgeld aus einem Erbe, um das sich Willi letztlich und allzeit geprellt fühlte.
Bei Studienbeginn war Hanne stolz auf ihre „NATO-Pelle“, für die das Wetter allerdings in den Augusttagen zu sonnig war, denn es handelte sich um einen Regenmantel aus Nylon, der als kleines Päckchen in eine Tasche gestopft werden konnte. In Braun, Grün oder Blau, mit eng geknotetem Gürtel liefen die Leute im brennbaren Material herum. Viele hatten die Mäntel noch höchstpersönlich in Westberlin gekauft, denn die Mauer war ja erst wenige Tage alt.
Jeans, Nylonmäntel und andere Klamotten durften in Paketen geschickt werden, auch wenn die sozialistische Propaganda diese dekadenten Sachen schmähte. Bücher und Drucksachen indes durften weder auf dem Postweg reisen, noch mitgebracht werden von Besuchern. Selbst jemand, der einen westdeutschen Onkel mit Buchladen besaß, konnte keine Westpäckchen mit Büchern empfangen. Die Post wurde von den Hütern des sozialistischen Gesetzes kontrolliert. Viel zu viele Sendungen wurden geöffnet und verbotene Dinge gnadenlos entfernt. Man durfte sich glücklich schätzen, wenn der Rest die Weiterreise antrat. In der DDR hielten sich hartnäckig Gerüchte, die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes würden ihr Alltagsleben mit den konfiszierten Westartikeln verschönern.
Während der ersten Studienwochen wusste Hanne oft nicht, wovon die anderen redeten. Sie fühlte sich nicht richtig zugehörig, weil sie von Heinrich Böll, Uwe Johnson, Ingeborg Bachmann, ja selbst von Franz Kafka noch nichts gehört, geschweige denn gelesen hatte. Nicht dass es sich um Pflichtlektüre gehandelt hätte, aber ein östlicher Germanistikstudent kannte sich eben mit Westliteratur aus, wenn auch inoffiziell. „Wovon reden die bloß?“ dachte sie mehr als einmal und kam sich klein und dumm vor.
Ein gewissenhafter, wenn auch spitzfindiger Student hatte schon vor ihrer Zeit ausgerechnet, wie viele Jahre für die Leseliste des Germanistischen Instituts benötigt würden. Er setzte einen Durchschnitt von 30 Seiten pro Stunde an und erkannte noch ohne Taschenrechner, selbst wenn man rund um die Uhr läse, reichte ein durchschnittliches Menschenleben nicht aus, die aufgeführte Pflichtliteratur zu bewältigen.
Darüber lachten die Neulinge, als sie sich nach der feierlichen Immatrikulation im Germanistischen Institut trafen. Die Raumnummer fanden sie am Schwarzen Brett. Sie waren die einzige Gruppe von Diplomgermanisten im ersten Studienjahr. Im 3. Studienjahr existierte eine weitere Gruppe. Alle anderen waren simple Lehrerstudenten. 19 Leute hatten es auf die begehrten Studienplätze geschafft und saßen nun zum ersten Treffen der Seminargruppe um die hufeisenförmig zusammen gestellten Tische.
Die Seminargruppe wurde eine Art Heimathafen, den Hanne und ihre Kommilitonen fünf Jahre lang jeden Studientag ansteuerten. Ein eigenes Klassenzimmer im Institut gab es zwar nicht, aber man kümmerte sich umeinander. Das ging so weit, dass man sich entschuldigte, wenn man fehlte, und gegebenenfalls ein Attest vorwies. Dann schrieb einer für den anderen mit. Man ging als sozialistischer Student nicht in den Gefilden der Wissenschaft verloren, sondern lernte im Kollektiv.
Am ersten Tag machte sich zunächst Verlegenheit an den Tischen breit, die sich mit Tintenflecken und Schnitzkunst wenig von einer Schulbank unterschieden. Alle trugen brav das Blauhemd der Freien Deutschen Jugend. Auch die Parteigruppe der DDR-Kommunisten, der SED, war – wie sich bald herausstellte - in ihren Reihen eine schlagkräftige Truppe. Gut zwei Drittel der Neuen machte sie aus.
Der rotbärtige Wolfgang verhinderte mit lauter Stimme, dass sich die Schweigeminuten zu Stunden dehnten und die Erforschung der Mensa womöglich bis zum nächsten Tag hätte aufgeschoben werden müssen. „Also stellen wir uns einfach mal gegenseitig vor“, sagte er und fuhr ohne Atempause fort: „Ich komme als Wolfgang Wurzel eigentlich später im Alphabet an die Reihe. Übrigens nennen mich meine Freunde Gustav. Warum, erzähle ich irgendwann mal. Ich komme aus Thüringen und bin stolzer Unteroffizier der Nationalen Volksarmee. Einige Leute hier kenne ich bereits von unserer ersten Parteiversammlung. Das war’s, glaube ich, und nun der – oder die – nächste.“
Reihum ging es daraufhin ohne Stocken..
Bemerkenswert stellte sich Winfried vor. Er komme von der Arbeiter- und Bauern-Fakultät und werde Schriftsteller. Als Lehre dafür scheine ihm das Germanistikstudium geeignet. Bei der SED-Versammlung sei auch er gewesen, und Unteroffizier sei auch er.
Dieser Rang war offensichtlich eine Voraussetzung für Männer, um die Karriereleiter bei den Germanisten zu erklimmen.
Außer Hanne kam nur noch ein Mädchen direkt von der Erweiterten Oberschule mit frisch geschriebenem Abiturzeugnis. Die anderen hatten einen Beruf erlernt oder in Betrieben Hand in Hand mit der Arbeiterklasse ein praktisches Jahr hinter sich gebracht, kannten sich also aus in der sozialistischen Produktion. Einige hatten wie Winfried die Arbeiter- und Bauern-Fakultät absolviert, eine sozialistische Erfindung in der Nachkriegszeit, um benachteiligten Arbeitern und Bauern das Abitur und damit die Hochschulreife zu ermöglichen. Die meisten jungen Männer der Seminargruppe hatten drei Jahre bei der Nationalen Volksarmee gedient, obgleich die Wehrpflicht nur eineinhalb Jahre dauerte. Offiziell hieß es, man verpflichte sich freiwillig zu drei Jahren Ehrendienst. Wer das nicht wollte, musste die Frage beantworten, warum er den Sozialismus nicht drei Jahre lang mit der Waffe in der Hand vor seinen Feinden beschützen wolle. So war das mit den freiwilligen Entscheidungen in der DDR!
Als die Gruppe wenige Tage später wieder an den Tischen saß, war eine Assistentin des Instituts zugegen. Hanne hatte in den ersten Vorlesungen die hohe Wissenschaft nur teilweise verstanden, aber durchaus die Bedeutung des Augenblicks empfunden, und sie hatte gelernt, dass es unterhalb des hohen Reigens der Professoren emsige Mitarbeiter gab, die entweder als Assistenten zuarbeiteten oder als Aspiranten am eigenen Beitrag zur Wissenschaft, der Doktorarbeit, feilten. Jetzt ging es in der Sitzung der Seminargruppe um eine äußerst wichtige Angelegenheit. Die Assistentin trug sie vor. Während die SED-Mitglieder sie vertraut als Sabine duzten, hatte Hanne nicht einmal ihren Nachnamen verstanden. Sie fühlte sich fehl am Platze und sehnte sich nach der vertrauten Umgebung am Goetheweg bei Grimms.
Ihre Gedanken hatten wenig mit den Feinden des Sozialismus zu tun, von denen Sabine sprach und die es zu bekämpfen galt. Der Mauerbau reichte noch nicht aus. Vorgeschlagen wurde eine Entsagung.
„Und so“ erklärte Sabine, „verpflichten wir uns, keine Radiosender aus dem Westen zu hören. Wir stehen zu unserem sozialistischen Staat. Er lässt euch studieren, gibt euch Stipendium, sorgt für uns. Er tut alles, um uns vor den Feinden des Sozialismus zu schützen, zum Beispiel tut er das mit dem Antifaschistischen Schutzwall. Wir gehen den Imperialisten nicht auf den Leim. Sie wollen uns durch dekadente Musik in ihren Hitparaden locken. Sie geben sich den Anstrich, als informierten sie umfassend in ihren Nachrichtensendungen. Wir verweigern uns dieser Hetze. Wir geben unserem Staat schriftlich, dass wir die Hetzsendungen nicht einschalten. Wir hören keine Hetzsendungen!“
Bei den letzten Sätzen ließ die leise Sabine etwas wie Temperament erkennen. Kämpferisch rief sie: „Wir versprechen: wir hören keine Westsender!“
Die angehende Intelligenz der DDR schwieg. Einige nickten. Mit ernstem Blick und bekennender Mimik. Sabine kramte einen Zettel aus ihrer Aktentasche. Die Verpflichtungserklärung war vorbereitet. Sie enthielt den Aufruf und die Namensliste.
Die Assistentin besann sich - irgendwie noch - auf demokratisches Prozedere, während sie das Papier dem neben ihr sitzenden Wolfgang reichte, und sprach ins Abseits: „Gibt es Fragen?“
Greifbar lag der Einwand in der Luft, dass man sich doch selbst und umfassend informieren müsse. Als Student sei man in der Lage, zwischen falsch und richtig zu unterscheiden. Jedenfalls sollte man es lernen.
Keiner sagte etwas. So hört sich betretenes Schweigen an. Angesichts des Zettels sah jeder vor sich auf den Tisch. Wenn der Aufruf vor ihm landete, unterschrieb er ohne Zögern. Alle unterschrieben.
Alle verkaufen ihre Seele, dachte Hanne bekümmert. Schon wieder hätte sie die Schwurhand nach unten halten müssen, um die Verpflichtung aufzuheben, noch während sie unterschrieb. Hanne war sich sicher, dass niemand dieses Versprechen gegenüber der den sozialistischen Staat regierenden SED ernst nahm. Schon vor der Unterschrift hatte keiner den RIAS oder andere Hetzsender in üblicher Lautstärke eingestellt, sondern stets ein bisschen leiser.
Nachdem alle ihren Namen geschrieben hatten, sagte Hans, der Däne, mit seinem skandinavischen Akzent ein weiches „Ja, aber“. Er fragte, wie das mit ihm denn sei, wenn er nach Hause fahre, was ja nicht oft vorkomme. „Wenn ich als Kommunist mit meinen Landsleuten diskutieren will, muss ich doch wissen, welche Meinungen unter ihnen verbreitet werden und was die einzelnen Parteien an Parolen und Lügen loslassen.“ Na ja, und eigentlich wäre es doch auch sonst nicht unklug- er wiederholte das Wort unklug, weil er stolz darauf war, dass er es gefunden hatte: Es wäre doch nicht unklug, die Argumente des Klassenfeindes zu kennen. „Dann lässt sich besser dagegen halten. Ist es nicht besser, den Klassenfeind mit den eigenen Waffen zu schlagen?“
Einige zunächst zustimmende Kopfbewegungen gingen beim Blick in die Runde in ein bedenkliches Wiegen des Kopfes über.
„Hm! Hm!“ sagte Winfried, der künftige Schriftsteller. „Ich denke, wir erhalten von den Sendern unseres Arbeiter- und Bauern-Staates genug Munition für derartige Auseinandersetzungen.“
Sabine musste nichts mehr hinzufügen. Sie nahm den Zettel an sich und hatte ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllt, alle Unterschriften beizubringen.
Als Hanne in der S-Bahn saß, schämte sie sich. Ihr wurde beinahe übel, und sie hatte eines der Aha-Erlebnisse, wie sie nicht oft im Leben vorkommen.
„Ich bin nicht besser als ein Nazi, obwohl ich mich bisher immer haushoch überlegen fühlte“, dachte sie. „Ich bin nicht besser als die Mitläufer unter Hitler. Auch mit mir wären Morde in den Konzentrationslagern und im Krieg möglich. Weil ich feige bin. Weil ich kusche und meine Meinung nicht vertrete. Ich gebe klein bei. Ich bin ein Feigling. Ich muss mich schämen.“
Sie hatte nicht das Gefühl, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, sondern diese Unterschrift wurde ihr Schlüsselerlebnis als Mitläuferin. Wenngleich es sich nur um eine Unterschrift handelte, die niemanden verriet und niemandem schadete, ein Wort auf einem Papier, wurde ihr plötzlich klar, wie angepasst sie war, wie sie sich längst hatte verbiegen lassen. Jemand, der nicht Nein sagt, obwohl er Nein denkt, ist ein Opportunist. Diesmal ging es nicht um Leben und Tod. Aber Hanne glaubte in diesem Moment nicht, dass sie mutiger handeln würde, wenn der Anlass von größerer Bedeutung wäre, wenn es wirklich um Leben und Tod ginge.