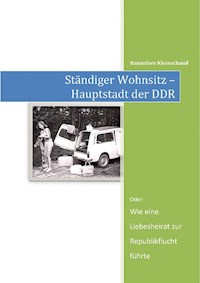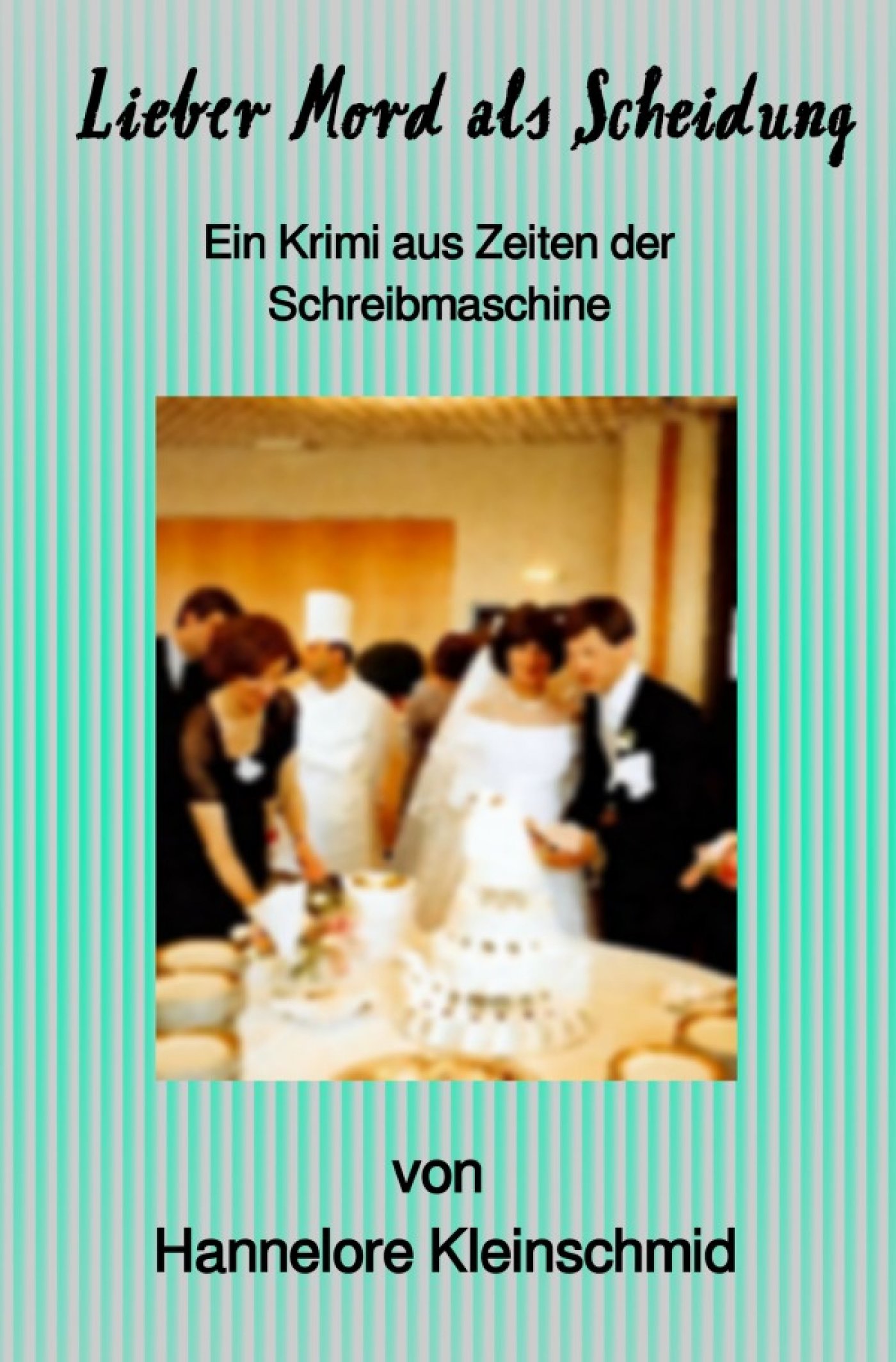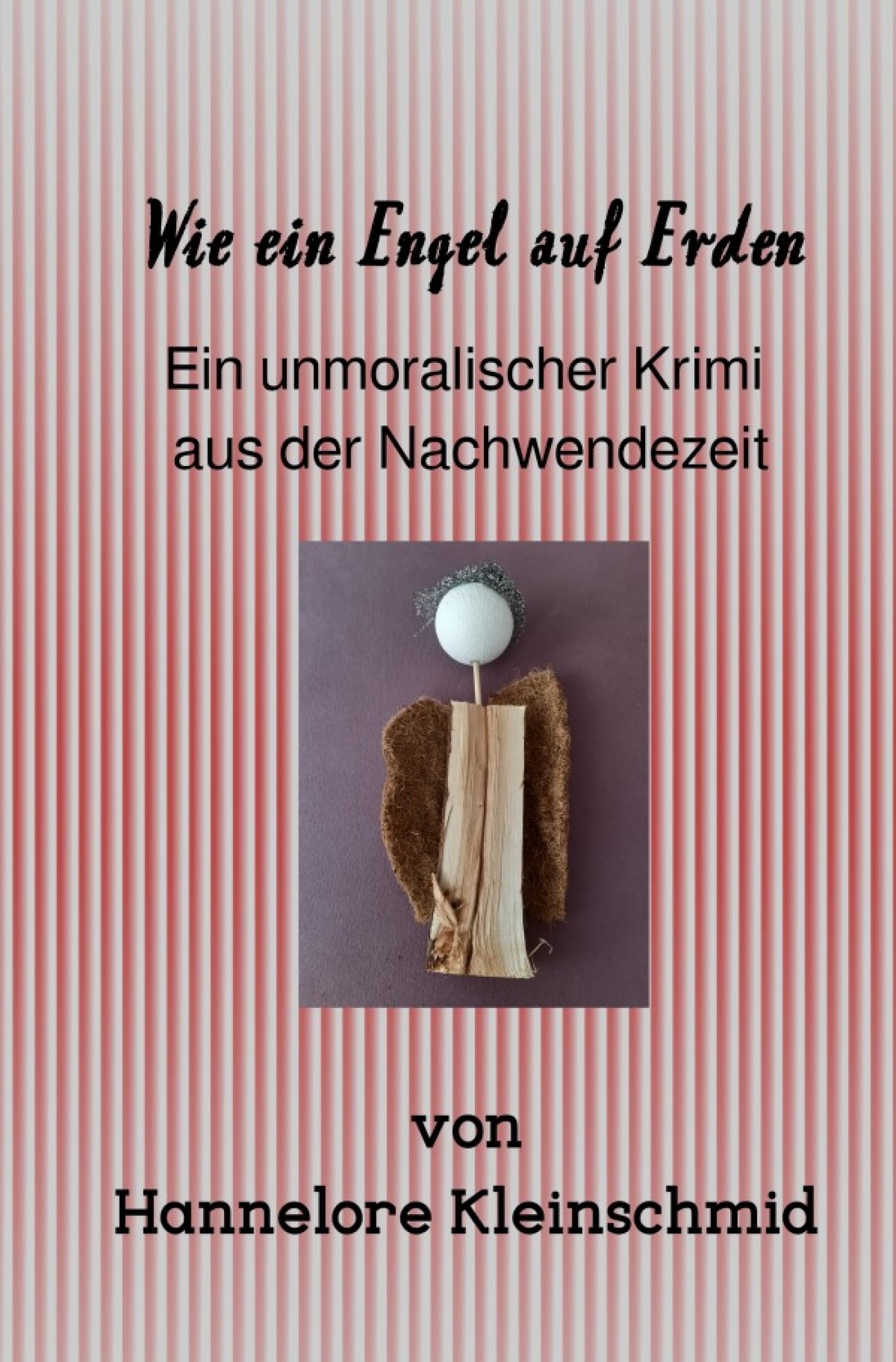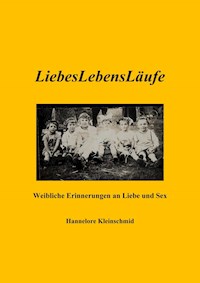Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Adoption wird zum Zauberwort für Benno und Beate, die über eineinhalb Jahre das qualvolle Sterben ihres Babys mit ansehen müssen. Sie suchen Halt beieinander und erzählen sich immer wieder eine Geschichte aus der Zukunft: "Wir werden einem Kind ein Zuhause geben, das schon auf der Welt ist. Es darf schwarz-weiß kariert sein. Nur gesund muss es sein." Mit 13 Monaten kam Winny in ihr Leben, sah sie mit großen runden braunen Augen an und gewann sie als Eltern. Die steile Falte zwischen seinen Brauen entdeckten sie erst später, als ein steiniger Weg begann: Der Sohn flog nach einem Vierteljahr von der Privatschule, bekam Einzelunterricht und wurde auf einer psychosomatischen Station behandelt. Zu Hause gab es ständig Krach. Beate fühlte sich als unfähige Mutter und schimpfte immerfort: "Winny, lass das! Hör sofort auf damit!" Winny hörte sofort auf und warf die Tasse voller Kakao auf den Boden. Beate brüllte erbost. Tochter Jana weinte. Und Benno erklärte zwischen Rage und Verzweiflung, dass man sich eben trennen müsse, wenn Beate mit dem Sohn nicht klarkomme. Man trennte sich nicht, aber Winny geriet nicht nur einmal mit dem Gesetz in Konflikt, die Eltern zahlten die Rechtsanwälte und setzten ihn – voller Verzweiflung – vor die Tür, als er 18 Jahre alt war. Von nun an beobachteten sie ihn aus der Ferne. Benno suchte allerdings stets die Nähe, auch wenn sie schmerzte, bis hin zum Herzinfarkt. Beate reagierte distanziert und skeptisch, sah den Sohn obdachlos unter der Brücke, was nie geschah. Beide erlebten sie schlaflose Nächte. Das Buch stellt die Frage, was mit liebevoller Zuwendung zu erreichen ist, wie man mit elterlicher Erwartungshaltung und Dominanz umgeht. Es fragt, inwieweit die Bemühungen des sozialen Umfelds die genetischen Gegebenheiten beeinflussen können. Einfache Antworten gibt es nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adoption
„Es ist gut, wenn unsere Mütter nicht da sind, die Mütter mit den ungläubig forschenden Augen, die traurig sind und weinen müssen, strenge und fürchterlich und dennoch traurig, unsere armen Mütter, die nichts verstehen und schelten und vor denen wir lügen müssen. Wir brauchen niemandem Bericht zu erstatten, und keine Furcht ist in uns vor dem Zwang zur Lüge und keine um ihre Entdeckung.“
Joseph Roth
„DER BLINDE SPIEGEL“
Hör mal gut zu, Winny! Es war einmal ....
Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Sie hießen Benno und Beate und wünschten sich ein Kind. Sie dachten und sagten: Wir wünschen uns ein Kind. Wir wollen eine richtige Familie sein.
So sehr wünschten sie es, dass sie jeden Tag von dem großen Wunsch erzählten. Immer wieder. Lange Zeit.
Und dann endlich sahen sie einen kleinen Jungen mit riesengroßen dunkelbraunen Augen, die sie anguckten.
Alle beide dachten zur selben Zeit: Das ist unser Sohn.
Das sagten sie alle beide: Das ist unser Sohn.
Da der kleine Winny Mama und Papa suchte und brauchte, nahmen sie ihn in die Arme und gaben ihm viele Küsschen und zum guten Schluss einen ganz dicken Kuss.
Sie erkannten, dass sie von nun an eine Familie sein und bleiben würden, ein Leben lang.
So ist das gewesen, Winny, als du als kleines Baby zu uns gekommen bist. Man nennt das übrigens Adoption.
Und später kam noch deine kleine Schwester in die Familie, die Jana.
I. Teil: Der andere Weg
Neben dem bunt geblümten, abgetretenen Teppichboden sitzt er auf seinem Windelpaket. Mittelblonde lockige Haare, riesige, fast schwarze Augen, die interessiert alles ringsum verfolgen. Er macht nicht den Eindruck, als sei er zurückgeblieben, wie in seiner Akte vermerkt ist. Mit 13 Monaten läuft er jedoch noch nicht, sondern rutscht auf dem Po hinter dem geliebten Ball hinterher.
Mrs. Keen erklärt nachdrücklich: There is nothing wrong with that boy. Sie fügt hinzu, sie sei nicht erst seit gestern Pflegemutter und kenne sich aus mit Kindern. Schließlich habe sie vier eigene Töchter großgezogen. If you know, what I mean!
Sie wiederholt: There is nothing wrong, there is. Also alles in Ordnung!
Winston wurde zwei Monate zu früh geboren, nicht einmal vier Pfund schwer, nur 30 Zentimeter lang. Mutterseelenallein lag das Frühchen im Krankenhaus, denn es wurde schon vorab zur Adoption freigegeben.
In der Akte ist vermerkt, das Baby habe sich sechs Wochen lang im Ventilator befunden. Kein Wunder also, sagte Benno Jahre später und meinte es nicht ernst. Die missglückte Wahl eines Fremdworts. Der Inkubator war gemeint.
Beate und Benno waren 1968 ein Jahr verheiratet, als Beate schwanger wurde. Beide wünschten sich ein Kind, obwohl sie nicht wussten, wie das gehen sollte, ein Baby zu betreuen und arbeiten zu gehen. Doch auch andere Leute bekamen Kinder. Sie waren im richtigen Alter, um eine Familie zu gründen.
Lydia kam zur Welt und war todkrank. Die Ärzte suchten einige Tage lang nach der Diagnose, bis sie wussten, dass das Kind „nicht lebensfähig“ sein werde. Aber sie wussten nicht genau, wie lange es mit medizinischer Hilfe würde leben können. Vermutlich einige Wochen oder Monate.
Es wurden eineinhalb Jahre. Ohne Hoffnung auf Überleben oder gar Gesundheit. Benno und Beate kümmerten sich um ihr Kind. Sie suchten Trost beieinander und in einer Geschichte aus der Zukunft, die sie sich immer wieder erzählten. Das heißt: Beate erzählte, und Benno nickte zustimmend. Es war wie ein Versprechen: Wir werden einem Kind, das schon auf der Welt ist, ein Zuhause geben. Wir werden ein Kind adoptieren, unabhängig von eigenen Kindern, egal ob Junge oder Mädchen, egal welche Hautfarbe. Es darf auch kariert sein, Hauptsache es ist gesund.
Wenn wir dem Kind ein liebevolles Zuhause geben, wird es ein glücklicher und zufriedener Mensch werden. So dachten sie in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wie viele ihrer Generation.
Im Jahr 1973 sitzt Winston vor ihnen und schaut sie an: erstaunt, ernsthaft, die Andeutung einer skeptischen Falte zwischen den Augenbrauen. Entgegen ihrem ersten Eindruck und dem spontanen Gefühl zögern die beiden, die Eltern werden wollen. Ein wenig jedenfalls.
Sie haben gegenüber der Adoptionsgesellschaft nur den einen Wunsch geäußert: Ihr Kind soll gesund sein.
Von dem kleinen Jungen aber heißt es, er sei rather retarded, ziemlich zurückgeblieben. Ist er womöglich geistig behindert, trügt sein lebhafter Blick?
Winston wurde der Sohn von Beate und Benno Grimm.
Es geschah nicht über einen kurzen Weg, sondern dauerte länger als eine Schwangerschaft. Am Anfang stand eine Zeitungsannonce, in der Mitarbeiter für den Deutschen Dienst der BBC in London gesucht wurden. Sie bewarben sich und wurden alle beide genommen. So zog das Paar beglückt nach London, für mindestens drei Jahre.
Nachdem sich beide eingearbeitet und eingelebt hatten und ihr unzureichendes Englisch sich in stockenden Sprachgebrauch wandelte, redete Beate häufiger von der Adoption:
Vielleicht sind wir es Lydia schuldig, wir könnten doch ein Kind glücklich machen, das ansonsten womöglich von einem Heim zum anderen wandern würde. Ohne feste Bezugspersonen, ohne Eltern.
In London hatten sie den damals einzigen Spezialisten weltweit aufgesucht, der sich mit der seltenen angeborenen Missbildung an der Galle auskannte, die bei Lydia aufgetreten war. Er machte ihnen deutlich, dass sie ihr Schicksal nicht herausfordern sollten.
Er sagte: Ich weiß noch nicht, ob es eine erbliche Variante gibt. Aber das könnte durchaus der Fall sein, und so wäre es vernünftig, wenn Sie, sollten Sie zwei gesunde Kinder haben, es dabei beließen.
Eines Tages begannen die beiden Grimms damit, herauszufinden, wie man in London ein Kind adoptiert.
In jener Zeit suchte der Mensch im Telefonbuch nach bestimmten Institutionen, Adressen oder Telefonnummern. Das Londoner Telefonbuch bestand aus mehreren dickleibigen Bänden.
Oder der Mensch rief beim zuständigen städtischen Amt an oder verfasste ein Schreiben.
Beate entdeckte eine zentrale Anlaufstelle für Adoptionswillige.
In der Antwort auf ihren Brief hieß es, die meisten Adoptionsgesellschaften hätten lange Wartelisten und würden vorläufig keine Bewerber annehmen. Bei farbigen Jungen gäbe es jedoch noch Chancen, wenn man Geduld bewies. Aber – und damit tat sich das nächste Problem auf – die Paare müssten zunächst nachweisen, unfruchtbar zu sein. Mit einem ärztlichen Attest.
Auch wenn Benno kurz zuvor auf äußerst schmerzhafte Weise die Kinderkrankheit Mumps durchlitten hatte, so konnten seine Spermien, wie eine Untersuchung zeigte, doch weiterhin ihr Ziel finden. Waren Beate und er am Ende ihres Traums?
Wie kann man Unfruchtbarkeit nachweisen?
Beate wollte nicht einfach so aufgeben und schrieb an die zuständige Abteilung der Universitätsklinik. In umständlichem Englisch erklärte sie, warum Benno und sie unbedingt ein Kind adoptieren wollten und Hilfe benötigten. Zur Antwort bekam sie den Termin für eine Untersuchung. Es hieß, dass sie die Anwesenheit von Studenten in Kauf nehmen müsse.
Die Angelegenheit wurde komplizierter als erwartet und wirkte – im Nachhinein betrachtet – wie pure Ironie des Schicksals.
Der Professor untersuchte Beate auf die damals übliche prüde englische Art. Sie musste sich auf einer Liege ausstrecken, mit einem Laken zugedeckt. Er erklärte den Studenten in vielen Fachausdrücken, die sie nicht verstand, was er ertastete. Anschließend begründete er, an die Patientin gewandt, warum sie vermutlich nicht schwanger werden könne. Jedenfalls auf normalem Wege.
In diesem Moment erlebte sie, wie schwierig es ist, in einer fremden Sprache Zwischentöne und Ungesagtes zu verstehen. Sie begriff es erst viel später.
Der Professor bezog sich auf einen Eingriff, den ein deutscher Arzt vorgenommen hatte. Beate wusste damals nicht, dass dieser Doktor jeder seiner Patientinnen den kleinen Eingriff am Muttermund empfahl. Er verdiente daran, es war eine Art Vorsorge und schadete scheinbar nicht. Dem englischen Professor fiel es dadurch leichter, ihr Unfruchtbarkeit zu attestieren. Sie verstand nichts von dem, was zwischen den Worten mitschwang. Der Mediziner war gebeten worden, ihr zu helfen. Dafür hatte er einen Weg gefunden und erfüllte ihren Wunsch.
Aber Beate reagierte verzweifelt, fühlte sich unerwartet zur Kinderlosigkeit verdammt und fuhr weinend nach Hause. Zu Benno. Der sie zaghaft zu trösten versuchte. Dem sie nach einigen Tagen sagte, sie sei sowas von einer Spinnerin, dass sie es selbst nicht aushalte. Kaum habe der Professor Unfruchtbarkeit diagnostiziert, bleibe ihre Temperatur bei der morgendlichen Messung nach der Gnaus-Ogino-Methode in einem Bereich, als sei sie schwanger. Offenbar protestiere ihr Körper gegen das Urteil. Sie spinne eben!
Erst die Fehlgeburt nach einer langen Autofahrt zeigte, dass da mehr gewesen war.
Die Adoptionsgesellschaft, an die der Wunsch der Grimms weitergeleitet wurde, vermittelte Kinder, deren Vorfahren aus der karibischen Inselwelt nach London gekommen waren, dunkelhäutige Jungen und Mädchen: Babys, aber auch Schulkinder.
Monate gingen ins Land, bis Beate und Benno den Bescheid erhielten, dass sich demnächst eine Sozialarbeiterin bei ihnen melden werde.
Als Anne Martin tatsächlich anrief, wurden sie damit zum ersten ausländischen Paar, bei dem ein Adoptionsverfahren in London eingeleitet wurde. So jedenfalls sagte Anne Martin.
Nach dem ersten Kennenlernen freuten sie sich auf ihre weiteren Besuche. Die sympathische Frau wurde in den nächsten Monaten zu einer Freundin. Nur fehlende Vokabeln bremsten den Redefluss, wenn Grimms über ihr bisheriges Leben berichteten und über das Leiden der kleinen Lydia, das ihr eigenes wurde.
Selbst die Ankündigung, Beate müsse ein adoptiertes Kind zunächst ein Jahr lang zu Hause betreuen und also im Beruf pausieren, gab keinen Anlass, die Sache zu überdenken.
Nachdem Mrs. Martin ihre Lebensläufe, mit vielen Einzelheiten verziert, gehört hatte, forschte sie nach den Motiven für den Adoptionswunsch.
Warum wollen sich Benno und Beate um ein fremdes Kind kümmern? Wollen sie womöglich damit eine Ehekrise oder sonstige eigene Probleme zudecken?
Oder sich selbst von dergleichen ablenken?
Soll das Kind als Trostpflaster dienen?
Wie würden sie reagieren, wenn jemand ihr Kind wegen seiner Hautfarbe angriffe? Oder auch nur anstarrte?
Die Sozialarbeiterin musste sich ein Bild verschaffen. Sie würde den Fall vor dem zuständigen Gremium der Adoptionsgesellschaft vertreten. Nicht Beate und Benno persönlich würden dort Auskunft geben. Nicht einmal ihre Anwesenheit war erforderlich, sondern Anne Martin würde ihre Stimme sein, während sie zu Hause auf die Entscheidung warteten und die Daumen drückten.
Wochen vergingen mit vielen vergeblichen Blicken in den Briefkasten, es war eine Zeit voller Erwartungen auf einen neuen Lebensabschnitt. Sie dehnte sich.
Als Grimms zum Sommerfest der Adoptionsgesellschaft eingeladen wurden, hatten sie zum ersten Mal das Gefühl, aus ihrem Wunsch könne Wirklichkeit werden. Irgendwann. Erwartungsvoll sahen sie dem Picknick im Grünen entgegen, mit vielen Kindern, deren Adoptiveltern und Leuten wie ihnen, die ein Kind annehmen wollten.
Das Wetter meinte es gut, die Sonne schien – nicht nur in der Erinnerung.
Die Kinder, fast ausnahmslos dunkelhäutig, tobten fröhlich durchs Gelände. Allerhand zukünftige Sprinter schienen darunter zu sein, auch jede Menge Fußballer und Handballerinnen, Babys, Kleinkinder und Schulkinder.
Benno und Beate sahen vor allem frohe Menschen. Erst nach Jahren verstand Beate einige Sätze besser, die sie beim Sommerfest gehört hatte.
Ein Vater sprach mit leichtem Bedauern in der Stimme über das Temperament: Mein Sohn ist nicht nur westindischer Herkunft, sondern noch dazu ein Mischling. Die sind überhaupt nicht zu bremsen, wollen nie Ruhe geben oder still sitzen. Das ist manchmal etwas anstrengend, a little bit.
Nachdem Beate ein kleines Mädchen bewundert hatte, antwortete die Mutter, es sei zwar wunderbar, ein Kind zu haben, aber kraftzehrend sei es auch. Sehr sogar. Bei diesem Temperament!
Der sonnige Nachmittag unter vielen fröhlichen Leuten bestärkte die beiden, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Ungeduldig stellten sie sich den Prozeduren. Und lasen Bücher.
How to adopt etwa.
Oder über Kindererziehung.
Dr. Benjamin Spock, seines Zeichens Kinderarzt und Erziehungsberater aus den USA, war gerade in und wurde von Beate beinahe auswendig gelernt. Eine Art Bibel der modernen Erziehung. Groß in Mode wurde durch ihn der Versuch, sich ganz in das Gemüt des Kindes zu versetzen, um die Eltern verständnisvolles Handeln zu lehren. Der Weg zur antiautoritären Erziehung wurde gespurt und von den Kinder-Verstehern theoretisch beschritten.
Was will uns das Kleinkind damit sagen, dass es schreiend Porzellanteller auf den Fliesenboden wirft?
Leider hat der Freund in Deutschland beruflich viel zu tun, außerdem Frau und Kind, ein Adoptivkind. Englisch ist wegen mangelnder Übung nicht die Sprache, in der sich ein Brief locker und leicht schreibt. Noch dazu ein ungewöhnlicher offizieller Brief, wie man ihn nur selten im Leben verfasst.
Grimms sollten jemanden benennen, der Auskunft über sie als Freunde geben könne. Ein Vierteljahr verstreicht, ehe die Adoptionsgesellschaft die gewünschte Antwort erhält. Erst beim Abschied aus England übergibt ihnen Anne Martin einen schmalen Hefter, der nicht nur die Fotokopie eines Briefes von Winnys Mutter, sondern auch den Brief des Freundes enthält.
Seine Auskünfte haben die beiderseitige Beziehung nicht getrübt und das Adoptionsverfahren befördert.
Nach Monaten des Wartens erhalten Benno und Beate endlich eine erste Nachricht von Winston:
Die Sozialarbeiterin will mit ihnen über einen kleinen Jungen mit westindischen Wurzeln reden, der zwar schon ein Jahr alt ist, aber ein Frühchen und wahrscheinlich deshalb in seiner Entwicklung zurückgeblieben.
Ziemlich zurückgeblieben. Rather - das Wort beunruhigt die zukünftigen Eltern.
Jetzt aber sollen sie erst einmal sagen, ob sie grundsätzlich interessiert sind. Mrs. Martin hat zu verstehen gegeben, dass sie Nein zu einem Kind sagen dürfen, ohne damit das Recht auf eine Adoption zu verwirken. Doch der Gedanke an ein Nein ist ihnen suspekt. Wird ein Kind in einer Familie geboren, gibt es auch kein Nein zu diesem Baby.
Anne Martin schreibt ihnen, dass sie sich Zeit für ein weiteres Gespräch freihalten werde und auf ihre Antwort gespannt sei.
Von nun an wird es noch knapp zwei Monate dauern, bis Winny sein Zuhause findet.
Da Sie ein farbiges Kind haben werden, sagt die Sozialarbeiterin, sollten Sie ihm so früh wie möglich von der Adoption erzählen. Sie lässt sich ja schon wegen des unterschiedlichen Aussehens nicht verheimlichen. Also erzählen Sie eine Art Märchen, erzählen Sie, warum Sie ausgerechnet dieses Kind und kein anderes haben wollten. Fangen Sie damit an, sobald Ihr Kind diese Geschichte verstehen kann, also mit drei oder vier Jahren. Es sollte ein besonders schönes Märchen sein, das oft wiederholt wird. Und das auf der Wahrheit fußt.
Fotos vom Neugeborenen gibt es nicht.
Als er mit acht Wochen zu Mrs. Keen in Pflege gegeben wird, macht sie im Laufe des Jahres einige Bilder von ihm. Sie berichtet, dass sie zunächst alle zwei Stunden, Tag und Nacht, füttern musste. Nur langsam habe er das Fläschchen getrunken. Viel Zeit hätten sie beide dafür gebraucht.
Trotz dieser engen Beziehung musste sie von Anfang an wünschen, er möge so bald wie möglich Eltern finden, sie folglich wieder verlassen.
Leider sei er schon zweimal abgelehnt worden. Sie wisse nicht warum. Wo doch alles in bester Ordnung sei mit dem Kleinen!
Auf einem Foto sitzt Winny mit sechs Monaten angelehnt in einer Sofaecke. Mit neun Monaten sieht er rundlich und fröhlich aus und planscht mit zehn Monaten in der kleinen Badewanne.
Zum ersten Geburtstag gibt es fünf Glückwunschkarten von der Pflegemutter und ihren erwachsenen Töchtern. Und darauf jede Menge „little kisses“. Auf dem Papier. Im wirklichen Leben kann der Kleine mit 13 Monaten noch kein Küsschen geben.
Traditionell werden die Glückwunschkarten England gesammelt, denn wer viele vorweisen kann, gehört zu den beliebten Menschen. Wer einen Kamin hat, stellt sie auf den Sims, so dass Besucher sie sehen und auch zählen können.
Winnys Karten wurden sorgsam aufgehoben und an die Adoptiveltern weitergegeben.
Gut einen Monat nach seinem ersten Geburtstag sahen Grimms ihr zukünftiges Familienmitglied zum ersten Mal, und a bit slow (ein bisschen langsam, wie angekündigt) erschien es ihnen nicht.
Als Beate Jahre später die Fotos des kleinen Jungen betrachtet, die im neuen Zuhause aufgenommen wurden, erkennt sie, was sie im ersten Glück übersehen hat. Erst nach mehr als zwei Monaten verschwindet zusammen mit der senkrechten Stirnfalte die Skepsis aus Winnys Augen, er blickt entspannter in die Kamera. Wie es die Eltern vormachen, macht auch er schon bald einen Buhmann, indem er die Backen kräftig aufbläst und die Unterlippe vorschiebt. Doch ein zaghaftes Lächeln zeigt sich erst nach einem halben Jahr, und ein Lachen, auf den Film gebannt, bleibt die Ausnahme.
Wenn man bedenkt, dass der kleine Junge fast zwei Monate allein im Brutkasten und ein Jahr bei der Pflegemutter neben wechselnden fremden Kindern hinter sich hat und dann von einer Stunde auf die andere in eine neue Umgebung zu noch fremden Menschen gegeben wurde, erkennt man seine Skepsis als das natürlichste Gefühl der Welt.
Benno und Beate ahnen, wie groß der Einschnitt im jungen Leben ihres Sohnes sein würde, und hoffen, dass sie ihm mit weit geöffneten Armen und viel Zuwendung bei dem Schritt ins neue Leben helfen können. Wie tief seine bisherigen Erfahrungen sitzen, weiß keiner von ihnen. Trotz der vorbereitenden Gespräche mit der Sozialarbeiterin, trotz kluger Bücher.
Auch als Kindergarten- und Schulkind zeigt Winston selten ein fröhliches Gesicht, meist nur ein Grinsen, wenn der Fotograf Lachen verordnet. Es fiel den Eltern nicht auf, als sie die Bilder ins Album klebten. Sie hatten ein lebhaftes und neugieriges Kind, so dass sie nicht merkten, wie wenig es zu lachen fand.
Fasching mochte Winny nicht, das heißt er wollte sich nicht verkleiden. Während seine Schwester Jana als Clown fröhlich in die Kamera grinst, blickt der siebenjährige Bruder, als Ritter verkleidet, von unten herauf sehr ernst, beinahe missmutig. Seine Mutter hatte angenommen, der Ritter mit Pappschwert oder ein Jahr später der Pirat werde ihm viel Freude bereiten. Sie erkannte nicht, wie schwer es ihm fiel, seine Identität zu finden und daran festzuhalten. Er ist Winston, niemand sonst.
Fröhlich lachend schaut er nur neben seiner Schwester beim Start ins Teenagerleben. Zwei eigene Porträtfotos gefallen ihm so sehr, dass er sich als junger Erwachsener Abzüge wünscht. Auf dem einen Bild steht er in London Knightsbridge vor dem Kaufhaus Harrods neben einem Rolls Royce, einen Fuß lässig nach vorn gesetzt, mit stolzem Lächeln. Die Familie befindet sich auf der Heimreise nach einem Bootsurlaub in England. Das andere Foto dürfte ein Jahr später geknipst worden sein, wiederum beim Bootfahren: Winny sitzt am Steuer, die Lässigkeit in Person, ein Fuß hochgestellt, eine Hand am Lenkrad, die andere locker im Schoß, eine dunkle Sonnenbrille auf der Nase. Und natürlich konnte er das Kajütboot so fehlerlos steuern, mit dem die Grimms auf dem irischen Shannon unterwegs waren, wie er vieles vom bloßen Zuschauen lernte.
Benno und Beate hatten der Sozialarbeiterin von Anfang an gesagt, sie würden in einigen Jahren nach Deutschland zurückkehren. Daraus ergab sich ein weiteres Problem. In England vertrat man in den 1970er Jahren Vorstellungen über den Rassismus in Deutschland, die noch aus der Hitler-Zeit herrührten. Deswegen wurde der kleine Winston für die Deutschen ausgesucht. Er war bei der Geburt so hellhäutig, dass man seiner sehr jungen Mutter, einer blauäugigen Weißen, kaum glauben wollte, der Vater, ebenfalls 15 Jahre alt wie sie, sei ein Schwarzer.
Dark brown hat sie ihn beschrieben.
Doch der Sohn ist dunkelblond.
So wird er das Kompromisskind, das die Adoptionsgesellschaft auswählt. Für die Ausländer.
Verabredungsgemäß fährt Beate zur Pflegemutter in den Südosten Londons. Sie werden einen Vormittag gemeinsam mit dem kleinen Jungen verbringen. Doris Keen lebt in einem achtgeschossigen Wohnblock mit Sozialwohnungen. Sie ist verwitwet und seit einigen Jahren Pflegemutter. Während Winny schläft wie jeden Vormittag, erzählt sie von den anderen Kindern, die sie aufnimmt und die – meistens nur wochenweise – bei ihr leben. Der vierjährige Peter etwa, der häufig seiner Mutter weggenommen werden muss, weil sie zu viel trinkt. Oder der kleine Ian, der manchmal vom Freund der Mutter geschlagen wird. Kein Wunder, sagt Doris Keen, wenn die Kinder nach solchen Erfahrungen schreien oder um sich schlagen. Ein Baby wie Winny bleibe davon nicht unberührt, sagt sie weiter.
Beate fragt nach. Aber die Frau antwortet nur, es sei nicht einfach, einen jähzornigen Vierjährigen und ein Baby wie Winston gleichzeitig zu versorgen.
Als der kleine Junge aufwacht und sich durch Meckern bemerkbar macht, lässt die Pflegemutter Beate den Vortritt. Unsicher nimmt sie ihn hoch, wickelt und füttert ihn unter den Augen der erfahrenen Frau. Sie spielt mit ihm und denkt wie beim ersten Besuch, dass dieses lebhafte Kind nicht zurückgeblieben sein kann. Es wurde zu früh geboren und braucht einfach noch Zeit, bis es läuft und erste Worte spricht.
Beim Abschied suchen sie gemeinsam einen Termin, zu dem Mrs. Keen mit Winston zu Grimms zu Besuch kommen wird.
Derweil fragt Anne Martin, die Sozialarbeiterin, wie sie in der Drei-Zimmer-Wohnung Platz für Winny schaffen wollen. Sie haben sich schon überlegt, dass sie das Kinderbettchen bei sich im Schlafzimmer unterbringen werden, um so viel Nähe wie möglich herzustellen zu einem Kind, das die ersten Wochen seines Lebens ganz ohne Bezugsperson verbracht hat, ohne Mama oder Papa, die das kleine Wesen hätten streicheln und zärtlich mit ihm sprechen können. Mrs. Martin nickt zustimmend.
Aber Doris Keen findet die Idee nicht so gut, als sie sich in der Wohnung umschaut. Zögernd gesteht sie, dass der Kleine zum Einschlafen und häufig auch während der Nacht heftig Headbanging macht, auf dem Bauch liegend mit der Stirn auf die Matratze schlägt. Er habe sich das wohl von den anderen Kindern abgeschaut, fügt sie hinzu. Ihr Blick bittet, Winston nicht aufzugeben.
Der Deutsche Dienst der BBC verabschiedet die künftige Adoptivmutter mit einem Blumenstrauß und dem Hinweis, freiberuflich könne sie nur in Ausnahmefällen hier tätig werden, denn die Honorarkasse sei dürftig ausgestattet.
So werden sie zu dritt künftig nur über die Hälfte des bisherigen monatlichen Einkommens verfügen. Eng wird das schon werden, denn die Wohnung in der Nähe des großen Parks ist teuer und verschlang von Anfang an ein Viertel der verdienten Pfunde. Es beginnt eine Zeit, in der Beate Angst vor jeder Rechnung hat, die im Briefkasten landet.
Noch einmal gibt es ein Hindernis. Ganz plötzlich!
Ganz plötzlich hat man in der Adoptionsgesellschaft noch einmal eine Frage zum deutschen Rassismus. Mrs. Martin übermittelte sie.
Wo werden die Grimms mit Winston in Deutschland leben, wenn sie dorthin zurückkehren?
Sie werden in der Stadt leben, in der sie Arbeit finden. Das ist die Antwort. Rundfunkjournalisten wie sie arbeiten für gewöhnlich in einer Großstadt, also werden sie nicht in einer deutschen Provinzstadt oder auf dem Lande landen.
Auch in der Bundesrepublik sind Großstädte weltoffener. Diese Antwort verspricht die Sozialarbeiterin zu übermitteln. Nach einigen Tagen neuerlicher Anspannung kommt die Gewissheit: Winston wird mit ihnen leben. Zunächst während einer Probezeit, in der sie unangekündigt besucht werden können und über sie schriftlich berichtet wird. So erklärt es Anne Martin. Sie ist weiterhin zuständig.
Er liegt wirklich vor ihr auf der Wickelunterlage, die sie für ihn gekauft hat.
Beate gibt Winny einen schmatzenden Kuss auf das runde Bäuchlein. Dazu macht sie ein prustendes Geräusch. Der Kleine kreischt. Noch ein Kuss, sie beugt ihren Kopf über das Bäuchlein und kitzelt es mit ihren Haaren. Sie liebkost ihn, will ihm Nähe geben, die er bisher nicht gehabt hat. Nicht einmal ein „Küsschen durch die Luft“ kann er mit seinen 13 Monaten verschicken.
Unversehens landet seine Hand auf Beates Wange. Klatsch! Sie spürt eine winzige Enttäuschung, die schnell verfliegt.
Im Garten sitzt ihr Kind. Auf einer Decke, auf dem Rasen, den der irische Gärtner kurz geschoren hat. Der Finger zeigt in viele Richtungen, der Mund stößt muntere Töne aus. Mit dem Po schiebt sich der Kleine näher an den Ball heran.
Nur über die Straße gelangen sie mit dem Buggy, dem leichten, zusammen klappbaren Kinderwagen, in den Park. Wieder breitet Beate die bunte Decke aus. Aber Winny bleibt starr sitzen, die Händchen ineinander verschränkt, die winzige Falte zwischen den Augenbrauen, ein misstrauischer Blick.
Beate schüttet das bunte Spielzeug aus dem Plastikeimer auf die Decke. Doch der kleine Junge starrt unbewegt. Sie nimmt den Ball und kullert ihn auf der Decke hin und her. Als sie den Sohn aus dem Buggy hebt und auf die Decke setzt, bleibt sein Blick ängstlich, er streckt die Hände in Brusthöhe aus, spreizt die Finger, hält sie in die Luft, obwohl sie oft blitzschnell Dinge greifen, bewegen oder schubsen können.
Erst langsam begreift Beate, was mit ihrem Kind los sein könnte.
Das Gras ist hoch gewachsen im Park. Die Büsche biegen sich unter dem Laubwerk. So viel Natur scheint Winny selten oder gar nicht erlebt zu haben. Ihm ist es unheimlich, wo er sich wohl fühlen soll. Ein paar Monate später wird er sagen: Bumban tun nix (Blumen tun nichts). Wiederum Wochen später wird er sich nicht trauen, den Ball wieder hervorzuholen, wenn er im Garten unter einen Busch gerollt ist. Als kühner Schwimmer wird er in späteren Jahren naturtrübes Wasser meiden, wenn es irgend geht.
Manches ist schwerer zu deuten.
Beate wird manches nicht richtig verstehen in den Jahren, die kommen.
Das Headbanging macht Lärm, wenn das Bett nicht fest auf seinen Füßen steht und die Matratze nicht stramm und geräuscharm auf dem Lattenrost liegt.
Bummbumm, bummumm, bummbumm.
Es wird nicht mehr viel Zeit vergehen, bis Winny im Rhythmus dazu Hänschen klein auf hmhmhm singt.
Als Heranwachsender liegt er fast quer im Bett, jedenfalls mit weit ausgebreiteten Armen und Beinen, auf dem Bauch. Vermutlich hört das Headbanging erst auf, als eine Freundin neben ihm liegt.
Seine Eltern ahnen, welche große innere Spannung ihr Kind beherrscht.
Obwohl Winny gut isst und einen kleinen Kugelbauch vorstreckt bei den Gehversuchen, ertappt sich Beate dabei, wie sie ihm in ererbter Manier den Brei in den Mund redet:
Noch ein Löffel für Papa, ein Löffel für die Miau, ein Löffel für das Auto.
Als sie im schlauen Buch über Erziehung liest, nickt sie zustimmend.
Achtung, heißt es da, man praktiziert allzu gern selbst, was man in der Kindheit gehasst hat.
Sie hat es gehasst, ewig am Tisch hinter dem längst kalten Essen hocken und den Teller leeren zu müssen. Und nun versucht sie, Winny auch noch den letzten Löffel hineinzuzwingen.
Pass auf, Beate, denkt sie, bei allem Bemühen kann Erziehung in die falsche Richtung gehen.
Beate und Benno sind stolze Eltern eines munteren Knaben, der sie auf Trab hält, wenn er wach ist. Papa wird sein erstes Wort sein. Benno in Jeans mit Schlag, langen Haaren und nacktem Oberkörper folgt unermüdlich Winnys Wunsch, laufen zu lernen. Er bückt sich zu den Händchen, die der Sohn nach oben reckt. Noch ist er besonders klein, und der Vater krümmt sich. Da der Sohn Hausschuhe sofort auszieht, übt er seine Schritte in Strumpfhosen. Der Strumpf bleibt weit hinter dem Fuß zurück, wodurch die Hose rutscht. Doch Winny nimmt wie Benno keine Notiz davon.
Der Kleine setzt bunte Plastikbecher aufeinander. Er bemüht sich, sie danach in der richtigen Reihenfolge ineinander zu stecken. Stolz zeigt das Fingerchen auf die eigene Brust: Ich habe das gekonnt!
Winny will bewundert werden und nicht allein sein.
Die Eltern denken, dass ein Kind, das wichtige Wochen seines Lebens ohne Zuwendung verbrachte, nicht allein in seinem Zimmer bleiben und sich allein beschäftigen muss.
Wenn Winny später unzufrieden nach immer neuen Beschäftigungen sucht, fragt sich Beate gegelegentlich, ob es ein Fehler war, sich ständig zu kümmern. Vielleicht hat der Sohn auf diese Weise nicht genug Luft zum Atmen bekommen, nicht genügend Freiräume für seine Entwicklung? Konnte er sich nicht selbst entdecken? Hatte keine Chance dazu?
Noch ahnen die Eltern nichts von solchen Gefahren. Sie meinen es doch nur gut!
Winny, sag mal Mama. Winny sag mal Papa. Winny, sag doch mal Auto.
Sein zweites Wort klingt nach Auto. Aber er macht sie auch mit den wirklich wichtigen ersten Wörtern glücklich.
Nach sechs Wochen Familienleben werden sie in das große Krankenhaus eingeladen, in dem Winny geboren und im ersten Lebensjahr als Frühchen regelmäßig untersucht und getestet worden ist. Im Grunde genommen wissen die Grimms längst, dass ihr Sohn nicht behindert ist. Manchmal fragt sich Beate allerdings noch immer angstvoll, ob es denn sein könne, dass die Entwicklung eines Kindes plötzlich stehen bleibt. Doch wenn sie Winny anschaut, weiß sie, mit ihm haben solche Überlegungen nichts zu tun. Nun wollen die Eltern von den Ärzten die Bestätigung erhalten, mit der dieses Retarded endgültig aus der Welt geschafft wird.