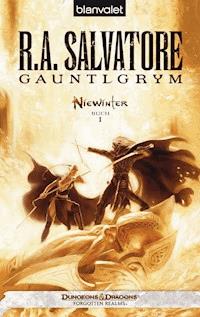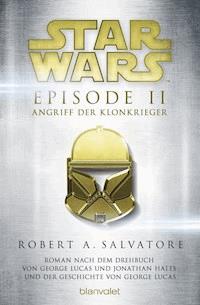
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Filmbücher
- Sprache: Deutsch
Spitzbübisch und entschlossen, tapfer bis zur Bedenkenlosigkeit, wuchs Anakin Skywalker in einer Zeit großer Veränderungen zum Mann heran. Obi-Wan Kenobis 20-jähriger Schüler ist dem Jedi-Rat ein Rätsel und für seinen Jedi-Meister eine Herausforderung. Die Zeit hat Anakins Ehrgeiz nicht geschmälert, und auch die Jedi-Ausbildung hat seinen Drang zur Unabhängigkeit nicht bändigen können. Als ein heimtückisches Attentat auf das Leben der Senatorin Padmé Amidala die beiden zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder zusammenführt, zeigt sich, dass die Zeit an Anakins tiefen Gefühlen für die wunderschöne Diplomatin nichts hat ändern können ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ES WAR EINMAL VOR LANGER ZEIT IN EINER WEIT, WEIT ENTFERNTEN GALAXIS
Prolog
Er versank vollkommen in der Szene, die sich vor ihm auftat. Es war alles so still und ruhig … so normal.
Das war die Art von Leben, die er sich immer gewünscht hatte, umgeben von Verwandten und Freunden – denn das waren diese Personen wohl, obwohl seine Mutter die einzige war, die er erkannte.
So sollte es sein. Wärme und Liebe, Lachen und ruhige Stunden. So hatte er es sich immer erträumt, darum hatte er gebetet. Liebevolles, freundliches Lächeln. Angenehme Gespräche – obwohl er nicht hören konnte, worüber sie sprachen. Hier und da ein Schultertätscheln.
Aber das Wichtigste war das glückliche Lächeln seiner Mutter, die nun endlich keine Sklavin mehr war. Als sie ihn anschaute, sah er all das und noch viel mehr, erkannte, wie stolz sie auf ihn war, wie sehr sie sich nun ihres Lebens freute.
Nun war sie direkt vor ihm, strahlte ihn an, streckte die Hand aus, um ihm sanft über die Wange zu streicheln. Ihr Lächeln wurde noch freudiger, noch strahlender.
Zu strahlend.
Einen Augenblick lang hatte er dieses übertriebene Strahlen für das Zeichen einer Liebe gehalten, die über alle Grenzen hinausging, aber dann verzog sich das Gesicht seiner Mutter immer mehr, verzerrte sich seltsam.
Es sah aus, als bewegte sie sich in Zeitlupe. Alle bewegten sich nun so, wurden langsamer, als wären ihnen ihre Arme und Beine zu schwer geworden.
Nein, nicht zu schwer, erkannte er plötzlich; aus der wohligen Wärme, die ihn umfangen hatte, wurde nun ein Glühen. Es war, als würden diese Freunde und seine Mutter starr und steif, als würden sie sich von lebendigen, atmenden Menschen in etwas anderes verwandeln. Wieder starrte er diese Karikatur eines Lächelns an, dieses verzerrte Gesicht, und erkannte die Schmerzen dahinter, eine kristallene Qual.
Er wollte nach ihr rufen, wollte sie fragen, was er tun sollte, wie er ihr helfen könnte.
Ihr Gesicht verzerrte sich noch mehr, und Blut lief ihr aus den Augen. Ihre Haut wurde kristallin, beinahe durchsichtig, beinahe gläsern.
Glas! Sie war zu Glas geworden! Das Licht ließ sie glitzern, das Blut floss rasch über ihre glatte Oberfläche. Und ihre Miene, ein Ausdruck der Resignation, beinahe entschuldigend, ein Blick, der sagte, dass sie ihn nun im Stich ließ und dass er sie im Stich gelassen hatte, trieb dem hilflosen Betrachter einen Stachel direkt ins Herz.
Er versuchte, sie zu berühren, wollte sie unbedingt retten.
Dann bildeten sich erste Risse im Glas. Er hörte das Knirschen, als sie länger und länger wurden.
Er rief nach ihr, streckte verzweifelt die Arme nach ihr aus. Dann fiel ihm die Macht ein, und er entsandte seine Gedanken mit all seiner Willenskraft, griff mit all seiner Energie nach ihr.
Aber sie zerbrach.
Der Jedi-Padawan schoss erschrocken auf seiner Koje im Schiff hoch, die Augen plötzlich weit offen. Er war schweißüberströmt und atmete schwer.
Ein Traum. Es war alles nur ein Traum.
Das sagte er sich immer wieder, während er versuchte, noch einmal einzuschlafen. Es war alles nur ein Traum.
Oder nicht?
Immerhin sah er manchmal Dinge, schon bevor sie geschahen.
»Ansion! Wir sind da!«, erklang eine Stimme weiter vorn im Schiff – die vertraute Stimme seines Meisters.
Er wusste, er musste diesen Traum abschütteln, musste sich auf die Ereignisse konzentrieren, die direkt vor ihnen lagen, auf diesen neuesten Auftrag, den er und sein Meister erhalten hatten. Aber das war leichter gesagt als getan.
Denn er sah immer wieder seine Mutter vor sich, wie sie erstarrte, wie ihr Körper kristallin wurde und dann in Millionen Splittern explodierte.
Er spähte nach vorn, stellte sich vor, wie sein Meister an den Navigationskontrollen saß, fragte sich, ob er dem Jedi alles erzählen sollte, ob sein Meister ihm wohl helfen könnte. Aber dieser Gedanke verschwand so schnell wieder, wie er gekommen war. Obi-Wan Kenobi würde ihm nicht helfen können. Er war zu beschäftigt mit anderen Dingen, mit seiner Ausbildung, mit kleineren Aufträgen wie diesen Grenzstreitigkeiten, die sie so weit von Coruscant weggebracht hatten.
Der Padawan wollte so schnell wie möglich wieder nach Coruscant zurückkehren. Er brauchte Anleitung, aber nicht von der Art, wie Obi-Wan sie ihm gab.
Er musste mit Kanzler Palpatine sprechen, die tröstlichen Worte dieses Mannes hören. Palpatine hatte in den vergangenen zehn Jahren großes Interesse an ihm gezeigt und dafür gesorgt, dass der Padawan immer die Möglichkeit erhielt, mit ihm zu sprechen, wenn er und Obi-Wan auf Coruscant waren.
Das tröstete den Anakin auch jetzt irgendwie, obwohl der schreckliche Traum ihm noch so lebhaft vor Augen stand. Denn der Oberste Kanzler, der weise Anführer der Republik, hatte ihm versichert, dass sich seine Kräfte zu bisher unbekannten Höhen entwickeln würden, dass er selbst unter den mächtigen Jedi ganz und gar ungewöhnlich sein würde.
Vielleicht war das ja die Antwort. Vielleicht könnte ja der mächtigste aller Jedi, der Mächtigste der Mächtigen, das zerbrechliche Glas stärken.
»Wir sind da«, erklang es wieder von vorn. »Komm schon, Anakin!«
Eins
Shmi Skywalker Lars stand am Rand des Sicherheitszauns an der Grenze der Feuchtfarm, einen Fuß oben auf der Mauer, die Hand aufs Knie gestützt. Sie war in mittleren Jahren, ihr dunkles Haar war schon ein wenig ergraut, ihr Gesicht hager und müde. Sie starrte hinauf zu den vielen hellen Sternen, die in dieser klaren Nacht am Himmel von Tatooine zu erkennen waren. In der Landschaft rings um sie her gab es keine scharfen Kanten, nur die glatten und abgerundeten Oberflächen der scheinbar endlosen Sandwüsten dieses Planeten. Irgendwo draußen, weit entfernt, stöhnte ein wildes Tier – ein klagendes Geräusch, das an diesem Abend in Shmis Stimmung seinen Widerhall fand.
An diesem besonderen Abend.
Ihr Sohn Anakin, ihr lieber kleiner Annie, wurde an diesem Abend zwanzig Jahre alt – ein Geburtstag, den Shmi in keinem Jahr vergaß, obwohl sie ihren geliebten Sohn seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Wie anders er jetzt sein musste! Wie groß, wie stark, was für ein weiser Jedi! Shmi, die ihr ganzes Leben in dieser abgelegenen Region des trostlosen Tatooine verbracht hatte, wusste, dass sie sich die Wunder kaum vorstellen konnte, die ihr Junge da draußen in der Galaxis wohl sehen würde, auf Planeten, die so ganz anders waren als dieser hier, mit viel lebendigeren Farben und Wasser, das ganze Täler füllte.
Ein sehnsuchtsvolles Lächeln breitete sich auf ihrem immer noch schönen Gesicht aus, während sie sich an die Tage vor so langer Zeit erinnerte, als sie und ihr Sohn Sklaven des elenden Watto gewesen waren. Annie mit seiner Schalkhaftigkeit und seinen Träumen, seiner Unabhängigkeit und seinem unübertrefflichen Mut hatte den toydarianischen Schrotthändler immer schrecklich geärgert. Aber trotz der vielen Nachteile des Sklavendaseins hatten sie damals auch gute Zeiten erlebt. Sie hatten nie genug zu essen gehabt, nie genug andere Dinge, sie waren beinahe ununterbrochen von Watto herumkommandiert und schikaniert worden, aber Shmi war mit Annie zusammen gewesen, ihrem geliebten Sohn.
»Komm lieber rein«, erklang eine leise Stimme hinter ihr.
Shmis Lächeln wurde noch liebevoller, und sie drehte sich zu ihrem Stiefsohn Owen Lars um, der nun auf sie zukam. Owen war ein kräftiger, untersetzter junger Mann in Anakins Alter, mit kurzem braunem Haar, ein paar Bartstoppeln und einem breiten Gesicht, dem immer deutlich anzusehen war, was sich gerade in seinem Herzen abspielte.
Shmi zauste Owens Haar, als er neben sie trat, und er legte ihr den Arm um die Schultern und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Kein Sternenschiff heute Abend, Mom?«, fragte Owen liebevoll, denn er wusste, wieso Shmi hier herausgekommen war, warum sie es an stillen Abenden wie diesem so oft tat.
Shmi strich mit dem Handrücken sanft über Owens Wange und lächelte. Sie liebte diesen jungen Mann wie ihren eigenen Sohn, und er war so gut zu ihr gewesen, hatte immer verstanden, dass in ihrem Herzen ein blinder Fleck zurückgeblieben war. Owen hatte Shmis Schmerz wegen Anakin ohne jegliche Eifersucht akzeptiert, und sie hatte bei ihm stets Trost gefunden.
»Nein, heute Abend nicht«, erwiderte sie und blickte wieder zum Sternenhimmel auf. »Anakin ist wahrscheinlich damit beschäftigt, die Galaxis zu retten oder Schmuggler und andere Gesetzlose zu jagen. Er muss diese Dinge jetzt tun, das gehört zu seinen Pflichten.«
»Dann werde ich von nun an besser schlafen können«, erwiderte Owen grinsend.
Shmi hatte ihre Bemerkung nicht ernst gemeint, aber nun begriff sie, dass auch ein wenig Wahrheit darin lag. Anakin war ein besonderes Kind gewesen, ein ungewöhnliches Kind – selbst für einen Jedi, glaubte sie. Anakin hatte immer über den anderen gestanden. Nicht körperlich – körperlich war er, wie Shmi ihn in Erinnerung hatte, einfach ein lächelnder kleiner Junge mit einem neugierigen Ausdruck in den blauen Augen und dunkelblondem Haar. Aber Annie hatte sich bei dem, was er tat, stets ausgezeichnet. Obwohl er damals noch ein Kind gewesen war, hatte er an Podrennen teilgenommen und ein paar der besten Rennfahrer auf Tatooine besiegt. Er war der erste Mensch, der überhaupt je ein Podrennen gewonnen hatte, und das mit neun Jahren! Und ausgerechnet, wie sich Shmi nun lächelnd erinnerte, mit einem Podrenner, den er aus Schrott von Wattos Hinterhof zusammengebaut hatte.
Aber so war Anakin nun einmal – anders als andere Kinder, und sogar anders als andere Erwachsene. Anakin »sah« Dinge, bevor sie geschahen, als wäre er so auf seine Umgebung eingestimmt, dass er sofort instinktiv begriff, wie sich Ereignisse weiterentwickeln würden. Zum Beispiel spürte er oft schon Probleme mit seinem Podrenner, bevor diese Probleme sich wirklich einstellten und eine Katastrophe auslösen konnten. Er hatte seiner Mutter einmal gesagt, dass er die Hindernisse, auf die er mit dem Podrenner zuraste, spüren konnte, noch bevor er sie tatsächlich sah. Es war eben seine besondere Art, und deshalb hatten die beiden Jedi, die nach Tatooine gekommen waren, auch erkannt, wie einzigartig er war, hatten ihn Watto abgekauft und ihn mitgenommen, um sich um ihn zu kümmern und ihn zu unterrichten.
»Ich musste ihn gehen lassen«, sagte Shmi leise. »Ich konnte ihn nicht hier behalten, wenn das bedeutete, dass er als Sklave hätte leben müssen.«
»Das weiß ich doch«, sagte Owen.
»Ich hätte ihn nicht einmal bei mir behalten können, wenn wir keine Sklaven mehr gewesen wären«, fuhr sie fort, und dann sah sie Owen an, als wäre sie von ihren eigenen Worten überrascht. »Annie kann der Galaxis so viel geben. Seine Begabung ist zu groß für Tatooine. Er muss dort draußen sein und durch die Galaxis fliegen. Planeten retten. Er war geboren, um Jedi zu werden, geboren, um so vielen so viel zu geben.«
»Deshalb werde ich von jetzt an ja besser schlafen«, wiederholte Owen, und als Shmi ihn ansah, bemerkte sie, das sein Grinsen noch breiter geworden war.
»Ach, du willst mich nur necken!«, sagte sie und versetzte ihrem Stiefsohn einen Klaps auf die Schulter. Owen zuckte einfach nur die Achseln.
Dann wurde Shmi wieder ernst. »Annie wollte gehen«, fuhr sie mit ihrer Ansprache fort, die sie Owen schon so oft gehalten hatte, die sie für sich selbst lautlos seit zehn Jahren jede Nacht rezitierte. »Sein Traum war es, Raumfahrer zu werden, jeden Planeten in der ganzen Galaxis zu sehen und große Taten zu vollbringen. Er ist als Sklave geboren, aber nicht dazu geboren, Sklave zu sein. Nein, nicht mein Annie. Nicht mein Annie.«
Owen drückte ihre Schulter. »Du hast es ganz richtig gemacht. Wenn ich Anakin wäre, würde ich dir dankbar sein. Ich würde begreifen, dass du getan hast, was für mich das Beste war. Größere Liebe als das gibt es nicht, Mom.«
Shmi streichelte ihm noch einmal über die Wange, und es gelang ihr sogar, noch einmal sehnsuchtsvoll zu lächeln.
»Komm jetzt rein, Mom«, sagte Owen und griff nach ihrer Hand. »Es ist gefährlich hier draußen.«
Shmi nickte und wehrte sich nicht, als Owen begann, sie hinter sich herzuziehen. Plötzlich jedoch blieb sie stehen und starrte ihren Stiefsohn beunruhigt an, als er sich zu ihr umdrehte. »Weiter draußen ist es noch gefährlicher«, sagte sie mit brechender Stimme. Erschrocken schaute sie wieder in den weiten, offenen Himmel hinauf. »Was, wenn man ihm wehgetan hat, Owen? Was, wenn er tot ist?«
»Es ist besser, bei der Verwirklichung seiner Träume zu sterben, als ohne Hoffnung zu leben«, erklärte Owen, aber das klang irgendwie nicht sonderlich überzeugend.
Nun sah Shmi wieder ihren Stiefsohn an, und ihr Lächeln kehrte zurück. Owen war, ebenso wie sein Vater, ganz im Pragmatismus verwurzelt. Sie wusste, dass er das nur um ihretwillen gesagt hatte, und das machte es noch besser.
Sie wehrte sich nicht mehr, als Owen sie weiterführte, zurück zu dem bescheidenen Heim von Cliegg Lars, ihrem Mann, Owens Vater.
Sie hatte das Richtige getan, sagte Shmi sich bei jedem Schritt. Sie und Anakin waren Sklaven gewesen, und außer dem Angebot der Jedi hatte es keine Aussicht auf Freiheit gegeben. Wie hätte sie Anakin auf Tatooine behalten können, wenn doch die Jediritter ihm all seine Träume erfüllen konnten?
Shmi hatte damals selbstverständlich nicht gewusst, dass sie an einem schicksalhaften Tag in Mos Espa Cliegg Lars begegnen würde, dass dieser Feuchtfarmer sich in sie verlieben, sie Watto abkaufen und dann, erst dann, als sie eine freie Frau war, bitten würde, sie zu heiraten. Hätte sie Anakin auch gehen lassen, wenn sie gewusst hätte, wie bald nach seinem Abflug sich ihr Leben verändern sollte?
Wäre ihr Leben jetzt nicht besser, vollständiger, wenn Anakin an ihrer Seite wäre?
Shmi lächelte, als sie darüber nachdachte. Nein, erkannte sie, sie würde immer noch wollen, dass Annie gegangen wäre, selbst wenn sie hätte vorhersehen können, wie dramatisch sich ihr Leben so kurz darauf verändern würde. Nicht um ihretwillen. Aber für Anakin. Sein Platz war da draußen. Das wusste sie.
Shmi schüttelte den Kopf, überwältigt von den vielen Wendungen auf ihrem Weg, auf Anakins Weg. Selbst im Nachhinein konnte sie nicht sicher sein, dass die gegenwärtige Situation das beste Ergebnis darstellte.
Und in ihrem Herzen blieb ein blinder Fleck.
Zwei
Dabei kann ich dir doch helfen«, sagte Beru höflich und stellte sich neben Shmi, die mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt war. Cliegg und Owen waren gerade dabei, den Hof für die Nacht zu sichern – eine Nacht, in der ein Sandsturm drohte.
Mit einem liebevollen Lächeln reichte Shmi der jungen Frau ein Messer. Sie freute sich, dass Beru bald zur Familie gehören würde. Owen hatte noch nichts davon gesagt, dass er Beru heiraten wollte, aber Shmi sah es an der Art, wie die beiden einander anschauten. Es war nur noch eine Frage der Zeit – einer eher kurzen Zeit, wenn sie ihren Stiefsohn kannte. Owen war kein Abenteurer, er war so solide wie ein Fels, aber er wusste, was er wollte, und das holte er sich störrisch und entschlossen.
Und er wollte Beru. Die junge Frau ihrerseits erwiderte Owens Liebe aus ganzem Herzen. Sie war für das Leben als Frau eines Feuchtfarmers hervorragend geeignet, dachte Shmi, als sie beobachtete, wie Beru ihren Pflichten in der Küche nachging. Sie schreckte vor keiner Arbeit zurück, war ausgesprochen fähig und sehr fleißig.
Und sie erwartet nicht viel und braucht nicht viel, um glücklich zu sein, dachte Shmi, und das war, wenn man ehrlich sein wollte, das Wichtigste. Ihr Leben hier war schlicht und einfach. Es gab nur wenig Abenteuer, und keines von ihnen war willkommen, denn Aufregung bedeutete hier draußen für gewöhnlich, dass man Tusken-Banditen in der Nähe gesichtet hatte oder dass ein gewaltiger Sandsturm oder ein anderes potenziell katastrophales Naturereignis drohte.
Die Familie Lars hatte nur die einfachen Dinge, überwiegend ihre eigene Gesellschaft, um sich daran zu erfreuen. Für Cliegg war dies die einzige Art von Leben, die er je gekannt hatte, ein Leben, wie es schon Generationen seiner Vorfahren geführt hatten. Das Gleiche galt für Owen. Und obwohl Beru in Mos Eisley aufgewachsen war, schien sie gut hierher zu passen.
Ja, Owen würde Beru heiraten, das wusste Shmi. Und was für ein glücklicher Tag das sein würde!
Die beiden Männer kehrten schon bald ins Haus zurück, zusammen mit C-3PO, dem Protokolldroiden, den Anakin damals gebaut hatte, als ihm noch Wattos Schrottplatz als Reservoir zur Verfügung stand.
»Hier sind noch zwei Tangarwurzeln für Euch, Mistress Shmi«, sagte der schlanke Droide und reichte Shmi ein paar der orangegrünen Gemüsewurzeln. »Ich hätte noch mehr mitgebracht, aber man hat mich alles andere als höflich darauf hingewiesen, dass ich mich beeilen soll.«
Shmi warf Cliegg einen Blick zu, und er zuckte grinsend die Schultern. »Ich hätte ihn auch für eine frische Sandstrahlreinigung draußen lassen können«, sagte er. »Allerdings wäre es durchaus möglich, dass ein paar von den größeren Steinen einen Schaltkreis oder zwei erledigt hätten.«
»Ich bitte um Verzeihung, Meister Cliegg«, sagte der Droide. »Ich wollte eigentlich nur sagen …«
»Wir wissen, was du sagen wolltest, 3PO«, versicherte Shmi dem Droiden und legte ihm eine tröstende Hand auf die Schulter, die sie dann rasch wieder wegzog – was für eine alberne Geste einem wandelnden Blechhaufen gegenüber! Sicher, C-3PO war für Shmi Skywalker Lars viel mehr als ein wandelnder Blechhaufen. Anakin hatte den Droiden gebaut … beinahe jedenfalls. Als Anakin mit den Jedi weggegangen war, hatte C-3PO bereits hervorragend funktioniert, aber keine Abdeckung gehabt. Shmi hatte ihn lange unvollendet gelassen und sich vorgestellt, dass Anakin bald zurückkehren und die Arbeit beenden würde. Erst nach ihrer Heirat mit Cliegg hatte Shmi den Droiden selbst fertiggestellt und ihn mit dieser matten Metallhülle versehen. Es war ein bewegender Augenblick gewesen – in gewisser Weise hatte sie damit eingestanden, dass sowohl sie als auch Anakin nun an dem Platz waren, an den sie gehörten. Der Protokolldroide konnte einem manchmal gewaltig auf die Nerven gehen, aber für Shmi war C-3PO vor allem eine Erinnerung an ihren Sohn
»Wenn da draußen Tusken sind, dann hätten sie ihn allerdings noch vor dem Sturm geschnappt«, fuhr Cliegg fort, dem es offenbar großes Vergnügen bereitete, den armen Droiden zu hänseln. »Du hast doch keine Angst vor Tusken-Banditen, nicht war, 3PO?«
»In meiner Programmierung ist so etwas wie Angst nicht vorgesehen«, erwiderte C-3PO, aber er hätte sich ein wenig überzeugender angehört, wenn er nicht so gezittert hätte und seine Stimme dadurch nicht so quietschend und ungleichmäßig gewesen wäre.
»Das reicht jetzt«, sagte Shmi zu ihrem Mann. »Armer 3PO«, murmelte sie und tätschelte dem Droiden abermals die Schulter. »Verschwinde jetzt. Ich habe heute Abend mehr als genug Hilfe.« Sie bedeutete dem Droiden zu gehen.
»Du bist einfach schrecklich zu diesem armen Droiden«, erklärte sie, schmiegte sich an ihren Mann und versetzte ihm einen liebevollen Klaps auf die breiten Schultern.
»Nun, wenn ich mit ihm keinen Spaß haben darf, muss ich eben etwas anderes versuchen«, erwiderte Cliegg – ein üblicherweise eher ernster Mann –, kniff die Augen zusammen, sah sich um und ließ den drohenden Blick schließlich auf Beru ruhen.
»Cliegg«, warnte Shmi.
»Was ist denn?«, protestierte er theatralisch. »Wenn sie wirklich vorhat, hier einzuziehen, dann sollte sie lieber lernen, sich zu verteidigen!«
»Dad!«, rief Owen.
»Ach, macht euch wegen dem guten alten Cliegg keine Gedanken«, warf Beru ein und betonte dabei das Wort »alt«. »Ich wäre ja eine schöne Ehefrau, wenn ich bei einem Rededuell gegen einen wie den nicht bestehen könnte!«
»Ah! Eine Herausforderung!« Cliegg war begeistert.
»Für mich nicht unbedingt«, erwiderte Beru trocken. Dann begannen die Frotzeleien zwischen den beiden, und auch Owen warf hier und da ein Wort ein.
Shmi hörte kaum hin – sie war zu sehr damit beschäftigt, Beru einfach nur zu beobachten. Ja, sie würde gut auf die Farm passen. Sie hatte genau den richtigen Charakter. Sie war solide, aber wenn die Situation es gestattete, konnte sie auch verspielt sein. Der barsche Cliegg konnte es bei seinen trockenen Witzeleien mit den Besten aufnehmen, aber Beru stand ihm in nichts nach. Shmi machte sich wieder ans Kochen, und ihr Lächeln wurde jedes Mal noch wärmer, wenn Beru Cliegg etwas ganz besonders Boshaftes an den Kopf warf.
Sie konzentrierte sich so auf ihre Arbeit, dass sie das Wurfgeschoss nicht kommen sah und laut aufschrie, als das überreife Gemüse sie am Kopf traf.
Das bewirkte bei den drei anderen selbstverständlich nur noch lauteres Gelächter.
Shmi wandte sich ihnen zu, wie sie da saßen und sie anstarrten, und aus Berus verlegener Miene schloss sie, dass die junge Frau das Ding geworfen hatte. Sie hatte wohl Cliegg treffen wollen, aber ein wenig zu hoch gezielt.
»Das Mädchen hört zumindest gut zu, wenn man ihr sagt, sie soll aufhören«, erklärte Cliegg Lars, aber sein sarkastischer Tonfall wurde durch das darauffolgende laute, herzhafte Lachen ziemlich unglaubwürdig.
Er brach ab, als Shmi ihn mit einem saftigen Stück Obst traf, das an seiner Schulter zerplatzte.
Und so begann eine Schlacht mit Obst und Gemüse – und selbstverständlich gab es dabei noch mehr ironische Drohungen als wirkliche Wurfgeschosse.
Schließlich machte sich Shmi ans Putzen, und die anderen drei halfen ihr eine Weile. »Ihr beiden solltet lieber gehen und ein wenig Zeit ohne diesen boshaften alten Mann verbringen«, sagte Shmi zu Owen und Beru. »Cliegg hat mit dem Unfug angefangen, also kann er auch beim Saubermachen helfen. Geht schon. Ich werde euch rufen, wenn das Essen auf dem Tisch steht.«
Cliegg lachte leise.
»Und wenn du noch mehr von dem Zeug in der Gegend rumwirfst, gehst du hungrig ins Bett«, verkündete Shmi drohend und fuchtelte dabei mit einem Löffel vor seiner Nase herum. »Und alleine.«
»Das will ich lieber nicht riskieren!« Cliegg hob unterwürfig die Hände.
Mit weiterem Löffelfuchteln trieb Shmi Owen und Beru aus der Küche, und die beiden gingen natürlich gerne.
»Sie wird ihm eine gute Frau sein«, sagte Shmi zu ihrem Mann.
Er zog sie fest an sich. »Wir Lars-Männer verlieben uns nur in die Besten.«
Shmi drehte sich um, sah sein liebevolles und ehrliches Lächeln und erwiderte es aus vollem Herzen. So sollte es sein. Gute, ehrliche Arbeit, das Gefühl, etwas geleistet zu haben, und genug Freizeit, um auch ein wenig Spaß zu haben. Das war das Leben, das Shmi sich immer gewünscht hatte. Es war perfekt. Beinahe.
Plötzlich wurde ihre Miene sehnsüchtig.
»Du denkst wieder an deinen Jungen.« Cliegg Lars brauchte nicht erst zu fragen.
Shmi sah ihn an, ihr Ausdruck eine Mischung aus Freude und Trauer. »Ja, aber diesmal ist es in Ordnung«, erklärte sie. »Er ist in Sicherheit, das weiß ich, und vollbringt große Taten.«
»Aber wenn wir so viel Spaß haben, wünschst du dir, dass er hier bei uns wäre.«
Shmi lächelte abermals. »Ja. Und auch zu anderen Zeiten. Ich wünschte, Anakin wäre von Anfang an hier gewesen, seit wir uns kennen gelernt haben.«
»Vor fünf Jahren«, bemerkte Cliegg.
»Er hätte dich ebenso lieb gewonnen wie ich, und er und Owen …« Ihre Stimme war leiser geworden und verklang nun ganz.
»Glaubst du, Anakin und Owen wären Freunde geworden?«, fragte Cliegg. »Bah! Selbstverständlich wären sie das!«
»Du hast meinen Annie nicht mal kennen gelernt«, tadelte Shmi.
»Sie wären die besten Freunde«, versicherte Cliegg ihr und nahm sie noch fester in den Arm. »Das könnte gar nicht anders sein, mit dir als Mutter.«
Shmi nahm das Kompliment erfreut entgegen, dann küsste sie Cliegg liebevoll und anerkennend. Sie musste an Owen denken, an die blühende Liebe des jungen Mannes zu der reizenden Beru. Wie sehr sie die beiden liebte!
Aber dieser Gedanke brachte auch ein gewisses Unbehagen mit sich, denn Shmi hatte sich oft gefragt, ob Owen nicht ein wichtiger Grund gewesen war, dass sie so schnell zugestimmt hatte, Cliegg zu heiraten. Sie sah ihren Mann wieder an und strich mit der Hand über seine breiten Schultern. Ja, sie liebte ihn, sie liebte ihn sehr, und sie konnte nicht abstreiten, dass sie glücklich war, keine Sklavin mehr zu sein. Aber dennoch, welche Rolle hatte die Tatsache, dass Cliegg einen Sohn in Annies Alter hatte, bei ihrer Entscheidung gespielt? Diese Frage war im Lauf der Jahre immer wieder aufgetaucht. Hatte sie tief in ihrem Herzen eine Sehnsucht gehegt, die Owen erfüllt hatte? Eine mütterliche Sehnsucht danach, die Lücke, die Anakins Abreise gerissen hatte, wieder zu füllen?
Tatsächlich waren die beiden Jungen sehr unterschiedlich. Owen war solide und gelassen, ein Fels von einem Mann, der, wenn der Zeitpunkt gekommen war, mit Freude die Feuchtfarm von Cliegg übernehmen würde, wie sie schon seit Generationen innerhalb der Familie Lars weitervererbt worden war. Owen war bereit und freute sich sogar darauf, dieses Erbe anzutreten, und er war mehr als fähig, ein solch schwieriges Leben zu führen. Stolz und das Gefühl, etwas geleistet zu haben, wenn er die Farm angemessen bewirtschaftete, wären ihm Lohn genug.
Aber Annie …
Shmi hätte beinahe laut gelacht, als sie sich ihren ungeduldigen und von Wanderlust getriebenen Sohn in derselben Situation vorstellte. Zweifellos hätte Anakin Cliegg ebenso zu Wutanfällen getrieben, wie er es mit Watto getan hatte. Anakins Abenteuergeist hätte sich von einem Gefühl der Verantwortung gegenüber seinem Erbe nicht zähmen lassen, das wusste Shmi. Sein Bedürfnis nach Abenteuern, nach den Podrennen, nach Reisen durch die Galaxis, wäre nicht geringer geworden, und das hätte Cliegg wahrscheinlich viel Nerven gekostet.
Jetzt kichert Shmi tatsächlich, als sie sich vorstellte, wie Cliegg vor Zorn rot anlief, weil Anakin wieder einmal seine Pflichten nicht erfüllt hatte.
Cliegg umarmte sie noch fester, als er das Kichern hörte, denn er hatte offenbar keine Ahnung, was für ein Bild da vor ihrem geistigen Auge stand.
Shmi ergab sich ganz der Umarmung. Sie wusste, sie gehörte hierher, und sie tröstete sich mit dem Gedanken, dass auch Anakin dort war, wo er wirklich hingehörte.
Sie trug nicht mehr die großartigen Gewänder, die in den letzten mehr als zehn Jahren Zeichen ihrer gesellschaftlichen Stellung gewesen waren. Ihr Haar war nicht mehr kunstvoll frisiert, es gab keine glitzernden Schmuckstücke in den dichten braunen Strähnen mehr, keinen komplizierten Kopfputz. Und in dieser Schlichtheit war Padmé Amidala nur noch schöner und strahlender.
Die Frau, die neben ihr auf der Schaukel saß, ganz offensichtlich eine Verwandte, war ein wenig älter, vielleicht auch ein wenig matronenhafter, und ihre Kleider waren sogar noch einfacher als Padmés, ihre Frisur schlichter. Aber sie war nicht weniger schön; sie strahlte von innen heraus.
»Hattest du eine Besprechung mit Königin Jamillia?«, fragte Sola, und aus ihrem Tonfall wurde sehr deutlich, dass solche Besprechungen nicht gerade einen der vorderen Plätze auf ihrer Wunschliste einnahmen.
Padmé sah sie an, dann schaute sie wieder zurück zu dem Spielhaus, in dem Solas Töchter Ryoo und Pooja mit wildem Tauziehen beschäftigt waren.
»Es war eine wichtige Besprechung«, erklärte Padmé. »Die Königin wollte Informationen an mich weitergeben.«
»Über das Armee-Gesetz«, stellte Sola fest.
Padmé hielt es nicht für notwendig, das Offensichtliche noch zu bestätigen. Das Gesetz über die Aufstellung einer Armee, das nun im Senat diskutiert wurde, war eine der wichtigsten politischen Angelegenheiten seit langem, und seine Bedeutung für die Republik reichte weit über die der Ereignisse jener finsteren Zeiten hinaus, als Padmé Königin gewesen war und die Handelsföderation versucht hatte, Naboo zu erobern.
»Die ganze Republik ist in Aufruhr, aber fürchtet euch nicht, Senatorin Amidala wird alles wieder in Ordnung bringen«, sagte Sola.
Padmé drehte sich wieder zu ihr um, denn sie war überrascht von Solas Sarkasmus.
»Das wirst du doch, oder?«, fragte Sola unschuldig.
»Ich versuche es.«
»Und das ist alles, was du versuchst.«
»Was soll denn das heißen?«, fragte Padmé verblüfft. »Immerhin bin ich tatsächlich Senatorin.«
»Erst Königin, dann Senatorin, und danach wirst du sicher noch viele andere Ämter haben«, sagte Sola. Sie warf wieder einen Blick zum Spielhaus und ermahnte ihre Töchter, nicht so laut zu sein.
»Du sagst das, als wäre es etwas Schlimmes«, bemerkte Padmé.
Sola sah sie ernst an. »Es ist eine gute Sache«, erklärte sie, »wenn du die richtigen Gründe hast.«
»Und was soll das nun wieder bedeuten?«
Sola zuckte die Achseln, als wäre sie selbst nicht ganz sicher. »Ich denke einfach, du hast dich selbst davon überzeugt, dass du für die Republik unersetzlich bist«, sagte sie. »Dass sie ohne dich nicht mehr zurechtkäme.«
»Schwester!«
»Das stimmt doch«, beharrte Sola. »Du gibst und gibst und gibst. Willst du denn nie auch ein wenig zurückhaben?«
Padmés Lächeln zeigte Sola, dass diese Worte sie überrascht hatten. »Was sollte ich denn wollen?«
Sola schaute wieder zu Ryoo und Pooja hin. »Schau sie dir an. Ich sehe doch, wie deine Augen leuchten, wenn du meine Kinder ansiehst. Ich weiß, wie gern du sie hast«
»Aber selbstverständlich!«
»Hättest du nicht gerne eigene Kinder?«, fragte Sola. »Eine Familie?«
Padmé richtete sich auf, und ihre Augen wurden größer. »Ich …«, begann sie und hielt dann wieder inne. »Ich arbeite im Augenblick für etwas, an das ich zutiefst glaube. Für etwas, das mir wichtig ist.«
»Und wenn das erledigt ist, wenn dieses Gesetz verabschiedet oder abgelehnt worden ist, wirst du etwas anderes finden, an das du zutiefst glaubst, etwas, das wirklich wichtig ist. Etwas, das die Republik und die Regierung betrifft, aber nicht dich selbst.«
»Wie kannst du so etwas sagen?«
»Weil es wahr ist, und das weißt du auch. Wann wirst du einmal etwas nur für dich selbst tun?«
»Das tue ich doch.«
»Du weißt, was ich meine.«
Padmé lachte leise, schüttelte den Kopf und wandte sich wieder Ryoo und Pooja zu. »Ist das immer so, dass Menschen mit Kindern sich gar nichts anderes vorstellen können?«, fragte sie.
»Selbstverständlich nicht«, erwiderte Sola. »Aber darum geht es nicht. Oder nicht nur. Ich rede hier von Größerem, Schwesterchen. Du verschwendest all deine Zeit damit, dir wegen anderer Leute Probleme Gedanken zu machen, über die Streitigkeiten zweier Planeten, oder ob diese Kaufmannsgilde jenes System gerecht behandelt. Deine ganze Energie geht darin auf, das Leben anderer zu verbessern.«
»Was ist daran falsch?«
»Was ist mit deinem Leben?«, fragte Sola ganz ernst. »Was ist mit Padmé Amidala? Hast du je auch nur daran gedacht, was dein Leben verbessern könnte? Ich weiß, dass du gerne anderen hilfst. Das ist offensichtlich. Aber gibt es nicht noch etwas, was tiefer geht? Was ist mit der Liebe? Ja, und was ist mit Kindern? Hast du je auch nur daran gedacht? Hast du dich je gefragt, wie es sein würde, dich niederzulassen und an die Dinge zu denken, die dein eigenes Leben erfüllter machen?«
Padmé wollte gerade sagen, dass sie kein noch erfüllteres Leben brauchte, aber dann hielt sie sich zu ihrer eigenen Verwunderung zurück. Irgendwie kamen ihr solche Worte im Augenblick hohl vor, während sie beobachtete, wie ihre Nichten im Garten hinter dem Haus tobten und gerade damit angefangen hatten, den armen R2-D2, Padmés Astromechdroiden, in ihr wildes Spiel einzubeziehen.
Zum ersten Mal seit Tagen lösten sich Padmés Gedanken von ihrer Verantwortung, von der wichtigen Abstimmung, an der sie im Senat in weniger als einem Monat teilnehmen musste. Irgendwie drangen die Worte »Gesetz über die Aufstellung einer Armee« nicht durch das alberne kleine Lied, das Ryoo und Pooja über R2-D2 erfanden.
»Das war zu nahe«, sagte Owen ernst zu Cliegg, als die beiden noch einmal die Schutzvorrichtungen der Farm überprüften. Das Brüllen eines Bantha, eines dieser großen zottigen Tiere, die häufig von den Tusken als Reittier benutzt wurden, hatte ihr Gespräch unterbrochen.
Sie wussten beide, wie unwahrscheinlich es war, dass sich ein wilder Bantha hier herumtrieb, denn in der Nähe der trostlosen Feuchtfarm gab es kaum Futter für ein Tier. Aber sie hatten den Ruf gehört und eindeutig erkannt, und daher nahmen sie an, dass sich Feinde ganz in der Nähe befanden.
»Was treibt sie so nah zu den Farmen?«, fragte Owen.
»Es ist lange her, seit wir gegen sie vorgegangen sind«, erwiderte Cliegg barsch. »Wir lassen diese Bestien frei herumlaufen, und dann vergessen sie, dass wir ihnen in der Vergangenheit beigebracht haben, sich fernzuhalten.« Owens skeptische Miene verärgerte ihn nur noch mehr. »Du musst den Tusken hin und wieder Manieren beibringen. Du stellst einen Trupp zusammen und jagst sie und bringst sie um, und die, die davonkommen, werden sich an die Grenzen erinnern, die du gezogen hast. Sie sind wie wilde Tiere, sie brauchen die Peitsche, und zwar oft!«
Owen stand nur da und antwortete nicht.
»Siehst du, wie lange es schon her ist?«, sagte Cliegg mit einem Schnauben. »Du kannst dich schon nicht mehr daran erinnern, wann wir die Tusken zum letzten Mal gescheucht haben! Und genau das ist das Problem!«
Wieder brüllte der Bantha.
Cliegg knurrte leise in die Richtung, aus der das Brüllen gekommen war, dann winkte er ab und ging zum Haus zurück. »Sorg dafür, dass Beru einige Zeit drin bleibt«, wies er seinen Sohn an. »Ihr bleibt innerhalb des Sicherheitszauns und achtet darauf, dass ihr immer einen Blaster dabei habt.« Owen nickte und folgte seinem Vater zum Haus. Gerade, als sie die Tür erreichten, brüllte der Bantha wieder.
Diesmal schien er näher an der Farm zu sein.
»Was ist denn los?«, fragte Shmi, die sofort gemerkt hatte, dass etwas nicht in Ordnung war.
Ihr Mann blieb stehen, und es gelang ihm, ein halbwegs beruhigendes Lächeln aufzusetzen. »Nur der Sand«, sagte er. »Er hat ein paar Sensoren verschüttet, und ich habe langsam genug davon, die Dinger immer wieder auszugraben.« Jetzt grinste er noch breiter und ging auf den Flur zum Badezimmer zu.
»Cliegg …«, rief Shmi ihm misstrauisch hinterher, und er blieb stehen.
Nun kam auch Owen herein, und Beru sah ihn an. »Was ist denn los?«, fragte sie und wiederholte damit unbewusst Shmis Worte.
»Gar nichts. Alles in Ordnung«, erwiderte Owen, aber als er durchs Zimmer ging, trat ihm Beru in den Weg, packte ihn an den Oberarmen und zwang ihn, sie direkt anzusehen. Sie war zu ernst geworden, als dass er ihre Sorge einfach mit einem Scherz abtun konnte.
»Anzeichen eines Sandsturms«, log Cliegg. »Weit entfernt und wahrscheinlich ungefährlich.«
»Aber jetzt schon schlimm genug, um ein paar Sensoren zu verschütten?«, wollte Shmi wissen.
Owen sah sie neugierig an, dann hörte er, wie Cliegg sich räusperte. Er warf seinem Vater einen Blick zu. Cliegg nickte, und Owen wandte sich wieder Shmi zu und bestätigte Clieggs Worte: »Die ersten Böen. Aber ich glaube nicht, dass er so heftig wird, wie Vater denkt.«
»Wie lang wollt ihr eigentlich noch dastehen und uns anlügen?«, fauchte Beru plötzlich und kam Shmi damit nur um Sekundenbruchteile zuvor.
»Was hast du gesehen, Cliegg?«, wollte Shmi wissen.
»Nichts«, antwortete er, so überzeugend er konnte.
»Dann hast du also etwas gehört«, drängte Shmi weiter, die die Ausweichmanöver ihres Mannes gut genug kannte.
»Ich habe einen Bantha gehört, nichts weiter«, gab Cliegg zu.
»Und du glaubst, dass da draußen Tusken sind«, schloss Shmi. »Wie weit entfernt?«
»Wer könnte das in der Nacht und bei diesem Wind schon sagen? Es könnte kilometerweit entfernt sein.«
»Oder?«
Cliegg kam wieder zurück ins Zimmer und baute sich direkt vor seiner Frau auf. »Was soll ich denn noch alles wissen, Liebes?«, fragt er und umarmte sie fest. »Ich habe einen Bantha gehört. Ich weiß nicht, ob ein Tusken draufsaß.«
»Aber es hat in der letzten Zeit mehr Anzeichen von Banditen gegeben«, gab Owen zu. »Die Dorrs haben einen Haufen Banthadung gefunden, der einen ihrer Grenzsensoren bedeckte.«
»Es ist gut möglich, dass einfach ein paar halb verhungerte wilde Banthas da draußen rumrennen«, meinte Cliegg.
»Oder vielleicht werden die Tusken auch wieder dreister und kommen direkt an die Grenzen der Höfe, um nachzusehen, wie gut die Sicherheitseinrichtungen sind.« Das hätte eine Prophezeiung sein können, denn gerade, als Shmi den Satz zu Ende gesprochen hatte, ging der Alarm los und zeigte an, dass etwas den Sicherheitszaun durchbrochen hatte.
Owen und Cliegg griffen nach ihren Blastergewehren und rannten aus dem Haus, dicht hinter ihnen Shmi und Beru.
»Ihr bleibt hier!«, wies Cliegg die beiden Frauen an. »Oder bewaffnet euch wenigstens!« Er sah sich um, zeigte Owen mit dem Finger die Richtung an, in die sie gehen würden, und bedeutete ihm dann, ihm Deckung zu geben.
Und dann rannte er im Zickzack und geduckt über den Hof, den Blaster in der Hand, und hielt nach verdächtigen Bewegungen Ausschau. Falls er etwas entdecken sollte, das auch nur annähernd nach Tusken oder Bantha aussah, würde er erst schießen und die Fragen später stellen.
Aber dazu kam es nicht. Cliegg und Owen suchten die gesamte Grenzlinie ab und überprüften die Sensoren. Sie fanden kein Anzeichen dafür, dass etwas eingedrungen war.
Alle vier blieben den Rest der Nacht wachsam und unruhig und achteten darauf, dass sie stets eine Waffe in der Nähe hatten. Sie schliefen nur abwechselnd.
Am nächsten Tag fand Owen draußen an der Ostgrenze, was den Alarm ausgelöst hatte: Ein Fußabdruck nahe einer Stelle mit festerem Boden am Rand der Farm. Es war keiner der großen, runden Abdrücke, wie ihn ein Bantha hinterlassen würde, sondern der eines Fußes, der mit weichem Material umwickelt war – genau, wie es die Tusken taten.
»Wir sollten mit den Dorrs und allen anderen reden«, sagte Cliegg, als Owen ihm den Fußabdruck zeigte. »Dann stellen wir einen Trupp zusammen und treiben diese Bestien wieder in die offene Wüste zurück.«
»Die Banthas?«
»Die auch«, zischte Cliegg und spuckte auf den Boden. Noch nie hatte Owen seinen Vater so zornig und entschlossen gesehen.
Senatorin Padmé Amidala war in ihrem Büro, das sich auf dem Palastgelände befand, wenn auch nicht im gleichen Gebäude wie die Gemächer von Königin Jamillia. Aus irgendeinem Grund, der ihr selbst nicht ganz klar war, fühlte sie sich unbehaglich. Ihr Schreibtisch war mit Holodisketten und all dem anderen Durcheinander übersät, das ihr Amt mit sich brachte. Ganz vorn am Rand der Tischplatte wurde ein Holo projiziert, das eine Waage darstellte. Ein Soldat in einer Waagschale, eine Waffenstillstandsfahne in der anderen zeigten die Prognosen für die Abstimmung auf Coruscant an. Die Waagschalen befanden sich beinahe vollkommen im Gleichgewicht.
Padmé wusste, das Abstimmungsergebnis würde knapp ausfallen, da der Senat über die Frage, ob die Republik eine offizielle Armee aufstellen sollte oder nicht, beinahe genau in zwei Hälften gespalten war. Es ärgerte sie zu wissen, dass sich so viele ihrer Kollegen bei der Abstimmung von ihren Aussichten auf persönliche Bereicherung beeinflussen lassen würden – von möglichen Versorgungsverträgen für ihre Heimatsysteme bis zu direkter Bestechung durch jene Systeme, die sich von der Republik separieren wollten –, statt danach zu gehen, was das Beste für die Republik war.
Padmé war fest entschlossen, sich der Aufstellung dieser Armee entgegenzustellen. Die Republik basierte auf Toleranz. Sie bildete ein ausgedehntes Netz von tausenden von Systemen und noch mehr Spezies, von denen alle über eine unterschiedliche Perspektive verfügten. Das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war Toleranz – Toleranz gegenüber jenen, die anders waren. Viele Spezies, die weit entfernt von dem Stadtplaneten Coruscant lebten, würden die Aufstellung einer Armee als beunruhigend, wenn nicht sogar als bedrohlich empfinden.
Draußen wurde es plötzlich unruhig, und Padmé ging ans Fenster und schaute in den Hof hinab. Dort waren Zivilisten und Sicherheitskräfte in ein Handgemenge verstrickt, während weitere Palastwachen rasch herbeieilten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Dann klopfte es laut an ihrer Bürotür, und noch während Padmé sich der Tür zuwandte, glitt diese auf und Captain Panaka kam herein.
»Ich wollte nur nach Euch sehen, Senatorin«, erklärte der Mann, der ihre Leibwache befehligt hatte, als sie noch Königin gewesen war. Captain Panaka war ein hoch gewachsener dunkelhäutiger Mann mit stählernem Blick und athletischem Körperbau, der von dem Schnitt seines braunen Lederwamses, des blauen Hemds und der blauen Hose nur noch betont wurde. Schon sein Anblick bewirkte, dass Padmé sich sicherer fühlte. Panaka hatte inzwischen die vierzig überschritten, aber er sah immer noch aus, als könnte er es mit jedem auf Naboo aufnehmen.
»Solltet Ihr Euch nicht um die Sicherheit von Königin Jamillia kümmern?«, fragte sie.
Panaka nickte. »Sie ist gut geschützt, das versichere ich Euch.«
»Vor wem müssen wir eigentlich geschützt werden?«, wollte Padmé wissen und deutete zu dem Fenster, das auf den Hof blickte, wo die Auseinandersetzungen weitergingen.
»Gewürzbergleute«, erklärte Panaka. »Vertragsangelegenheiten. Nichts, was Euch beunruhigen sollte, Senatorin. Tatsächlich war ich ohnehin auf dem Weg zu Euch, um mit Euch über die Sicherheitsmaßnahmen für Euren Flug nach Coruscant zu sprechen.«
»Das wird erst in ein paar Wochen sein.«
Panaka schaute zum Fenster. »Dann haben wir genügend Zeit, uns angemessen vorzubereiten.«
Padmé versuchte erst gar nicht, sich mit diesem störrischen Mann anzulegen. Da sie ein offizielles Schiff der Sternenflotte von Naboo fliegen würde, hatte Panaka das Recht, wenn nicht sogar die Pflicht, sich einzumischen. Und tatsächlich freute sie sich über seine Fürsorge, selbst wenn sie das niemals offen zugegeben hätte.
Ein Schrei draußen und ein erneutes Aufflammen der Kämpfe lenkten ihre Aufmerksamkeit kurz ab. Sie verzog das Gesicht. Noch ein Problem. Es gab immer irgendwo ein Problem. Padmé fragte sich, ob es nicht einfach in der Natur von Lebewesen lag, immer dann, wenn alles eigentlich recht gut aussah, irgendwo Aufruhr zu stiften. Bei diesem beunruhigenden Gedanken fiel ihr ihr Gespräch mit Sola wieder ein, und vor ihrem geistigen Auge sah sie Ryoo und Pooja. Wie sie diese beiden sorglosen kleinen Racker liebte!
»Senatorin?«, sagte Panaka und riss sie damit aus ihren Grübeleien.
»Ja?«
»Wir sollten jetzt über die Sicherheitsmaßnahmen sprechen.«
Es tat Padmé in diesem Augenblick regelrecht weh, sich von dem Gedanken an ihre Nichten loszureißen, aber dann nickte sie und rang sich wieder zu einer verantwortungsvolleren Haltung durch. Captain Panaka hatte gesagt, sie müssten über Sicherheitsvorkehrungen sprechen, und genau das würde Padmé Amidala nun tun.
»Wir hätten sie schon lange umbringen sollen, und zwar alle!«, knurrte Cliegg und knallte den Teller auf den Tisch.
Wieder einmal brachten ihnen mehrere Banthas ein Ständchen, und keiner der vier im Haus zweifelte mehr daran, dass die Tusken dort draußen waren, nicht weit von der Farm, und vielleicht sogar die Lichter beobachteten.
»Sie sind wie wilde Tiere, und wir hätten schon lange die Behörden von Mos Eisley veranlassen sollen, sie auszurotten wie Ungeziefer. Denn nichts anderes sind sie, die Tusken und die stinkenden Jawas!«
Shmi seufzte und legte ihrem Mann die Hand auf den Unterarm. »Die Jawas haben uns geholfen«, erinnerte sie ihn sanft.
»Dann sollen die Jawas eben am Leben bleiben!«, brüllte Cliegg, und Shmi zuckte zusammen. Als ihr Mann ihre entsetzte Miene bemerkte, nahm er sich sofort wieder zusammen. »Tut mir Leid. Dann sollen die Jawas eben am Leben bleiben. Aber die Tusken – sie töten und stehlen, wann immer sie können. Von denen kommt nichts Gutes!«
»Wenn sie versuchen, hier einzudringen, werden am Ende schon weniger übrig sein, die wir in die Wüste zurückjagen müssen«, warf Owen ein, und Cliegg nickte zustimmend.
Sie versuchten weiterzuessen, aber jedes Mal, wenn ein Bantha brüllte, spannten sich alle an und legten die Hände an die Blaster.
»Hört doch«, sagte Shmi plötzlich, und sie wurden alle vollkommen still und spitzten die Ohren. Draußen war alles ruhig geworden: kein Laut mehr von den Banthas.
»Vielleicht sind sie nur in der Nähe vorbeigezogen«, sagte Shmi, als sie sicher sein konnte, dass die anderen es ebenfalls bemerkt hatten. »Auf dem Weg zurück in die offene Wüste, wo sie hingehören.«
»Wir werden morgen zu den Dorrs gehen«, sagte Cliegg zu Owen. »Wir werden alle Farmer zusammentrommeln, und vielleicht werden wir uns auch an Mos Eisley wenden.« Er sah Shmi an und nickte. »Nur, um ganz sicherzugehen.«
»Morgen früh«, bestätigte Owen.
Am nächsten Tag brachen Owen und Cliegg im Morgengrauen auf, noch vor dem Frühstück, denn Shmi hatte das Haus schon vor ihnen verlassen, wie sie es häufig morgens tat, um an den Verdampfungsanlagen Pilze zu suchen.
Sie erwarteten, ihr auf dem Weg zur Farm der Dorrs zu begegnen, aber stattdessen fanden sie nur ihre Fußspuren, umgeben von den Abdrücken vieler anderer – den weichen Stiefel der Tusken.
Cliegg Lars, einer der stärksten und zähsten Männer in der Region, fiel auf die Knie und weinte.
»Wir werden sie zurückholen«, erklang plötzlich eine feste Stimme.
Cliegg blickte über die Schulter und sah seinen Sohn – kein Junge mehr, sondern ein Mann mit grimmiger, entschlossener Miene.
»Sie ist am Leben, und wir werden sie ihnen nicht überlassen«, erklärte Owen mit ungewöhnlicher, beinahe übernatürlicher Ruhe.
Cliegg wischte sich die letzten Tränen ab und starrte seinen Sohn an, dann nickte er. »Sag den Nachbarn Bescheid.«
Drei
Da sind sie!«, rief Sholh Dorr und zeigte geradeaus, ohne die Geschwindigkeit seines Speederrads zu verlangsamen.
Die anderen Neunundzwanzig folgten mit den Blicken seinem ausgestreckten Arm und entdeckten weit entfernt eine Staubwolke, wie sie mehrere Banthas aufwirbeln würden. Unter lautem Kampfgeschrei eilten die zornigen Farmer weiter, entschlossen, Rache zu üben, entschlossen, Shmi Skywalker zu retten, wenn sie noch am Leben war.
Mit brüllenden Triebwerken und Schreien nach Rache rasten sie in die Senke hinab und holten die Banthas rasch ein.
Cliegg beschleunigte noch mehr, knurrte vor sich hin, als wollte er die Motoren anflehen, ihm noch mehr Schub zu geben. Dicht gefolgt von Owen zog er den Speeder von der linken Flanke in die Mitte der Formation, dann beugte er sich vor und gab vollen Schub. Er wollte die Anführer der Tusken erwischen. Ja, Cliegg wollte mitten im Getümmel sein, wollte seine kräftigen Hände fest um eine Tuskenkehle schließen.
Nun waren die Banthas mit ihren Reitern in den wehenden Gewändern schon deutlich zu erkennen.
Wieder erklangen Rufe nach Rache.
Aber sie wurden rasch zu Schreien des Entsetzens.
Denn die Anführer des Farmertrupps rasten buchstäblich kopflos weiter, nachdem ihre Speeder einen Draht passiert hatten, der tückisch in Halshöhe eines Mannes auf einem Speederrad gespannt worden war.
Auch Cliegg schrie voller Schrecken auf, als er zusehen musste, wie mehrere seiner Freunde geköpft und andere schwer verwundet von ihren Speedern gerissen wurden. Er wusste, auch für ihn war es zu spät auszuweichen, und es war reiner Instinkt, der ihn veranlasste, hoch zu springen, sich mit einem Fuß auf den Sitz des Speeders zu stellen, dann noch einmal zu springen.
Er spürte sengenden Schmerz und überschlug sich. Dann prallte er auf dem Boden auf und rutschte ein Stück weiter.
Die Welt rings um ihn her verschwamm in einem hektischen Wirbel. Er sah die Stiefel anderer Farmer, hörte, wie Owen nach ihm rief, aber es kam ihm so vor, als wäre sein Sohn weit, weit entfernt.
Er sah die Lederbänder eines Tuskenstiefels, das sandfarbene Gewand, und mit einer Wut, die selbst der Sturz nicht hatte mildern können, packte Cliegg das Bein des laufenden Banditen.
Er blickte auf und riss den Arm hoch, um den Stockhieb seines Gegners abzufangen. In seiner Wut spürte er den Schmerz kaum, schob sich vorwärts und schlang die Arme nun um beide Beine des Tusken und riss ihn zu Boden. Er kroch auf seinen Gegner, drosch mit starken Händen auf ihn ein und fand dann, wonach er gesucht hatte.
Schmerzensschreie von Freund und Feind gellten rings um ihn, aber Cliegg hörte sie kaum. Er hatte die Hände fest an der Kehle des Tusken und drückte nun mit all seiner beträchtlichen Kraft zu; er riss den Kopf des Tusken hoch und stieß ihn dann in den Sand, wieder und wieder; er drückte und stieß weiter, auch als der Tusken sich schon lange nicht mehr wehrte.
»Dad!«
Der Ruf riss Cliegg aus seiner Wut. Er ließ den Tusken zu Boden sacken und drehte sich um, sah Owen im Kampf mit einem weiteren Banditen.
Cliegg drehte sich um und wollte aufstehen, zog das Bein unter sich, bewegte sich schwungvoll.
Und lag wieder am Boden, unerwartet aus dem Gleichgewicht geraten. Verwirrt schaute er nach unten und ging davon aus, dort einen anderen Tusken zu sehen, der ihn zu Fall gebracht hatte. Aber dann erkannte er, dass ihn sein eigener Körper im Stich gelassen hatte.
Erst jetzt begriff Cliegg Lars, dass er bei seinem Sprung vom Speederrad ein Bein verloren hatte.
Überall war Blut, strömte rasch aus den Wunden. Mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen umklammerte Cliegg sein Bein.
Er schrie nach Owen. Er schrie verzweifelt nach Shmi.
Ein Speeder raste an ihm vorbei – ein Farmer, der vor dem Massaker floh –, wurde aber nicht einmal langsamer.
Cliegg versuchte, abermals zu rufen, aber kein Laut kam mehr aus seinem Mund. Das Wissen, dass er versagt hatte und dass nun alles verloren war, schnürte ihm die Kehle zu.
Dann kam ein zweites Speederrad vorbei und bremste ruckartig. Cliegg packte zu, und bevor er sich noch in eine bessere Position bringen konnte, bevor er sich hochziehen konnte, raste der Speeder weiter und zerrte ihn mit.
»Halt dich fest, Dad!«, schrie Owen, der Fahrer, ihm zu.
Das tat Cliegg. Mit derselben Sturheit, die ihn durch alle schweren Zeiten auf der Feuchtfarm gebracht hatte, derselben wilden Entschlossenheit, die es diesem Mann ermöglicht hatte, sich den unwirtlichen Boden von Tatooine untertan zu machen, klammerte Cliegg Lars sich fest.
Es ging um sein Leben. Aber was noch wichtiger war: Sein Überleben war auch für Shmi die einzige Chance, gerettet zu werden. Die Tusken hetzten sie weiter, aber Cliegg Lars ließ nicht los.
Oben auf dem Kamm angekommen, hielt Owen den Speeder an und sprang ab. Er band das zerfetzte Bein seines Vaters so gut ab, wie es ihm in der kurzen Zeit möglich war, dann legte er Cliegg, der rasch schwächer wurde, quer über den Speeder.
Mit vollem Schub floh er weiter. Er wusste, er musste seinen Vater in Sicherheit bringen, und zwar schnell. Die Wunde musste unbedingt gereinigt und verbunden werden.
Erst jetzt fiel ihm auf, dass nur noch zwei weitere Speeder in Sicht waren, die ebenfalls flohen, und dass er in all dem Lärm hinter sich nicht einen einzigen Speedermotor hören konnte.
Dann schob er seine Verzweiflung beiseite. Die gleiche grimmige Entschlossenheit, die seinen Vater weitergetrieben hatte, bestimmte nun auch Owens Handlungen. Er dachte nicht mehr an die vielen Freunde, die er verloren hatte, dachte nicht mehr an die Wunden seines Vaters – jetzt zählte nur noch, sein Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.
»Das sind keine guten Nachrichten«, stellte Captain Panaka fest.
»Wir hatten ja schon länger befürchtet, dass Graf Dooku und seine Separatisten um die Handelsföderation und die diversen Kaufmannsgilden buhlen würden.« Padmé ließ sich nicht erschüttern. Panaka war mit Captain Typho, seinem Neffen, zu ihr gekommen, um zu berichten, dass die Neimoidianer und ihre Handelsföderation sich mit der Separatistenbewegung zusammengeschlossen hatten, die nun drohte, die Republik zu spalten.
»Vizekönig Gunray ist ein Opportunist«, fuhr sie fort. »Er tut das, wovon er sich finanziellen Nutzen verspricht. Seine Loyalität hört da auf, wo sein Geldbeutel in Mitleidenschaft gezogen wird. Graf Dooku muss ihm gute Handelsverträge angeboten haben; vermutlich kann er seine Waren produzieren, ohne sich um Arbeiter und Umwelt zu kümmern. Vizekönig Gunray hat mehr als einen Planeten als tote Steinkugel zurückgelassen. Oder vielleicht hat Graf Dooku der Handelsföderation die vollständige, wettbewerbsfreie Beherrschung lukrativer Märkte versprochen.«
»Ich mache mir mehr Sorgen darum, was das für Euch bedeuten könnte, Senatorin«, sagte Panaka, was ihm einen neugierigen Blick seiner Schutzbefohlenen einbrachte.
»Die Separatisten haben schon mehrmals gezeigt, dass sie vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken«, erklärte er. »Es hat überall in der Republik Attentate gegeben.«
»Aber würden Graf Dooku und die Separatisten Senatorin Amidala zu diesem Zeitpunkt nicht beinahe als Verbündete betrachten?«, wandte Captain Typho ein, und sowohl Panaka als auch Padmé starrten den üblicherweise sehr wortkargen Mann überrascht an.
Padmés Blick wurde rasch zu einem zornigen Starren, und in ihren liebenswerten Zügen zeigte sich so etwas wie Aggressivität. »Ich werde nie die Verbündete einer Bewegung sein, die die Republik auflösen will, Captain«, erklärte sie nachdrücklich, und ihr Tonfall ließ keinen Raum für Diskussionen – nicht, dass es ansonsten welche gegeben hätte. In ihren wenigen Jahren als Senatorin hatte sich Amidala als eine der loyalsten und mächtigsten Befürworterinnen der Republik erwiesen, eine Politikerin, die entschlossen war, das System zu verbessern, aber innerhalb des Rahmens der Verfassung der Republik. Senatorin Amidala war immer der Ansicht gewesen, dass die wahre Schönheit des derzeitigen Regierungssystems in seiner Fähigkeit zur Verbesserung bestand.
»Selbstverständlich, Senatorin«, sagte Typho und verbeugte sich. Er war kleiner als sein Onkel, aber kräftig gebaut; Muskeln spannten die blauen Ärmel seiner Uniform, und die Brust unter dem braunen Lederhelm wirkte fest und breit. Er trug eine lederne Augenklappe über der linken Augenhöhle, denn er hatte vor zehn Jahren bei der Schlacht gegen genau jene Handelsföderation, von der sie gerade gesprochen hatten, ein Auge verloren. Er war damals noch ein Junge gewesen, hatte sich aber tapfer geschlagen und seinen Onkel Panaka sehr stolz gemacht. »So hatte ich es auch nicht gemeint. Aber was die Aufstellung einer Armee der Republik angeht, habt Ihr Euch immer für Verhandlungen ausgesprochen und Gewaltanwendung strikt abgelehnt. Würden die Separatisten das nicht begrüßen?«
Nachdem Padmé ihren anfänglichen Zorn beiseite geschoben und über sein Argument nachgedacht hatte, musste sie zugeben, dass er Recht haben könnte.
»Graf Dooku hat sich mit Nute Gunray zusammengetan, heißt es in den Berichten«, warf Panaka ein. »Schon diese Tatsache verlangt, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen für Senatorin Amidala verstärken.«
»Hört auf, von mir zu sprechen, als ob ich gar nicht da wäre«, tadelte sie ihren Leibwächter, aber Panaka zuckte mit keiner Wimper.
»In Sicherheitsangelegenheiten, Senatorin, seid Ihr tatsächlich so gut wie nicht anwesend«, erwiderte er. »Zumindest zählt Eure Stimme hier nicht. Mein Neffe untersteht mir, und seine Befehle in dieser Sache könnt Ihr nicht unterlaufen. Er wird alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.«
Nach diesen Worten verbeugte sich Panaka knapp und ging hinaus, und Padmé verkniff es sich, ihn zu maßregeln. Er hatte ja Recht, und es war nur gut, dass er sie darauf hinwies. Sie wandte sich wieder Captain Typho zu.
»Wir werden wachsam sein, Senatorin.«
»Ich habe Pflichten, und diese Pflichten verlangen, dass ich schon bald nach Coruscant zurückkehre«, erklärte sie.
»Ich habe ebenfalls Pflichten«, versicherte ihr Typho, dann verbeugte er sich ebenso wie Panaka und ging.
Padmé Amidala sah ihm hinterher. Mit einem tiefen Seufzer erinnerte sie sich an Solas Worte. Sie fragte sich ehrlich, ob sie jemals Gelegenheit haben würde, dem Rat ihrer Schwester zu folgen – einem Rat, den sie im Augenblick seltsam verlockend fand. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie seit beinahe zwei Wochen weder Sola und ihre Kinder noch ihre Eltern gesehen hatte, nicht seit diesem Nachmittag mit Ryoo und Pooja im Garten hinter dem Haus.
Die Zeit verging viel zu schnell.
»Das Ding ist nicht schnell genug, um die Tusken einzuholen!«, rief Cliegg Lars wütend, als sein Sohn und seine zukünftige Schwiegertochter ihm in einen Repulsorsessel halfen, den Owen gebastelt hatte.
»Die Tusken sind lange weg, Vater«, sagte Owen Lars leise, und er legte die Hand auf Clieggs breite Schulter, um ihn zu beruhigen. »Wenn du kein Mech-Bein benutzen willst, muss es erst mal dieser Schwebesessel tun.«
»Ich werde nicht zulassen, dass du mich zu einem halben Droiden machst«, entgegnete Cliegg. »Dann nehme ich noch lieber den Sessel. Und jetzt brauchen wir mehr Männer«, fügte er hektisch hinzu und tastete automatisch nach dem Stumpf seines rechten Beins, das der Draht in der Mitte des Oberschenkels durchtrennt hatte. »Du gehst nach Mos Eisley und siehst zu, dass wir dort Hilfe bekommen. Und Beru kannst du zu den anderen Farmen schicken.«
»Sie werden uns nicht helfen können«, erwiderte Owen ehrlich. Er ging näher zu dem Sessel, beugte sich vor und sah Cliegg ins Gesicht. »Es wird Jahre dauern, bis sich die Farmen von dem Kampf erholt haben. Schon bei dem Angriff sind viele umgekommen, und noch mehr bei dem Rettungsversuch.«
»Wie kannst du so etwas sagen, wenn deine Mutter da draußen ist?«, tobte Cliegg Lars. Tief im Herzen wusste er, dass sein Sohn Recht hatte, aber das ließ ihn nur noch wütender werden.