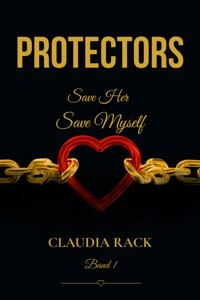Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gerade erst aus den Fängen ihrer Entführer befreit, muss Zoe Perkins feststellen, dass der Mann, der sie befreite, das Oberhaupt der Vampire ist. Gerard Thigaud ist autoritär, machtvoll, beherrscht und attraktiv. Er beansprucht sie für sich, doch Zoe verfolgt andere Pläne. Sie muss ihre Schwester retten. Um dieses Ziel zu erreichen, würde sie alles tun. Das Einzige, was ihr im Weg steht, sind ihre Gefühle. Gefangen zwischen ihren Zweifeln, begeht Zoe einen schwerwiegenden Fehler. Seine Strafe fällt hart aus. Erlösung kann Zoe nur finden, wenn er ihr vergeben kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis 1
Kapitel 1 2
Kapitel 2 11
Kapitel 3 19
Kapitel 4 32
Kapitel 5 42
Kapitel 6 52
Kapitel 7 61
Kapitel 8 68
Kapitel 9 77
Kapitel 10 86
Kapitel 11 97
Kapitel 12 109
Kapitel 13 118
Kapitel 14 129
Kapitel 15 140
Kapitel 16 149
Kapitel 17 161
Kapitel 18 172
Kapitel 19 181
Kapitel 20 190
Kapitel 21 198
Kapitel 22 206
Kapitel 23 215
Kapitel 24 226
Kapitel 25 236
Kapitel 26 244
Kapitel 27 254
Kapitel 28 262
Kapitel 29 270
Kapitel 30 278
Kapitel 31 287
Kapitel 32 297
Kapitel 33 312
Kapitel 34 325
Kapitel 35 337
Kapitel 36 349
Danksagung 357
Kapitel 1
»Ist es erforderlich, dass du mir auf Schritt und Tritt folgst?« Zoe Perkins kräuselte die Stirn und brachte ihren Ärger zum Ausdruck. Sie warf einen Blick hinter sich, nur um festzustellen, dass Maxime ihr weiterhin folgte. Seitdem Gerard in Paris weilte, oblag es Maxime, sich um ihre Sicherheit zu kümmern. Er hatte nicht zu viel versprochen, als er sagte, dass sie sich frei bewegen konnte. Allerdings hatte er mit keinem Wort erwähnt, dass sie nicht ohne Begleitung das Hotel verlassen durfte. Ihr Unmut wuchs. Energisch lief sie die 5th Avenue in Manhattan entlang, um zu ihrem Buchladen zu kommen. Ihr langes schwarzes Haar hatte sie zu einem Zopf zusammen gebunden. Da es merklich kälter wurde und der Winter in großen Schritten nahte, trug sie einen dunklen Parka und dunkle, eng anliegende Jeans. Ihre Füße wurden von den kniehohen schwarzen Stiefeln gewärmt. Mit jedem Ausatmen bildete sich eine neue weiße Wolke um ihren Mund. Seit Monaten war sie nicht mehr in ihrem Buchladen gewesen. Zoe mochte sich nicht vorstellen, was das für ihre Kunden bedeutete. Mit ihrer Entführung durch Professor Allan Douglas war sie von einem Moment auf den anderen verschwunden. Ohne eine Erklärung für ihre Kundschaft, weshalb der Laden geschlossen war. Mit Pech hatte sie damit den Großteil ihrer Kunden verloren. Was das für ihre Einnahmen bedeutete, wollte sie nicht wissen. Als sie den Buchladen vor zwei Jahren vom Vorbesitzer übernahm, schrieb sie noch rote Zahlen. Sie war kurz davor, Gewinn zu erzielen, als der Professor sie aus ihrem Leben riss. Verärgert beschleunigte sie ihren Schritt. Sie wünschte sich, sie könnte die Zeit zurückdrehen. Kein Wunder, dass sie missgelaunt war. Alles entglitt ihr. Hatte sie vor einigen Monaten noch ein bescheidenes Leben geführt, mit dem sie sich wohlfühlte, war davon heute nichts mehr übrig. Als die Bilder in ihrem Kopf Gestalt annahmen und sie die Erinnerungen an ihre Gefangenschaft aufblitzen ließ, fröstelte es sie. Sie hatte geglaubt, sie würde niemals mehr in ihr altes Leben zurückkehren können. So abwegig war das nicht. Mit dem Auftauchen von Gerard Thigaud, der sie befreite, veränderte sich alles. Zoe tauschte ein Gefängnis mit einem anderen. Sicher, Gerard wollte sie beschützen. Das betonte er immer wieder. Zoe war nicht so dumm, zu glauben, dass es nur das war, was er von ihr wollte. Die Tatsache, dass er sie hatte erstarren lassen, damit er sie mitnehmen konnte, sprach für sich. Er war ein Vampir. Ohne Zweifel. Genauso wie Maxime, die hinter ihr herlief und sie nicht aus den Augen ließ. Zoe fragte sich, was sie für Fähigkeiten besaß. Konnte sie ebenfalls Menschen erstarren lassen? Zoe warf ihr einen skeptischen Blick entgegen, bevor sie weiter vorwärtslief. Obwohl sie froh war, dass sie dem Professor entkam, hatte sie keine Ahnung, was sie tun sollte. Sie hasste es, unter Beobachtung zu stehen. Hinzu kam, dass Gerard anders war, als sie angenommen hatte. Er benahm sich wie ein Gentleman, zumindest wenn er nicht gerade Befehle erteilte oder wütend war. Er strahlte eine Autorität aus, die sie jetzt noch erschauern ließ. Dennoch musste Zoe zugeben, dass sie ständig an ihn denken musste. Sie dachte oft an sein seltsames Verhalten, als er in ihr Zimmer kam. Er hatte geweint. Zoe schüttelte verständnislos den Kopf, als sie daran zurückdachte. Wieso? Dieser Augenblick hatte sie aufgewühlt. Sie hatte es sich nicht anmerken lassen, aber tief in ihrem Inneren hatte er sie überrumpelt. Sobald sie vor ihrem Buchladen ankam, blieb sie stehen und schaute sich das Gebäude von außen an. Kein Licht brannte. Der Laden wirkte verlassen. Zoe hatte niemanden beauftragen können, der sich in ihrer Abwesenheit darum kümmerte und den Laden aufschloss. Sie verzog mürrisch den Mund und kramte den Schlüssel aus ihrer Jackentasche hervor. Die Türglocke erklang, sobald sie die Tür aufstieß und ins Innere trat. Nachdem sie das Licht einschaltete, atmete sie erleichtert aus. Der bekannte Geruch, der ihr hier entgegenschlug, beruhigte sie. Es roch nach den Duftkerzen, die sie zuletzt angezündet hatte. Es war eine Mischung aus Orange und Zimt. Zoe atmete tief ein und schloss für einen Moment die Augen. Das Rascheln hinter ihr unterbrach sie. Maxime trat ein und stellte sich in die Mitte des Raumes. Ihr Blick inspizierte den Buchladen. Sie trug ihre langen blonden Haare offen. Der schwarze Ledermantel verdeckte ihre schlanke Figur und reichte ihr bis zu den Knöcheln. Zoe wusste, dass sie darunter einen schwarzen Neoprenanzug trug. Sie hatte Maxime skeptisch angesehen, als sie sie beobachtete, wie sie ihn überzog. Maxime hatte sie nur angelächelt und nichts weiter gesagt. Zoe vermutete, dass es eine Art Kampfanzug war, den Maxime trug, wenn sie auf Missionen war. Zumindest war das für sie die einzige Erklärung dafür, weshalb Maxime so etwas anziehen sollte. Nachdem Maxime sich umgesehen hatte, schien sie überzeugt davon, dass ihnen hier keine Gefahr drohte. Zoe rollte mit den Augen und zog ihren Parka aus. Als ob in ihrem Buchladen jemand auf sie wartete, der über sie herfallen würde.
»So langsam fühle ich mich, wie eine VIP Person«, sagte sie zu Maxime. Zoe ging zum Tresen, auf dem die Kasse stand und suchte nach einem bestimmten Buch. Als Erstes wollte sie sich einen Überblick über die Zahlen verschaffen. Sie musste einiges aufholen, wusste sie. Sie glaubte nicht, dass sie den Buchladen heute öffnen konnte. Sie hoffte darauf, dass in spätestens zwei Tagen alles, soweit aufbereitet war, sodass die Kunden eintreten konnten. Zoe schlug das Buch auf, in dem die Statistik über ihre Einnahmen stand. Sie seufzte tief, als ihr schnell klar wurde, dass sie zu viel Zeit verloren hatte. Wie sollte sie das aufholen?
»Du bist Gerard wichtig«, sagte Maxime. Sie trat zu ihr an den Tresen und stützte ihre Unterarme darauf ab, um sich zu ihr vorzubeugen. Dabei erhaschte Zoe einen Blick auf ihr Amulett. Kurz starrte sie es neugierig an, bis sie sich auf ihre Zahlen konzentrierte. Der Professor hatte ihr erklärt, was es mit diesem Amulett auf sich hatte. Das behielt sie für sich. Niemand von ihnen wusste, dass Zoe mehr darüber wusste, als sie ihnen glauben ließ.
»Das heißt noch lange nicht, dass ich einen Bodyguard benötige, Maxime. Ich kann gut auf mich aufpassen«, antwortete sie zerknirscht.
»Das haben wir gesehen«, grinste Maxime. »Du wärst immer noch in deiner Zelle, wenn Gerard dich nicht raus geholt hätte. Gerard beschützt, was ihm wichtig ist.« Maxime sah sie eingehend an, bevor sie sich umdrehte und ihren Blick auf die Inneneinrichtung legte. Mit den Ellenbogen am Tresen abstützend, kaute sie auf ihrem Kaugummi herum. »Nett hast du es hier«, sagte sie anerkennend. »Und du bist dir sicher, dass dieser Laden deine Bestimmung sein soll?«
Zoe schnaufte wütend und schüttelte daraufhin den Kopf. Sie musste sich zwingen, ihre Gedanken nicht laut auszusprechen. Sie würde es nicht verstehen. Der Buchladen war ihr heilig. Kurz fragte sie sich, ob Vampire Bücher lasen? Ihr Buchladen führte sowohl Neuerscheinungen als auch echte Raritäten. Es gab einige Kunden, die einzig wegen dieser Antiquitäten ihren Laden frequentierten. Zoe ersparte es sich, Maxime eine Erklärung abzugeben. Sie blickte sich um. Auf der linken Seite hatte sie die Antiquitäten, ihre sogenannten Schätze, angeordnet. Zwei meterhohe Regale standen dort. In der Mitte waren die Regale mit den aktuellen Neuerscheinungen. Und rechts von ihr verkaufte sie ältere Bücher, nach dem jeweiligen Genre sortiert. In der Mitte des Ladens hatte sie einen kleinen runden Tisch gestellt, daneben zwei gemütliche dunkelrote Sessel, die zum Verweilen einluden. Sie konnte über ihren Onlinehandel Exemplare ordern, sofern ein Kunde einen speziellen Wunsch hatte. Alles in allem war es ein nettes, kleines Buchgeschäft. Jeder, der ihren Buchladen kannte, kannte somit ihren Vornamen. Ihr Laden hieß nicht umsonst »Zoe´s Book Store«.
Maxime schlenderte zu einen der Sessel und ließ sich hinein plumpsen. Sie öffnete den Ledermantel und überschlug ein Bein übers andere. Ihre Hände drapierte sie auf den Armlehnen. »Ich bin nicht sicher, was Gerard hiervon halten wird, Zoe. Es könnte sein, dass er dich mit nach Paris nehmen möchte. Hast du daran gedacht?«
Zoe vermied es, Maxime direkt anzusehen. Natürlich war ihr der Gedanke gekommen. Allerdings konnte sie nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Außerdem hatte sie nicht vor, mit Gerard mitzugehen. Wieso sollte sie das tun? Das ihr noch ein ernstes Gespräch mit Gerard bevorstand, stand für sie außer Frage. »Das bespreche ich eher mit Gerard. Ich glaube nicht, dass das jetzt Priorität hat.«
»Stimmt, ich wollte es nur anmerken, Zoe. Er plant etwas. Sonst hätte ich nicht die Order bekommen, dich nicht aus den Augen zu lassen.«
»Daran musst du mich nicht erinnern. Ich denke, er möchte einfach nur vermeiden, dass mir der Professor erneut auflauert. Das ist verständlich. Immerhin hatte er mich entführt.«
Maxime betrachtete sie skeptisch. »Ich denke nicht, dass das alles ist.«
Zoe warf ihr einen nervösen Blick zu. »Können wir bitte das Thema wechseln? Ich habe keine Lust, jetzt darüber zu sprechen.«
Maxime zuckte mit den Schultern. »Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ich kann spüren, dass du mich nicht sonderlich magst.« Ihre braunen Augen schossen zu ihr.
Zoe fühlte sich sofort unwohl. Der Blick, mit dem Maxime sie beäugte, behagte ihr nicht. Sie schüttelte den Kopf und klappte das Buch vor sich zu. »Das ist es nicht. Wir kennen uns noch nicht lange genug. Mir behagt es nur nicht, dass ich ständig verfolgt werde. Ich habe einiges zu erledigen und kann es nicht gebrauchen, wenn ich dabei ständig beobachtet werde.« Zoe kam um den Tresen herum. »Außerdem könnte deine Aufmachung meine Kunden vergraulen. Ich kann uns Kaffee machen. Möchtest du einen?«, fragte sie, als sie ins Hinterzimmer ging.
»Nein, ich trinke keinen Kaffee«, antwortete Maxime und sah ihr nachdenklich hinterher.
Zoe prüfte, ob sie noch genug Kaffeepads auf Vorrat hatte und war erleichtert, als sie noch eine volle Packung im Schrank vorfand. Sie schaltete die Kaffeemaschine ein und stützte sich mit den Händen am Tisch vor sich ab. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Fieberhaft überlegte sie, wie sie Maxime loswerden konnte? Sie brauchte nur wenige Minuten für sich. Sie brauchte einen Plan. Einen verdammt guten Plan, wenn sie erfolgreich sein wollte. Als das Telefon im Laden klingelte, zuckte Zoe zusammen. Sie riss den Kopf hoch und starrte zum Telefon, das auf dem Tresen stand. Wer konnte das sein? Niemand wusste, dass sie im Laden war. Stirnrunzelnd ging sie darauf zu und warf Maxime einen erstaunten Blick entgegen. Zoe stand mit dem Rücken zu ihr, als sie den Hörer abnahm. »Zoe´s Book Store«, meldete sie sich.
»Zoe, es ist schön, ihre Stimme zu hören«, antwortete die ihr bekannte Stimme am anderen Ende der Leitung.
Zoe verkrampfte sich und atmete hörbar ein.
»Nennen sie mich einfach Richard, falls sie nicht allein sind.«
Zoe schluckte schwer und umklammerte den Hörer fester. »Richard? Ich bin erstaunt, von dir zu hören. Woher weißt du, dass ich hier bin?«, stammelte sie nervös.
»Ich weiß über jeden ihrer Schritte Bescheid, Zoe. Das hatte ich ihnen in meiner letzten Nachricht gesagt. Wie ich sehe, haben sie sich mit Maxime angefreundet. Das ist gut. Was meinen sie, wie lange sie brauchen werden?«
»Das kann ich nicht sagen. Ein paar Tage.«
»In Ordnung, damit lässt sich arbeiten. Ich habe etwas für sie, was es ihnen leichter macht. Es wird bald im Buchladen mit dem Postboten ankommen. Ich bin sicher, dass Quinn zufrieden ist, wenn sie zügig vorankommen. Ich muss sicher nicht erwähnen, was es für Quinn bedeutet, wenn sie versagen sollten, oder?« Die Drohung war deutlich herauszuhören. Zoe hielt gebannt den Atem an. Ihr Herz raste in der Brust. Quinn. Der Gedanke an ihre Schwester brach ihr das Herz. Er hatte sie in ihrer Gewalt. Wer weiß, was er mit Quinn anstellte? Für Zoe zählte nur ein Gedanke, sie musste Quinn retten. Das, was sie dafür tun musste, missfiel ihr. Aber sie hatte keine andere Wahl. »Ich gebe mein Bestes, Richard«, meinte sie mit brüchiger Stimme.
»Gut, ich melde mich in zwei Tagen. Bis dahin solltest du mir sagen können, wo und wann?« Mit diesen Worten unterbrach er das Gespräch und legte auf.
Zoe starrte eine ganze Weile den Hörer in ihrer Hand an. Sie zitterte, als sie ihn auf die Gabel zurücklegte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Maxime hinter ihr.
Zoe spannte sich an und holte Luft. »Ja, das war Richard. Ein guter Kunde von mir. Er hat uns gesehen, als wir in den Laden gingen. Er wollte nur wissen, wann ich öffne.« Sie drehte sich zu Maxime herum und begegnete tapfer ihrem skeptischen Blick.
Maxime sah sie lange an und wägte ab, ob sie ihr glauben sollte. Als sie sich entspannte, nickte sie nur und ließ es dabei bleiben.
Zoe wirbelte herum, froh sie nicht länger ansehen zu müssen, und schnappte sich einen Stift und Zettel. Sie entwickelte sich noch in eine hervorragende Lügnerin, dachte sie zerknirscht. In Großbuchstaben informierte sie auf dem Zettel darüber, dass sie übermorgen den Buchladen öffnete. Es war ihr egal, was Maxime oder Gerard davon hielten. Sie würde sich nicht davon abbringen lassen. Mit dem Zettel ging sie zur Tür und brachte ihn gut sichtbar an der Glasscheibe an. In zwei Tagen war es so weit. Bis dahin hatte sie noch genug Zeit, um sich einen Plan zurechtzulegen. Das Überleben ihrer Schwester hing davon ab. Sie musste sie retten.
Kapitel 2
Gerard Thigaud stand vor der Doppeltür und warf Erik neben sich einen vielsagenden Blick entgegen. Sofort, als sie in Paris ankamen, machten sie sich auf den Weg hierher. Der Vampirrat hatte seinen Hauptsitz in einem viktorianischen Schloss eingerichtet. Der Besprechungsraum verbarg sich hinter der Doppeltür auf der oberen Etage. Die untere Etage wurde für Veranstaltungen genutzt und beherbergte im Kellergewölbe die Unterbringungen der Dienerschaft. Gerard drückte den Rücken durch, hob den Kopf und öffnete die Tür. Seine innere Anspannung war ihm deutlich anzusehen. Als er den Raum betrat, dicht gefolgt von Erik, atmete er tief ein. Kurz sah er sich um. Es war eine Weile her, seit er das letzte Mal hier gewesen war. An den Steinwänden hingen Kerzenhalter, auf denen Kerzen brannten und den großen Saal erhellten. Links und rechts von ihnen befanden sich Torbögen, die einen kleinen Gang offenbarten, der zu mehreren Türen führte. Die Mitte des Raumes war offen gehalten. Es gab keine Möbelstücke, bis auf einen langen Tisch am Ende des Raumes. Hinter diesem Tisch standen drei Stühle, mit rotem Samt überzogen. Diese Stühle waren für den Vampirrat vorgesehen. Alles erinnerte eher an einen Gerichtssaal. Kein Wunder, dass Erik dichter zu Gerard aufschloss, als dieser zielstrebig zu dem Tisch ging. Der Boden und die Wände bestanden aus grauem Stein. Es wirkte kahl und weitläufig. Sobald sie sich dem Tisch näherten, erblickten sie die zwei Männer, die rechts und links daneben standen. Ihre Gesichter wirkten ernst, als sie starr nach vorn blickten und sich nicht rührten. Gerard wusste, dass dies die Leibgarde des Vampirrates war. Er war keinem der Mitglieder jemals ohne ihnen begegnet. Normalerweise bestand die Leibgarde aus vier Vampiren. Sie kamen zusammen, sobald der Vampirrat beschloss, das Anwesen zu verlassen. Obwohl die Mitglieder des Rates mächtig waren und sich verteidigen konnten, begleiteten sie diese Vampire auf Schritt und Tritt. Gerard blieb vor dem Tisch stehen und musste den Kopf leicht anheben, da der Tisch auf einer höheren Ebene stand. Erik stellte sich hinter ihm und verschränkte die Oberarme vor seiner Brust. Sie mussten nicht lange warten, denn die rechte Tür öffnete sich sogleich und die drei Mitglieder des Vampirrates betraten den Raum. Die Aura, die sie ausstrahlten, legte sich auf den Saal. Die Luft um sie herum schien sich zu erwärmen. Die drei Vampire waren Franzosen und weitaus älter, als Gerard es war. Alle drei trugen ihre Haare lang, meist offen oder zu einem Zopf gebunden. Esteban Fairrier war der Sprecher unter ihnen. Er war es, der Gerard als Erstes direkt ansah. Seine langen blonden Haare waren zu einem Zopf gebunden und seine blauen Augen sahen Gerard sträflich an. Er schritt an den Tisch und besetzte den mittleren der drei Stühle. Sobald er Platz genommen hatte, schlossen die anderen beiden zu ihm auf. Adrian Caubrier setzte sich zu seiner Rechten und galt unter ihnen als der Sanftmütigste. Unterschätzen sollte man ihn deshalb nicht, wusste Gerard. Er trug seine langen schwarzen Haare offen und richtete seine braunen Augen auf Erik. Der dritte unter ihnen, Mattéo Nocardin, hatte seine roten Haare ebenfalls zu einem Zopf gebunden und setzte sich auf den linken Stuhl. Seine hellblauen Augen sahen zuerst seine zwei Mitstreiter an, bevor er sich direkt auf Gerard konzentrierte. Er galt unter ihnen als aufbrausend und ungeduldig. Erik sah den Vampirrat zum ersten Mal und war sichtlich beeindruckt. Oft hatte er von ihnen gehört, eher unschöne Geschichten, die von ihren Bestrafungen erzählten. Allerdings war das nichts im Vergleich dazu, sobald man direkt vor ihnen stand. Die Energie, die diese drei Vampire ausstrahlten, zeugte von ihrer Kraft und ihrem Wissen. Erik hoffte inständig, dass er sich niemals mit ihnen anlegen muss. Respektvoll bog er den Rücken durch und hielt ihren Blicken stand, als sie ihn eindringlich musterten.
Esteban faltete die Hände vor sich zusammen, als er sie auf dem Tisch ablegte. »Gerard Thigaud, es ist lange her«, fing er an zu reden. Seine tiefe, kraftvolle Stimme hallte in den Wänden wider. »Da unsere Zeit begrenzt ist, kommen wir direkt zum Punkt. Mattéo war erstaunt, als er dich nicht auf deinem Anwesen in Paris vorfand. Ein Diener berichtete uns von dem Umstand, dass du in den Vereinigten Staaten zugegen bist. Ich gehe davon aus, dass du dich erklären kannst.« Sein strenger Blick richtete sich auf Gerard. Der unterschwellige Ton war eine deutliche Warnung an ihn.
»Das ist richtig, Esteban. Ich hatte bedauerlicherweise nicht die Zeit, um euch in Kenntnis zu setzen. Ich musste schnellstens aufbrechen.« Gerard hielt dem strengen Blick stand, als er seine Erklärung abgab.
Mattéo räusperte sich leise und wechselte mit Esteban einen Blick. »Uns ist einiges zugetragen worden, was uns beunruhigt. Mattéo wollte von dir persönlich eine Stellungnahme. Du kannst dir denken, wie aufgebracht er war, als er feststellen musste, dass du nicht vor Ort bist. Was hat dich bewegt, so schnell aufzubrechen, Gerard?«
Gerard sah kurz zu Boden und wägte seine nächsten Worte ab. »Verzeiht, dass ich euch nicht informieren konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass genau diese Erzählungen der Grund sind, weshalb ich in den Vereinigten Staaten gebraucht werde. Eine Gruppe von Menschen entführt Vampire. Ich bin ihnen auf der Spur und versuche, dies zu unterbinden, bevor es größeren Schaden annimmt.« Er sah zu Esteban und zu Mattéo, der ihn mit Argusaugen beobachtete.
»Ist es nicht so, dass die Regierung dahinter steckt? Ich finde, das ist weitaus bedenklicher. Ich muss dir sicher nicht erklären, welche Konsequenzen es mit sich bringen wird, wenn die Menschheit von uns erfährt. Zum Glück ist es Valerius zu verdanken, dass wir davon erfahren haben. Ich bin nicht sicher, ob du uns in Kenntnis setzen wolltest?« Fragend sah er Gerard an. »Vielleicht sollten wir deine Position noch einmal überdenken. Mattéo schwärmt in höchsten Tönen von Valerius.«
Seine Worte hinterließen einen Stich in Gerards Brust. Valerius hatte den Vampirrat informiert. Dabei hatte er immer angenommen, dass Valerius einer unter ihnen war, der sich nicht so leicht vom Vampirrat einwickeln ließ. Gerard schluckte und versuchte, ruhig zu bleiben. »Mir ist bewusst, dass das nicht unserer Absprache entspricht. Ich war der Meinung, dass Eile geboten ist. Ich wollte mir es zuerst ansehen, bevor ich euch damit belästige. Ihr habt weitaus wichtigere Aufgaben zu erledigen«, schmeichelte er ihnen.
Esteban sah ihn lange abschätzend an, bevor er nickte. »Dem ist nichts entgegenzusetzen. Wer ist die Person, die es wagt, unseresgleichen gefangen zu halten?«
»Ein Professor, Professor Allan Douglas. Er scheint für die Regierung zu arbeiten und ist besessen von der Vorstellung, er könnte Nachkommen von uns hervorbringen. Ich denke, das ist nicht alles, was ihm vorschwebt. Zusammen mit dem Serrash Clan versuchen wir gerade, den Professor aufzuhalten.«
»Und diese Frauen?«, meldete sich Adrian zu Wort.
Gerard erschrak und sah Adrian direkt an. Ertappt senkte er den Blick. Kurz darauf sah er zu Esteban und überlegte fieberhaft, woher der Vampirrat davon wissen konnte. Valerius hatte bei ihrer Versammlung nichts davon angedeutet, dass er davon wusste. »Dem gehen wir noch nach. Es ist noch nicht klar, was es mit ihnen auf sich hat.« Gerard wusste, dass dies fadenscheinig klang, er hatte keine Ahnung, wie er dieses Gespräch in eine andere Richtung lenken konnte.
»Du gehst doch nicht erneut dieser merkwürdigen Legende nach, Gerard?«, fragte Adrian mit hochgezogener Augenbraue.
»Nun ja, anscheinend haben die Frauen eine besondere Verbindung zu manchen von uns. Es kommt der Legende nahe, das gebe ich zu.«
»Das beantwortet zwar nicht die Frage, aber mir ist bewusst, dass du dem nicht widerstehen kannst«, sagte Esteban und sah dabei Adrian direkt an. »Du bist einer von unseren Ältesten, lebst also schon sehr lange allein, da ist es nicht verwunderlich, dass du dich einsam fühlst.« Sein Blick richtete sich direkt auf Gerard. »Ich erinnere mich gut an das letzte Mal, als du dem nachgejagt bist. Wenn wir dir nicht Einhalt geboten hätten, wärst du noch wahnsinnig geworden.« Esteban ließ es absichtlich so klingen, als ob der Vampirrat dafür Verantwortung trug, dass Gerard nichts Übles geschehen konnte. Wie nahe Gerard dem Rausch stand, mussten sie nicht erwähnen.
Gerard nickte Esteban zu. »Das ist mir bewusst und dafür bin ich euch auf ewig zu Dank verpflichtet«, sagte er.
»Dennoch begibst du dich erneut in Gefahr und hast mit dieser Legende zu tun. Das ist enttäuschend. Es ist unabdingbar, dass die Regierung und dieser Professor aufgehalten werden. Einige Clans in den USA sind aufgebracht und sinnen auf Rache. Das gilt es zu vermeiden, wenn wir keinen Krieg wollen. Diese Legende scheint dich abzulenken und deine Prioritäten zu verschieben. Ich sage es dir erneut, an dieser Legende ist nichts dran, Gerard. Vergiss sie! Kümmere dich um diesen Professor.« Der Befehl war eindeutig. Der Vampirrat verlangte von Gerard, dass er der Legende abschwor. Esteban sah es ihm an, dass es ihm widerstrebte. Das entfachte seinen Unmut. Er erhob sich, stützte die Hände auf dem Tisch vor sich ab und beugte sich vor. »Ich kann es dir ansehen, dass du widersprechen möchtest. Mattéo und Adrian wiesen mich darauf hin, dass du so reagieren würdest. Von daher haben wir Vorkehrungen getroffen.«
Gerard sah alarmiert auf und runzelte die Stirn. Er sah einem nach dem anderen direkt in die Augen. Gerard ahnte nichts Gutes. Ihre Gesichter drückten Entschlossenheit aus. Egal, was sie beschlossen hatten, es würde ihm nicht gefallen.
Esteban richtete sich auf und sprach zu ihm: »Wir stellen dir jemanden zur Seite, der jeden deiner Schritte überwacht und uns berichten wird. Jacques de Cosellier hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Er ist auf dem Weg und wird sich dir anschließen, sobald du in Manhattan bist. Sei gewarnt Gerard, sollten wir feststellen, dass diese dumme Legende weiterhin dein Tun einschränkt, sind wir gewillt, deinen Posten neu zu vergeben.«
Gerard starrte Esteban ungläubig an. Er wusste, dass er nicht widersprechen konnte. Seine Aufgabe bestand ab sofort darin, den Professor aufzuhalten und einen Krieg zu vermeiden. Wie er das anstellen sollte, war ihm noch ein Rätsel. Vor allem wenn er an Zoe dachte. Er hatte sie gerade erst gefunden. Er musste sie beschützen. Gerard konnte sie jetzt nicht aufgeben. Für ihn war es schleierhaft, weshalb sich der Vampirrat von Anfang an dagegen sträubte, mehr über diese Frauen und die Verbindung zu den Vampiren zu erfahren. Wenn ihn nicht alles täuschte, mussten sie dafür einen Grund haben. Was immer es war, was sie davon abhielt, es schien ihnen Angst zu machen. Und das war erstaunlich. Der Vampirrat war das mächtigste Organ unter ihnen. Wieso sollten sie vor einer Legende Angst haben? Seine Gedanken überschlugen sich und er hörte Estebans Stimme nur noch verschwommen, als dieser ihn entließ. Die drei Vampire nickten Erik zu, bevor sie den Saal verließen. Gerard starrte noch lange auf die Tür, durch die sie verschwanden. Die Wut darüber, dass sie Jacques de Cosellier als seinen Aufpasser erwählten, ließ ihn zischen. Vorbei war es mit seiner Beherrschung. Gerard drehte sich erzürnt auf dem Absatz herum, sah Erik kurz direkt an, bevor er wortlos davon stiefelte.
Kapitel 3
Auf ihrem Weg zum Flughafen sprachen sie kein Wort miteinander. Gerard war erbost und kämpfte mit seinem Zorn. Erik sah es ihm an und schwieg, obwohl er einige Fragen hatte, die er ihm gern stellen wollte. Erst, als sie im Privatjet saßen, verließ Erik die Geduld. Er betrachtete Gerard. Er hatte die Augen geschlossen. Seine Beine lagen auf dem Sitz vor ihm, sodass er sie ausstrecken konnte. Seine Hände ruhten übereinander gekreuzt auf seinem Oberkörper. Er wusste, dass er wach war. Seine Körperhaltung war angespannt und seine Stirn gerunzelt, als ob er schweren Gedanken nachhing.
»Jacques de Cosellier, ist das nicht der Vampir, der dich verwandelt hat?« Erik stellte die Frage geradeheraus, obwohl er wusste, dass das ein schwieriges Thema war.
Gerard öffnete die Augen und blickte ihn nachdenklich an. Er hatte Maxime und ihm nie die ganze Geschichte erzählt. Sie kannten nur den Namen des Vampirs, der dafür verantwortlich war. Gerard überlegte, ob er das Thema wechseln sollte. Er hatte wenig Elan, darüber zu sprechen. Er dachte daran, dass sie bald viel Zeit mit Jacques verbringen würden. Sie mussten von ihm erfahren. Immer noch verärgerte es ihn, dass der Vampirrat ausgerechnet ihn ins Boot holte. Was hatten sie sich nur dabei gedacht? Sie vertrauten ihm nicht mehr. Er konnte es ihnen nicht verdenken. Esteban wusste genau, wer Jacques war. Sie wussten, was er getan hatte und weshalb Gerard nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen war. Gerard seufzte. »Ja, genau das ist er«, sagte er zu Erik. »Mir ist schleierhaft, wieso sie ausgerechnet ihn geholt haben. Sie wissen, was ich von ihm halte.«
Erik sah Gerard mitfühlend an. »Wahrscheinlich ist genau das der Grund. Er ist der Einzige, der es wagt, sich gegen dich zu stellen, wenn es erforderlich ist.«
Gerard nickte zustimmend. »Richtig, daran hatte ich gerade gedacht. Ich hätte ihnen früher berichten sollen. Das war mein Fehler.«
Erik sah das nicht so, aber das behielt er für sich. »Wieso bist du so schlecht, auf ihn zu sprechen? Was ist passiert?« Die Neugier in seinen Augen sprach Bände.
Gerard sah ihn lange an und haderte mit sich. Er rutschte etwas nach oben, um sich aufrecht hinsetzen zu können. Er überschlug ein Bein übers andere. Mit der Hand fuhr er durch seine stoppeligen blonden Haare. Seine bernsteinfarbenen Augen blitzten kurz auf, als die Erinnerung in seinem Gedächtnis aufkam. »Ich hatte ein gutes Leben. Ich war glücklich verheiratet und liebte meine Frau über alles. Ihr Name war Racquel. Sie war wunderschön. Ihre hellblauen Augen sahen mich immer so an, als ob sie alles für mich tun würde. Sie hatte lange braune Haare, das ihr in Wellen über den Rücken floss. Unsere Ehe geschah aus Liebe. Das war selten zu der damaligen Zeit. Meistens gab es Vereinbarungen, weit vor der Geburt, und die Ehen wurden beschlossen, noch bevor sich das Brautpaar kannte. Als ich sie das erste Mal sah, wusste ich sofort, das ist meine Frau. Das stand fest. Zu meinem Glück empfand sie genauso. Es dauerte nicht lange, bis wir uns das Ja-Wort gaben. Ich lebte eher bescheiden auf einem Bauernhof in Frankreich. Wir arbeiteten hart, sieben Tage in der Woche. Wir bauten unser Leben zusammen auf. Unser Glück schien uns perfekt, wenn wir erst ein Kind unser Eigen nennen durften. Also arbeiteten wir fleißig daran. Racquel wünschte sich sehnlichst ein Kind. Und ich wollte ihr diesen Wunsch erfüllen. Leider war das schwieriger, als wir dachten. Sie erlitt zwei Fehlgeburten innerhalb von drei Jahren. Das hat seine Spuren bei ihr hinterlassen. Sie wurde melancholischer und traurig. Ich wusste mir bald nicht mehr zu helfen. Schließlich wurde sie erneut schwanger, obwohl wir nicht mehr damit rechneten. Von da an blühte sie regelrecht auf. Die Hoffnung in ihren Augen zu sehen, war wunderschön. Sie achtete auf sich, arbeitete weniger und tat alles, um eine erneute Fehlgeburt zu verhindern. Die Schwangerschaft verlief reibungslos. Wir freuten uns und konnten es kaum erwarten, unser Kind in den Armen zu halten. Am Tag der Geburt blieb ich bei ihr daheim, anstatt auf den Feldern zu arbeiten. Es war eine schwere Geburt. Der Arzt beteuerte, alles würde normal verlaufen. Allerdings war ich nicht sicher. Ich sah das viele Blut, hörte ihre Schreie und das Wimmern aus ihrem Mund. Es hat mich umgebracht, nichts tun zu können. Sie starb im Kindbett, gemeinsam mit meinem Sohn.« Gerard sah betrübt aus dem Fenster, bevor er sich kurz räusperte.
Erik hörte ihm aufmerksam zu und konnte die Spuren erster Tränen in seinen Augen erkennen.
»Ich habe den Arzt hinaus geworfen und ihn zum Teufel gejagt. Dann bin ich ausgerastet und ich habe wild um mich geschlagen. Kein Möbelstück in unserem Haus blieb verschont. Doch das brachte mir Racquel nicht zurück. Ich konnte und wollte nicht ohne sie leben. Mein Entschluss stand fest, desto länger ich an ihrem Totenbett stand und auf sie hinunter blickte. Ich ging nach draußen. Ich weiß noch, dass es in Strömen regnete und stürmisch war. Ich empfand es als passend. Ich rannte los, ohne wirkliches Ziel. Ich war neben mir. Irgendwann stand ich vor der Dorfkirche und blickte an dem Gebäude empor. Ich sah den Glockenturm und die Umrandung. Und ich hatte meine Antwort gefunden. Ich lief hinauf, stellte mich auf die Brüstung und war bereit zum Sprung. Ich zögerte nur wenige Sekunden, bevor ich es tat. Ich erinnere mich gut an den freien Fall. Das Gefühl der Schwerelosigkeit und des Loslassens. Es hat mich berauscht und es fühlte sich richtig an. Der Aufprall hingegen weniger. Ich überlebte, war aber schwer verletzt. Und dann erschien Jacques über mir. Er umschmeichelte mich, redete auf mich ein und versuchte, mir das ewige Leben schmackhaft zu machen. Mit letzter Kraft gab ich ihm zu verstehen, dass ich nicht leben wollte. Ich weigerte mich und wollte sterben. Jacques nahm mich nicht Ernst. Er verwandelte mich gegen meinen Willen. Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen. Jetzt weißt du, wer Jacques de Cosellier ist.« Gerard schloss die Augen und lehnte sich in seinem Sitz zurück.
Erik dachte über seine Worte nach und verstand seine Beweggründe viel besser. Allerdings wusste er, dass er nicht beide Seiten der Geschichte kannte. Er war gespannt darauf, was Jacques sagen würde. So, wie Gerard von seiner Frau gesprochen hatte, war er überzeugt davon, dass er sie geliebt hatte. Erik fand es erstaunlich, so eine verletzliche Seite an Gerard zu sehen. Gerard Thigaud, stets beherrscht und autoritär, besaß eine weiche Seite. Erik sah ihn noch lange an, als dieser vor sich hin döste. Er fragte sich, ob er jemals so für eine Frau empfinden könnte? Er wagte es zu bezweifeln. Insgeheim war er neugierig darauf. Wie fühlte es sich an? Wieso verleitete es jemanden dazu, sich das Leben nehmen zu wollen, wenn man diese eine Person verliert? Wahrscheinlich würde er niemals Antworten auf diese Fragen bekommen. Er schüttelte den Kopf und machte es sich ebenfalls bequem. Sie hatten einen langen Flug vor sich. Sobald sie in Manhattan waren, hatten sie eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Erik schwor sich, dass er Jacques im Auge behielt. Sollte er für Gerard eine ernste Gefahr darstellen, würde er zur Tat schreiten.
Caleb konnte nicht länger warten. Gerard war seit Tagen in Frankreich unterwegs und er hatte keine Ahnung, wann er zurückkam. Die Trennung von Frankie hielt er keine Minute länger durch. Ständig wechselte seine Augenfarbe von Blau zu Pechschwarz und zurück. Er war reizbarer, ungeduldig und er vermisste sie. Er musste sie sehen. Er musste sie spüren und er brauchte ihr Blut. Er würde nicht länger tatenlos herumsitzen und darauf warten, dass ein Wunder geschehen möge und sie vor ihm stand, Sie hatte ihn verlassen. Natürlich nur mit seiner Zustimmung. Was hätte er sonst tun sollen? Sie hatte ihn darum gebeten, nachdem Nora die Bombe bei der Vampirversammlung hatte platzen lassen. Sie glaubte allen Ernstes, sie sei ihm versprochen. Unmöglich! Caleb war es egal, ob sie recht behielt oder nicht. Er wusste, dass er sich an so eine einschneidende Beziehung erinnern würde. Es konnte nicht stimmen. Absolut unmöglich! Was immer Nora mit ihrer Behauptung bezweckte, es war sicher keine Liebe. Es musste einen anderen Grund für ihr Handeln geben. So viel war ihm klar. Caleb zermarterte sich seit Stunden den Kopf darüber, was sie wollte. Und dann war ihm ein absurder Gedanken gekommen, wie er dem auf dem Grund gehen konnte, ohne das er auf Gerard warten musste. Er hatte ihn bitten wollen, dass er erneut eine Manipulation bei ihm einsetzte, um eventuelle Erinnerungen ans Licht zu holen, die noch verblasst waren. Immerhin hatte Nora erwähnt, dass er sich nicht an alles erinnerte. Inzwischen war er von diesem Vorhaben abgerückt. Ihm blieb keine Zeit dafür. Entschlossen griff er nach seinem Mantel und stürmte aus der Hotelsuite. Es gab nur eine Möglichkeit, Nora aus der Reserve zu locken. Er musste mit ihr reden. Er hatte Valerius kontaktiert, der ihm bereitwillig ihre Adresse gab. Wie es der Zufall so will, lebte Nora nicht weit entfernt vom Columbus Hotel. Bisher hatte Caleb angenommen, sie hatte sich abseits von Manhattan niedergelassen. Sobald er auf der Straße stand, gab er dem Concierge zu verstehen, dass er sein Auto brauchte. Eilig winkte dieser den Pagen heran und befahl ihm, sein Auto vorzufahren. Ungeduldig fuhr Caleb sich mit einer Hand durch die Haare. Nora würde es nicht begrüßen, dass er unangemeldet bei ihr erschien. Aber das war ihm egal. Die Zeit drängte. Er wusste nicht, wie lange er noch widerstehen konnte. Wie lange würde sein Körper noch in seiner Menschenform bleiben? Wie lange hatte er noch, bis er sich unkontrolliert verwandelte und etwas tat, was er auf ewig bereute? Sicher, er könnte zu Frankie fahren und einfach von ihr trinken. Allerdings wollte er nicht, dass sie ihn in diesem Zustand sah. Nein, vorerst musste er sich beruhigen. Er brauchte Antworten. Und diese Antworten konnte ihm nur Nora geben. Als sein Wagen vorfuhr und der Page ihm die Autoschlüssel übergab, sprang er hinters Steuer und brauste davon. Es dauerte keine halbe Stunde, bis er vor ihrem Anwesen ankam. Das dreistöckige Haus war umgeben von einer meterhohen Steinmauer, sodass es vor neugierigen Blicken geschützt war. Der Zugang zu ihrem Haus wurde von einem schwarzen Eisentor behindert. Nora hatte den Standort gut gewählt. Ihr Anwesen war weit und breit das einzige Gebäude in dieser Straße. Keine neugierigen Nachbarn, die dumme Fragen stellen konnten. Caleb würde es nicht wundern, wenn sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte, um ihr Heim zu schützen. Er wollte nicht einbrechen. Nein, er würde sich ankündigen, so wie es sich geziemte. Er parkte seinen Wagen am Straßenrand und ging auf das Eisentor zu. Sofort fand er die Klingel, eingelassen auf der rechten Seite der Mauer. Kurzerhand betätigte er den Klingelknopf und wartete. Es dauerte einige Minuten, bis endlich jemand die Haustür öffnete und er einen Diener auf ihn zukommen sah. Er war groß und schmächtig, gekleidet in einem schwarzen Anzug. Seine kurzen Haare waren mit grauen Strähnen überzogen. Eilig rannte er zum Tor und sah Caleb verwundert an. Seine braunen Augen musterten ihn von oben bis unten, bis sie entschieden hatten, dass er ihn nicht kannte. »Wie kann ich ihnen helfen, Sir?«, erklang seine Stimme.
Caleb trat näher heran und deutete auf das Haus, als er antwortete: »Ich muss mit der Dame des Hauses sprechen. Es ist wichtig. Sagen sie ihr, dass Caleb Serrash sie sprechen möchte.«
»Es tut mir leid, Sir. Sie ist gerade beschäftigt und empfängt keinen Besuch«, erwiderte der Diener unbeeindruckt. Er wollte auf dem Absatz kehrtmachen, als Caleb ihn aufhielt. »Hören sie, wenn sie mich nicht augenblicklich mit ihr reden lassen, wird es ungemütlich.« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, blinzelte er den Diener mit seinen schwarzen Augen böse an. Die Fangzähne lugten aus seinem Mund hervor und unterstrichen seinen Willen.
Der Diener schnappte empört nach Luft, als er bemerkte, dass Caleb ein Vampir war. Kurz sah er zum Haus zurück, bevor er das Eisentor öffnete und Caleb hereinließ. »Bitte warten sie im Foyer, Mr. Serrash. Ich gebe der Hausdame Bescheid«, meinte der Diener zu ihm, sobald sie das Anwesen betraten.
Sobald der Diener aus seinem Blickfeld verschwand, atmete Caleb hörbar ein und legte seine Vampirgestalt ab. Die Verwandlung fiel ihm schwer. Er sah sich im Foyer des Hauses um. Alles erstrahlte in weißem Marmor, das auf Hochglanz poliert war. Ein weinroter Teppich lag ausgebreitet in der Mitte und führte bis zum Treppenabsatz. Die Treppe war breit und uferte am oberen Ansatz nach links und rechts aus. Das Treppengeländer war ebenfalls in Weiß gehalten. Wenn es nicht vereinzelte Gemälde an den Wänden gegeben hätte und der auffällige Kronleuchter, der über seinem Kopf hing, sähe es steril aus. Caleb erkannte sofort, dass die Innenausstattung ein Vermögen gekostet haben musste. Neugierig geworden wollte er sich die anderen Zimmer anschauen. Der Diener erschien am oberen Treppenabsatz und beugte sich vor. Sein Arm wies nach links. »Sie empfängt sie, Mr. Serrash. Bitte hier entlang«, sagte der Diener.
Caleb nahm zwei Stufen auf einmal, als er zu ihm auf der Treppe aufschloss. Der Diener ging voran und führte ihn zu einer braunen Tür. Caleb ging seinen Plan im Kopf durch, als der Diener die Tür öffnete und ihn eintreten ließ. Nora saß an einem Klavier und sah nicht auf. Das Klavier war ebenfalls in Weiß gehalten. Der Diener nickte ihm kurz zu, bevor er aus seinem Blickfeld verschwand. Nora sah nicht auf und ließ sich durch seine Anwesenheit nicht stören. Sie spielte eine ihm unbekannte Melodie und schien gedanklich weit entfernt zu sein. Das Klavier stand direkt am großen Fenster, sodass man einen herrlichen Blick auf den Garten hatte. Links von Caleb machte er eine Sitzecke aus, die um einen Marmortisch stand. Der große weiße Kamin stand auf der anderen Seite und spendete eine gemütliche Atmosphäre. Nora ließ ihre schlanken Finger über die Klaviertasten fliegen und sah ihn nur kurz mit ihren blauen Augen an. Aha, sie hatte ihn wahrgenommen. Ihr langes schwarzes Haar wellte sich über ihren Rücken. Sie trug ein dunkelblaues Kleid, mit einem weißen Stehkragen, der ihren Hals umschloss. Verdeckte sie damit Bissspuren? Alles an ihr wirkte friedlich, nicht so boshaft, wie er sie zuletzt in Erinnerung hatte. Caleb schwankte in seinem Vorhaben. Tat er ihr Unrecht? Er konnte sich immer noch nicht erklären, was mit ihr los war? Wieso hatte sie ihn so hintergangen? Tief in Gedanken versunken, bemerkte er es zuerst nicht, als die Musik verstummte. Erst, als Nora aufstand und sich zu ihm wandte, konzentrierte er sich auf sie. Sie trat einen Schritt näher, wischte sich mit der Hand eine Strähne aus dem Gesicht und sah ihn direkt an. »Caleb, ich bin erstaunt, dich zu sehen. Hast du es dir anders überlegt und bist vernünftig geworden?«
Caleb presste die Lippen fest aufeinander, um ruhig zu bleiben. Sie nahm an, dass er um Vergebung bitten würde. Blödsinn! Da hatte sie sich getäuscht. »Ich wollte das ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ich erinnere mich an alles«, antwortete er mit fester Stimme und ließ sie nicht aus den Augen. Sie musste ja nicht wissen, dass er bluffte.
Nora horchte auf und nickte überrascht. »Ist das so? Dann sollte alles klar sein. Oder nicht?«
»So könnte man es nennen. Ich weiß, dass du gelogen hast, Nora. Du bist mir nicht versprochen. Ich erinnere mich an alles und bin mir sicher, dass wir keine intime Beziehung gepflegt haben.«
Sie sah kurz zu Boden, wie um sich zu fangen. Als sie ihn direkt ansah, konnte er die brodelnde Wut in ihren blauen Augen erkennen. »Wieso bist du hier, Caleb? Wenn du doch alles weißt, gibt es keinen Grund für dich, mich zu sehen, oder?«
»Und ob es den gibt, Nora«, meinte er aufgebracht. »Ich möchte aus deinem Mund hören, wieso du so eine Behauptung aufstellst? Was wolltest du damit bezwecken? Ich dachte immer, wir sind befreundet.«
Nora spannte sich an und schüttelte böse lächelnd den Kopf. »Pff, befreundet«, erwiderte sie bissig. »Wir waren niemals befreundet, Caleb. Und ich glaube nicht, dass es jemals so sein wird. Du warst mein Mentor, das ist alles. Das bedeutet nichts«, warf sie ihm entgegen.
Caleb betrachtete sie eingehend und dachte nach. Da war noch mehr. Er spürte es instinktiv. Sie wand sich regelrecht und versuchte alles, um ihren Zorn zurückzuhalten. Wieso war sie zornig auf ihn? Er hatte ihr geholfen. Er hatte sie gerettet und in die Vampirgemeinschaft eingeführt. Ohne ihn wäre sie nicht mehr hier. Er trat einen Schritt näher, bis er ihren gereizten Blick sah. Er stoppte sofort und blieb auf Abstand zu ihr. »Hast du Angst vor mir?«, fragte er geradeheraus.
Ihr lautes Lachen überraschte ihn. Nora legte eine Hand auf dem Klavier ab und hielt sich mit der anderen den Bauch vor Lachen. Doch es war kein hübsches Lachen. Es klang böse und nicht echt. Nachdem sie sich beruhigte, richtete sie sich auf und sah ihn hasserfüllt an. »Angst? Vor dir, Caleb? Das ist absurd«, sagte sie laut. »Ich habe keine Angst vor dir. Das, was ich für dich empfinde, grenzt an Hass und Verachtung.« Sie ließ ihre Worte wirken und weidete sich sichtlich daran, dass es ihn verblüffte, so etwas aus ihrem Mund zu hören.
Caleb runzelte die Stirn und fragte sich kurz, ob er in einem falschen Film war? »Ich verstehe nicht«, begann er.
Nora wirbelte herum und kam schnellen Schrittes auf ihn zu, bis sie direkt vor ihm stand. Wütend starrte sie ihm direkt ins Gesicht. »Ich hasse dich, Caleb. Ich hasse das, was du bist, das, was du aus mir gemacht hast!«, schrie sie ihn an. »Du bist an allem schuld. Du hast mich verwandelt, ohne um meine Erlaubnis zu bitten. Du hast ein Monster aus mir gemacht. Und du bist Schuld daran, dass meine Eltern tot sind. ICH HASSE DICH!«, tobte sie und lief aufgebracht vor ihm hin und her. Ihre Stimme hatte sich merklich angehoben und triefte vor Wut.
Caleb starrte ihr nach und kämpfte mit der Vernunft. »Nora, wie kannst du so etwas sagen? Ich habe dich gerettet. Du lagst im Sterben, als ich dich fand. Wie hätte ich anders reagieren können? Du wärst gestorben, wenn ich es nicht getan hätte«, versuchte er, sich zu erklären.
»Ich wollte es nicht«, schrie sie ihn an. »Ich wollte nicht, dass du mich verwandelst, Caleb. Ich wäre lieber an Ort und Stelle gestorben, als das ich ein Monster werden wollte. Du hättest mich liegen lassen sollen. Wer bist du, dass du so eine Entscheidung treffen kannst? Du bist nicht Gott. Das werde ich dir niemals verzeihen. Hörst du mich? Ich werde dir niemals vergeben können, dass du mich zu einem verdammten Vampir gemacht hast!« Sie redete sich regelrecht in Rage.
Caleb sah sie erschrocken an und registrierte in diesem Moment, dass das ihre absolute Überzeugung war. Nichts und niemand würde sie von diesen Glauben abbringen können, erkannte er. Das Einzige, was sie ihm entgegenbrachte, war purer Hass und Wut. Caleb war sprachlos. Er nahm an, er tat das Richtige, als er sie rettete. Weit gefehlt. Nora war besessen davon, sich an ihm zu rächen. Das sagte ihr rachsüchtiger Blick, dem sie ihn gerade zuwarf. Caleb erkannte, dass er nichts tun oder sagen konnte, um sie umzustimmen. Zu tief saß der Zorn und Hass in ihr.
»Raus hier!«, brüllte sie. »Verschwinde, bevor ich mich vergesse, Caleb!«
Er zuckte zusammen und sah sie entgeistert an. Erst, als ihre Verwandlung einsetzte und er die ersten Anzeichen ihrer Vampirgestalt wahrnahm, setzte er sich in Bewegung. Ihre schwarzen Augen stachen ihm in den Rücken, als er sich umwandte und sie zurückließ.
Kapitel 4
André stolperte aus dem Zimmer. Eine Hand am Treppengeländer, um sich zu stützen, starrte er apathisch vor sich hin. Was hatte er getan? Fassungslos blieb er am Treppenabsatz stehen. Seine bernsteinfarbenen Augen irrten ziellos umher. Seine Fangzähne fuhren langsam ein, als er sich zurückverwandelte. Er konnte es nicht glauben. Sicher, er hatte ihr damit das Leben gerettet. Das stand für ihn außer Frage. Aber mit seinem Handeln brach er eines der obersten Gesetze. Er hatte Jodie verwandelt, ohne ihr Einverständnis einzuholen. Machte es einen Unterschied, dass sie sich nicht hatte äußern können? Er glaubte es nicht. Seine Hand fuhr über die Stirn, die schweißgebadet war. Nachdem es geschehen war, hockte er noch lange an ihrem Bett und starrte sie einfach nur an. Er beobachtete, wie ihre Wunden sich schlossen und die Verwandlung einsetzte. Ihr Körper regenerierte sich und bereitete sich auf das vor, was ihr bevorstand. Gott, sie würde ihn sicher hassen. Sobald sie wach war, würde sie erfassen, was geschehen war. Was er ihr angetan hatte. Verdammt! So hatte er das nicht gewollt. Doch was blieb ihm anderes übrig? Sie wäre vor seinen Augen gestorben. SIE WAR GESTORBEN! Da machte er sich nichts vor. Er hatte ihre Herztöne gehört, bis ihr Herz versagte. Es hatte einfach aufgehört, zu schlagen. Verdammt, verdammt, verdammt! Im nächsten Moment sagte er sich, dass er es wieder tun würde. Er konnte und wollte sie nicht verlieren. Mit der Hand rieb er über seine brennende Brust und bemerkte nicht, dass er damit das Blut darauf noch mehr verteilte.
»Oh Gott, André!«, erklang Frankies entsetzte Stimme von unten zu ihm rauf. Sie stand vor der Treppe und sah ihn entgeistert an. Ihre Hand lag auf ihrer Brust, als ob sie ihr Herz festhalten musste, weil es jeden Moment aussetzen könnte. Der Schock saß tief. »Was ist passiert?«, hauchte sie fassungslos. Sie nahm ihn in Augenschein und starrte ihn von oben bis unten an. Sein Mund und seine nackte Brust waren mit Blut verschmiert. Seine Augen glänzten bernsteinfarben und schienen meilenweit entfernt zu sein. Er sah sie an und auch wieder nicht. Sie war nicht sicher, ob er anwesend war. Stirnrunzelnd kam sie einen Schritt auf ihn zu, setzte einen Fuß auf die erste Treppenstufe, nur um innezuhalten. »André?«, fragte sie unsicher. Der Drang, das Haus schnellstens zu verlassen, wurde in ihr übermächtig. Sie roch die Gefahr und wusste instinktiv, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Gerade noch, war er mit ihr im Salon gewesen, tadellos gekleidet und so liebenswürdig, wie sie ihn kennengelernt hatte. Von einem Moment zum anderen erkannte sie André nicht mehr wieder. Das war nicht der André, den sie kennengelernt hatte. Das da vor ihr war ein Abklatsch von dem Vampir, der in ihm steckte, wurde ihr bewusst. Sie durfte sich nichts vormachen. André Mayson war ein Vampir, genauso wie Caleb. Er musste Blut zu sich nehmen, bevorzugt Menschenblut. Genau so ein Blut, das sie gerade an ihm mit Entsetzen erkennen konnte. Er hatte getrunken und das nicht zu knapp, wie ihr schien. Kurz fragte Frankie sich, ob er kurz vor dem Rausch stand? Wurden sie so apathisch nach dem Trinken, so wie er es gerade zu sein schien? Sie hatte keine Ahnung. Verärgert darüber, atmete sie hörbar ein. Ihre Nerven lagen blank. Da hatte sie geglaubt, sie wäre unter seinem Dach sicher und dann kam das. Um Gottes willen! Wer war er? Waren das noch Rückstände von der Gefangenschaft beim Professor? Hatten sie ihn wahnsinnig werden lassen? Sie erinnerte sich an seine aufbrausende Art, als sie bei ihm in der Zelle war. Sie konnte nichts dagegen tun, dass sie Angst bekam. Vor ihm. Was ist, wenn er noch nicht genug hatte? Er würde sich auf sie stürzen, dachte sie alarmiert. Ohne länger zu überlegen, wirbelte Frankie herum und rannte auf den Hauseingang zu. Sie musste hier heraus. Sie musste von hier verschwinden, so lange sie das noch konnte. Ihre Hand lag um den Türknauf und wollte sich nach rechts drehen, als sie einen Schatten hinter sich ausmachte. Ein Frösteln überkam sie. Frankie wagte es nicht, nach hinten zu schauen. Stocksteif stand sie an der Tür und starrte vor sich. Ihre Füße bewegten sich nicht, keinen Millimeter. Sie stieß einen Aufschrei aus, als eine Hand rechts von ihr gegen die Tür klatschte. Eine männliche Hand, die ihr bekannt vorkam. Dann spürte sie ihn ganz nah hinter sich. Frankie schloss verzweifelt die Augen und vergaß, zu atmen. Ihr Puls raste.
»Ich kann dich nicht gehen lassen, Frankie«, krächzte er in ihr rechtes Ohr.
Sie spürte seinen Atem, als dieser ihren Hals streichelte, sobald er den Mund aufmachte. Seine Stimme klang verändert. Oder bildete sie sich das nur ein? Tiefer, bedrohlicher. Sein Körper presste sich an ihren Rücken und drängte sie regelrecht gegen die Tür vor ihr. Er hielt sie damit gefangen, sodass sie sich nicht bewegen konnte.
»Ich werde dir nichts tun, Frankie. Aber ich kann dich auf keinen Fall gehen lassen.«
Frankie hörte ihm zu, es dauerte eine Weile, bis ihr Verstand den Sinn erfasste. Zu groß war die Angst davor, was er vorhatte. Sie wusste, dass er sie nicht durch diese Tür gehen lassen würde. Egal, wie sehr sie ihn darum bitten würde. Wieso? Er hatte sie freundlich bei sich aufgenommen und geschworen, ihr keinen Schaden zuzufügen. Caleb vertraute ihm. Sie vertraute ihm. Was war passiert, sodass er sich so veränderte? Frankie nahm allen Mut zusammen, atmete tief ein, und ließ die Augen weiterhin geschlossen. »Ich glaube dir, André. Was ist passiert?«, hauchte sie mit zitternder Stimme. Wenn sie seine Verfassung verstehen wollte, musste sie wissen, was geschehen war. Würde er ihr antworten? Sie bezweifelte es. Er sah eher so aus, als ob er noch damit kämpfte und die Puzzleteile zusammensetzte. Umso überraschter war sie, als er sie freiließ.
Er trat noch einen weiteren Schritt zurück und ließ ihr genügend Freiraum, sodass sie sich langsam zu ihm umdrehen konnte. Als sie ihn direkt ansah, schnappte sie nach Luft. Seine blutverschmierte Brust reichte ihr bis zum Kinn und sie atmete den vertrauten, metallischen Geruch ein. Langsam hob sie den Kopf, bis sie ihm in die Augen schauen konnte. Er starrte sie gequält an. Seine bernsteinfarbenen Augen waren von Tränen verschleiert. Oh Gott! Er tat ihr unendlich leid. Sie konnte es nicht anders definieren. Die Angst, die sie gerade noch vor ihm hatte, verpuffte. Sicher, er war groß, stark und ihr weitaus überlegen, wenn er es darauf anlegen würde. Aber instinktiv wusste Frankie, dass sie vor ihm nichts zu befürchten hatte. Ihr Puls beruhigte sich langsam. »Du musst mir sagen, was geschehen ist, André«, sagte sie zu ihm. Sie sah ihn unmissverständlich an und verlangte Antworten.
Als er nickte, fiel ihr ein Stein vom Herzen. André trat einen weiteren Schritt zurück und drehte sich um. Ohne ein Wort zu sagen, ging er vorwärts, direkt auf den Salon zu. Er nahm einfach an, dass sie ihm folgen würde. Verwundert sah sie ihm nach und wagte erst dann, auszuatmen. Sie hatte nicht bemerkt, dass sie den Atem angehalten hatte. Ihre Hand legte sich um ihren Hals, der sich unnatürlich eng anfühlte. Ihre Brust hob und senkte sich schwer. Schließlich nahm sie die Hand herunter, holte tief Luft, ballte die Hände zu Fäusten und folgte ihm in den Salon. Er sah direkt zu ihr, sobald sie über die Türschwelle trat. Sein entschuldigender Blick ruhte auf ihr, als sie näher trat und sich auf der Couch niederließ. Die Hände auf dem Schoß zusammengefaltet, schluckte Frankie schwer. Sie krampfte die Finger eher zu fest zusammen, als das sie locker da lagen. Sämtliche Sinne in ihr liefen auf Hochtouren. Es dauerte einen Moment, bis sie André direkt ansehen konnte. Noch immer traf sie sein Aussehen mit voller Wucht. Sie ließ sich nichts anmerken und blieb tapfer sitzen.
»Entschuldige, ich wollte dir keine Angst einjagen, Frankie«, meinte er leise. »Du hast doch keine Angst vor mir, oder?« Fragend sah er sie direkt an.
Ihr knappes Nicken musste ihm reichen.
»Also schön, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich schätze, du hast eine ehrliche Erklärung verdient. Wenn ich gewusst hätte, was heute geschieht, hätte ich dich niemals in mein Haus geholt. Das kannst du mir glauben«, sagte er. Mit der Hand fuhr er über seinen kurz geschorenen Schädel. Sichtlich nervös schien er weiterhin unter Schock zu stehen. Sie zollte ihm Respekt dafür, dass er sich zusammenriss. Schließlich berichtete André ihr von seiner ersten Begegnung mit Jodie Deveraux. Er ließ nichts aus. Er erwähnte ihren Beruf und die damit verbundenen Probleme. Und er erzählte ihr ebenfalls, dass sie seine Frau war, so wie es mit ihr und Caleb war. Aufmerksam hörte sie ihm zu und konnte kaum glauben, was er in letzter Zeit alles für sich behalten hatte. Womit er gekämpft hatte. In welchem Zwiespalt er gestanden haben musste. Da waren ihre Probleme ein Witz dagegen, stellte sie fest. Überrascht, dass er so gefasst davon sprach, sah sie ihn an. Mittlerweile ging er durch den Raum hin und her, um seine Unruhe in den Griff zu bekommen. Verständlich. Jetzt verstand sie, weshalb er nicht hatte trinken wollen, als sie in seiner Zelle war. Es war genauso wie bei Caleb. Diese verfluchte Legende! In letzter Zeit dachte sie immer mehr daran, dass dieser blöde Fluch nur darauf aus war, sie alle zu bestrafen. Als André ihr von Jodies Flucht aus dem Labor erzählte und das sie tödlich verwundet wurde, hielt sie geschockt den Atem an. Und das nur weil sie ihnen hatte helfen wollen. Sie hatte nach der Liste gesucht. Oh Gott! Arme Jodie! Der krönende Abschluss des Ganzen war genau das, was André so apathisch hatte werden lassen. Er hatte sie vor dem Tod bewahrt und sie verwandelt. Vor nicht einmal einer halben Stunde, versteht sich. Fassungslos starrte sie André an, als er mit seiner Erklärung endete und tief ausatmete. Sie sah auf das Blut, das noch an ihm zu sehen war und zählte eins und eins