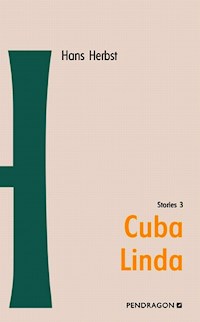Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hans Herbst ist ein großer Erzähler. Seine Geschichten nehmen den Leser mit auf eine Reise. Seine Beschreibungen sind so lebendig, dass man meint, den heißen Wüstenwind auf der Haut zu spüren. Beim fünften Band der auf sieben Bände angelegten Hans Herbst-Edition verfasste kein Geringerer als der mehrfach ausgezeichnete Krimi-Autor Friedrich Ani das Nachwort:"In diesen Geschichten gehören eine SIG Sauer und eine Walther PPK zum Leben eines Mannes wie der Trompetensound von Miles Davis, und es spielt keine Rolle, ob der Gegner ein Staatsanwalt, der Chef einer Abbruchfirma, ein alter Nazi oder man selbst ist. Es geht um Konsequenz und Stolz, um die Wahrheit und die Hoffnung, welche, wie es in der Geschichte ,Lisas Annonce' heißt, von Freiberuflern erfunden wurde. Das ist eine zutreffende Bezeichnung für die Getriebenen und Spurenverwischer im Kosmos des ,Herrn Herbst', wie er respektvoll genannt wurde, als er in München noch eine Weinhandlung betrieb und Gäste wie Jörg Fauser bewirtete, der als Schriftsteller, Trinker und Weltenbewohner in derselben Liga wie Hans Herbst spielte und für alle Zeiten spielen wird. Auftragsmenschen sind es, von denen Herr Herbst so unvergleichlich erzählt, Leute, die von der Hand in den Mund leben und ihre Faust in die Fresse der Lüge schlagen, weil sie sonst ersticken."FRIEDRICH ANI
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Herbst
Stille und Tod
Stories Band 4
Mit einem Nachwort von Friedrich Ani
PENDRAGON
Pendragon Verlag
gegründet 1981
www.pendragon.de
Originalausgabe
Veröffentlicht im Pendragon Verlag
Günther Butkus, Bielefeld 2010
© by Pendragon Verlag Bielefeld 2010
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Günther Butkus
Umschlag & Herstellung: Uta Zeißler (www.muito.de)
Gesetzt aus der Adobe Garamond
eISBN: 978-3-86532-294-4
Inhalt
Fernandez und sein Plan
Stille und Tod
Zwanzig Jahre sind nichts
Lisas Annonce
Sprachschwierigkeiten
Der Resident
Das Haus in der Karibik
Das Wort
Sieben Namen
Vergangenheit
Dunkelheit
Nachwort von Friedrich Ani
Fernandez und sein Plan
»Ich brauche eine Waffe«, sagte der Spanier. Er war ein sehr alter Spanier mit tiefen Falten in dem dunklen Gesicht.
»Wozu?«, fragte ich.
Er nahm einen Zug von seiner Selbstgedrehten und blickte an mir vorbei.
Wir standen vor der »Monaco Bar«, in der immer kleine Künstler, kleine Diebe und selbsternannte Existenzialisten herumsaßen und sich von den Amerikanern die Drinks zahlen ließen. Die Amerikaner hatten dann die Bohème kennengelernt und waren glücklich.
»Was geht es dich an?«, fragte der Spanier, und seine alten braunen Augen mit den dunklen Tränensäcken darunter kehrten zu mir zurück.
»Nichts. Was möchten Sie haben?«
Er machte eine knappe Bewegung mit der Hand, die die Zigarette hielt, und ich sah die braunen Altersflecken auf dem Handrücken.
»Etwas Großes, möglichst groß, ich verstehe nichts von Waffen.«
Sein Französisch klang härter als gewöhnlich, ähnlich wie das der Araber.
»Etwas Großes«, sagte ich, »ist schwer zu verstauen, Sie werden einen Fünfundvierziger nicht einfach so in die Tasche stecken können.«
»Lass das meine Sorge sein.«
Er nahm wieder einen tiefen Zug, kappte mit Daumen und Zeigefinger die Glut von der Zigarette und steckte den Rest in die aufgesetzte Brusttasche seines Jacketts hinter das weiße Ziertuch.
»So ein großes Ding ist teuer«, sagte ich.
Er hob die Schultern und ließ sie wieder sinken.
»Que va. Kannst du es machen?«
Das ist eine gute Frage, dachte ich und dachte noch ein wenig weiter.
»Sie wissen, dass ich es machen kann, sonst hätten Sie mich nicht gefragt. Dabei haben Sie mich gar nicht gefragt, Sie haben nur gesagt, ich brauche eine Waffe. Aber vielleicht will ich es nicht machen.«
Seine grauen Augenbrauen hoben sich und etwas geschah mit seinen Augen, und ich brauchte einen Moment, um es zu deuten. Ferne Angst war in seinen Augen.
»Warum?«, fragte er rau.
»Darf ich offen sprechen?«
»Sprich wie immer, dann ist es schon in Ordnung.«
»Es könnte Sie verletzen.«
Er lächelte flüchtig.
»Mich verletzt nicht mehr allzu viel.«
»Sie sind ein alter Mann, Monsieur Fernandez. Was macht ein alter Mann mit einer großen Knarre? Eine alte Rechnung?«
Er senkte langsam den Kopf und zupfte an seinem rechten Ohrläppchen herum, und vor der »Monaco Bar«, die nur ein von der Zeit aufgebrauchtes kleines Bistro war, saßen die Künstler, die Diebe und die Amerikaner, und es war ein warmer Sommerabend, und ich war jung, und Paris war meine Stadt. Niemand achtete auf mich und einen alten Spanier in einem altmodischen Anzug, der sauber gebügelt war. Ich wusste, dass er ihn selbst bügelte.
»Ja«, sagte er wie von weit her und sah mich wieder an, »eine alte Rechnung. Eine sehr alte Rechnung.«
Dagegen war nichts einzuwenden, gewisse Rechnungen sollten beglichen werden, und wenn man es einmal nicht macht, bleibt ein hohles, ödes Gefühl zurück, mit dem man nicht gut leben kann. Ich kannte mich aus damit. Fernandez wollte noch etwas in Ordnung bringen, bevor der Feierabend eingeläutet wurde, und vielleicht hatte er sich lange damit geplagt und sich gesagt, mach’s endlich, du feiger Hund, du hast nicht mehr viel Zeit, und wenn du es nicht bald machst, stirbt auch noch der Rest von Mann in dir, den sie bis jetzt nicht kaputt gekriegt haben. Spanier sind sehr eigen, was ihre Ehre betrifft. Ich würde ihm eine Neunmillimeter Automatik besorgen, ein gutes Kaliber, und sie ist flach genug, dass man sie bequem im Hosenbund verstauen kann. Und ich würde ihm zeigen müssen, wie das Ding funktioniert, er versteht nichts von Waffen, hatte er gesagt. Munition war inklusive, ein volles Magazin sollte reichen. Ich brauchte Geld, die Geschäfte waren in den letzten Tagen ein bisschen flau gewesen. Hatte Fernandez genug? Sollte ich ihn fragen? Es wäre nicht sehr höflich, aber mit Höflichkeit kann man seine Drinks nicht bezahlen.
»Monsieur Fernandez, haben Sie genug Geld, um die Waffe zu bezahlen?«
Er sah mich an, als hätte ich ihm einen Tritt verpasst, und dann lächelte er und sah sehr alt und müde aus.
»Ich habe dafür gespart«, sagte er.
Ich nannte ihm den ungefähren Preis und er wiederholte: »Ich habe dafür gespart.«
Wie haben Sie das gemacht, Monsieur Fernandez? Mahlzeiten ausgelassen in der alten Kellerkneipe bei den Hallen, wo Sie mit anderen alten Spaniern sitzen, und das kostenlose Leitungswasser getrunken? Sie trugen alle diese altmodischen Anzüge, die sorgsam geflickt und gebügelt waren, und ihre zerfransten Krawatten waren korrekt gebunden, und wenn sie auf die Straße traten, setzten sie ihre Hüte auf. Die abgetakelten Huren aus der Rue Sainte Denise, die wegen des billigen Mittagessens kamen, behandelten sie mit ausgesuchter Höflichkeit. Einige waren Akademiker, und sie sprachen von Spanien und der zerstörten Republik, der jeder auf seine Weise verpflichtet war, und von Franco, dem sie einen langen und einsamen Tod wünschten. Dann würden sie zurückkehren, nach seinem Tod würden sie alle zurückkehren und abrechnen. Wenn sie dann noch lebten. Fernandez war Dichter, und als die Faschisten Lorca umbrachten, wusste er, dass es Zeit war, und er flüchtete nach Frankreich und ließ seine Familie zurück. Sie sollte nachkommen, wenn er einen Verleger gefunden hatte und die finanziellen Probleme geregelt waren. Am Anfang schleppte er Gemüsekisten und Schweinehälften in den Hallen, und Paris wurde nie seine Stadt. Irgendein kleiner Hinterhofverlag brachte ein dünnes Buch mit seinen Gedichten heraus, er hat mir einen Band geschenkt und mit einem alten Füllfederhalter eine Widmung hineingeschrieben, und es waren, nach Lorca und Apollinaire, die besten Gedichte, die ich je gelesen hatte.
»Wird es Probleme geben?«, fragte er. Es klang besorgt.
»Nur wenn Sie vorbeischießen.«
Er lachte, und ich sah seine abgebrochenen Zähne. Es würde keine Probleme geben, ich müsste nur mit Abdel Krim sprechen. Er war Barmann in einer kleinen, dunklen Araberkneipe an der Place Blanche. Am Anfang war er sehr zurückhaltend gewesen und hatte die Ware mit der Lupe überprüft, und ich brachte ihm, was das Geschäft gerade abwarf. Kameras, sie waren immer leicht zu holen, ein bisschen Schmuck, Travellerschecks, Autopapiere und anderen Kleinkram. Wir saßen dann an der Theke und handelten die Preise aus, und weiter hinten im Halbdunkel saßen die alten Araber wie Schatten bei ihren endlosen Brettspielen und rauchten Haschisch aus kleinen, roten Tonpfeifen, und alles war friedlich und ohne Aufregung. Bis ich mit den Pässen ankam. Zwei amerikanische und ein argentinischer. Als ich sie auf die Theke legte, wurden die Augen des Arabers flach wie Knöpfe, und er machte eine knappe Bewegung mit dem Kopf. Ich folgte ihm durch einen Perlenvorhang am Ende der Kneipe und durch zwei massive Türen in eine Art von Büro und war weit weg von der Place Blanche. Es gab ein Dutzend Teppiche, und einige davon hingen an den Wänden. Sie waren aus Seide. Auf einem flachen Messingtisch mit Sitzkissen davor stand eine Wasserpfeife aus getriebenem Silber, und als der hagere Mann in der blauen Schürze und dem schmuddeligen Hemd sich hinter einen Empireschreibtisch setzte, wusste ich, dass er ein Houd war, ein Boss. Und ich hatte ihn nie in eleganten Anzügen und großen Autos gesehen. Er blätterte die Pässe aufmerksam durch, und dann lächelte er und sagte: »Gut gemacht, mein Bruder.«
Es war das erste Mal, dass er mich so nannte, aber ich blieb vorsichtig. Ich wusste jetzt, wer er war. Er spielte eine Rolle im algerischen Untergrund, die Algerier kämpften um ihre Unabhängigkeit, und der Krieg wurde auch in Paris ausgetragen, jede Nacht krachte es irgendwo, und Pässe, falsche Identitäten, waren für sie lebensnotwendig.
»Bring mehr davon«, sagte er, »bring alles, was du kriegen kannst.«
Er zahlte einen sehr anständigen Preis, und am Schluss sagte er: »Wenn du mal eine Waffe brauchst, lass es mich wissen.«
Seitdem war ich auch im Waffengeschäft. Es lief nicht besonders gut, aber es gab immer mal wieder einen Irren, der das ganz große Ding plante, oder einen Mann, der mit klaren Vorstellungen aus dem Knast gekommen war und sich neu einkleiden musste. Oder einen Mann, der eine Rechnung zu begleichen hatte. Ich konnte leben, und es hat nie Reklamationen gegeben.
»Wann kann ich sie haben?«, fragte Fernandez, und ich sagte: »Bald.«
Er sah mich an, ganz still und ohne Regung in dem dünnen Gesicht, und dann sagte er: »Ich vertraue dir.«
Er tippte leicht gegen seinen Hut und wandte sich ab, und ich sah ihn die Rue Monsieur le Prince runtergehen, eine schmale Gestalt in einem alten Anzug und blank geputzten Schuhen, und er hielt sich sehr aufrecht und würdevoll. In seiner linken Armbeuge hing ein leichter Mantel. Ich setzte mich an einen Tisch vor die »Monaco Bar« und bestellte bei Robert, dem rothaarigen Kellner, ein Bier. Er zog die Mundwinkel nach unten und nahm meine Bestellung wortlos entgegen. Wir kannten uns schon länger. Ich machte die Beine lang und blickte über den kleinen Platz in die Rue de l’Odéon, wo sich der Buchladen von Sylvia Beach befunden hatte, in dem Joyce und Hemingway herumgehockt waren, und sicher hatte Hemingway sein großes Maul aufgerissen und von seinen Heldentaten in Italien schwadroniert, und Joyce hatte mit seinen ruinierten Augen gekämpft und die Fahnenabzüge von »Ulysses« mit einer Lupe gelesen. Fernandez war Hemingway einmal begegnet, als der aus Spanien zurückkam, und er hielt ihn für einen Schwätzer, der einen Republikaner nicht von einem als Republikaner getarnten Faschisten unterscheiden konnte. Fernandez konnte, und vielleicht war er hier in Paris einem begegnet, einem anderen alten Spanier, und vielleicht war es der Mann, der damals seine Tür eingetreten und ihm einen Revolver durch das Gesicht gezogen hatte, und jetzt konnte er nicht mehr ruhig schlafen, bis die Sache erledigt war. Die alte Rechnung. Irgendetwas in der Art musste es sein, etwas, das weit zurück lag, und das konnte nur mit den spanischen Faschisten zu tun haben. Ich kannte ein paar Emigranten, einige waren Russen, und sie träumten alle den gleichen Traum. Den Mördern mit der Waffe in der Hand gegenüberzustehen und sie mit den Eiern an eine Laterne auf der Place Royal zu hängen. Gut, Fernandez, dir gönne ich dieses Vergnügen, und wenn ich dir dabei behilflich sein kann, macht mir das keine Kopfschmerzen. Oder plante er etwas anderes? Hatte er in der kleinen Besenkammer unter dem Dach, wo er sich im Winter an einem Elektrokocher wärmte, etwas ausgebrütet? Mit einer großen Pistole in der Hand hat man sehr viel Macht, auch wenn man alt ist, und jeder, der vor einem solchen Gerät steht und nicht verrückt oder betrunken ist, würde sofort sein Bargeld auf den Tisch legen. Hatte er sich gesagt, meine Zeit ist um, und es ist gleichgültig, was geschieht, aber ein spanischer Dichter stirbt nicht in einer französischen Besenkammer, und wenn er schon nicht in Madrid sterben kann, dann doch lieber im »Negresco« in Nizza, wo die Winter mild sind und das Licht angenehm. Die Idee gefiel mir, und ich dachte daran, wie es sein würde, wenn ich alt bin, und als die Vorstellung Konturen annahm, hörte ich auf, daran zu denken. Ich kaufte die Waffe bei Abdel Krim, und als ich ihm sagte, dass ein guter Mann damit einen alten Faschisten umlegen würde, lächelte er und machte mir einen guten Preis. Ich traf Fernandez im Jardin du Luxembourg, wo er auf einer Bank saß und den spielenden Kindern zusah, die von Großmüttern und Großvätern beaufsichtigt wurden, und der Himmel darüber war blau und warm. Er trug keine Krawatte, und seine Schuhe sahen staubig aus. Den Hut hatte er schräg über das rechte Auge gezogen und sein Gesicht lag im Schatten, aber ich sah, dass es sich verändert hatte seit dem letzten Mal. Die Falten schienen noch tiefer zu sein und sahen wie geschnitzt aus, und graue Bartstoppeln bedeckten Kinn und Wangen. Ich hatte ihn noch nie unrasiert gesehen. Er blickte mich fragend an, und ich nickte.
»Dann lass uns gehen«, sagte er undeutlich.
Er stand mit einiger Mühe auf, und wir gingen in die Rue Mouffetard, wo es sehr heiß war in dem kleinen Zimmer unter dem Blechdach. Als ich ihm die Funktion der Waffe erklärte, wurde er wieder ein bisschen munter und war ganz bei der Sache.
»Ein feines Ding«, sagte er, »macht sie großen Krach?«
Ich sagte ihm, dass sie großen Krach mache, und er meinte, das spiele keine Rolle, jetzt, wo er wisse, wie man damit umgehe, würde er schon alles richtig machen. Er bedankte sich, zahlte den vereinbarten Preis, und nachdem alles erledigt war, sagte er: »Ich möchte dir etwas schenken.«
Er zog einen alten Lederkoffer unter dem Eisenbett hervor und kramte darin herum.
»Hier.«
Auf seiner flachen Hand lag ein alter, schwarzer Füllfederhalter, den ich schon einmal gesehen hatte. Ich verstand ihn nicht, und er sah es an meinem Gesicht. Er lächelte.
»Der hat Lorca gehört.«
»Lorca? Federico Garcia Lorca?«
»Ja.«
»Sehr freundlich von Ihnen, Monsieur Fernandez, aber ich kann ihn nicht annehmen, so etwas verschenkt man nicht, behalten Sie ihn.«
»Unsinn, sei nicht sentimental, das passt nicht zu dir. Nimm ihn nur, du hast mir einen großen Gefallen getan, nimm ihn.«
Ich zögerte. Ich starrte dieses schwarze Ding auf der flachen Hand des alten Mannes an und hatte ein seltsames Gefühl dabei. Vielleicht, weil Lorca auf so grässliche Weise umgekommen war? Ich wusste es nicht und versuchte, meine Gedanken zu ordnen, aber es gelang mir nicht, es war heiß und stickig in dem kleinen Zimmer und roch nach dem alten Mann, und irgendwann sagte Fernandez: »Nun mach schon«, und langsam, mit spitzen Fingern, nahm ich den Füller entgegen und hatte das Gefühl, dass es nicht richtig war. Ich bedankte mich, und als ich die Tür öffnete, sagte er: »Vielleicht schreibst du etwas Schönes damit.« Die Falten in seinem Gesicht sahen immer noch wie geschnitzt aus, und das graue Haar klebte feucht an seinem Kopf.
Am nächsten Tag regnete es, und ich saß bei »Popoff« in der Rue la Huchette, wo der kleine Rouge ein paar Centimes kostete, was für die meisten der anderen Kleinkünstler, die da auf bessere Zeiten, Jesus Christus oder den Tod warteten, immer noch zu teuer war. Es war dunkel, und in der muffigen Luft hing dieser stechende Geruch aus schlechtem Wein, Knoblauchsuppe und alten Kleidern. Ich hätte mit meinem Geld ins »Select« oder ins »Dôme« gehen können, aber irgendwie war mir nicht danach. Ich gehörte da auch nicht hin, zu viele Amerikaner da, die zu viel Hemingway gelesen hatten, er war dort verkehrt in den alten Tagen, und sie gaben mit ihrem Geld an und bestellten auf Französisch ihre Drinks, was grausam war. Ich hatte den Füllfederhalter gereinigt und aufgefüllt, die Kammer war leer gewesen, mit eingetrockneten Tintenresten an den Rändern, und jetzt versuchte ich, ein paar Notizen zu schreiben, aber es funktionierte nicht so richtig. Der Füller war ganz in Ordnung, trotz seines Alters, aber ich war nicht bei der Sache, irgendetwas beschäftigte mich, und ich versuchte, es wegzudrücken, nicht wahrzunehmen, aber es war da und ließ sich nicht abschütteln. Fernandez beschäftigte mich. Er wollte jemanden umlegen, und weil er ein guter Mann war, konnte daran nichts Falsches sein, und es ging nur ihn und den anderen etwas an. Ich wünschte ihm Glück dabei. Glück? Er würde jede Menge davon brauchen. Wenn ein alter Mann einen umlegt und da heil rauskommen will, braucht er siebenundzwanzig Schutzengel und eine perfekte Planung. Alte Männer können nicht wegrennen, wenn’s hart kommt. Und es würde hart kommen, der Donner von dem großen Ding würde ein halbes Stadtviertel aufwecken, und weil die Bullen wegen der Spannungen mit den Algeriern pausenlos im Einsatz waren, konnten sie in Windeseile zur Stelle sein. Und sie schossen sofort, wenn ihnen irgendetwas nicht koscher vorkam, sie waren hochnervös, und es war ihnen vollkommen egal, ob sie ein Kind oder einen alten Mann wegräumten. Hatte Fernandez das bedacht? Ich hatte es auch nicht bedacht, ich hatte ein paar wacklige Hypothesen aufgestellt und ihm die Knarre verkauft, und warum sollte ich mit seinem Kopf denken? Jetzt, dachte ich. Und Schutzengel hatte er auch keine, die hätten nicht zugelassen, dass die Faschisten seine Familie und seinen Freund Lorca umbrachten. Hatte er eine perfekte Planung? Ein spanischer Intellektueller, der nie einen Kriminalroman gelesen hatte und mit Sicherheit nichts über die Feinheiten der Polizeiarbeit wusste? Würde er die Patronenhülsen aufheben, die von der Automatik bei den Schüssen ausgeworfen wurden? Sie könnten die Spur zu der Waffe sein, die ja nicht neu war. Würde er Handschuhe tragen, weil die Schussexplosionen feine Pulverspuren auf der Haut hinterlassen? Hatte er seinen Fluchtweg so geplant, dass seine alten Beine ihn mühelos schaffen konnten? Würde er vorher seine Fingerabdrücke von der Waffe entfernen, so wie ich meine entfernt hatte? Nichts davon, ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber irgendeine Sicherung musste er eingebaut haben, er war schließlich kein Idiot.
Der Gedanke beruhigte mich ein wenig, und ich versuchte, wieder zu schreiben. Aber da war noch etwas, irgendeine Kleinigkeit, die mir wichtig schien, um die ganze Angelegenheit zu verstehen, ich wusste, dass da noch etwas war, aber ich kam nicht drauf. Ich hatte irgendetwas übersehen. Oder überhört. Ich legte den Füller auf das Papier und starrte ihn an, als sei dieses alte Schreibgerät, das einem großen Dichter gehört hatte, der Schlüssel zu Fernandez und seinem Plan. Es war der Füller, mit dem er die Widmung in das Buch geschrieben hatte, eindeutig, und das war schon eine Weile her. Er hatte ihn aus der Innentasche seines Jacketts genommen, bedächtig die Kappe abgeschraubt, sie auf das hintere Ende gesetzt, einen Moment überlegt und ein paar Sätze und seinen Namen hineingeschrieben. Schöne Sätze. Und mit dem Füller war er nicht umgegangen wie mit irgendeinem Gebrauchsgegenstand, es lag etwas Feierliches in der Art, wie er ihn handhabte. Und irgendwann hatte er aufgehört, ihn zu benutzen. Nicht nur das, er hatte ihn ganz außer Sicht geschafft, unter sein Bett in den alten Koffer. Das war es, was in mir dieses seltsame Gefühl ausgelöst hatte in der Rue Mouffetard, nicht der Gedanke an Lorcas grässlichen Tod, jetzt wusste ich es. Ich starrte lange und grübelte, und dann wurde aus dem Füller der Schlüssel, die Tür öffnete sich und mir fiel ein, was ich überhört hatte. Natürlich hatte ich es gehört, sehr deutlich sogar, aber schnell verdrängt und an das Geschäft gedacht, weil ich Geld brauchte.
»Eine alte Rechnung«, hatte Fernandez gesagt, »eine sehr alte.«
Eine sehr alte Rechnung. Und ein sehr alter, kluger Mann, der über die Dinge nachdenkt, bevor er sie angeht, ein Dichter, hört auf zu schreiben und trennt sich von dem Kostbarsten, was er besitzt. Er hatte seine Frau und seinen Sohn zurückgelassen und es nicht geschafft, sie herauszuholen, bis es zu spät war und die Faschisten sie umbrachten. So lange hatte er damit gelebt. Ich rannte los. Es regnete, und ich fand kein Taxi und rannte den ganzen langen Weg, die Rue Saint Jacques hoch, am Panthéon vorbei, an der Kirche Sainte Geneviève du Monte, und ich spürte den Regen nicht und nur einen stechenden Schmerz in der Brust, der so heftig wurde, dass ich innehalten musste. Ich stützte mich mit einer Hand gegen eine Mauer und brauchte einige Zeit, um meinen Herzschlag unter Kontrolle zu bringen. Du rauchst und säufst zu viel, ging mir durch den Kopf, und dann dachte ich wieder an Fernandez. Es war nicht mehr weit bis in die Rue Mouffetard und die Besenkammer unter dem Blechdach. Ich dachte lange an Fernandez da an der Mauer im Regen, stand mit gesenktem Kopf, und irgendwann wurden die Gedanken klar und einfach. Er hatte für die Waffe gespart und dabei Mahlzeiten ausgelassen, Tabak, das Glas Rotwein. Er hatte seinen Entschluss nicht erst vor drei Tagen gefasst. Langsam löste sich meine Hand von dem nassen Stein, und ich drehte mich um und ging zurück. Ich ging ohne Eile und ohne viel wahrzunehmen, und dabei fiel mir ein, dass ich bei Popoff meinen Füller vergessen hatte. Ich ging schneller und dann rannte ich.
Stille und Tod
Levin ging langsamer, als das ockerfarbene Gebäude in Sicht kam. Er ging an gestutzten Hecken entlang, hinter denen ähnliche Anwesen lagen. Man musste viel sauber geschnittenen Rasen überqueren, um an ihre Türen zu gelangen. Gepflasterte Wege schlängelten sich durch Blumenrabatten und an exotischen Büschen und kleinen Teichen vorbei, und auf dem geharkten Kies der Vorplätze standen Limousinen und Sportwagen. Sie ähneln sich wie Klone, dachte Levin, irgendwie sind sie alle gleich. Wo ist der Unterschied zwischen denen und Santi? Es begann zu regnen, und er schlug den Mantelkragen hoch. Er ging jetzt langsam genug, um sicher zu sein, dass niemand sein leichtes Hinken bemerkte. Als er vor dem schmiedeeisernen Gittertor anlangte, blieb er stehen und sah nach dem Haus hinüber. Das ausladende Schieferdach glänzte schwarz im Regen, und von einigen der grün lackierten Fensterläden blätterte die Farbe. Er stand still, mit den Händen in den Manteltaschen, und nach einer Weile drückte er den Klingelknopf in dem rechten Torpfeiler. Es dauerte einige Zeit, bis eine Frauenstimme sich meldete. Sie klang blechern und leicht verzerrt durch die Sprechanlage.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!