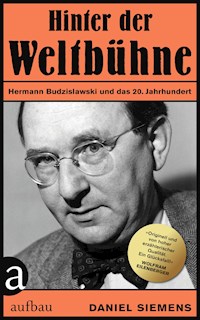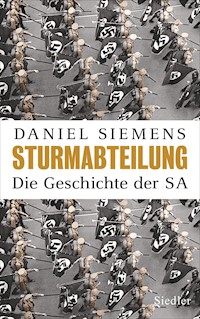
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das große Standardwerk über die Geschichte der SA
Dies ist die erste umfassende Geschichte der SA. Daniel Siemens, einer der renommiertesten deutschen Historiker der jüngeren Generation, beschreibt darin den Aufstieg der Ordnertruppe, die für die Hitlerbewegung den Straßenkampf gegen die politischen Feinde ausfocht. Bis zu den frühen dreißiger Jahren verwandelte sich die SA dann von einer Schlägertruppe zum entscheidenden Faktor bei der Machteroberung der Nationalsozialisten. In seinem Standardwerk zeigt Daniel Siemens zudem, wie sogar nach den Säuberungen beim „Röhm-Putsch“ 1934 die SA eine überraschend aktive Rolle in der nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik und dem Holocaust spielte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1088
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die SA war zu Beginn des »Dritten Reichs« zu einer straff organisierten und im gesamten deutschen Staatsgebiet präsenten Organisation herangewachsen. Sie war der Reichswehr nachgebildet und konkurrierte mit dieser um die Rolle als »Waffenträgerin der Nation«.
Während die Reichswehr aufgrund des Versailler Vertrags offiziell eine Stärke von 100 00 Mann nicht überschreiten durfte, hatte die SA mehr als 3 Millionen Mitglieder. In eine gewöhnliche Vorlage aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wurden im Frühjahr 1934 die Gebietsgrenzen der Obergruppen, Gruppen und Brigaden der SA eingezeichnet, was die Karte (links) zur Geheimsache werden ließ. Obwohl die NSDAP wie die SA in dieser Zeit in Österreich verboten waren, ist die Obergruppe XI (Österreich) wie selbstverständlich einbezogen.
Übersichtstafeln wie die im Nachsatz abgebildeten zeigen die Rangzeichen und Flaggen der SA und liefern Hinweise auf deren Herkunft. Sie dienten als Schulungsmaterial für neue Mitglieder, die mit den dem Militär nachempfundenen Grundzügen der Organisation noch nicht vertraut waren, und als Nachschlagewerk. Kenntnisse über den Rang eines SA-Führers sowie über die Herkunft der von ihm befehligten Einheit waren bei den Paraden und Massenaufmärschen der NSDAP von großem praktischen Nutzen.
Zum Buch
Dies ist die erste umfassende Geschichte der SA. Daniel Siemens, einer der renommiertesten deutschen Historiker der jüngeren Generation, beschreibt darin den Aufstieg der Ordnertruppe, die für die Hitlerbewegung den Straßenkampf gegen die politischen Feinde ausfocht. Bis zu den frühen dreißiger Jahren verwandelte sich die SA dann von einer Schlägertruppe zum entscheidenden Faktor bei der Machteroberung der Nationalsozialisten. In seinem Standardwerk zeigt Daniel Siemens zudem, wie sogar nach den Säuberungen beim »Röhm-Putsch« 1934 die SA eine überraschend aktive Rolle in der nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik und dem Holocaust spielte.
Zum Autor
Daniel Siemens, geboren 1975 in Bielefeld, ist Professor für Europäische Geschichte an der Newcastle University und Fellow der Royal Historical Society. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, darunter der hochgelobten Studie »Horst Wessel. Tod und Verklärung eines Nationalsozialisten« (Siedler 2009), die mit dem Preis Geisteswissenschaften International ausgezeichnet wurde.
DANIEL SIEMENS
STURMABTEILUNG
Die Geschichte der SA
Aus dem Englischen von Karl Heinz Siber
Siedler
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Stormtroopers: A New History of Hitler’s Brownshirts« bei Yale University Press.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erste Auflage
Copyright © 2017 by Daniel Siemens
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: ullstein bild/Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl
Karte Deutsches Reich und Österreich: Auswärtiges Amt – Politisches Archiv
Tableau Rangabzeichen und Flaggen: Julius Moritz Ruhl, Carl Starke und Kurt Bauer, Adolf Hitlers Braunhemden, Leipzig 1933, S. 18 und 23
Lektorat und Satz: Büro Peter Palm, Berlin
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-15535-3V002
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Einleitung Eine Nacht der Gewalt
Machtprobe in der Provinz
Grenzland-Nationalismus
Schläger, Mörder und politische Hooligans
Neue Perspektiven
Zwei Seiten der Gewalt
Der Gang der Untersuchung
TEIL I
1 Die Anfänge der nationalsozialistischen SA
Im Kampf um die Nachkriegsordnung
Die Gründung der SA
Ein öffentliches Ärgernis
Das Krisenjahr 1923
Die Nachwirkungen des Putsches
2Die SA und die Politik der Straße
Frühe Weichenstellungen
Von der Splittergruppe zur Massenbewegung
Bedeutung und Wirkung der braunen Uniform
Sarkasmus als Waffe?
Die Eskalation der Gewalt
Erwerbslosigkeit und soziale Unruhen in der SA
SA auf dem Land
Die Gefahr der frühen SA-Gewalt
3Der braune Kult um Jugendlichkeit und Gewalt
Militante Männlichkeit
NS-Aktivistinnen
Emotionale Bedürfnisse und ihre Befriedigung
SA-Merchandising
Geschäfte mit der Zigarettenindustrie
Moderne Kreuzritter
SA und Reichswehr
TEIL II
4Terror, Begeisterung und Enttäuschung
Gemischte Gefühle im Moment des Sieges
Die Erniedrigung des Gegners
Reaktionen
Über dem Gesetz
Die Eingliederung des Stahlhelms
Die Nazifizierung des deutschen Hochschulwesens
Griffe in die Staatskasse
Auf dem Weg zu einer zweiten »Revolution«?
5Der »Röhm-Putsch« und der Mythos vom homosexuellen Nazi
Showdown
»Reichsmordwoche«
Konsequenzen
TEIL III
6Die Wandlungen der SA zwischen 1934 und 1939
Auf der Suche nach neuen Aufgaben
Antisemitische Gewalt und die Grenzen der Volksgemeinschaft
Das Vordringen der SA in die bürgerliche Gesellschaft
Die Österreichische Legion
Die SA im Sudetenland und im Memelgebiet
Vom Bedeutungsgewinn an der Peripherie ins Zentrum der Gesellschaft
7Die SA und die »Germanisierung« des europäischen Ostens
Frühe Siedlungsinitiativen
Siegfried Kasche und die ambitionierten Siedlungspläne der SA
Bauern und Ideologen
Vom Mitwirken beim Aufbau einer deutschen »Volksgemeinschaft« in Osteuropa
8Die SA im Zweiten Weltkrieg
SA und Wehrmacht
Die Anfänge des Krieges
Die SA-Standarte Feldherrnhalle
Kommunistische Propaganda
Generalgouvernement, Protektorat, Slowenien
An der Heimatfront
Bis zum letzten Mann
Die Niederlage vor Augen
Alltagsfanatismus
9Diplomaten im Braunhemd und der Holocaust in Südosteuropa
SA-Führer im Auswärtigen Amt
Der Kampf hinter den Kulissen
Die Durchführung des Holocausts in der Slowakei
Tödliche Varianten
Bilanz
Vergessen oder Erinnern?
TEIL IV
10Was bleibt? Deutungskämpfe der Nachkriegszeit
Die SA vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg
Fehlgeleitete Idealisten?
Umgeschriebene Geschichte(n)
Die Politik der Erinnerung
FazitDie SA und der Nationalsozialismus. Eine Bilanz
ANHANG
Anmerkungen
Personenregister
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Es freut mich sehr, dass meine ursprünglich auf Englisch verfasste und im Jahr 2017 bei Yale University Press in London und New Haven veröffentlichte Geschichte der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA) nun auch auf Deutsch vorliegt. Geschrieben habe ich das Buch seit 2012 zunächst mit Blick auf ein internationales Publikum in der Hoffnung, dass es zeitgeschichtlich Interessierten wie Experten für die Geschichte des Nationalsozialismus noch Neues bieten könnte. Anfangs ging ich davon aus, dass das Werk keine übermäßige aktuelle Relevanz erfahren würde. Die Zeiten der politischen Straßengewalt, der antisemitischen Verfolgungen und auch des religiös verbrämten Nationalismus schienen in Europa überwunden. Gerade in Deutschland war in der liberalen Öffentlichkeit die optimistische Ansicht verbreitet, dass die historische Erfahrung mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen diese politische Ideologie ein für alle Mal delegitimiert hatte.
Inzwischen hat sich Skepsis ausgebreitet. In den letzten Jahren wurde uns deutlich vor Augen geführt, wie fragil die demokratisch verfassten Gemeinwesen der Gegenwart sind. Die jahrzehntelang vorherrschende Auffassung, Bonn sei nicht Weimar, die Bundesrepublik also nicht mit der kurzlebigen Weimarer Republik zu vergleichen, hat angesichts des wiedererstarkten Populismus in vielen Ländern des alten Westens zu Beginn des 21. Jahrhunderts erheblich an Überzeugungskraft eingebüßt. Das ehemals so stabile deutsche Parteiensystem hat sich deutlich verändert; neue politische Kräfte, die Grundüberzeugungen der liberalen Gesellschaften infrage stellen, sind in der Bundesrepublik ebenso wie in vielen anderen Ländern Europas auf dem Vormarsch. Ob es sich dabei um eine dauerhafte Verschiebung der politischen Koordinaten oder lediglich um eine temporäre Erscheinung handelt, ist eine Frage, zu deren Beantwortung der Historiker wenig beitragen kann. Er kann aber gegenwärtige Entwicklungen vor dem Hintergrund des historischen Erkenntnisstandes einordnen.
Die hier vorgelegte Geschichte vom Aufstieg und Fall der SA ist aus drei Gründen von besonderem Interesse: Erstens zeigt sie exemplarisch, welche Sprengkraft eine Politik der Straße entfalten kann, wenn sie tief sitzende Emotionen schürt, an traditionelle nationale und religiöse Überzeugungen anknüpft und vor dem Einsatz selbst massiver Gewalt nicht zurückschreckt. Zweitens macht sie die Gefahren deutlich, die sich für ein demokratisches Gemeinwesen ergeben, wenn sich gesellschaftliche Debatten in nahezu hermetisch abgeriegelten Teilöffentlichkeiten abspielen und missliebige Argumente und politische Positionen als fake news abgetan werden. Drittens schließlich kann man verfolgen, welch ungewöhnlich starke Loyalität gerade jene Gesellschaftsschichten, für die sich die politischen Eliten nur am Rande interessieren, entwickeln können, wenn man tatsächlich oder auch nur vorgeblich eine Politik in ihrem Sinne macht. Angesichts der radikalen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten gerät heute allzuleicht in den Hintergrund, dass diese politische Bewegung Angehörige sehr verschiedener gesellschaftlicher Gruppen für sich zu gewinnen vermochte. Die Geschichte der SA zeigt an vielen Beispielen, wie attraktiv die Vision einer nationalsozialistischen »Volksgemeinschaft« war – für die Zeit vor der »Machtergreifung« wie im späteren »Dritten Reich« und selbst noch lange nach 1945.
Der Siedler Verlag und hier besonders der ehemalige Programmleiter Tobias Winstel haben früh Interesse an diesem Projekt gezeigt. Karl Heinz Siber hat engagiert die Übersetzung besorgt; das Schlusslektorat erledigte Ditta Ahmadi auf die gewohnt zuverlässige Weise. Ich danke ihr sehr für die vertrauensvolle Zuammenarbeit in den letzten Monaten. Auch allen anderen Beteiligten im Verlag gilt mein herzlicher Dank. Gewidmet sei dieses Buch meinen Eltern. Ich verdanke ihnen viel.
Newcastle upon Tyne, den 25. Januar 2019
Daniel Siemens
Einleitung Eine Nacht der Gewalt
Aus der Dunkelheit der Schlafkammer kriechen die unzähligen Heiligenbilder von den Wänden.
Werden lebendige Zerrgestalten und dringen halb lächerlich, halb feindselig auf ihn ein.
AUGUST SCHOLTIS, 19311
Der 9. August 1932 war in der preußischen Provinz Oberschlesien ein kühler Sommertag und die sich anschließende Nacht ungewöhnlich frisch. Es sollten die letzten Stunden im Leben des 35-jährigen erwerbslosen Arbeiters Konrad Pietrzuch aus Potempa sein.2 Das unscheinbare Dorf im Kreis Tost-Gleiwitz hatte weniger als tausend Einwohner und lag nur drei Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Hier lebte Pietrzuch mit seinem jüngeren Bruder Alfons und seiner 68-jährigen Mutter Maria in einer einfachen Hütte, deren Wände mit Heiligenbildern geschmückt waren. Fenster gab es keine.3
Die drei schliefen, als in den Morgenstunden des 10. August mehrere bewaffnete Männer anrückten. Sie kamen aus den umliegenden Dörfern und waren Mitglieder der lokalen Ortsgruppe der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA), im Volksmund auch »Braunhemden« genannt. Die Angreifer gingen in Stellung, öffneten die unverriegelte Tür und brüllten: »Aus dem Bett, ihr verfluchten polnischen Kommunisten! Hände hoch!« Ohne eine Reaktion abzuwarten, drangen die Bewaffneten in das Haus ein, stießen die Mutter vor die Tür und zerrten den Sohn Konrad aus dem Bett. Sie prügelten hemmungslos auf ihn ein, bis schließlich ein SA-Mann einen Schuss auf ihn abgab. Alfons hörte den Schuss, während er mit dem Gesicht zur Wand stand und mit beinahe ebenso großer Wut misshandelt wurde, wohl mit einem Billardqueue oder einem Schlagstock. Seiner späteren Zeugenaussage zufolge dauerte der Überfall fast eine halbe Stunde. Kurz vor 2 Uhr fuhren die Angreifer schließlich in Richtung des benachbarten Dorfes Broslawitz (heute Zbrosławice in Polen) davon. Alfons hatte eine stark blutende Kopfwunde und war einige Zeit bewusstlos. Konrad Pietrzuch war tot.4
Der von dem Gerichtsmediziner Dr. Weimann angefertigte Autopsiebericht bezeugt die Brutalität des Überfalls: Nach den Feststellungen des Pathologen wies der Leichnam Konrad Pietrzuchs
im ganzen 29 Verwundungen [auf], von denen zwei verhältnismäßig gering waren. Besonders schwere Verletzungen wies die Leiche am Hals auf. Die Halsschlagader war vollkommen zerrissen. Der Kehlkopf hatte ein großes Loch. Der Tod ist durch Ersticken eingetreten, da das aus der Halsschlagader sich ergießende Blut durch den Kehlkopf in die Lunge gedrungen ist. Die tödliche Verletzung muss dem Pietrzuch beigebracht worden sein, als er auf dem Boden lag. Der Hals zeigt außerdem Hautabschürfungen, die von einem Fußtritt unbedingt herrühren. Außer diesen Verletzungen ist Pietrzuch am ganzen Körper zerschlagen. Er hat schwere Schläge mit einem stumpfen Beil oder einem Stock über den Kopf bekommen. Und andere Wunden, die so aussehen, als ob mit der Spitze des Billardstockes ihm ins Gesicht gestoßen worden sei.5
Die Behörden befürchteten, politisch interessierte Kreise könnten darauf aufmerksam machen, wie übel der Leichnam zugerichtet war. Daher beschlagnahmten sie diesen sofort nach Bekanntwerden des Verbrechens, um ihn »den Blicken der Kommunisten zu entziehen« und zu verhindern, dass diese Fotos von dem Toten machen und zu Propagandazwecken in Umlauf bringen konnten.6
Machtprobe in der Provinz
Verbrechen von solch außerordentlicher Brutalität waren zu jener Zeit nicht selten. In den Tageszeitungen vom Sommer 1932 lassen sich beinahe täglich Meldungen über Angriffe von Nationalsozialisten vor allem auf sozialistische und kommunistische Arbeiter, aber auch auf Juden finden.7 Zwischen 6. und 9. August 1932 etwa berichtete die jüdische CV-Zeitung jeden Tag von Sprengstoff- und Handgranatenanschlägen aus den oberschlesischen Städten Hindenburg (heute Zabrze), Gleiwitz (Gliwice) und Beuthen (Bytom).8 Mit Blick auf den Sommer 1932 konstatieren Historiker für Schlesien eine regelrechte »Terrorkampagne« von SA-Banden. Das war unter anderem eine Reaktion darauf, dass die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) bei der Reichstagswahl vom 31. Juli zwar die meisten Stimmen geholt hatte, es aber dennoch nicht zu einer Regierung unter Führung Hitlers gekommen war.9
Dass der Mord von Potempa landesweit Schlagzeilen machte, lag vor allem an der neuen Notverordnung »gegen politischen Terror«, die just am Tag des Mordes in Kraft getreten war.10 Diese Notverordnung sah die Todesstrafe für politisch motivierte Mordtaten vor, ein beinahe schon verzweifelter Versuch der Regierung unter dem Reichskanzler Franz von Papen, die im wahrsten Sinne des Wortes alltägliche Gewalt einzudämmen und das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen. Kapitalverbrechen mit politischem Hintergrund sollten von neu einzurichtenden Sondergerichten umgehend abgeurteilt werden. Aber auch dieser letzte Versuch, die Weimarer Republik zu retten, blieb wirkungslos. Wenige Monate später gab es sie nicht mehr.11 Joseph Goebbels, seit 1926 Gauleiter der NSDAP in Berlin und Brandenburg, lag in seiner Einschätzung richtig, als er am 10. August 1932 – wohl bevor er von dem Mord in Potempa erfuhr – in sein Tagebuch schrieb: »Telephon von Berlin: neue Notverordnung mit Standrecht […]. Aber das hilft alles nichts mehr.«12
Am 11. August, am Tag nach dem Mord, verhaftete die Polizei neun Männer als die mutmaßlichen Täter: den Bergmann und SA-Scharführer August Gräupner (geboren 1899), den Hauer und NSDAP-Mann Rufin Wolnitza (1907), den Elektriker Reinhold Kottisch (1906), den SA-Truppführer und Markenkontrolleur Helmuth-Josef Müller (1898), einen ehemaligen Polizeibeamten namens Ludwig Nowak (1891) und die Bergleute Hippolit Hadamik (1903) und Karl Czaja (1894). Inhaftiert wurden auch zwei Gastwirte, die bei dem Verbrechen eine Rolle gespielt hatten: der SA-Mann Paul Lachmann (1893), der in Potempa Gemeindevorsteher war, und der Gastwirt Georg Hoppe (1889), Inhaber eines Lokals im Nachbardorf Tworog, das den dortigen SA-Leuten als Stammkneipe (»Sturmlokal«) diente.13 Vier weitere mutmaßlich Beteiligte, darunter der Metzger Paul Golombek, wahrscheinlich einer der Haupttäter, hatten sich aus dem Staub gemacht.14 Wie sich aus den Geburtsdaten und Berufen der Angreifer schließen lässt, repräsentierten die zwischen 25 und 43 Jahre alten Männer einen typischen Querschnitt der männlichen Einwohnerschaft Oberschlesiens. Nach Einschätzung des Historikers Richard Bessel, der sich detailliert mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten in Schlesien befasst hat, übten die Rädelsführer des Überfalls allesamt »ziemlich solide Berufe« aus, nach seiner Ansicht ein Indiz dafür, dass in dieser Region seinerzeit politische Überfälle und sogar Morde so leichthin zur Kenntnis genommen wurden, dass Angehörige der Mittelschicht sie »zwanglos« verübten oder zumindest rechtfertigten.15
Den Verhafteten wurde eine gute Woche später, vom 19. bis 22. August 1932, vor dem Beuthener Sondergericht der Prozess gemacht. Das Verfahren entwickelte sich zu einem Kräftemessen im nationalsozialistischen Lager, bei dem sich der von Hans Frank, dem späteren Generalgouverneur in Krakau, geführte Nationalsozialistische Juristenbund und die neu eingerichtete Rechtsabteilung der SA unter Leitung des Rechtsanwalts Walter Luetgebrune heftig befehdeten.16 Das Aufsehen, das der Fall erregte, suchten Frank wie Luetgebrune zu nutzen, um im parteiinternen Konkurrenzkampf Punkte zu sammeln. Dabei war ihnen jedes Mittel recht. Sie schüchterten Gegenspieler und ortsansässige NS-Juristen ein und verteilten Geschenke an die Angeklagten, um sich deren Gunst zu sichern. Dieser »Bruderkampf« wirkte sich sehr zum Nachteil der Angeklagten aus, da die Rivalität unter den NS-Anwälten »eine reibungslose und wirksame Verteidigung praktisch unmöglich machte«.17
Gestützt auf die ausführlichen Aussagen von Zeugen und Angeklagten und in Anbetracht der Tatsache, dass die politische Einstellung der Angeklagten in der Region gut bekannt war, gelangte das Gericht zu einer plausiblen Rekonstruktion des Tathergangs. Demzufolge hatte Nowak, Führer des SA-Sturms 26 in Broslawitz, am frühen Abend des 9. August 1932 eine Gruppe von SA-Männern beauftragt, Gewaltakte zu verüben, um »die Region in Angst und Schrecken zu versetzen«.18 Diese Gruppe war zunächst zu Hoppes SA-Sturmlokal im nahe gelegenen Tworog gefahren. Hoppe, Führer des dortigen SA-Sturms 27, hatte die Männer mit Waffen ausgestattet und sie dann nach Potempa geschickt. Dort hatten sie bei dem Gastwirt Lachmann reichlich Alkohol und Zigaretten konsumiert. Lachmann und sein Freund, der Metzger Golombek, hatten den Männern dann offenbar die Namen von vier Personen genannt, die überfallen werden sollten.19 Pietrzuch war einer von ihnen. Nur durch Zufall blieb dieser tödliche Überfall der einzige in dieser Nacht. Die stark angetrunkenen SA-Männer suchten danach zwar noch zwei weitere Häuser im Ort auf, waren aber nicht mehr in der Lage, Überfälle zu begehen.
Lachmann räumte später ein, dass der mörderische Ausflug zu dem ortsbekannten, aber harmlosen Querulanten Pietrzuch nicht nur politische Gründe gehabt habe, sondern auch persönliche Motive im Spiel gewesen seien. Pietrzuch habe in seinem Lokal mehrfach Gäste beleidigt. Auch habe er in den zurückliegenden Jahren polnische Aufständische, die eine Angliederung Oberschlesiens an Polen mit Gewalt durchsetzen wollten, unterstützt.20 Der ausschlaggebende Grund dürfte aber gewesen sein, dass der Gastwirt fürchtete, Pietrzuch werde Lachmanns regelmäßiges Wildern in den umliegenden Wäldern öffentlich machen.21 Ein kommunistisches Pamphlet behauptete darüber hinaus, der Gemeindevorsteher Lachmann habe den erwerbslosen und mit Polen sympathisierenden Pietrzuch-Brüdern Sozialleistungen vorenthalten.22 »Politische« und »persönliche« Motive waren bei dieser Tat letztlich unauflösbar miteinander verknüpft, und das galt auch für viele andere Gewaltvorfälle in den späten Jahren der Weimarer Republik.
Am 22. August 1932 verhängte das Beuthener Sondergericht gegen fünf der Angreifer die Todesstrafe: Lachmann wegen »Anstiftung zum politischen Totschlag« und Kottisch, Wolnitza, Gräupner und Müller wegen »Totschlags, begangen aus politischen Beweggründen«. Hoppe erhielt wegen »Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung« eine zweijährige Gefängnisstrafe. Die übrigen drei Angeklagten – Hadamik, Czaja und Nowak – wurden freigesprochen.23 Die Angeklagten quittierten die Urteilsverkündung mit den Rufen »Heil Hitler!« und »Nieder mit dem Justizsystem!«.24 In den Verhandlungstagen zuvor hatten sie im Gerichtssaal einen überraschend »lässigen und fast lebhaften Humor« an den Tag gelegt, wie die Zeitungen berichteten. Mehreren NS-Funktionären, die den Prozess verfolgten – unter ihnen der berüchtigte SA-Führer für Schlesien, Edmund Heines –, hatten die Angeklagten im Gerichtssaal den Faschistengruß entboten. Auch die Aussicht auf die Todesstrafe schien sie nicht besonders zu schrecken. Eine nationalsozialistische Zeitung lobte dieses Verhalten ausdrücklich und prophezeite, dass sich im ganzen Land ein Proteststurm erheben werde, falls das Gericht »es wagen würde, auch nur ein einziges Todesurteil zu verhängen«.25
Das Urteil löste in der Region und in Teilen der Gesellschaft starke Proteste aus und stachelte etliche der nationalsozialistischen Unterstützer, die sich auf den Straßen um das Gerichtsgebäude versammelt hatten, um die Richter unter Druck zu setzen, zu Ausschreitungen an. Der von der Londoner Times nach Beuthen entsandte Korrespondent berichtete: »Die Tumulte um das Gerichtsgebäude erreichten ein solches Ausmaß, dass mit Stahlhelmen ausgestattete und mit Karabinern und automatischen Pistolen bewaffnete Polizei herbeigerufen werden musste.« Mit Unterstützung der zur Verstärkung aus der schlesischen Hauptstadt Breslau herbeigeeilten SA-Einheiten beherrschten die Nationalsozialisten zumindest am Tag der Urteilsverkündung die Straßen von Beuthen – nicht nur in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes, sondern auch in Straßenzügen abseits des Zentrums, wo die Fenster mehrerer Läden und der Räume einer sozialistischen Zeitungsredaktion eingeschlagen wurden. Aus Angst vor den Ausschreitungen schlossen jüdische Ladeninhaber ihre Geschäfte und ließen die Rollläden herunter.26
Nach dem Urteilsspruch hatte der schlesische SA-Führer Heines, der seit September 1930 für die NSDAP im Reichstag saß, noch im Gerichtssaal gedroht: »Das deutsche Volk wird bald andere Urteile sprechen.« Der Richterspruch von Beuthen werde ein Fanal der Hoffnung auf das »Erwachen« Deutschlands sein.27 Wenig später verkündete er diese Botschaft noch einmal vom Balkon eines nahe gelegenen Cafés vor der dort versammelten Anhängerschar erneut.28 Heines trat in Beuthen nicht zum ersten Mal als selbst ernannter Richter auf. Bereits 1920 hatte er als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Roßbach, einer berüchtigten, in Westpreußen und im Baltikum kämpfenden Freikorpseinheit, einen angeblichen Verräter »verurteilt« und hingerichtet. Im Mai 1929 war er für dieses Verbrechen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, doch nach Hinterlegung einer Kaution von 5000 Reichsmark auf freien Fuß gesetzt worden. Wenig später hatte er sich auf einer NSDAP-Kundgebung im Berliner Sportpalast stolz als »Femerichter« präsentiert.29
Adolf Hitler, dessen NSDAP seit den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 die größte Fraktion im Parlament stellte, nutzte die Vorfälle in Oberschlesien umgehend für einen politischen Angriff auf die Reichsregierung. Wenige Stunden nach Bekanntwerden des Urteils versicherte er den Tätern per Telegramm seine »unbegrenzte Treue« und bezeichnete den Richterspruch als »ungeheuerliches Bluturteil«. Obwohl der Form nach nur an die fünf zum Tode verurteilten Männer gerichtet, war das Telegramm, in dem Hitler die konservative Regierung Papen scharf kritisierte und eine Aufhebung des Urteils zur nationalen Pflicht erklärte, als Appell an alle seine Anhänger gedacht: »Eure Freiheit ist von diesem Augenblick an eine Frage unserer Ehre. Der Kampf gegen eine Regierung, unter der dies möglich war, unsere Pflicht!«30 Auch Hermann Göring schickte den verurteilten Männern ein aufmunterndes Telegramm und spendete 1000 Reichsmark für ihre Familien. SA-Stabschef Ernst Röhm kam sogar persönlich nach Beuthen und besuchte die SA-Männer im Gefängnis.31 Warum die NS-Führer sich offen zu den Mördern von Potempa bekannten, obgleich deren Untat in Deutschland und in der internationalen Presse Entsetzen und Empörung ausgelöst hatte, wird besser verständlich, wenn man sich die ausgiebige »Proklamation« anschaut, die Hitler am 24. August 1932 in der Parteizeitung Der Völkische Beobachter abdrucken ließ. Er erklärte darin pathetisch:
Über 300 niedergemetzelte, ja oft buchstäblich abgeschlachtete Parteigenossen zählen wir als tote Märtyrer. Zehntausende und abermals Zehntausende sind verletzt […]. Erst in dem Augenblick, da endlich das Maß zum Überlaufen voll war und der Terror der roten Mord- und Verbrecherorganisationen unerträglich wurde, schwang sich die »nationale« Regierung von Papen blitzschnell zu einer Handlung auf. […] Deutsche Volksgenossen! Wer von euch ein Gefühl für den Kampf um die Ehre und Freiheit der Nation besitzt, wird verstehen, weshalb ich mich weigerte, in diese bürgerliche Regierung einzutreten. […] Wir werden den Begriff »national« befreien von dieser Umklammerung durch eine Objektivität, deren wirkliches innerliches Wesen das Urteil von Beuthen gegen das nationale Deutschland aufpeitscht. Herr von Papen hat damit seinen Namen mit dem Blut nationaler Kämpfer in die deutsche Geschichte eingezeichnet.32
Joseph Goebbels, durch seine diffamierenden Angriffe auf politische Gegner bereits berüchtigt, bereicherte die NS-Propaganda zum Fall Potempa noch um die charakteristischen Note des Antisemitismus. Sein Leitartikel für den Angriff, die in Berlin erscheinende NS-Tageszeitung, die er selbst 1927 gegründet hatte und seither leitete, veröffentlichte er unter der in fetten Lettern gesetzten Überschrift: »Die Juden sind schuld«.33 Goebbels wiederholte diese Aussage in dem Artikel mehrfach, ohne jedoch irgendeine logisch nachvollziehbare Verbindung zwischen diesem Vorwurf und dem Verbrechen herzustellen. Seine Strategie war ebenso simpel wie wirkungsvoll, zumindest mit Blick auf die Anhänger der NSDAP: Er lenkte ihre Frustration und Wut über das Urteil sowie ihren Unmut über die politische und wirtschaftliche Lage ganz allgemein auf die Juden, die üblichen Sündenböcke der Nationalsozialisten. Auch vor direkten Gewaltandrohungen schreckte er nicht zurück: »Die Stunde wird kommen, da die Staatsmacht andere Pflichten zu erfüllen haben wird, als diejenigen vor dem Zorn des Volkes zu beschützen, die das Volk verraten haben.«34 Die Behörden reagierten auf Goebbels’ Hetze und seine Pogromaufrufe mit einem einwöchigen Publikationsverbot für den Angriff, das im Grunde völlig wirkungslos blieb.
Indem Hitler und andere führende Nationalsozialisten die Tatsachen verdrehten und explizit mit politischer Gewalt drohten, stachelten sie das Millionenheer ihrer Anhänger auf, insbesondere die in der SA organisierten. Diese Männer rechneten bereits im Sommer 1932 mit einer unmittelbar bevorstehenden Machtübernahme der NSDAP. Die NS-Führung vertraute darauf, dass unter diesem hohen Erwartungsdruck und in einem durch tiefe ideologische Zerrissenheit und wechselseitigen Hass geprägten politischen Klima nur wenige den Tod eines einfachen Arbeiters bedauern würden, der zudem angeblich für die polnische Sache gekämpft hatte.35 Dabei half auch, dass Hitler auf die SA bauen konnte, die nötigenfalls täglich neue blutige Zusammenstöße provozieren würde.36 In einer solch gewalttätigen Zeit würden die Details einer einzelnen Mordtat schnell in Vergessenheit geraten und nur ihr politischer Widerhall im öffentlichen Gedächtnis haften bleiben.
Im Kampf um die Deutungshoheit über die Tat gaben die NSDAP und ihre Zeitungen sich jede erdenkliche Mühe, die Schuld für den Mord von Potempa dem Opfer selbst, der kommunistischen Bewegung oder allgemeiner dem »jüdisch-marxistischen System« in die Schuhe zu schieben.37 Ein Gedicht, das angeblich aus der Feder eines einfachen SA-Mitglieds stammte und Anfang September 1932 in einem schlesischen NS-Blatt erschien, illustriert diese Verkehrungen besonders anschaulich:
Beuthen! Noch steht es am Horizont,Noch strahlt es düster und rot, Beuthen! Fünf Kameraden klagen anDahinter lauert der Tod.
Deutschland! Hörst Du ihr Drohen nicht?Nicht der Millionen Schrei?Es klingt durch die Städte, braust durch das LandGebt unsere Kameraden frei!
Für ihre Freiheit marschiert ein Heer,Zusammengeschweißt durch BlutEin Führer, ein Glaube und ein PanierGetragen durch Treue und Mut.
Der Glaube an Volk und Vaterland.Die Treue dem Führer, den ZielenDer Mut, mit dem in Stadt und LandDie braunen Toten fielen.38
Eine vollkommenere Umdeutung lässt sich kaum vorstellen: Das Opfer des Verbrechens, der ermordete Pietrzuch, wurde mit diesen Zeilen ein zweites Mal hingerichtet, während die fünf zum Tode verurteilten Mörder zu Helden erhoben wurden, geehrt als mutige Männer, die ihre Treue zur nationalsozialistischen Sache unter Beweis gestellt hätten und sich dafür des Zuspruchs von Millionen ihrer Landsleute sicher sein könnten. Die Unverfrorenheit, mit der führende Nationalsozialisten ihre Sichtweise unters Volk brachten, offenbare die »schreckliche Barbarisierung des deutschen politischen Lebens«, schrieb der britische Journalist Frederick A. Voigt 1932.39 Eine NS-Parteizeitung bezeichnete den ermordeten Pietrzuch als »polnischen Schuft« und »Untermenschen«, der »das Recht, auf deutschem Boden zu leben, seit langem verwirkt« habe.40 Auf ganz ähnliche Weise rechtfertigte der Schriftsteller und NS-Ideologe Alfred Rosenberg – dem breiten Publikum als Verfasser des 1930 erschienenen Buchs Der Mythus des 20. Jahrhunderts bekannt – die Tötung Pietrzuchs als einen »Lynchmord« – nach Rosenbergs Verständnis die »einzig mögliche Korrektur eines widernatürlichen Rechts«. In den USA bestehe, wie er erläuterte, »zwischen dem weißen Mann und dem Neger eine förmliche Gleichberechtigung, aber in der Praxis werden sie unterschiedlich behandelt«. Den »nordischen« Deutschen forderte er kaum verhüllt auf, eine ähnliche und potentiell tödliche Unterscheidung zwischen »Ariern«, Slawen und Juden zu treffen.41
Die gewalttätige Rhetorik konnte jedoch nicht verdecken, dass sich die Führung der NSDAP im Herbst 1932 in einer schwierigen Lage befand. Käme es zur Hinrichtung der zum Tode verurteilten SA-Männer, so notierte Goebbels in sein Tagebuch, würde dies zu einer »unerträglichen« Lage führen.42 Er fürchtete, dass dann der Druck vonseiten der ungeduldigen NS-Anhängerschaft so stark werden würde, dass eine offene Konfrontation mit der Staatsgewalt – für die Hitler in diesen Tagen den Ausdruck »Guillotinenregierung« prägte – unvermeidlich war.43 Eine solche Kraftprobe würde, egal wie sie ausging, die Beteuerung der Nationalsozialisten, auf legalem Weg nach der Macht zu streben, als Lüge entlarven. Doch das Preußische Staatsministerium, das seit dem »Preußenschlag« vom 20. Juli 1932 von dem katholischen Reaktionär Franz von Papen geführt wurde, gab dem Druck der verschiedenen nationalistischen Gruppen nach und wandelte die Todesurteile mit Wirkung vom 2. September 1932 in lebenslange Freiheitsstrafen um.44 So konnte die NSDAP ihr Scheinbekenntnis zum Rechtsstaat noch einige Monate aufrechterhalten.
Grenzland-Nationalismus
Der Mord von Potempa war ein für die damalige Zeit typischer Fall, da er die Erschütterungen und ethnischen Konflikte der unmittelbaren Nachkriegszeit mit der SA-Gewalt der frühen 1930er Jahre verband. In vielerlei Hinsicht prägten Kriegsende, Revolution und Bürgerkrieg die späteren Muster der Gewaltanwendung vonseiten der nationalistischen Rechten nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern.45 Bei dem tödlichen Überfall von Potempa war die enge Zusammenarbeit zwischen der SA und anderen nationalistischen Organisationen in der Region ein entscheidender Faktor. Die beiden jüngsten zum Tode verurteilten Täter, Reinhold Kottisch und Rufin Wolnitza, waren offiziell gar keine SA-Mitglieder, sondern gehörten dem Oberschlesischen Selbstschutz an. Zwischen den beiden Organisationen gab es in den frühen 1930er Jahren enge Verbindungen, wie sich auch daraus ersehen lässt, dass zumindest Wolnitza zugleich NSDAP-Mitglied war.46 Beide Männer wohnten bis zu ihrer Verhaftung in einem »SA-Heim« in Broslawitz und absolvierten dort paramilitärische Übungen, wobei vor allem die Besetzung von Straßen und Waldstücken, die Vorbereitung auf Schießereien sowie Angriffstechniken für Überfallkommandos trainiert wurden.47
Der Oberschlesische Selbstschutz war eine amtlicherseits geduldete paramilitärische Organisation, die nach dem Weltkrieg aufgebaut wurde und gegen polnische Nationalisten in den Grenzregionen vorging, deren Zugehörigkeit zwischen dem Deutschen Reich und dem wiedererstandenen polnischen Staat für Jahre umstritten und umkämpft blieb.48 Im Herbst 1918 hatten die Polen zunächst die Forderung erhoben, Oberschlesien, das sich seit dem 19. Jahrhundert dank seiner reichen Kohlevorkommen zu einem bedeutenden Industrierevier des Deutschen Reiches entwickelt hatte, in Gänze dem polnischen Staat zuzuschlagen. Führende deutsche Politiker wie auch die deutsche Öffentlichkeit hatten sich dieser Forderung aufs Heftigste widersetzt, wobei sie auf das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung pochten und darauf verwiesen, dass Oberschlesien trotz seines hohen polnischen Bevölkerungsanteils überwiegend deutsch geprägt und die Region für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar sei, die durch die militärische Niederlage bereits erheblich geschwächt war.49 Drei polnische Aufstände zwischen 1919 und 1921 mit dem missionarischen Anliegen, die heterogene Einwohnerschaft Oberschlesiens zu »re-polonisieren«, trugen wenig überraschend zur weiteren Anstachelung der nationalen Leidenschaften in den Städten und Dörfern Oberschlesiens bei.50
Das Eingreifen deutscher Freikorpsmilizen unter dem Befehl von populären Kämpfern wie Peter von Heydebreck, Hermann Ehrhardt, Wilfried von Loewenfeld oder Horst von Petersdorff schürte die Feindseligkeiten weiter. Diese Männer kämpften nicht nur gegen bewaffnete polnische Nationalisten, sondern jagten auch angebliche deutsche Verräter, was zeigt, dass nicht nur sprachliche und ethnische, sondern auch politische Grenzen innerhalb homogener ethnischer Gruppen heiß umkämpft waren.51 Der Gründer der sogenannten Spezialpolizei des Oberschlesischen Selbstschutzes, Heinz Oskar Hauenstein, später Gründungsmitglied der Berliner SA, brüstete sich 1921 in einem Gerichtsprozess, dass seine Organisation für mehr als 200 »Fememorde« verantwortlich sei. Als »Feme« – ein Begriff, der auf eine frühmittelalterliche germanische Strafpraxis zurückgeht – bezeichneten Rechtsextreme im Deutschland der Zwischenkriegszeit die Ermordung von »Verrätern«.52 Deutsche Freikorps exekutierten auch zahlreiche angebliche polnische Spione.53 Ein ehemaliger Freikorpsmann erklärte später zynisch: »Wir sparten uns die Kugeln beim Erledigen dieses Gesindels.«54 In der Anklageschrift in einem Prozess gegen Mitglieder der Brigade Ehrhardt vor dem Leipziger Reichsgericht bezeichnete 1922 sogar ein Staatsanwalt die Bekämpfung nationalistischer Polen durch deutsche Milizen verständnisvoll als einen Akt gerechtfertigter Notwehr. Solche Notwehr sei geboten, wenn es gelte, polnische Angriffe zurückzuschlagen, die »mit Hilfe ausländischer Mächte« durchgeführt würden und darauf gerichtet seien, »die Staats- und Wirtschaftsordnung Deutschlands zu vernichten«. Die Staatsanwaltschaft verwies dabei auf Beschlüsse der Interalliierten Kontrollkommission, der in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg von deutscher Seite vielfach propolnische Sympathien vorgeworfen wurden.55
Die Ressentiments der unmittelbaren Nachkriegsjahre hallten in den nationalistischen und scharf antipolnischen Einstellungen der oberschlesischen SA der frühen 1930er Jahre nach. Die antidemokratischen Grundüberzeugungen der Nationalsozialisten verschmolzen mit älteren, in der Region weitverbreiteten Einstellungen. Viele deutschstämmige Oberschlesier teilten den tiefen Unmut nationalistischer Kreise über die vermeintlich zu nachgiebige Haltung der Weimarer Regierungen in Angelegenheiten der nationalen Sicherheit, insbesondere bei der Verteidigung der deutschen Ostgrenzen.56 Vor diesem Hintergrund versuchte die oberschlesische SA nicht ohne Erfolg, sich als legitime Nachfolgerin der einstigen Freikorpsverbände darzustellen.57 Ihre Propaganda, die ebenso von führenden Figuren der extremen Rechten wie Manfred von Killinger, einem zur SA gestoßenen ehemaligen Freikorpsführer, überliefert ist, stellte diese »Abstammung« nachdrücklich heraus.58 Besonders in den unmittelbaren Grenzregionen präsentierten sich SA-Einheiten als Grenzwächter und behaupteten berufen zu sein, die nationale Einheit gegen Tschechen und Polen im Osten sowie gegen Franzosen im Westen zu verteidigen.59
Derartige Leidenschaften, die aus der Grenzland-Mentalität erwuchsen, zeigten sich allerdings nicht nur bei der SA. So organisierte der Nationalsozialistische Lehrerbund in Schlesien nach der Machtergreifung wiederholt »Trainingslager« für seine Mitglieder. Erklärter Zweck dieser zweiwöchigen Lehrgänge war es, das »Grenzbewusstsein« der deutschen Lehrer zu schärfen, worunter das rassisch und geschichtlich fundierte Wissen um die besondere Rolle Schlesiens als Teil des »alldeutschen Ostens« verstanden wurde.60 Viele deutsche Lehrer in der Region, die bereits seit den frühen 1920er Jahren eine heftige Abneigung gegen Polen und dessen Schutzmacht Frankreich hegten, brüsteten sich jetzt stolz mit ihrer vaterländischen »Grenzland-Perspektive« und gaben nationalistische Einstellungen und Ideen mit dem Segen der neuen Machthaber an ihre Schülerinnen und Schüler weiter.61
Diese kulturelle Prägung, die in der bisherigen Forschung nur wenig Beachtung gefunden hat,62 war eine der wichtigsten ideologischen Triebkräfte der SA und hat ihr Selbstverständnis und ihre Identität bis 1945 bestimmt. Angesichts der territorialen Expansionspolitik Deutschlands von Mitte der 1930er Jahre an, die zeitlich mit der Existenz- und Sinnkrise der SA nach der »Nacht der langen Messer« (30. Juni bis 2. Juli 1934) zusammenfiel, gewann das Selbstverständnis der SA als Organisation, die durch paramilitärisches Training, Leibesertüchtigung, ideologische Unterweisung und später auch durch aktive Kampfeinsätze im Zweiten Weltkrieg wichtige nationale Aufgaben wahrnahm, zentrale Bedeutung. Spätestens seit Ende der 1930er Jahre galt dies nicht mehr nur für das Reichsgebiet, sondern weit über dessen Grenzen hinaus. Die vielen Volksdeutschen, die sich zwischen 1937 und 1939 im Sudetenland und im Memelgebiet der SA anschlossen, sind ein Beleg für die anhaltende Anziehungskraft dieser Organisation und ihrer Ideologie zumindest in den Regionen, deren Eingliederung ins Deutsche Reich unmittelbar bevorstand oder mittelfristig geplant war.63
Die Geschichte der SA war nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 weiter von Gewalt, Hass und Kämpfen geprägt. Bereits am 23. März 1933, als sich die neu errichteten Konzentrationslager in Oranienburg, Dachau und anderswo mit politischen Häftlingen füllten, sorgte Hitler dafür, dass die verurteilten SA-Mörder von Potempa aus dem Gefängnis entlassen wurden.64 Die oberschlesische Presse brach ob dieses vermeintlichen Akts nationaler Gerechtigkeit in »Begeisterungsstürme« aus, wie der Bund der Polen in Oberschlesien im Oktober 1933 in einer Petition an den Völkerbund beklagte. Da Mörder jetzt offiziell wie Helden behandelt würden, habe die polnische Minderheit in Deutschland jedes Gefühl von Sicherheit verloren.65 Die Entwicklung in den darauffolgenden Jahren sollte die schlimmsten Befürchtungen der Polen noch übertreffen. Im Rückblick auf die Chronik der Gewalt und des Blutvergießens in Oberschlesien resümierte der Schriftsteller August Scholtis, ein gebürtiger Oberschlesier aus dem Dorf Bolatitz (heute Bolatice in Tschechien) in seiner 1959 erschienenen Autobiografie pessimistisch: »In dieser Region scheint Mitteleuropa noch immer Mittelalter zu sein. Hier wird die Kreatur von Generation zu Generation zwischen preußischen und polnischen Staatsgrenzen hin und her gezerrt, abwechselnd durch beide Seiten des freien Willens beraubt, genötigt, gejagt, geplündert oder am Straßenrand einfach abgeschlachtet.«66
Nach dem Potempa-Mord von 1932 nahmen die brutalen Ausschreitungen in Nieder- und Oberschlesien noch an Intensität zu. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten und ihre Politik der »Gleichschaltung« waren dort ein extrem gewaltsamer Vorgang. Nur wenige Jahre später wurden die deutsch-polnischen Grenzregionen und die daran angrenzenden Gebiete weiter östlich zu Schauplätzen staatlich geplanter Massen- und Völkermorde, zu den »Bloodlands« des Zweiten Weltkriegs.67 Die SA war, wie in diesem Buch gezeigt werden wird, eine der Organisationen, die in Wort und Tat entscheidend zur Radikalisierung des ethnischen und politischen Hasses in Mittel- und Osteuropa beitrugen. Analog zu dem Diktum von Ian Kershaw, dass Gewalt im nationalsozialistischen Deutschland »systemimmanent« gewesen sei,68 lässt sich von der SA sagen, dass ihr die Gewalt gewissermaßen innewohnte – nicht nur im Auftreten und konkreten Handeln. Gewalt war ein zentrales Element ihrer Propaganda, trug zur Sozialisierung ihrer Mitglieder bei und war mit entscheidend für die Ausprägung einer nationalsozialistischen Identität.
Schläger, Mörder und politische Hooligans
Der Mord von Potempa war ohne Zweifel eine besonders brutale Tat, doch sie war nur eines von vielen Hundert politisch motivierten Verbrechen, die Deutschland zwischen 1927 und 1932 erschütterten. Sie gaben einen Vorgeschmack auf die systematische Verfolgung politischer Gegner und anderer vermeintlicher Feinde, die mit der Errichtung des »Dritten Reiches« 1933/34 einsetzte. Mit jedem dieser Verbrechen schwand der Glaube der deutschen Öffentlichkeit an die Fähigkeit der Weimarer Republik, des anschwellenden politischen Terrors Herr zu werden. Die nationalsozialistische SA war keinesfalls die einzige paramilitärische Organisation, die der deutschen Demokratie den Kampf angesagt hatte und die gewaltsame Auseinandersetzung mit gegnerischen Kräften suchte, aber ihr Beitrag zum Anstieg der politischen Gewalt war erheblich.69 Unausweichlich war der Untergang der aus Kriegsniederlage und Revolution hervorgegangenen Weimarer Republik, die seit 1919 mehrfach existentielle Krisen durchlief, jedoch nicht,70 auch nicht, als sich die Lage am Vorabend der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 erheblich verschärfte. Allein im Juni und Juli 1932 wurden im Verlauf politisch motivierter Straßenkrawalle, bei Schießereien, Schlägereien und Überfällen im Deutschen Reich mehr als 300 Menschen getötet und weit über 1000 verletzt.71 In diesem politischen Klima, das mitunter bürgerkriegsähnliche Züge trug, hätte der Mord von Potempa kaum mehr als zeitlich und regional begrenztes Aufsehen erregt, wäre dies nicht das erste politische Kapitalverbrechen nach Inkrafttreten der Notverordnung gegen politischen Terror gewesen.
Der Mord von Potempa enthält bereits viele der Aspekte, die in den folgenden Kapiteln eingehend analysiert werden. Die Tat gibt einen Einblick in die typischen Formen und Motive der von der SA ausgeübten politischen Gewalt, zeigt die Reaktion des demokratischen Staatswesens auf die zunehmende Gefahr, die von den Nationalsozialisten ausging, und führt vor, wie die Nationalsozialisten Grenzstreitigkeiten zwischen Deutschland und seinen Nachbarstaaten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichten, für ihre Zwecke nutzten.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich für die SA – zumindest ihrer offiziellen Propaganda zufolge – nichts. Sie blieb die Inkarnation nationalsozialistischer Werte, Überzeugungen und Kampfbereitschaft. Von jedem einzelnen SA-Mann wurde erwartet, dass er den »Idealtypus des Nationalsozialisten«72 verkörperte und als solcher der – männlichen – deutschen Jugend als Vorbild diente. Die nationalsozialistische Propaganda schloss damit an den Freikorpsmythos an, integrierte aber auch neuere Trends wie die »Muscular Christianity«, die bewusste Vermännlichung des Christentums, und die Vorstellungen der »konservativen Revolution« um 1930.73 Die Ermordung des SA-Stabschefs Ernst Röhm und mehrerer Dutzend ranghoher SA-Führer zwischen 30. Juni und 2. Juli 1934 versetzten dem Ehrgeiz der Organisation, die Politik des »Dritten Reiches« maßgeblich mitzugestalten, allerdings einen erheblichen Dämpfer. Die Geschichtsschreibung ist sich einig, dass die »Nacht der langen Messer« die SA für die verbleibenden elf Jahre des »Dritten Reiches« auf den Status einer zweitrangigen Propagandatruppe innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung reduzierte.74
Vor diesem Hintergrund bedarf eine neue Studie über die SA zwar nicht unbedingt der Rechtfertigung, doch scheinen einige erläuternde Worte zu ihrer Intention, zur Reichweite und zur Methodik angemessen. In dem vorliegenden Werk soll gezeigt werden, dass die gängige Erzählung vom Aufstieg und Niedergang der SA, wie sie oben kurz angedeutet wurde, unvollständig ist, und der Nachweis geführt werden, wie dieses Narrativ über Jahrzehnte verhindert hat, dass die durchaus erhebliche Bedeutung und Wirkung der SA im »Dritten Reich« in den Blick geriet. Während der zwölf Jahre des real existierenden »Dritten Reiches« blieb die SA ein wichtiges Werkzeug, mit dem deutsche Männer nach den Bedürfnissen und Wünschen des Regimes geformt wurden. Dem einfachen SA-Mann bot die Organisation die Möglichkeit, sich aktiv in die »Volksgemeinschaft« einzubringen.75 In diesem Sinn war die SA bis 1945 auch politisch von hoher Relevanz – eine Einschätzung, die dem etablierten Konsens der geschichtswissenschaftlichen Forschung entgegensteht. Nach wie vor gehen die meisten Historikerinnen und Historiker davon aus, dass die SA nach der »Nacht der langen Messer« 1934 entscheidend an Macht und Einfluss verlor. In den Jahren danach sei sie zwar noch eine Organisation von beeindruckender zahlenmäßiger Stärke, aber politisch irrelevant gewesen. Dabei wirkte sie sogar noch nach, als die NS-Herrschaft bereits in Trümmern lag, weil sie, um eine Wortprägung des US-amerikanischen Soziologen Levis A. Coser aufzugreifen, eine »gierige Institution« war, die sich durch weitreichende Forderungen an ihre Mitglieder auszeichnete, aber auf der Basis von freiwilliger Unterordnung, Loyalität und hoher Einsatzbereitschaft funktionierte. Organisationen dieses Typs bemühen sich, »die gesamte Persönlichkeit zu erfassen«.76
In Anlehnung an Hans Mommsen, der die Entwicklung der nationalsozialistischen Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik als eine «kumulative Radikalisierung« beschrieb,77 lässt sich die bisherige Literatur zur SA nach 1934 zusammenfassend als kumulative Banalisierung bezeichnen. In dieser Literatur wird gewöhnlich der Eindruck vermittelt, dass sich der Ehrgeiz der SA nach 1934 darin erschöpft habe, ihren Mitgliedern Gelegenheit zur nostalgischen, trinkfreudigen Kameraderie fernab der Politik zu bieten. Diese Auffassung ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus strategischem Eigeninteresse nicht zuletzt von den einstigen SA-Männern selbst verbreitet worden. Die Mär vom bierseligen, aber ansonsten weitgehend harmlosen »SA-Stammtisch« blendet keinesfalls zufällig wichtige Aktivitäten der Sturmabteilungen in den Jahren vor und im Zweiten Weltkrieg aus: die gewalttätigen antisemitischen Ausschreitungen, deren Kulminationspunkte im Sommer 1935 sowie im Juni und November 1938 erreicht waren, ebenso den Beitrag der SA zur praktischen Kriegführung sowie die wichtige Rolle, die diese Organisation bei der Stabilisierung der NS-Herrschaft in Deutschland und in den besetzten Gebieten bis in die letzten Wochen vor dem Zusammenbruch des Regimes gespielt hat.
Um diese Schieflage in der Forschung zu korrigieren, muss in diesem Buch die gesamte Periode abgedeckt werden, in der die SA aktiv war: von 1921, als die Sturmabteilung in München ins Leben gerufen wurde, bis 1945, als sie im Zuge der militärischen Niederlage Deutschlands zu existieren aufhörte.78 Zudem sind das Phänomen der »Übergangsjustiz« (transitional justice) in den Besatzungszonen nach 1945 und die Rechtsprechung in den beiden 1949 gegründeten deutschen Staaten darauf zu untersuchen, wie sie sich auf die Geschichtsschreibung über die SA in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewirkt haben. Erst in diesem weiten zeitlichen und räumlichen Untersuchungsrahmen lässt sich die Bedeutung der SA in der Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus neu bestimmen.
Während wissenschaftliche Studien zur Geschichte des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust in so großer Zahl vorliegen, dass heute selbst Spezialisten nicht mehr behaupten würden, diese Literatur vollständig zu überblicken,79 ist das Angebot an Arbeiten, die sich gezielt mit der SA befassen, überraschend überschaubar. Abgesehen von der vor allem in den 1980er Jahren geführten Kontroverse um die soziale Zusammensetzung der SA – überwiegend proletarisch oder bürgerlich? – kommen die vorliegenden Studien zu recht einheitlichen Einschätzungen über den Charakter der Organisation.80 Sie konzentrieren sich dabei fast ausschließlich auf die Zeit zwischen Mitte der 1920er Jahre und 1934, wobei die Aktionsformen der SA und deren politische Auswirkungen im Zentrum der Analyse stehen.81 Ein frühes und in der Bewertung typisches, sprachlich allerdings ungewöhnlich farbiges Beispiel ist das Bild, das Ernst Niekisch in seinem 1953 in der Bundesrepublik Deutschland erschienenen Buch Das Reich der niederen Dämonen von der SA zeichnete. Er charakterisierte die SA darin als
eine Gegenauslese; sie zog alle Existenzen an, in denen etwas faul und morsch war. In der SA enthielten alle verbrecherischen Neigungen einen freien Auslauf. Die SA-Kasernen waren Lasterhöhlen; Arbeitsscheue, Säufer, Lebensbankrotteure, Homosexuelle, Raufbolde, Totschläger brüteten hier jene finsteren Anschläge aus, mit deren Hilfe Deutschland »erweckt« werden sollte. […] In der Qualität der braunen Haufen, in denen die Söhne des deutschen Bürgertums auf den Stil der Unterwelt gedrillt wurden, stellte sich der trostlose menschliche Niedergang dieses Bürgertums dar.82
Der einstige »Nationalbolschewist« Niekisch, von den Nationalsozialisten 1937 inhaftiert, war nach dem Krieg auf eine Professur für Soziologie an der Ost-Berliner Humboldt-Universität berufen worden. Der Zorn und Hass, den er persönlich gegen seine einstigen Peiniger empfand, korrespondierte mit den politischen Lehrmeinungen seiner Zeit, zumindest was die Sturmabteilung betraf. Sowohl das Bildungsbürgertum in der Bundesrepublik als auch die politische Elite in der DDR sahen in der SA, ihrer Gewalttätigkeit und Skrupellosigkeit eine der Grundfesten der faschistischen Herrschaft. Begründet wurde diese Sichtweise jedoch unterschiedlich: In der Bundesrepublik diente die Beschäftigung mit der SA-Gewalt oft dazu, den Nationalsozialismus als eine fehlgeleitete politische Ideologie und als »Herrschaft des Pöbels« abzuqualifizieren. In dieser Deutung schwangen eindeutig apologetische Töne mit, da man einen Gegensatz konstruierte zwischen der angeblich verkommenen SA und dem deutschen Bürgertum, das sich vermeintlich bemüht hatte, nationalsozialistische »Exzesse«, wo immer es ging, einzudämmen oder gar zu verhindern. Indem die SA und ihre Mitglieder als »fanatische Nazis« porträtiert wurden, wirkten selbst Unterstützer des Regimes und sogar »gewöhnliche« Parteimitglieder vergleichsweise harmlos. Nicht wenige Nationalsozialisten der letzteren Kategorie hielten sich jetzt zugute, allenfalls »taktische« oder sogar »aufrechte« Nazis gewesen zu sein. In der DDR stellte sich die Situation in den unmittelbaren Nachkriegsjahren ambivalenter dar. Die neuen Machthaber ließen insbesondere SA-Gewalttaten, die in den frühen 1930er Jahren begangen worden waren, streng verfolgen und mitunter auch in Schauprozessen ahnden, insbesondere dann, wenn sich die Verbrechen gegen Kommunisten gerichtet hatten. Doch bereits in den frühen 1950er Jahren dominierte die Strategie, die Masse der einstigen Braunhemden für das neue sozialistische Staatswesen zu gewinnen, was die strafrechtliche Verfolgung von SA-Verbrechen beinahe zum Erliegen brachte. In beiden deutschen Staaten herrschte zumindest bis in die 1970er Jahre die Tendenz vor, die SA-Männer einseitig als tumbe Gewalttäter zu brandmarken. In den Augen des einflussreichen Journalisten und Publizisten Joachim Fest, der stellvertretend für die konservativen Intellektuellen der Bundesrepublik zitiert sei, war die SA letztlich nur eine notdürftig getarnte kriminelle Bande, ein »Ringverein mit politischem Akzent«.83 Mit einem ähnlichen Zungenschlag charakterisierte der Historiker Hans Buchheim die »SA-Rowdies« als »die vollkommenste Form einer abartigen soldatischen Tradition«.84 Und der US-amerikanische Historiker William L. Shirer behauptete sogar mit unüberhörbar homophobem Zungenschlag, dass viele SA-Führer »berüchtigte homosexuelle Perverse« gewesen seien.85
Solche negativen Beurteilungen verraten mehr über die Voreingenommenheit der Nachkriegsgeschichtsschreibung als über die sozialen Realitäten in der SA. Im Gegensatz zu den zitierten Würdigungen betonte eine 1931 angefertigte polizeiliche »Denkschrift über Kampfvorbereitung und Kampfgrundsätze radikaler Organisationen«, dass in der SA »zweifellos eine Menge wertvollen Menschenmaterials« vorhanden sei und es unter ihren Kommandeuren »hoch qualifizierte Führer« gebe.86 Der »Nationalrevolutionär« Karl Otto Paetel, der das »Dritte Reich« im Exil überlebte und später das bundesdeutsche Publikum mit den amerikanischen Beatnik-Poeten bekannt machte, vertrat eine mittlere Position. Er erklärte 1965, die Beschäftigung mit der SA dürfe sich nicht auf die Rekonstruktion ihrer »Verwaltungs- und Befehlsstrukturen« beschränken. Seiner Überzeugung nach komme es vielmehr darauf an, eine profunde Antwort auf die Frage zu geben, wie sich unter einem solchen »administrativen Wust« zweierlei Typen von SA-Männern herausbilden und miteinander auskommen konnten: die »Idealisten« und diejenigen, denen er die »Dschungelmentalität sadistischer Rowdys« attestierte.87 Er benannte damit eine Herausforderung, vor der die Historiker nach wie vor stehen, nicht zuletzt weil »Idealisten« und »Sadisten« in der SA – um für den Moment an Paetels Terminologie festzuhalten – schon von den Zeitgenossen schwer zu unterscheiden waren und in der historischen Rückschau noch schwerer zu identifizieren sind.
Seit 1970 sind mehrere wichtige Arbeiten über die SA erschienen, die neue Akzente gesetzt haben. Während in der oben erwähnten frühen Literatur in der Regel der »verbrecherische Charakter« der SA hervorgehoben wurde – angesichts der Tatsache, dass bis in die späten 1950er Jahre viele Deutsche den Nationalsozialismus als eine im Prinzip gute Sache betrachteten, die leider aus dem Ruder gelaufen sei, eine durchaus wichtige volkspädagogische Aufgabe –,88 nahmen die Autoren der neueren Arbeiten die soziale Zusammensetzung der SA, ihr Agieren als politische Organisation und die Mentalität ihrer Mitglieder genauer in den Blick. Bahnbrechende Arbeiten – von Peter Merkl über das Selbstverständnis der SA-Männer, von Mathilde Jamin über das SA-Führerkorps und seine Probleme nach dem »Röhm-Putsch« und von Richard Bessel über den Aufstieg und die politische Gewaltkultur der SA in Schlesien vor 1933 – sind zu Fixsternen geworden, an denen sich die Forschung noch immer orientiert. Peter Longerichs 1989 veröffentlichtes Standardwerk über die politische Geschichte der SA markiert den vorläufigen Endpunkt dieses in den 1970er und 1980er Jahren neu erwachten Interesses.89
Seit den 1990er Jahren haben sich drei neue Forschungsschwerpunkte der SA-Geschichtsschreibung entwickelt. Erstens erschien eine Reihe von Arbeiten, die etablierte sozialgeschichtliche Ansätze mit der jüngeren Gewaltgeschichte verbinden. In diesen Studien wird oft aus praxeologischer und mikrogeschichtlicher Perspektive argumentiert, zuweilen sind sie auch komparativ ausgerichtet. In ihnen wird hervorgehoben, dass SA-Verbände »Gewaltgemeinschaften« waren, die ein spezifisches Lebensgefühl zusammenhielt, das zwischen Exzess und Disziplinierung changierte.90 Sven Reichardts 2002 veröffentlichte Dissertationsschrift, in der die deutsche SA mit den italienischen squadristi verglichen wird, gab hier wichtige Impulse und prägte die Forschung der nachfolgenden Jahre entscheidend.91 Zweitens wurden in vielen Regional- und Lokalstudien zur nationalsozialistischen Machtübernahme sowie in Arbeiten über die deutsche Polizei, die deutsche Justiz und die frühen Konzentrationslager wichtige Teilaspekte der SA-Geschichte genauer untersucht.92 In diesem Zusammenhang sind auch die biografischen Bücher zu nennen, in denen Autoren die Geschichte von Familienmitgliedern mit SA-Vergangenheit aufgearbeitet haben. Zumeist aus persönlichen Mitteilungen und Dokumenten schöpfend, enthalten diese Studien oft wichtige Informationen über die Beweggründe des Einzelnen für sein Engagement bei der Sturmabteilung – Informationen, wie man sie in staatlichen Archiven nur selten findet.93 Drittens sind in zunehmendem Maße Arbeiten entstanden, die von der »neuen Kulturgeschichte« inspiriert sind. Die Autoren dieser Studien interessieren sich etwa für die »Körperbilder« der SA- und SS-Männer, oder sie analysieren nationalsozialistische Rituale und Symbole, besonders den für faschistische Ideologien so charakteristischen Märtyrer- und Totenkult.94 Wieder andere Autoren erforschen den Paramilitarismus der Zwischenkriegszeit unter besonderer Berücksichtigung seiner geschlechtergeschichtlichen Dimension, nehmen das Klischee des »schwulen Nazis« kritisch unter die Lupe oder bemühen sich um eine Neubewertung der Beziehungen zwischen NS-Anhängern und den Kirchen.95
Neue Perspektiven
Ohne Frage ist die SA kein Stiefkind der historischen Forschung, und dennoch liegt bislang keine umfassende Gesamtdarstellung ihrer Geschichte vor. Hier setzt das vorliegende Buch an, in dem die zahlreichen und mitunter disparaten Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte mit neuen Erkenntnissen, die auf Basis von Recherchen in mehr als einem Dutzend staatlicher, regionaler und lokaler Archive in mehreren Ländern gewonnen wurden, verbunden werden. Auf diese Weise soll ein deutlicheres und ausgewogeneres Bild als das bislang verbreitete entstehen.96 Es ist mein Anspruch, hier die erste umfassende Geschichte der Sturmabteilung vorzulegen, die zumindest partiell eine Neubewertung des Stellenwerts der SA für die Geschichte des »Dritten Reichs« vornimmt. Dass ein solcher Ansatz Potential hat, lässt sich anhand mehrerer Aspekte demonstrieren.
Zunächst ist hervorzuheben, dass die Geschichte der SA – wie bereits erwähnt – bislang nur für die Zeit bis zum Sommer 1934 gründlich erforscht ist. Zwar hat der amerikanische Historiker Bruce Campbell seine Berufskollegen schon vor mehr als zwanzig Jahren in einem wegweisenden Aufsatz ermahnt, die SA der späteren Jahre nicht aus den Augen zu verlieren, doch haben das bislang nur wenige beherzigt.97 Da die historiografische Aufmerksamkeit überwiegend dem Gewalthandeln der SA in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik galt – der »Systemzeit«, wie die Nationalsozialisten diese Jahre abfällig nannten –, blieben zwei Aspekte ihrer Geschichte weitgehend im Dunkeln: erstens die Tatsache, dass die SA nicht nur die »Nacht der langen Messer« überstand, sondern dass ihr in den späten 1930er Jahren sogar ein partielles Comeback gelang; und zweitens das Ausmaß, in dem diese Organisation den Nazis als Instrument für die Durchdringung der deutschen Gesellschaft diente. 1939, unmittelbar vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, hatte die SA noch mehr als 1,3 Millionen Mitglieder – und damit rund dreimal so viele wie 1932.98 Politische Mobilisierung durch Gewalt und disziplinarische Integration in die SA blieben Kennzeichen der nationalsozialistischen »Volksgemeinschaft« bis 1945. Über den Begriff »Volksgemeinschaft« und seine Angemessenheit als historische Kategorie haben Historiker in den letzten Jahren intensiv gestritten. Einig ist man sich nur, dass »Volksgemeinschaft« eine seinerzeit höchst populäre politische Verheißung war, aber niemals eine gesellschaftliche Realität. Die SA wurde von den Wortführern der verschiedenen Lager nur wenig beachtet. Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Arbeit nicht nur ein empirischer Beitrag zur Volksgemeinschaftsdebatte, sondern auch ein kritischer Kommentar zu ihren vorläufigen Resultaten.99
Eine Perspektive, die die Geschichte der SA in der Weimarer Republik ebenso einschließt wie ihre Entwicklung im »Dritten Reich«, erleichtert es zudem, sie in einen vergleichenden und transnationalen Kontext zu stellen.100 Nicht nur die frühen Jahre der SA müssen vor dem Hintergrund des weißen Terrors, der nach dem Ersten Weltkrieg weite Teile Mitteleuropas überzog, und der Machtübernahme Mussolinis in Italien 1922 gesehen werden. Auch die zunehmende transnationale Dimension der SA in den 1930er Jahren gilt es zu berücksichtigen. Aspekte dieser Geschichte handeln von der sogenannten Österreichischen Legion, einem Seitenzweig der SA, der sich aus österreichischen Nationalsozialisten zusammensetzte, die in den Jahren vor dem »Anschluss« von 1938 Zuflucht im Reich gefunden hatten,101 und vom geografischen Ausgreifen der SA in die dem »Dritten Reich« angegliederten Territorien in den späten 1930er Jahren. 1942 fanden sich SA-Einheiten nicht nur auf dem Territorium des ehemaligen tschechoslowakischen Staates, sondern auch im Elsass, in Slowenien, im Warthegau und im Generalgouvernement, also dem von Deutschen besetzten, aber nicht annektierten Teil der Zweiten Polnischen Republik. Die Geschichte der SA in diesen Regionen ist praktisch unbekannt. Sie eröffnet wichtige Einsichten in die Probleme nationalsozialistischer Germanisierungspolitik, also die »Eindeutschung« der Bewohner dieser Regionen, sofern dies nach den kulturellen und rassischen Maßstäben der Nazis oder einfach nur aus pragmatischen Gründen geboten schien. Meine Analyse ergänzt damit die bereits vorliegenden Arbeiten, die sich mit der SS, dem Auswärtigen Amt und diversen anderen, mit Fragen der deutschen Kolonisierung befassten Behörden beschäftigen.102 Die SA hatte mittels ihrer »SA-Diplomaten« – Männer aus den höchsten Rängen der SA, die in den frühen 1940er Jahren als deutsche Gesandte in die Hauptstädte der deutschen Vasallenstaaten im Südosten Europas geschickt wurden – sogar Einfluss auf die deutsche Außenpolitik. Diese SA-Generäle waren versierte Gewaltexperten und direkt an der Durchführung des Holocaust in den jeweiligen Ländern beteiligt.
Schließlich: Das Ausmaß der physischen Gewalt, die die SA ausübte, war sicherlich enorm, besonders im Jahr der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933. Es stach aber im internationalen Vergleich – jedenfalls gemessen an den anderen Beispielen extremer Massengewalt im 20. Jahrhundert – nicht hervor.103 Am Beispiel der SA lässt sich jedoch besonders gut zeigen, warum die Ausübung von Gewalt in bestimmten Milieus und zu bestimmten Zeiten gerade für junge Männer anziehend war und ist. Ganz abgesehen davon, dass Gewalt einen wesentlichen Faktor menschlichen Zusammenlebens darstellt, bringt ihre Anwendung auch erheblichen potentiellen Nutzen. Gewalthandeln ist oftmals »zielgerichtet rational«.104 In einer kapitalistischen Moderne, die nicht nur fortwährend wirtschaftliche Gewinner und Verlierer produziert, sondern dem Einzelnen auch wenig Möglichkeiten bietet, Gefühle der kollektiven Begeisterung und Zugehörigkeit zu erleben, kann die gemeinschaftliche Ausübung von Gewalt durchaus attraktiv sein, wie etwa der Philosoph und Literaturwissenschaftler Jan Philipp Reemtsma argumentiert hat.105 Sie sei so etwas wie eine Ausbruchstrategie, bei der bürgerliche Vorstellungen, die etwa auf durchdachter Lebensplanung und Unterordnung unter eine angeblich universelle, verbindliche Sittlichkeit beruhen, zugunsten des erhebenden Gefühls von Freiheit (zu zerstören), der individuellen Ermächtigung und der Eröffnung ungeheurer Gewinnchancen (im materiellen wie im spirituellen Sinn) zur Seite gedrängt würden. Gewalt kann demzufolge einen Lustgewinn spezieller Art erzeugen, der gerade dann einen besonderen Reiz entfaltet, wenn sich auf absehbare Zeit tatsächlich oder auch nur vermeintlich keine Alternativen bieten.106 Insofern war es nur konsequent, dass politische Denker wie Karl Marx und Friedrich Engels, die nicht an die Reformierbarkeit des Kapitalismus glaubten, revolutionäre Gewalt als »Hebamme der Geschichte« und als legitimes »Werkzeug« neuer sozialer Bewegungen, die auf die Überwindung erstarrter politischer Verhältnisse zielten, akzeptierten.107 Dieser Punkt lässt sich verallgemeinern: Wenn sich die vorübergehende »Ermächtigung« des Einzelnen mittels Gewalt zur Erreichung höherer Zwecke rechtfertigen lässt – etwa als Dienst an der Nation oder um den Willen Gottes durchzusetzen (ideal ist eine Kombination von beidem) –, dann werden diejenigen, die diese Gewalt ausüben und für sich selbst legitimieren, von einer relativ stabilen alternativen Gruppenidentität profitieren. Diese Identität steht nicht notwendigerweise auf schwächeren Füßen als die etablierte Moralordnung, gegen die sie sich wendet.108
Zwei Seiten der Gewalt
In diesem Buch wird gezeigt, dass die Ausübung von Gewalt durch die SA in vielfacher Weise das Resultat von zweckrationalen, auf Selbstermächtigung zielenden Willensentscheidungen darstellte. Allerdings war nichts an dieser Gewalt spezifisch für die SA-Männer in den 1920er und 1930er Jahren – weder der Besitz potentiell tödlicher Waffen, die Widersacher das Fürchten lehrten und zugleich den Status ihrer Benutzer erhöhten, da sie sich als Träger solcher Waffen von der »normalen« Gesellschaft und ihren Werten abgegrenzt wähnten, noch das ausgefeilte und sehr geschickt eingesetzte Propaganda-Arsenal, das den gewaltbereiten Einzelnen ermunterte, sich als moderner Kreuzritter im Dienste der Nation und Gott zu verstehen, ermächtigt den Kampf gegen die »Ungläubigen« zu führen. Es handelt sich bei dem vorliegenden Buch um eine historische Arbeit, daher ist die Untersuchung auf einen spezifischen Gegenstand – die SA als Organisation und Personenverband in einer bestimmten Zeitspanne – fokussiert. Sie kann daher nicht den Status einer Studie beanspruchen, in der auf systematische Weise Spielarten und Organisationsformen der Gewalt bis zum heutigen Tag einer vergleichenden Analyse unterzogen würden. Trotz dieser Einschränkung ist die Geschichte der SA in vielfacher Weise anschlussfähig. Sie steht paradigmatisch für die Art und Weise, wie im 20. Jahrhundert Politik, Medienberichterstattung, Gewalt und selbst organisierter Aktivismus ineinandergriffen.
Angesichts dieses umfassenden Anspruchs sind einige zusätzliche methodologische Erläuterungen angebracht. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf der Gewalt und ihren persönlichen, strategischen und kulturellen Implikationen, doch handelt es auch von der Integrationskraft, die eine Organisation wie die SA zu entfalten vermochte. Mein besonderes Augenmerk wird der Mobilisierung durch Gewalt und der disziplinarischen Integration gelten. Bei der SA waren beide Phänomene untrennbar miteinander verknüpft. Die NS-Bewegung nutzte Gewalt sowohl als Mittel zur Mobilisierung ihrer Anhänger und zur Bekämpfung ihrer Feinde als auch zur Einschüchterung der Bevölkerung im Allgemeinen und zur Disziplinierung ihrer Parteiaktivisten im Besonderen. Herrschte der erstgenannte Gebrauch von Gewalt in den Jahren bis 1933/34 vor, so trat in den späteren Jahren des »Dritten Reiches« der zweite in den Vordergrund. Aber auch dann noch schwangen in Prozessen der disziplinarischen Integration durch Gewalt immer auch Elemente der Mobilisierung mit – und umgekehrt war die frühere Phase die Mobilisierung durch Gewalt oft mit disziplinarischem Druck auf die Fußtruppen der SA verbunden.109
Die Geschichte der Gewalt hat in den letzten zwanzig Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen.110 Insbesondere die Periode zwischen 1914 und 1945, von manchen Historikern auch als »europäischer Bürgerkrieg« bezeichnet, ist unter diesem Aspekt von der Zeitgeschichtsschreibung umfassend analysiert worden – nicht nur wegen der beiden Weltkriege mit ihrem extrem hohen Maß an Zerstörung und menschlichem Leid, sondern auch wegen der sich bekämpfenden Ideologien des Kommunismus und des Faschismus, die beide dem politischen Liberalismus den Kampf angesagt hatten.111 Der Nationalsozialismus als die deutsche Spielart des Faschismus – oder, präziser, der »autoritären Rechten« – ist ein fester Bestandteil im Feld der transnationalen und komparativen Studien über autoritäre, faschistische und extrem nationalistische Bewegungen und Regime im Europa der Zwischenkriegszeit, die ihrerseits ältere totalitarismustheoretisch geleitete Studien abgelöst haben.112 Auch die Praxisformen der politischen Gewalt, die diese Bewegungen ausgeübt haben, sind inzwischen in zunehmendem Umfang Gegenstand von komparativen und transnationalen Studien geworden.113 Tatsächlich wird die Geschichte des Nationalsozialismus –zumindest die seiner Frühphase – heute eher als Variante eines europäischen Phänomens und weniger als Beleg für einen »Sonderweg« der modernen deutschen Geschichte interpretiert. Dieser wurde für Jahrzehnte mit dem vermeintlich fortschrittlichen Entwicklungspfad in anderen westlichen Ländern kontrastiert, ein Denkmodell, das insbesondere die einflussreiche sozialgeschichtlich ausgerichtete »Bielefelder Schule« vertrat.114 Ähnlichkeiten hervorzuheben bedeutet jedoch nicht, Unterschiede zu ignorieren. Mit Errichtung des »Dritten Reiches« entfaltete der Nationalsozialismus eine exzessive Gewalttätigkeit. Er radikalisierte sich im Verlauf des Zweiten Weltkriegs ein weiteres Mal, als er ein Massenvernichtungsprogramm von nie dagewesener Größenordnung ins Werk setzte: Millionen Menschen, vor allem die europäischen Juden, wurden vom Regime für »unerwünscht« erklärt, versklavt und ermordet.115
In dem vorliegenden Buch folge ich dem transnationalen Trend in der Geschichtsschreibung, ohne jedoch die spezifisch nationalen Charakteristika der SA aus dem Blick zu verlieren. Analysiert werden die sich wandelnden Muster der SA-Gewalt und deren Auswirkungen von den Anfangsjahren der Organisation als paramilitärischer Wehrverband über ihre Hochphase als gewalttätige soziale Bewegung bis in die Jahre des NS-Regimes hinein, als die SA sich zu einer Massenorganisation mit hilfspolizeilichen Aufgaben entwickelte, während ihr politischer Einfluss zurückging.116 Diese unterschiedlichen Entwicklungsstadien bezeichne ich zuweilen auch als die erste (1920/21–1923), zweite (1925/26–1933/34) und dritte SA (1934–1945). Methodisch stützt sich meine Untersuchung vor allem auf praxeologische Analysen realer Gewaltereignisse. Sven Reichardt hat am Beispiel des Faschismus der Zwischenkriegszeit bereits überzeugend demonstriert, dass diese Methode geeignet ist, bei der Erforschung sozialen Handelns Struktur und Ereignis sowie Ideologie und Alltagspraxis zu verbinden. Eine Analyse des Routinehandelns der SA-Männer, ihrer kollektiv geteilten Weltanschauungen und der »subjektiven Sinnzuschreibungen«, mit denen sie ihre Taten vor sich selbst rechtfertigten, bietet die Möglichkeit zu rekonstruieren, wie »Vergemeinschaftung« in der SA funktionierte.117 Dabei wird zugleich eines der zentralen Argumente Reichardts, wonach in der SA ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen der Ausübung von Gewalt und der Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls bestand, kritisch überprüft.118 Dies ist schon deshalb wichtig, weil Reichardt sich in seiner Analyse fast ganz auf die kurze Phase zwischen den späten 1920er und den frühen 1930er Jahre konzentriert hat. Vor diesem Hintergrund ist zu klären, inwieweit die Beobachtungen Reichardts auch den Realitäten der dritten SA entsprechen – oder anders gesagt, ob in der Geschichte der Sturmabteilung Umbrüche oder Kontinuitäten vorherrschten.
Die von der SA praktizierte Gewalt hatte physische, psychologische, kulturelle und strukturelle Elemente.119 Während die beiden erstgenannten Formen intuitiv zu verstehen sind – physische Gewalt ist ein direkter körperlicher Angriff auf einen anderen Menschen, psychologische Gewalt der bewusste Versuch, jemandem seelischen Schaden zuzufügen –, sind kulturelle und strukturelle Gewalt sowie Formen symbolischer Gewalt viel schwerer zu definieren und noch schwerer in der historischen Rückschau zu bewerten. Um die letztgenannten Gewaltformen zu verstehen, reicht es nicht aus, die Schädigungsabsichten zwischen konkreten Personen zu evaluieren, da diese Gewalt immer auch das Ergebnis allgemeinerer sozialer und politischer Prozesse ist.120