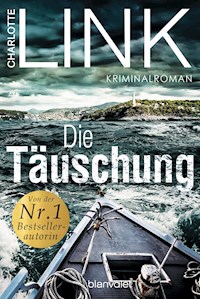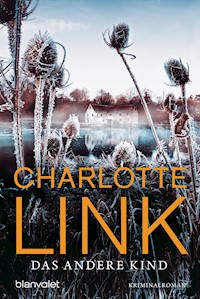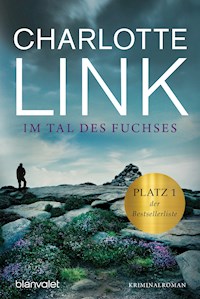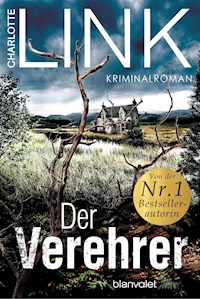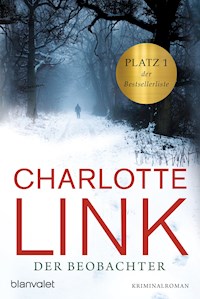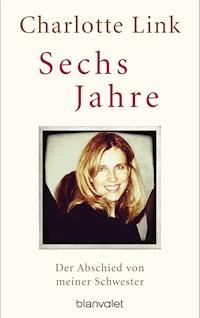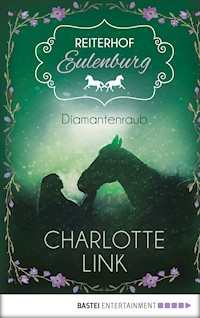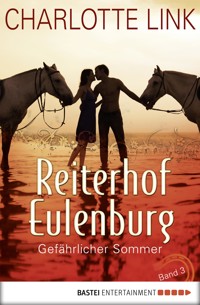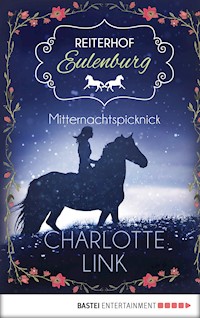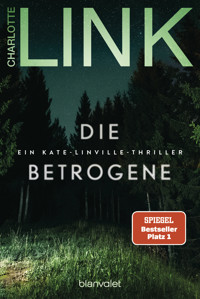9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sturmzeittrilogie
- Sprache: Deutsch
Deutschland 1977. Alexandra Marty hat viel von ihrer Großmutter Felicia geerbt – nicht nur deren Familiensinn, sondern vor allem auch ihren Ehrgeiz und Freiheitsdrang. Aufgewachsen in den Jahren politischer Unruhen und Veränderungen, ist Alexandra eine junge Frau ihrer Zeit, kühl und zärtlich, eigenwillig und anschmiegsam, träumerisch und mit einem ausgeprägten Blick für die Wirklichkeit. Doch als sie das große Erbe Felicias antritt und das Familienunternehmen übernimmt, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung, durch die auf einmal alles auf dem Spiel steht. Ein Zurück in die behütete Idylle auf dem Gut der Familie kann es nicht geben, und Alexandra muss sich erneut entscheiden, ob sie ihren ganz eigenen unabhängigen Weg gehen und sich endlich aus dem Schatten ihrer Familie lösen möchte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Deutschland 1977. Alexandra Marty hat viel von ihrer Großmutter Felicia geerbt – nicht nur deren Familiensinn, sondern vor allem auch ihren Ehrgeiz und Freiheitsdrang. Aufgewachsen in den Jahren politischer Unruhen und Veränderungen, ist Alexandra eine junge Frau ihrer Zeit, kühl und zärtlich, eigenwillig und anschmiegsam, träumerisch und mit einem ausgeprägten Blick für die Wirklichkeit. Doch als sie das große Erbe Felicias antritt und das Familienunternehmen übernimmt, begeht sie einen folgenschweren Fehler, durch den auf einmal alles auf dem Spiel steht. Ein Zurück in die behütete Idylle auf dem Gut der Familie kann es nicht geben, und Alexandra muss sich entscheiden, ob sie ihren ganz eigenen unabhängigen Weg gehen möchte ...
Autorin
Charlotte Link, geboren in Frankfurt/Main, ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Ihre Kriminalromane sind internationale Bestseller, auch Die Betrogene und zuletzt Die Entscheidung eroberten wieder auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste. Allein in Deutschland wurden bislang über 28 Millionen Bücher von Charlotte Link verkauft; ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Charlotte Link lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt/Main.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
CHARLOTTE LINK
STURMZEIT
Die Stunde der Erben
Band 3
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 1989 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: Joana Kruse /Arcangel Images; www. buerosued.deNB · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-22963-4V003
www.blanvalet.de
PROLOG
September 1957
Das Kind wurde auf den Namen Alexandra Sophie getauft, in einer besonders schönen und würdigen Zeremonie, die es gänzlich verschlief. Erst am Tag zuvor war das kleine Mädchen, aus Los Angeles kommend, in München eingetroffen, sah seine bis dahin mit akribischer Genauigkeit eingehaltenen Schlafens- und Essenszeiten völlig auf den Kopf gestellt und reagierte darauf mit einer von der ersten bis zur letzten Minute durchschrienen Nacht. Nun war es wahrscheinlich zu erschöpft, um noch gegen das kratzige weiße Taufkleidchen, das Weihwasser auf der Stirn und den modrigen Kirchengeruch protestieren zu können. Hier handele es sich um ein ganz besonders braves und ruhiges Baby, lobte sogar der Pfarrer.
Die übermüdeten Eltern, denen der Jetlag noch in den Knochen steckte, und mehr noch die endlosen Nachtstunden, in denen sie ihre vier Monate alte Tochter auf den Armen geschaukelt, beruhigend auf sie eingeredet und ihr alberne Kinderlieder vorgesungen hatten, ließen die Feierlichkeit mit blassen Gesichtern und umschatteten Augen über sich ergehen.
Beim Verlassen der Kirche sagte Belle Rathenberg ärgerlich: »Wir hätten uns einfach weigern sollen hierherzukommen. Alexandra ist noch zu klein. Wir hätten sie drüben taufen lassen sollen, und alles wäre in Ordnung gewesen.«
»Deine Mutter wollte nun einmal ein großes Familienfest daraus machen, und das wäre in Los Angeles nicht möglich gewesen.« Andreas, ihr Mann, versuchte, sie zu beruhigen. »Jetzt haben wir uns darauf eingelassen, ihr den Gefallen zu tun, nun müssen wir es auch durchstehen. Komm, reiß dich zusammen. Schau die Welt ein bisschen freundlicher an!«
»Wenn mir das gelingen soll, brauche ich jetzt erst einmal einen Sherry«, sagte Belle und stieg in eines der vielen bereitstehenden Autos, die die Taufgesellschaft zum Haus ihrer Mutter bringen sollten. »Wahrscheinlich brauche ich sogar zwei oder drei.«
Felicia Lavergne stand in der Terrassentür und beobachtete ihre Gäste. Sie waren fast alle gekommen, ohne wichtigen Grund erteilte man der alten Patriarchin keine Absage. Außerdem waren ihre Gesellschaften beliebt, ihr malerisch schönes Anwesen am oberbayerischen Ammersee lud ein zu grandiosen Sommerpartys, und sie war immer eine großzügige Gastgeberin gewesen.
Felicia hatte das geräumige Bauernhaus am Ostufer des Sees gleich nach Kriegsende gekauft in der Absicht, einen Ort zu schaffen, an dem alle zusammenkommen konnten, die zu ihr gehörten. Sie war weder eine mütterliche noch eine fürsorgliche Frau, aber sie hatte den ausgeprägten Beschützerinstinkt eines Schäferhundes, der seine Herde umkreist und bewacht. Die Familie war ihr Heiligtum – was sie auf eine sehr spezielle Weise zum Ausdruck brachte, die ihr wenig Sympathie, aber eine Menge widerwillig gezollter Bewunderung eintrug: Sie war in der Lage, es über Jahre hin nicht zu bemerken, wenn einer ihrer nächsten Anverwandten unter Depressionen litt, aber sollte der Betreffende den Entschluss fassen, sich aufzuhängen, würde sie im letzten Moment hinstürzen und den Strick durchschneiden. Dann würde sie aus allen Wolken fallen, wenn sie erführe, dass sich der Gerettete bereits seit Langem mit ernsthaften Problemen herumschlug.
Das Haus bestand aus einer Unzahl kuscheliger Zimmer, aus knarrenden Fußböden, großen Kaminen, Holzbalken an den Decken, aus blumengeschmückten Balkonen und einer großen Terrasse. Der Garten fiel bis zum See hinab, es gab einen Bootssteg, ein Bootshaus, einen Badestrand.
An diesem Septembertag, der ihnen noch einmal sommerliches Wetter, strahlende Sonne und einen wolkenlosen Himmel bescherte, hatte Felicia überall Sonnenschirme aufstellen, Kissen auf Stühle und Bänke legen und den Rasen mähen lassen. Nach dem Mittagessen, einem von vielen Reden unterbrochenen fünfgängigen Menü, hatten sich nun alle Feiernden hinausbegeben und über den Garten verteilt. Auf der Terrasse gab es ein Kuchenbüfett, wo sich jeder selber bedienen konnte, außerdem wurden Kaffee, Tee und alle erdenklichen kalten Getränke ausgeschenkt. Die Herbstblumen leuchteten in der Sonne auf, der See glitzerte türkisblau, ein paar Segelboote malten weiße Tupfen auf die Wellen.
Felicias Blick glitt über die bunte Schar zu ihren Füßen und blieb an Belle, der Mutter des Täuflings, hängen. Alexandra war Ende Mai zur Welt gekommen, aber Belle hatte es bis jetzt nicht geschafft, ihre alte Figur zurückzuerlangen. Sie war früher sehr schlank gewesen, aber jetzt sah sie ziemlich unförmig aus in ihrem geblümten Hängekleid. Sie trug sehr hochhackige Schuhe, aber auch die konnten ihre geschwollenen Beine nicht schlanker erscheinen lassen. Felicia registrierte, dass ihre Tochter ziemlich viel trank, einen Cocktail nach dem anderen, und alle kippte sie hinunter wie Wasser. Neben ihr stand Andreas, den fast vierjährigen gemeinsamen Sohn Chris auf dem Arm. Andreas war um einiges älter als Belle und sah immer noch sehr gut aus. Felicia mochte ihn, hatte aber längst begriffen, dass dieses Gefühl nicht erwidert wurde. Wie die meisten Leute, die Felicia kannten, war auch er überzeugt, dass sie mit ihren Töchtern alles falsch gemacht hatte, dass sie sie materiell blendend versorgt, ansonsten jedoch links liegen gelassen hatte.
Ja, aber glaubt er, ich hätte erreicht, was ich erreicht habe, wenn ich es anders gemacht hätte, fragte sich Felicia.
Immerhin war auch Susanne, Belles jüngere Schwester, erschienen, und das, obwohl sie ihre Mutter unverhohlen hasste. Sie hielt sich abseits, gab sich keinerlei Mühe zu verbergen, wie sehr ihr das alles auf die Nerven ging. Sie trug ein graues Kostüm, viel zu warm für diesen Tag, und hatte ihre Haare streng zurückfrisiert. Sie sah aus wie eine alternde Gouvernante. Wenn jemand sie ansprach, tat sie alles, das Gespräch sofort im Keim zu ersticken. Seit der schrecklichen Geschichte mit ihrem Mann, der elf Jahre zuvor als Kriegsverbrecher hingerichtet worden war, wurde ihr Leben überschattet von brennender Scham, die ihr Kontakte fast unmöglich machte. In Berlin unterrichtete sie sprachgestörte Kinder, und die waren vielleicht die einzigen Menschen, unter denen sie sich sicher fühlte. Selbst ihren drei Töchtern gegenüber verhielt sie sich auf eine verschrobene Weise distanziert, so, als handele es sich nicht um ihre Kinder, sondern um fremde Wesen, die ihr jeden Augenblick gefährlich werden könnten.
Aber allmählich müsste sie über die alten Geschichten hinwegkommen, dachte Felicia ungeduldig, der Krieg ist doch schon so lange vorbei!
Sie strich sich ihr weißes Sommerkleid glatt, obwohl es da nichts zu glätten gab, aber sie hatte sich diese Bewegung angewöhnt, wann immer sie ihre Gedanken zu ordnen und Entschlüsse zu fassen suchte. Ein junger Mann in einem eleganten Anzug, der nicht weit von ihr stand und sie bereits seit einigen Minuten beobachtete, trat auf sie zu.
»Was denkst du gerade?«, fragte er. »Du musterst die Leute hier wie ein General seine Armee, und eben hast du über deinen nächsten strategisch sinnvollen Schritt gebrütet, stimmt’s?«
Felicia lachte. »Mach dich nur über mich lustig. Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe nur geschaut!«
Sie mochte Markus Leonberg, ihren Berater in Finanzfragen, mochte seinen Charme und seine Liebenswürdigkeit. Vor allem aber imponierten ihr seine Zähigkeit und Durchsetzungskraft, mit denen er sich aus dem Nichts eine solide Existenz aufgebaut hatte. Nach Kriegsende war er als Einundzwanzigjähriger für ein knappes Jahr in amerikanischer Kriegsgefangenschaft gewesen, anschließend hatte er verzweifelt nach seinen Eltern geforscht, Schlesiern, von denen er keine Spur mehr finden konnte. Endlich fand er heraus, dass beide beim Einmarsch der Roten Armee ums Leben gekommen waren. Dieses Wissen machte aus dem weichen dunkelhaarigen Jungen mit den sanften grünen Augen von einem Tag zum anderen einen Mann, der nur noch daran interessiert schien, immer mehr Geld anzuhäufen und sich um nichts sonst zu kümmern. Er wurde ein König des schwarzen Marktes, tätigte glänzende Geschäfte, warf sich dann auf Immobilien. Inzwischen zählte er zu den reichsten Männern Münchens. Felicia bewunderte ihn, hatte jedoch auch eine vage Ahnung von seinen Schwierigkeiten. Irgendetwas sagte ihr, dass Markus Leonberg womöglich nicht immer einen kühlen Kopf behalten würde. Mit dem Tod seiner Eltern und dem Verlust seiner Heimat war etwas in ihm in Unordnung geraten, oft schien er sich in sich selber nicht zurechtzufinden. Manchmal, wenn er so dastand und für einen Moment nicht darauf achtete, der Welt sein strahlendes Siegerlächeln zu zeigen, wirkte er so einsam und verloren, dass es sogar Felicia danach verlangte, ihn in den Arm zu nehmen. Natürlich hatte sie es noch nie getan, es hätte sie beide nur in Verlegenheit gebracht.
»Du bist ja heute ganz ohne Begleitung hier«, sagte sie jetzt. Normalerweise hatte Markus immer ein hübsches Mädchen an seiner Seite.
»Mit Maren ist es aus. Wir passten nicht zueinander.«
»Schon wieder! Länger als ein halbes Jahr geht es bei dir wirklich nie gut!«
»Was soll ich machen? Ich scheine eben nie den richtigen Griff zu tun.«
»Ich glaube, du hast einen Hang zu den falschen Mädchen«, sagte Felicia, die kaum wusste, wie sie die puppenhaften Geschöpfe, die er bevorzugte, überhaupt auseinanderhalten sollte.
Markus zuckte mit den Schultern und bemühte sich, das Thema zu wechseln. »Wer ist der Herr dort hinten?«, fragte er.
»Der mit dem kleinen Jungen neben sich? Das ist Peter Liliencron, ein alter Freund von mir. 39 schaffte er es gerade noch, aus Deutschland hinauszukommen. 45 ist er dann zurückgekommen. Der Junge ist sein Sohn Daniel.«
»Verstehe. Und da drüben – das ist doch Tom Wolff, nicht? Er wird immer dicker!«
Tom gehörte die eine Hälfte der Spielwarenproduktion Wolff & Lavergne,Felicia die andere. Sie waren ein ungleiches Paar, hatten einander in schwierigen Zeiten jedoch immer geholfen und wussten jeder praktisch alles über den anderen. Inzwischen machte Tom Wolff sein Herz schwer zu schaffen, ebenso sein Bluthochdruck, und da er alle Warnungen der Ärzte, was Alkohol, Nikotin und fettes Essen anging, konsequent ignorierte, schien es nur eine Frage der Zeit, wie lange sein Körper das aushalten würde.
»Wenn Tom nicht mehr lebt«, sagte Felicia, »erbt seine Frau Kassandra seinen Anteil. Gnade mir Gott, wenn ich die als Partnerin habe. Sie kann mich nicht ausstehen.«
Felicia hat eine Menge Feinde, dachte Markus, zumindest ist sie nicht gerade beliebt.
»Kassandra ist die Frau neben ihm, nicht?«, fragte er. »Sie ist unheimlich elegant. Und sehr unnahbar.«
»Das kann man wohl sagen. Unnahbarer geht es nicht mehr. Aber irgendwann werde ich mich mit ihr arrangieren müssen.«
»Und wo«, wollte Markus wissen, »ist die Hauptperson des Tages?«
»Sie schläft. Belle quält sich mit ihren Schlafens- und Essenszeiten, weil die Zeitumstellung alles durcheinandergebracht hat. Allerdings muss ich auch sagen, dass man heutzutage sehr viel Getue um diese Dinge bei Babys macht. Früher hat man das lockerer gesehen, und es ging schließlich auch.«
»Ich finde jedenfalls, sie ist ein hübsches Baby«, sagte Markus, »und sie hat einen schönen Namen. Alexandra Sophie. Das klingt wunderbar.«
»Alexandra heißt sie nach Belles verstorbenem Vater. Und Sophie hieß Belles kleine Tochter aus erster Ehe. Sie starb vor zwölf Jahren auf unserer Flucht aus Ostpreußen.«
Nachdenklich betrachtete Markus die runde Belle, die sich gerade wieder einen Campari von einem Tablett nahm. »Sie hat manches hinter sich, denke ich.«
»O ja. Und sie kommt nicht richtig auf die Füße. Sie war als junges Mädchen Schauspielerin bei der UFA. Allerdings nur sehr kurz, der Krieg hat alles durcheinandergebracht. Danach ging sie dann nach Amerika. Andreas, ihr jetziger Mann, hatte schon vorher heimlich für die Alliierten gearbeitet und bekam einen leitenden Posten in einem Rüstungskonzern angeboten. Sie träumte natürlich von Hollywood. Aber es wurde nichts. Anfangs auch deshalb, weil die Studios Deutsche nicht akzeptierten. Und jetzt – na ja, sieh sie dir an. Nicht gerade das, wovon sie bei MGM träumen.«
»Sie scheint ziemlich viel zu trinken«, sagte Markus vorsichtig.
Also merkten es andere auch schon. »Ich verstehe nicht«, sagte Felicia, »warum Andreas dem tatenlos zusieht.«
Susannes Töchter kamen aus dem Haus gelaufen, wo sie die Plattensammlung ihrer Großmutter vergeblich nach Elvis-Presley-Aufnahmen durchforstet hatten. Sie trugen Badeanzüge und Handtücher über dem Arm und verkündeten, schwimmen gehen zu wollen. Der zehnjährige Daniel Liliencron schloss sich ihnen sofort an. Schwatzend und lachend zogen sie los. Susanne machte sich daran, den Garten zu inspizieren, war in Wahrheit wohl aber nur wieder auf der Flucht vor einem möglichen Gesprächspartner. Andreas und Peter Liliencron diskutierten den grandiosen Wahlsieg Adenauers vom Sonntag zuvor. Tom Wolff baute sich vor dem Kuchenbüfett auf und fing an hineinzuschaufeln, was er nur fassen konnte. War noch beim Mittagessen eine etwas verkrampfte Atmosphäre spürbar gewesen, plätscherte der Nachmittag nun friedlich dahin. In zwei Stunden würde es dunkel sein, dann würden sie drinnen noch etwas zusammensitzen, und schließlich würde jeder nach Hause fahren und finden, dass es eigentlich recht nett gewesen sei.
»Vielleicht sollte ich doch einmal mit Belle reden«, sagte Felicia, »noch eine halbe Stunde, und sie ist völlig betrunken. Du entschuldigst mich, Markus?«
Sie winkte ihrer Tochter, ihr zu folgen, und trat dann ins Haus. Widerwillig kam Belle der Aufforderung nach. Als sie die Wohnzimmertür hinter sich und ihrer Mutter schloss, klingelte es. Flüchtig fragte sich Belle, wer der verspätete Gast sein mochte, aber im Grunde interessierte es sie nicht wirklich. Es bereitete ihr viel zu große Mühe, sich zu konzentrieren, als dass sie darüber hätte nachdenken mögen.
Hanna, die Haushälterin, hatte sich vergeblich bemüht, dem unerwarteten Besucher den Eintritt zu verwehren.
»Sind Sie eingeladen?«, fragte sie misstrauisch, als sie des zerlumpten Fremden ansichtig wurde, der unrasiert und in völlig verwahrlosten Kleidern vor der Tür stand. Sie hielt ihn zuerst für einen Bettler, aber er behauptete, eine Verabredung mit einem der Gäste zu haben. Er verströmte einen penetranten Schweißgestank, der sich mit dem Geruch von Ölfarbe mischte, die in dicken Spritzern überall auf seiner Jacke klebte. Seine Schuhe sahen aus, als wollten sie ihm jeden Moment von den Füßen fallen.
»Ich bin nicht eingeladen, aber verabredet, das sagte ich doch«, antwortete er nun ungeduldig auf Hannas Frage und stand auch schon im Flur.
»Sie können hier nicht einfach hereinkommen«, protestierte Hanna. Er starrte sie an. »Wieso nicht? Bin ich nicht fein genug?«
»Nein, nur …«
Er ließ ein bitteres Lachen hören. »Als ich meinen Kopf hingehalten habe für euch, damals in Russland, da war ich euch auch gut genug, oder nicht? Die Zehen hab ich mir abgefroren im Winter vor Moskau, und dann haben sie mich getroffen. Hier oben!« Er wies auf seinen Kopf. Hannas Abscheu wandelte sich in hilfloses Mitleid. Ein Veteran, der einen ziemlichen Knacks davongetragen hatte; es gab viele von ihnen. Männer, die nicht wieder ins normale Leben hatten zurückfinden können, die an Spätfolgen von Verletzungen, körperlicher oder seelischer Art, litten und vom Wirtschaftswunder-Deutschland nicht den Dank erhielten, den sie benötigt hätten, um mit dem Erlebten fertigzuwerden. Man speiste sie mit Geld ab, stattdessen hätten sie Zuhörer gebraucht. Aber niemand wollte mehr etwas wissen von ihren Geschichten. Das war Vergangenheit, man hatte genug zu tun, die Zukunft zu bewältigen. Hanna wusste nur zu gut Bescheid, ihr Sohn saß seit seiner U-Boot-Zeit von schweren Psychosen geplagt in einer Nervenheilanstalt.
»Kommen Sie doch zu mir in die Küche«, sagte sie gutmütig, »dann mache ich Ihnen erst einmal etwas zu essen. Sie sehen ganz so aus, als ob …« Er ließ sie einfach stehen, ging den Flur entlang und trat hinaus auf die Treppe zur Terrasse.
Zunächst bemerkte ihn niemand, alle waren viel zu sehr mit Gesprächen oder mit Essen und Trinken beschäftigt. Als Erste wurde schließlich Susanne aufmerksam, die von ihrem Rundgang durch den Garten zum Haus zurückkehrte. Sie sah eine vogelscheuchenähnliche Gestalt in der Tür stehen und sagte in ihrer ersten Überraschung ziemlich laut: »Oh! Wer ist das denn?« Die näher stehenden hatten sie gehört und schauten nun auch zu dem Neuankömmling hin. Nach und nach merkten alle, dass es dort oben irgendetwas zu sehen gab. Das Stimmengewirr verstummte. Vom See her waren Lachen und Geschrei der badenden Kinder zu vernehmen.
Der Fremde kam langsam die Treppe herunter. Er schwankte ein wenig, fast als sei er betrunken, in Wahrheit hatte er Mühe, seine Bewegungen richtig zu koordinieren. Das würde auch nicht mehr besser werden, dafür hatte die Kugel in seinem Kopf gesorgt. Als er unten angekommen war, sagte er: »Ich bin Walter Wehrenberg. Ich bin aus München hierhergekommen.«
Alle sahen ihn verwirrt an. Der Name sagte niemandem etwas. Susanne, als Tochter der Hausherrin, besann sich schließlich auf die Gebote der Höflichkeit und sagte: »Guten Tag, Herr Wehrenberg. Sind Sie mit meiner Mutter verabredet?«
Wehrenberg schüttelte den Kopf. Er hatte eine ungesund wirkende bläulichbleiche Gesichtsfarbe. Auf seiner Stirn standen Schweißtropfen.
»Ich möchte zu Markus Leonberg«, sagte er.
Markus, der sich nach seiner Unterhaltung mit Felicia auf eine Bank gesetzt und den Ausblick über den See genossen hatte, stand auf und kam näher. Er hielt ein Glas Orangensaft in der Hand. Seine Miene spiegelte nicht das mindeste Erkennen.
»Ja bitte?«, fragte er.
»Wissen Sie, wer ich bin?«
»Tut mir leid, nein. Müsste ich es wissen?«
Wehrenberg lachte ebenso bitter und zynisch wie zuvor im Haus bei Hanna. »Müsste ich es wissen, fragt er! Müsste ich es wissen! Das ist natürlich unter Ihrer Würde, nicht? Die Leute auch noch alle zu kennen, die Sie ins Unglück stürzen!«
Markus schien die Angelegenheit ziemlich peinlich. »Mir ist nicht klar, worauf Sie hinauswollen, Herr Wehrenberg. Aber vielleicht können wir irgendwo unter vier Augen …«
Wehrenberg unterbrach ihn sofort. »Das könnte Ihnen so passen! Unter vier Augen! Damit niemand von Ihren Machenschaften erfährt. Aber das sollen ruhig alle wissen! Die sollen wissen, was für ein feiner Mensch Sie sind!«
»Ich denke, das ist hier nicht der richtige Ort für derartige Gespräche«, mischte sich Andreas ein, »vielleicht sollten Sie sich am Montag in der Stadt treffen.«
»Richtig«, sagte Markus, »es ist Wochenende, und dies ist eine private Feier. Sie sollten besser gehen, Herr Wehrenberg.«
»Nein. Ich werde nicht gehen.« Ein angestrengter Blick trat in seine Augen. »Ich war in Sibirien«, verkündete er, »sechs Jahre. Straßenbau. Wissen Sie, was das bedeutet?«
»Sie haben viel mitgemacht«, sagte Tom Wolff, dem inzwischen aufging, dass es sich hier um einen Verwirrten handelte, dem mit scharfen Worten sicherlich nicht beizukommen war. »Wie ist es, möchten Sie nicht etwas trinken? Einen Martini? Nach einem guten Drink sieht die Welt gleich freundlicher aus!«
»Danke«, sagte Wehrenberg, »ich möchte nichts trinken. Bekommt mir nicht. Ich hatte einen Kopfschuss. Vor Moskau. Fast ein Jahr Lazarett. Der Arzt sagt, ist ein Wunder, dass Sie noch leben, Wehrenberg.«
Niemand wusste etwas zu erwidern. Markus zerbrach sich den Kopf, was dieser Mann mit ihm zu tun haben mochte. Es fiel ihm nicht ein. Womöglich handelte es sich um eine Verwechslung.
»Die hätten mich nie mehr rausschicken dürfen«, sagte Wehrenberg, »aber die haben jeden gebraucht am Ende. Sonst wäre ich nicht in Gefangenschaft gekommen. Sechs Jahre. Da habt ihr’s euch hier gut gehen lassen.«
»Ich war auch in Gefangenschaft«, sagte Markus etwas gereizt, »es ist doch wirklich …«
»Oh, das können Sie nicht vergleichen!«, schrie Wehrenberg. Alle fuhren zusammen. »Das können Sie nicht vergleichen! Sie waren nicht in Sibirien! Sie wissen nicht, was Sibirien ist. Sie haben keine Ahnung! Überhaupt keine!«
»Ich denke, Sie sollten nun wirklich gehen«, sagte Markus kühl. »Kommen Sie am Montag in mein Büro und bringen Sie Ihr Anliegen dort vor.«
»Ich war in Ihrem Büro. Gestern. Da waren Sie schon weg. Aber Ihre Sekretärin war da. Die wollte nicht rausrücken, wo Sie sind. Da hab ich mir den Terminkalender gegriffen. Der lag vor ihr, war nicht schwer. Da stand, dass Sie hier sind heute. Da hab ich gedacht, ich fahre auch hierher!«
»Das ist unglaublich«, murmelte Markus, »das ist wirklich unglaublich.«
Andreas seufzte tief. »Dann sagen Sie eben, was Sie sagen wollen. Eher gehen Sie ja doch nicht. Aber machen Sie es bitte kurz.«
»Ich bin Maler«, sagte Wehrenberg. In seiner Stimme klang Stolz, er reckte den Kopf, und über sein bleiches, krankes Gesicht flog ein Hauch von Würde. »Eva sagt, meine Bilder sind sehr gut. Eva ist meine Frau, wissen Sie. Sie versteht etwas davon. Sie sagt, eines Tages werden es auch die anderen begreifen. Sie werden meine Bilder kaufen. Sie werden mich nicht mehr auslachen.«
»Wenn Sie versprechen, dann zu verschwinden, kaufe ich Ihnen ein Bild ab«, sagte Markus entnervt. »Und am Montag werde ich meine Sekretärin entlassen, weil sie mich nicht gewarnt hat. Also, was ist?«
»Ihnen«, entgegnete Wehrenberg, »würde ich keines meiner Bilder geben. Nicht für eine Million. Nie.«
»Dann lassen Sie es eben bleiben. Aber ich habe keine Lust mehr, meine Zeit mit Ihnen zu vertrödeln.« Markus wandte sich demonstrativ ab und zündete sich eine Zigarette an. Seine Hände zitterten dabei ganz leicht.
»Schauen Sie mich an!«, brüllte Wehrenberg Wut entbrannt. »Verdammt, drehen Sie sich um und schauen Sie mich an!«
Markus drehte sich um. In diesem Augenblick zog Wehrenberg eine Pistole aus der Innentasche seines Jacketts. Hanna, die über ihm in der geöffneten Tür stand und die Szene beobachtete, hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht laut zu schreien.
»Um Gottes willen«, sagte Tom Wolff beschwörend, »machen Sie keinen Unsinn!«
»Ich habe eine Tochter!«, schrie Wehrenberg. »Ich habe eine Tochter, sie ist vierzehn Jahre alt, und sie braucht mich. Ich muss für sie sorgen. Ich bin ihr Vater! Ich muss malen, damit wir leben können!«
»Natürlich«, sagte Tom beruhigend, »natürlich!«
»Und jetzt will er das Haus abreißen, in dem wir wohnen! Dieser gottverdammte Immobilienhai will den einzigen Ort zerstören, an dem ich malen kann. Den einzigen Ort, der das richtige Licht hat. Er zerstört meine Zukunft. Und die meines Kindes. Dieser gewissenlose Verbrecher nimmt mir mein Leben!«
Markus war grau geworden bis in die Lippen. Er wusste jetzt, auf welches Haus der Fremde anspielte. »Eine Ruine«, sagte er heiser, »ich wusste ja nicht … hören Sie, wir können über alles reden. Aber dieses Haus ist abbruchreif. Es würde irgendwann zusammenstürzen. Es wurde zu stark beschädigt im Krieg. Es ist …«
»Halt deinen Mund!«, schrie Wehrenberg. »Halt um Gottes willen deinen Mund, Leonberg! Du hast keine Ahnung! Niemand hier hat eine Ahnung! Ihr seid alle gleich!« Er fuchtelte mit seiner Waffe herum.
»Lieber Himmel«, flüsterte Susanne tonlos.
»Im nächsten Jahr werde ich vierzig«, sagte Belle, »ich glaube nicht, dass du noch irgendein Recht hast, mich zurechtzuweisen.« Das Sprechen strengte sie an, sie bemerkte selber, wie ihre Zunge anschlug. Zu viel Alkohol, zu schnell getrunken, und das bei diesen sommerlichen Temperaturen … Sie bereute es zutiefst. Sie hätte ein Vermögen gegeben, ihrer kühlen, eleganten Mutter jetzt nicht in dieser Verfassung gegenüberstehen zu müssen. Sie bemühte sich ständig, irgendeinen Punkt im Zimmer zu fixieren, um nicht vom Schwindel übermannt zu werden.
»Ich mache mir Sorgen, Belle, das ist alles«, entgegnete Felicia nun, »es mag ja sein, dass du nur heute die Kontrolle etwas verloren hast, was das Trinken angeht, aber vielleicht steckt da doch schon eine gewisse Gewohnheit dahinter. In diesem Fall würde ich dir raten, etwas zu unternehmen.«
»Und ich würde dir raten, deine Nase in deine eigenen Angelegenheiten zu stecken«, fauchte Belle. Dann strich sie mit einer erschöpften Geste ihre Haare aus dem Gesicht. »Wir hätten nicht kommen sollen«, murmelte sie.
»Ich finde es nicht zu viel, wenn du einmal in zehn Jahren deine Heimat besuchst. Es ist das erste Mal seit Kriegsende, dass du wieder hier bist.«
»Das ist nicht mehr meine Heimat, Mutter. Ich bin inzwischen Amerikanerin. Andreas ist Amerikaner. Unsere Kinder auch. Wir sind nur hier, weil du so gedrängt hast.«
»Wir sind eine Familie. Und …«
»Ach, hör doch auf, Mutter!« Belle griff mit der linken Hand unauffällig nach einer Sessellehne, um sich daran festzuhalten. »Du beschwörst diesen Familiengedanken immer dann herauf, wenn du das Gefühl hast, an Einfluss zu verlieren. Es passt dir nicht, zwei Enkelkinder in Kalifornien zu wissen, die ohne deine permanente Einmischung aufwachsen. Deshalb musstest du unbedingt diese Taufe hier veranstalten. Und jetzt nutzt du die Gelegenheit sofort, mich von Kopf bis Fuß zu kritisieren.«
»Entschuldige, ich habe wirklich nur gesagt …«
»Ich trinke zu viel!«, rief Belle. »Ich bin zu fett! Ich habe beruflich nichts als Misserfolge geerntet! Mein Mann betrügt mich! Fällt dir noch etwas ein? Dann sag es. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir das in einem Aufwasch erledigen!«
»Andreas betrügt dich?«, fragte Felicia überrascht. »Das hätte ich nicht erwartet.«
»Aber du kannst ihn verstehen, oder nicht? So wie ich aussehe! Und Los Angeles ist voll von hübschen Mädchen. Er braucht nur zuzugreifen.«
»Etwas Ernstes?«
Belle machte eine wegwerfende Handbewegung, die ziemlich schlingernd ausfiel. »Nein. Nein, nichts Ernstes. Mal dies, mal das. Kurze Verhältnisse. Dazwischen kommt er zurück. Aber die Mädchen machen es ihm leicht. Er sieht sehr gut aus.«
Felicia war aus dem Konzept gebracht und schwieg. Schließlich sagte sie: »Den Kindern zuliebe solltet ihr eure Familienverhältnisse …«
»… in Ordnung bringen?«, unterbrach Belle. Ihre Stimme vibrierte vor Hohn. »So wie du es uns zuliebe getan hast? Oh, Mutter! Du hast doch wirklich gelebt, wie du mochtest, kreuz und quer. Also gib mir in dieser Hinsicht bloß keine Ratschläge. Ich könnte sie nicht ernst nehmen.«
»Ich frage mich«, sagte Felicia, »warum es immer Streit geben muss zwischen uns. Ich meine, dass Susanne praktisch überhaupt nicht mit mir redet, daran hab ich mich ja schon fast gewöhnt. Aber dass du nun so aggressiv wirst …«
»Ich bin der friedlichste Mensch von der Welt, Mutter, wenn man sich nicht in meine Angelegenheiten mischt.«
»Ich habe es gut gemeint. Aber selbstverständlich brauchst du dich nach meinen Ratschlägen nicht zu richten. Bitte!« Felicia wies zur Tür. »Geh hinaus. Alle Getränke stehen dir offen. Mach einfach da weiter, wo du aufgehört hast!«
Belle starrte sie an. »Wie gemein du sein kannst«, flüsterte sie, »wie böse und gehässig!«
Sie drehte sich um und verließ das Zimmer, knickte leicht mit einem Fuß um und fluchte leise. Es lag an den Absätzen, keineswegs am Alkohol – oder nicht?
Sie trat hinaus in das herbstliche Sonnenlicht des Septembertages, dicht gefolgt von ihrer Mutter. Vor der Tür blieb sie so abrupt stehen, dass Felicia gegen sie stieß. »Was …«, fing sie an, doch dann verstummte sie. Sie sah, was ihre Tochter auch sah: eine Szene wie im Kino und so absurd, dass man im ersten Moment kaum glauben konnte, was man sah. In einem Halbkreis standen die Gäste, blass und verstört allesamt, Gläser und Zigaretten wie Requisiten in den Händen, und vor ihnen fuchtelte ein fremder Mann mit seiner Pistole herum und schrie. Markus Leonberg war zu ihm getreten und redete beschwichtigend auf ihn ein, aber der andere brüllte nur umso lauter. Es sah aus, als wollte er sie alle nacheinander erschießen, und Felicia, noch ehe sie richtig nachdachte, sagte scharf: »Hören Sie sofort auf mit dem Unsinn!«
Er wirbelte herum. Felicia sah sofort, dass er krank war, sein Ausdruck war fanatisch, wirr, unberechenbar, sein Gesicht bleich, die Augen gerötet. Der Lauf der Waffe richtete sich auf sie und Belle, und sie dachte: Das gibt es doch nicht. So etwas passiert einfach nicht.
Markus Leonberg, der die Gefahr erkannte, in die Felicia sich und ihre Tochter unvermittelt gebracht hatte, trat noch einen Schritt nach vorn und sagte: »Hören Sie, seien Sie doch …«
Wehrenberg wandte sich wieder um, wurde um noch eine Schattierung bleicher. »Niemand kommt mir zu nahe. Keinen Schritt mehr! Niemand wird mich vertreiben!«
»Niemand will Sie vertreiben«, sagte Markus beruhigend, »es wird alles …«
Er kam nicht weiter. Wehrenberg hob die Pistole. Ein Schuss krachte, Belle schrie entsetzt auf, Tom Wolff fuhr so zusammen, dass er sich seinen Drink über den Anzug schüttete, aus dem Haus erklang die entsetzte Stimme von Hanna, die sich hinter einen Schrank im Flur zurückgezogen hatte.
Aber Walter Wehrenberg hatte niemanden angegriffen als sich selbst. Die Kugel traf ihn direkt in die Schläfe, er fiel zu Boden und schlug hart auf. Die Waffe rutschte ein ganzes Stück weit über die Steine. Überall war Blut. Belle jagte die Treppe hinunter zu ihrem Mann, hörte nicht auf zu schreien, während alle anderen wie erstarrt dastanden. Dann sank Felicia auf der obersten Treppenstufe nieder und sagte leise: »O Gott, o Gott!«, und Andreas herrschte Belle an, sie solle still sein. Belle verstummte, als habe man sie auf den Mund geschlagen. Sie standen da in ihrer Szene, das Stichwort war gefallen, aber keiner wusste seinen Text. Wieder hörte man in dieser Stille die Kinder vom See herauf lachen.
Und im Haus schrie die kleine Alexandra Sophie, deren Fest auf so schreckliche Weise gestört worden war.
I. BUCH
1977–1978
1
Als Chris die Wohnung von Professor Falk verließ, war es schon sechs Uhr abends, und ihm war klar, dass er unmöglich noch rechtzeitig zum Essen draußen in Breitbrunn sein konnte. Man würde das mit hochgezogenen Augenbrauen quittieren, schließlich heiratete seine Schwester nur einmal – zumindest war das zu hoffen –, und er hatte noch nicht einmal an der Trauung teilgenommen. Aber die Familie hatte auch keine Ahnung, wie schwierig es war, sich als Student über Wasser zu halten; er konnte es nicht riskieren, seinem Job einfach fernzubleiben.
Mit seinem Vater hatte sich Chris wegen dessen Arbeit für die Rüstungsindustrie vollkommen überworfen, und obwohl Andreas Rathenberg inzwischen pensioniert war, weigerte sich Chris, von ihm auch nur einen Dollar anzunehmen. Bei der Hochzeitsfeier seiner Schwester Alexandra würde er ihm, und natürlich auch seiner Mutter, unweigerlich begegnen. Sie würden sich wieder über seine langen Haare aufregen, über seine vergammelten Jeans und das schwarz-weiße Palästinensertuch, das er um den Hals trug. Er könnte darauf wetten, dass er nach fünf Minuten mit seinem Vater streiten würde, denn es war immer so gewesen. Ob es um Chris’ Kriegsdienstverweigerung ging, um seine Hippiefreunde oder seine Sympathie für Che Guevara – sie rasselten unweigerlich aneinander. Mit sechzehn hatte Chris an einem Sitzstreik der Friedensbewegung vor dem Konzern, den sein Vater leitete, teilgenommen. Es war der Tag, an dem Andreas Rathenberg offiziell verabschiedet werden sollte. Alle Zufahrten waren blockiert, dann rückte Polizei an, und schließlich kam es zu stundenlangen Kämpfen, in deren Verlauf Autos umstürzten, Fensterscheiben zersplitterten und Verletzte auf beiden Seiten übrig blieben. Andreas musste Chris am nächsten Tag aus dem Gefängnis abholen. Es kam zum offenen Bruch zwischen ihnen, und kaum hatte Chris seinen Schulabschluss, zog er auch schon daheim aus, in eine Landkommune in den kalifornischen Bergen. Sie bauten dort ihr eigenes Gemüse an, lebten mit unzähligen Hunden und Katzen zusammen, probierten die Liebe in vielen Variationen, diskutierten die Nächte durch, umnebelten sich mit Drogen. Obwohl er dabei nicht unglücklich war, begann sich Chris mehr und mehr zu langweilen.
In dieser Phase der Unentschlossenheit und Stagnation erreichte ihn ein Brief seiner Großmutter Felicia. Sie fragte, ob er nicht zu ihr nach Deutschland kommen und dort studieren wolle, einfach so, um »frischen Wind um die Nase zu spüren«, wie sie es ausdrückte. Es war ein Strohhalm, Chris ergriff ihn. Da er neben der amerikanischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, musste er nicht einmal Formalitäten erledigen. Er flog einfach nach München, besuchte noch zwei Jahre ein Gymnasium, machte sein deutsches Abitur und schrieb sich dann an der Ludwig-Maximilians-Universität für Jura ein. Felicia, in deren Haus er zu diesem Zeitpunkt wohnte, wollte ihn unbedingt zu Betriebswirtschaft überreden, und während einer ihrer langen Diskussionen eröffnete sie ihm, dass sie vorhabe, ihn als Geschäftsführer ihrer Spielwarenproduktion einzusetzen.
Ihr Partner, Tom Wolff, war 1964 gestorben, seither führte sie das Unternehmen gemeinsam mit seiner Witwe. Beiden alten Damen war jedoch inzwischen klar geworden, dass sie jüngere Leute ans Ruder lassen mussten, aber natürlich konnten sie sich nicht auf einen gemeinsamen Geschäftsführer einigen. Letztlich würde Wolff & Lavergne zwei Geschäftsführer aushalten müssen. Während Kassandra Wolff noch hin und her überlegte, hatte sich Felicia für ihren einzigen männlichen Enkel entschieden.
Chris fand, dass sie ihm das auch schon in ihrem Schreiben nach Los Angeles hätte mitteilen können, aber Felicia bevorzugte nun mal ihre Überrumpelungstaktik. Lebensweise, Weltanschauung, Überzeugung hätten es Chris verbieten müssen, ihr Angebot anzunehmen, aber es war nicht einfach, »nein« zu sagen, wenn einem eine glänzende Zukunft auf dem Silbertablett angeboten wurde. Irgendwie gelang es ihm in dem Gespräch, sich nicht genau festzulegen, obwohl Felicia weiterhin davon ausging, dass die Dinge so geschehen würden, wie sie sich das vorstellte.
Chris beharrte auf Jura und darauf, in München statt am Ammersee zu leben; in beiden Punkten stimmte sie zu, weil ihr nichts anderes übrig blieb. Er fand Unterschlupf in einer Schwabinger WG. Seinen Lebensunterhalt verdiente er teilweise mit Nachhilfestunden, ansonsten mit der Arbeit bei Professor Falk, für den er hauptsächlich Manuskripte abtippte. Falk war äußerst veröffentlichungsfreudig, und er zahlte sehr anständig.
An der Windschutzscheibe von Chris’ klapprigem Käfer hing ein Strafzettel, den er einfach zerknüllte und in den Rinnstein warf. Dann schaute er an sich hinunter. Er hatte keine Zeit, nach Hause zu fahren und sich umzuziehen, also musste es so gehen. Mit seinen ausgefransten Jeans musste sich die Familie eben abfinden. An dem schwarzen T-Shirt konnte eigentlich niemand herummäkeln. Das lederne Stirnband würde Dad wohl stören, aber zum Teufel mit ihm! Mit dreiundzwanzig Jahren brauchte man sich nicht mehr um die Meinung seines Vaters zu scheren.
Als er losfuhr, dachte Chris an seine Schwester und daran, dass er die Wahl, die sie getroffen hatte, einfach nicht verstehen konnte. Alexandra war etwas später nach Deutschland gekommen, von ähnlichen Motiven geleitet wie er: Sie wusste nicht so recht, wie ihre Zukunft aussehen sollte. Im Übrigen floh sie vor ihrer Mutter. Chris hatte sich an Belles Trinkerei nie besonders gestoßen, aber er wusste, dass Alexandra sehr darunter gelitten hatte und bis heute nicht damit umgehen konnte. Eigentlich, dachte Chris, ein Armutszeugnis für unsere Eltern, vor einem von ihnen sind wir beide davongelaufen.
Er hatte sich gefreut, Alex, wie er sie ebenso zärtlich wie burschikos nannte, in seiner Nähe zu haben, war mit ihr durch München gestreift und hatte nächtelang mit ihr in den Schwabinger Studentenlokalen herumgehangen. Zwar wurde sie mit seinen Freunden nie warm – für die linke Szene hatte sie zu sehr den Anstrich der höheren Tochter –, aber das störte ihn nicht. Sie war seine kleine Schwester, und er liebte sie.
Dann aber hatte sie in Felicias Haus Markus Leonberg kennengelernt, der inzwischen dreiundfünfzig Jahre alt war. Chris würde nie den warmen Junitag vergessen – drei Monate war es jetzt her –, als er mit ihr in einem Straßencafé auf der Leopoldstraße saß und sie ihm eröffnete, dass sie Leonberg liebe und ihn heiraten werde. Er hatte von dieser Romanze absolut nichts mitbekommen, und so traf ihn fast der Schlag. Schließlich sagte er heiser: »Alex … das ist doch ein Witz, oder?«
Sie musterte ihn ruhig, aus kühlen grauen Augen. »Natürlich nicht. Glaubst du, ich mache Witze mit so etwas?«
Es war nicht zu fassen! Der Kerl hätte ihr Vater sein können! Alles, einfach alles fand Chris an ihm abstoßend: das dicke Auto, die teuren Anzüge, die Seidenkrawatten, die grauen Schläfen, sein Immobiliengeschäft. Jeder wusste, dass sich gerade dort die beutegierigsten und skrupellosesten Typen herumtrieben. Er selber hatte Mühe, Leonberg überhaupt die Hand zu geben, und Alex … er hielt sich eigentlich für völlig offen und unverkrampft, aber ihm wurde übel, wenn er sich vorstellte, dass sie mit ihm ins Bett ging. Es machte ihn so verrückt, dass er schließlich darüber sprechen musste. »Wie ist es, wenn … ich meine, ich kann mir nicht … schläfst du mit ihm?«
Einen Moment schien es, als wolle sie lachen über diese absurde Frage, aber dann bemerkte sie, wie ernst es ihm war.
»Ja, ich schlafe mit ihm«, sagte sie, »und es ist nicht so, dass er … nun, er ist kein alter Mann, verstehst du? Es ist alles okay bei ihm.«
Klar war es okay bei ihm. Dieser junge schöne Körper in seinem Bett aktivierte noch einmal alle Reserven. Merkte Alex denn nicht, dass er sie ausbeutete? Ihre Jugend, ihre Frische, ihre Unverbrauchtheit. Er nahm sich etwas, was ihm nicht mehr zustand, und Alex war so blind, es ihm vertrauensvoll zu geben.
»Du weißt, er hatte Frauengeschichten ohne Ende«, sagte er.
Alex schüttelte den Kopf. »Du redest daher wie ein spießiger Moralapostel. Ausgerechnet du! Du schläfst jede Woche mit einer anderen und machst sogar eine Weltanschauung daraus!«
»Das ist etwas anderes«, sagte Chris, aber er wusste nicht, wie er ihr erklären sollte, was anders war. Der Unterschied war der, dass Leonberg ein Scheißkerl mit viel Geld war, der sein Leben lang geglaubt hatte, sich jede Frau kaufen zu können. Der Mann, so Chris’ felsenfeste Überzeugung, war keines einzigen aufrichtigen Gefühls fähig.
Wütend trat er das Gaspedal durch, als er auf die Autobahn Richtung Lindau auffuhr. Eigentlich hätte er größte Lust, sich in irgendeiner Kneipe richtig volllaufen zu lassen.
Es gab Tage, da hasste Simone ihren Job aus ganzem Herzen, und heute war so ein Tag. Manchmal war es ganz nett, Taxi zu fahren, Leute kennenzulernen, mit ihnen zu plaudern, zu tratschen oder ihre Kummerkastentante zu spielen. Es erstaunte sie immer wieder, was die Leute einer Taxifahrerin alles erzählten. Liebeskummer, Geldsorgen, Probleme mit den Kindern, Ärger im Geschäftsleben. Da Simone als Psychologiestudentin sehr an Menschen interessiert war, hörte sie gern zu. Manchmal mochten die Fahrgäste am Ziel gar nicht aussteigen.
Heute aber hatte sie einen Mann im Auto, der ihr Angst machte. Am Karlsplatz war er eingestiegen, hinten. Er trug Jeans, ein blaues T-Shirt, ein grau kariertes, billiges Jackett darüber. Er roch unangenehm, irgendwie säuerlich, aber das bemerkte sie erst, als er schon eine Weile im Auto saß. Außerdem ging ihr plötzlich auf, dass sie den Mann schon längere Zeit gesehen hatte, ohne ihn bewusst zu registrieren. Während sie in der Taxireihe stand und darauf wartete, an die erste Stelle zu rücken, hatte er auf dem Platz vor dem Brunnen gestanden, scheinbar ziellos und so unauffällig, dass Simones Blick ihn nur kurz gestreift hatte. Jetzt, als ihr dies ins Gedächtnis kam, wurde ihr klar, dass er mindestens vier Taxis hatte abfahren lassen, ehe er bei ihr eingestiegen war. Natürlich konnte es dafür eine harmlose Erklärung geben, er hatte vielleicht auf jemanden gewartet, der nicht gekommen war, dann hatte er aufgegeben und war in den nächsten Wagen, zufällig ihren, eingestiegen. Es konnte aber auch sein, dass er es gezielt auf sie abgesehen hatte, auf eine Frau also. Warum?
Für den Fall, dass er sie nicht erwürgen, vergewaltigen oder aufschlitzen würde, konnte sie eine Menge Geld an ihm verdienen: Er wollte nach Hechendorf am Pilsensee. Das waren gut vierzig Kilometer Fahrt. Aber es fuhr doch eine S-Bahn dorthin, warum verschleuderte der Mann sein Geld? Zumal er nicht aussah, als habe er allzu viel davon. Wollte er sie in Wahrheit nur einfach aus der Stadt herauslocken?
Beklommen meldete sie die Fahrt über Funk an die Zentrale. »Ich fahre nach Hechendorf, Autobahn Lindau.«
Stutzen auf der anderen Seite, dann eine muntere Stimme: »Alles klar!«
Sicher dachte man dort, dass Simone mal wieder einen Glückstag habe.
Der Mann machte keinerlei Anstalten, ein Gespräch zu beginnen, hüllte sich in Schweigen. Aber er wandte nicht eine Sekunde den Blick von ihr. Wann immer sie in den Rückspiegel sah, begegnete sie seinen starren Augen.
Sie wollte auf keinen Fall hysterisch werden und versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Morgen musste sie eine Ferienhausarbeit abgeben, von der die letzten Seiten noch nicht getippt waren. Wenn sie diesen ominösen Fahrgast los war, würde sie Schluss machen für heute, nach Hause fahren und sich an die Schreibmaschine setzen. Vorher ein heißes Bad, dann einen großen Becher Tee. Sie sehnte sich plötzlich heftig nach der Sicherheit und dem Frieden ihrer vier Wände.
Sie schaltete das Radio ein. In den Nachrichten ging es wie immer in den letzten Wochen um den entführten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer. RAF-Terroristen hatten ihn Anfang September in Köln von der Straße weg gekidnappt und verlangten nun die Freilassung inhaftierter Gesinnungsgenossen. Nach den Morden an Generalbundesanwalt Buback und Bankier Ponto war dies der dritte Anschlag von Baader-Meinhof in diesem Jahr. Simone hatte für Repräsentanten der bundesdeutschen Wirtschaft wie Hanns Martin Schleyer wenig Sympathie, aber von diesem Drama fühlte sie sich doch tief betroffen. Seit drei Wochen wurde der Mann irgendwo festgehalten. Es gab Polaroidfotos von ihm, die seine Entführer der Öffentlichkeit zuspielten. Er sah elend aus darauf, leidend, erschöpft. Simone wünschte, die Sache möge gut ausgehen für ihn.
Die neueste Radiomeldung zur Entführung nahm sie zum Anlass, ein Gespräch mit dem Fahrgast zu beginnen. »Ich frage mich, was die Regierung jetzt tun wird«, sagte sie, »ich denke, sie wird nachgeben müssen. Sie können ihn doch nicht einfach opfern.«
Der Mann sagte nichts.
»Andererseits«, fuhr Simone nervös fort, »zeigt sie sich damit erpressbar. Die RAF wird es immer wieder auf diese Weise versuchen. Festnahmen von Terroristen könnten eine reine Farce werden.«
Der Mann schwieg noch immer. Sie fuhren inzwischen auf der Autobahn, auf der an diesem Samstagnachmittag kaum Verkehr herrschte. Schon wurde es dämmrig, die Sonne stand tief über den bunten Herbstwäldern. Ende September waren die Tage schon merklich kürzer.
»Ein bisschen hysterisch ist es schon, wie sie inzwischen jeden als Terroristen verdächtigen, finden Sie nicht?« Simone hatte den Eindruck, dass sich ihre Stimme ganz atemlos anhörte, solche Angst hatte sie inzwischen. Sie redete auch nur, weil sie die Stille nicht mehr ertrug, nicht weil sie das Thema im Augenblick interessierte. Nichts interessierte sie, außer der Frage, wie sie den Kerl loswerden könnte. »Man muss nur etwas unbürgerlich wirken, schon nehmen sie einen aufs Korn. Ein hervorragender Nährboden für Spitzel und Denunzianten.«
Er sagte nichts. Sie schaute ihn im Rückspiegel an. Seine Augen waren so starr, als seien sie aus Glas, die Pupillen unnatürlich geweitet. Nie hatte sie ein Gesicht von solcher Kälte und Regungslosigkeit erlebt. Der Kerl war ein Psychopath, und das hätte sie sofort erkennen müssen. Sie hätte ihn nicht in ihr Auto lassen dürfen. Auf einmal war sie auch ganz sicher, dass er am Stachus gezielt auf sie gewartet hatte. Sie war eine verdammte Idiotin.
Der Schweiß brach ihr unter den Handflächen und im Nacken aus. Am Rücken fing ihre Haut an zu jucken, wie immer, wenn sie sich aufregte. Die Panik kletterte jetzt so heftig in ihr hoch, dass sie spürte, sie würde sie nicht mehr lange unterdrücken können.
»Ich fürchte, es geht mir nicht so gut«, hörte sie sich sagen, »mein Kreislauf ist sehr schlecht. Es ist zu unsicher, wenn ich weiterfahre.« Die Angst gab ihr die Worte ein, sie hatte nicht den Eindruck, dass sie in ihrem Kopf entstanden. »Hier ist die Abfahrt nach Germering. Ich könnte Sie dort zur S-Bahn bringen. Damit kommen Sie auch nach Hechendorf.« Sie schaute wieder nach hinten, suchte irgendeine Regung in diesen starren Augen zu entdecken. Ihr Atem ging keuchend.
Sie befand sich direkt vor der Abfahrt. »Soll ich also hier …« Sie setzte den Blinker nach rechts. Im selben Moment fühlte sie etwas Kaltes am Hals.
»Fahren Sie weiter geradeaus«, sagte der Mann. Ihn sprechen zu hören kam so unerwartet, dass sich Simone erst klarmachen musste, dass die Worte von ihm kamen. Es war eine schreckliche Stimme, viel zu hoch für einen Mann und eigenartig winselnd. Jetzt erst registrierte sie, dass er ihr ein Messer an den Hals hielt.
»O Gott«, sagte sie, »o Gott.« Der Blinker zeigte immer noch nach rechts, aber sie fuhren weiter geradeaus. Ein paar Meter lang bewegte sich das Auto im Zickzack, weil Simone so zu zittern begann, dass sie das Steuer nicht mehr gerade halten konnte. Ein genervter Mercedesfahrer hinter ihr blinkte sie an, dann überholte er sie und schaute dabei kopfschüttelnd zu ihr hinüber. Ihre Situation bemerkte er nicht, er fuhr zu schnell, um wirklich etwas erfassen zu können, außerdem verbargen ihre langen Haare das Messer. Offenbar fragte er sich nicht, weshalb sich der Fahrgast eines Taxis in dieser Weise zur Fahrerin vorbeugte.
»Was wollen Sie?«, fragte Simone, obwohl sie ziemlich deutlich ahnte, worum es ihm ging. Das war kein Räuber, der es auf ihr Geld abgesehen hatte. Es war der Triebtäter, wie er im Buche steht. Ein klassisches Exemplar.
Schluchzen würgte sie im Hals. »Wenn Sie Geld möchten, Sie können es haben. Ich werde Sie nicht anzeigen …«
Er will kein Geld, er will mich!
Als einzige Antwort drückte er ihr das Messer fester gegen den Hals. Sie konnte seinen heißen Atem an ihrem Ohr spüren und nahm jetzt verstärkt seinen schlechten Geruch wahr. Er roch wie saure Milch, gemischt mit tagealtem Schweiß. Er hatte sich mindestens eine Woche lang nicht mehr gewaschen.
Sie wollte nicht betteln und weinen, aber die Tränen kamen ihr, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. »Bitte«, sagte sie, »bitte tun Sie mir nichts. Bitte.«
»Fahr da auf den Parkplatz«, sagte der Mann. Seine Stimme klang jetzt heiser. Unverkennbar verriet sie Erregung. Eine Sekunde lang erwog Simone, seine Aufforderung zu ignorieren und einfach weiter geradeaus zu fahren. Die Frage war, ob er dann zustechen würde. Es schien ihr vorstellbar, er wirkte zu gestört, um vernünftig zu handeln.
Die spitze Klinge ritzte in ihre Haut. Das Tempo des Wagens verlangsamend, bog sie auf den Parkplatz. Die Dämmerung hatte sich so vertieft, dass sie automatisch die Scheinwerfer einschaltete, aber sie bezahlte es mit einem jähen Schmerz an ihrem Hals. »Licht aus!«, zischte der Mann. Die Tränen liefen ihr jetzt in Strömen über das Gesicht. Außerdem blutete sie am Hals, er hatte sie ernsthaft verletzt. Sie betete, es möchten Menschen auf dem Parkplatz sein, aber er lag da wie ausgestorben. Kein Auto, kein Reisender, nichts. Rechter Hand Felder, endlos weit, links die Autobahn, jede Sicht zu ihr unmöglich durch eine Wand aus hohen dichten Büschen. Was immer hier geschah, niemand von den Vorüberfahrenden würde es bemerken.
Als sie begriff, dass ihr Leben kaum noch einen Pfifferling wert war, versiegten Simones Tränen, und etwas von der Ruhe und Vernunft, die andere Menschen an ihr schätzten, kehrte zurück. Sie hielt an und sagte: »Wissen Sie, ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht Probleme haben, über die Sie gern reden würden. Falls Sie mit mir sprechen möchten, ich kann sehr gut zuhören. Für manches wüsste ich sicher einen Rat. Wir könnten …« Sie stieß einen Schmerzenslaut aus, als der Mann ihr in die Haare griff und grob ihren Kopf zur Seite zerrte. Das Messer lag nun unmittelbar an ihrer Kehle. »Halt’s Maul, du Hure«, sagte er, »wir steigen jetzt aus.«
Das weckte einen Hoffnungsschimmer in Simone. Wenn er sie nicht hier im Auto umbrachte, fand sie vielleicht eine Chance wegzulaufen. Nur ein paar Meter, und sie wäre an der Straße. Wenn kein Auto käme, könnte sie hinüber zur anderen Fahrbahn laufen; dort war der Verkehr dichter, weil viele Münchner den schönen Herbsttag an den Seen verbracht hatten und nun zurückfuhren. Irgendeiner würde anhalten.
Nicht durchdrehen, befahl sie sich im Stillen, du musst jetzt die Nerven behalten.
Der Mann stieß die Tür auf und stieg aus. Für drei Sekunden musste er ihre Haare loslassen und das Messer von ihrem Hals nehmen, ehe er ihre Tür öffnen und sie hinauszerren konnte. Simone nutzte die Gelegenheit sofort, war wie der Blitz auf dem Beifahrersitz, kümmerte sich nicht darum, dass ihr linker Schuh am Schalthebel hängen blieb. Sie sprang hinaus, war geistesgegenwärtig genug, nicht in die Felder zu laufen. Die Straße! Aber zwischen ihr und der Straße befanden sich sowohl das Auto als auch der Mann, und sie musste verharren, um zu sehen, um welche Seite des Wagens herum er auf sie zukommen würde. Sie fixierten einander, und jetzt war Leben in seinen starren Augen, Wut, Hass, Grausamkeit. Er mochte geistesgestört sein, aber er war clever. Er tat einen Satz, als wollte er um die Nase des Autos herumrennen, aber kaum lief sie um das Heck, drehte er um. Er erwischte sie sofort, packte ihren Arm mit eisenhartem Griff und drehte ihn auf den Rücken. Sie schrie auf, vor Schmerz, vor Angst, vor Verzweiflung. Seine helle, kranke Stimme klang wieder dicht an ihrem Ohr. »Ich werde dich töten, du Biest! Ich werde dich töten!«
Sie weinte wie ein Kind, flehte um ihr Leben, versprach ihm alles Geld, das sie bei sich hatte, aber es interessierte ihn nicht. Er zerrte sie an den Haaren in Richtung Feld, und sie versuchte, die Füße gegen den Boden zu stemmen, wimmernd, von Übelkeit ergriffen. »Tun Sie mir nicht weh! Tun Sie mir bitte, bitte nicht weh!« Und dann, plötzlich, bog ein Auto auf den Rastplatz. Helles Scheinwerferlicht flammte auf und erfasste genau die gespenstische Szenerie: ein sich wild wehrendes, wimmerndes Mädchen, das von einem mit einem Messer bewaffneten Mann an den Haaren weggeschleift wurde. Mit quietschenden Bremsen kam das Auto zum Stehen.
Der Mann erstarrte, stieß einen Fluch aus und ließ Simone los, so unvermittelt, dass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. In Sekundenschnelle saß er im Taxi, wo der Zündschlüssel noch steckte, und ließ den Motor an. Aus dem anderen Auto sprang ein junger Mann, der einen Moment unschlüssig schien, ob er sofort wieder einsteigen und das flüchtende Taxi verfolgen oder sich um das am Boden liegende Mädchen kümmern sollte. Er entschied, dass es für ihn schwierig und gefährlich sein würde, den Mann zu stellen, und dass der ohnehin keine Chance hätte, wenn er die Taxinummer möglichst schnell der Polizei durchgäbe. Zudem konnte das Mädchen verletzt sein und schnelle Hilfe brauchen.
Sie lag zusammengekrümmt da, zitternd und schluchzend, die langen blonden Haare wirr über den Asphalt verteilt. Sie trug ein übergroßes weißes Männerhemd, verwaschene Jeans und nur einen Schuh. Als Chris neben ihr niederkauerte, entdeckte er zu seinem Entsetzen Blut an ihrer Schulter. Er schob die Haare weg, fand die Wunde am Hals, die ihm jedoch nicht gefährlich zu sein schien. Das Mädchen krümmte sich, als er es berührte, in panischer Angst noch mehr zusammen, stieß Laute aus, die an ein junges verzweifeltes Tier erinnerten. Ihre Nerven versagten nun völlig. Chris sprach beruhigend auf sie ein. »Keine Angst. Bitte, haben Sie keine Angst. Er ist weg. Hören Sie doch, der Kerl ist weg. Ihnen wird nichts geschehen.«
Er hatte noch nie einen Menschen so zittern sehen. Guter Gott, sie war aber auch verdammt dicht daran gewesen, mit zerfetzten Kleidern irgendwo in diesen Feldern zu landen und Tage später als Leiche von einem Bauern oder spielenden Kindern entdeckt zu werden. Der reine Zufall hatte ihn auf den Rastplatz geführt, vielmehr das dringende Bedürfnis, noch eine Zigarette zu rauchen, ehe er seinem Vater und dem unerträglichen Bräutigam seiner Schwester gegenübertreten würde. Mit dem Rest der Familie käme er zurecht, auch wenn Mum sicher wieder ein paar Gläser zu viel getrunken hatte, aber diese beiden Männer lagen ihm gewaltig im Magen. Da er sich seine Zigaretten selber drehte, musste er anhalten, und das hatte diesem Mädchen das Leben gerettet.
Vorsichtig zog er sie hoch, lehnte sie im Sitzen gegen sein Bein, strich ihr sanft die Haare aus dem Gesicht. Grüne Augen, von Panik erfüllt, starrten ihn an. Das Schluchzen verstummte, aber sie zitterte noch immer wie Espenlaub.
»Es ist alles okay«, sagte Chris, »ich tue Ihnen nichts. Haben Sie bitte keine Angst mehr.«
Sie nickte, schluckte, bemühte sich, ihren heftigen Atem unter Kontrolle zu bekommen. »Haben Sie ein Taschentuch?«, fragte sie dann.
Chris durchsuchte seine Hosentaschen und fand tatsächlich ein Papiertuch. Sie putzte sich kräftig die Nase und trocknete ihr nass geweintes Gesicht. »Es war so grässlich«, flüsterte sie, »er war irr, vollkommen irr. Ich hätte es gleich merken müssen. Ich war wahnsinnig, ihn einsteigen zu lassen.«
»Sie sind Taxifahrerin, nicht?«
Sie nickte, fügte dann aber hinzu: »Eigentlich bin ich Studentin. Ich jobbe nur nebenher.«
Sie war unwahrscheinlich klein und dünn, stellte Chris fest. Das sehr blasse Gesicht mit der etwas spitzen Nase gab ihr das Aussehen eines unterernährten Kindes. Sie wirkte intelligent und energisch, wenn auch im Augenblick völlig aufgelöst und noch dicht an der Grenze zu einem hysterischen Ausbruch.
»Wir sollten versuchen, das nächste Telefon zu erreichen«, sagte Chris, »wir müssen die Polizei anrufen. Die können ihn leicht schnappen, solange er in Ihrem Taxi unterwegs ist.«
»Ich will nach Hause.«
»Natürlich. Aber wir müssen erst die Polizei anrufen. Wollen Sie, dass er entwischt?«
Er half ihr vorsichtig auf die Beine, während sie unaufhörlich wiederholte: »Ich will nach Hause.«
»Ich bringe Sie nach Hause. Aber vorher rufen wir die Polizei an. Sie möchten doch nicht, dass er einer anderen Frau antut, was er Ihnen fast angetan hätte, oder?«
Sie schüttelte den Kopf, hielt Chris’ Hand fest, während sie ihm zu seinem Auto folgte. Einmal blieb sie stehen, starrte über die herbstlichen Felder, die immer mehr eintauchten in die Dunkelheit des Abends. »Ich wäre jetzt schon tot«, sagte sie leise, »ich bin sicher, jetzt in diesem Moment wäre ich schon tot.«
Chris hielt das auch für ziemlich wahrscheinlich, sagte aber aufmunternd: »Sie sehen, Sie haben einen guten Schutzengel. Wie heißen Sie?«
»Simone.«
»Ich heiße Chris. Simone, wir werden jetzt die Polizei anrufen und denen die Nummer des Taxis durchsagen. Kann sein, die wollen, dass Sie aufs Revier kommen und eine Täterbeschreibung abgeben, aber wir werden versuchen, das auf morgen zu verschieben. Und dann fahre ich Sie nach Hause.«
»Okay.« Sie schien etwas ruhiger zu werden. Dann fiel ihr etwas ein. »Ich wohne in München. Sie wollten aber offensichtlich in die andere Richtung. Ich will Ihnen nicht …«
Er öffnete ihr die Wagentür. »Machen Sie sich keine Gedanken. Ich hatte nichts Wichtiges vor. Jedenfalls nichts Angenehmes. In gewisser Weise haben Sie mir auch aus der Patsche geholfen.« Das stimmte. Nun brauchte er seinem Vater nicht zu begegnen und dem verhassten frischgebackenen Schwager nicht die Hand zu schütteln. Und niemand, nicht einmal dieser Drache Felicia, konnte ihm einen Strick daraus drehen. Eine Sekunde lang bedauerte er nur, dass Alex enttäuscht sein würde. Aber warum hatte sie sich auch mit diesem Ausbeuter Leonberg einlassen müssen? Er würde es nie verstehen.
2
Die Nacht war kalt und klar, der Himmel voller Sterne und unendlich hoch, der Geruch ringsum würzig, feucht, voller Pilze und Blätter, Beeren und nasser Rinde. Der Geruch einer Herbstnacht. Alexandra lehnte an Markus Leonbergs Auto, froh, dem Trubel entflohen zu sein. Die Hochzeitsfeier hatte im Haus ihrer Großmutter stattgefunden, nachmittags draußen auf der großen Sonnenterrasse, abends zum Essen dann drinnen, bei Kerzenschein und leiser Musik. Alexandra und Markus hatten am Kopfende gethront, flankiert von den Brauteltern Andreas und Belle. Alexandra hatte die ganze Zeit über ihre Mutter nervös beobachtet, die dem Sherry, der am Vormittag vor der Trauung als Begrüßungstrunk gereicht worden war, schon reichlich zugesprochen hatte. Bis zum Abend war sie zwar immer stiller geworden, aber nur einem aufmerksamen Beobachter wäre aufgefallen, dass sie sich sehr elend fühlte. Sie schlug sich auch gerade wieder mit einer Diät herum, was sie nicht schlanker, dafür aber nervöser und zittrig werden ließ.
Chris war nicht erschienen, und beim Dessert hörte Alexandra auf, noch mit seinem Erscheinen zu rechnen. Sie hatte gewusst, dass er nicht die ganze Zeit über dabei sein konnte, wegen dieses Jobs, den er bei dem Professor hatte, aber er hatte gesagt, dass er am Abend kommen würde. Obwohl er Markus nicht leiden konnte und mit Dad vollkommen verkracht war. Irgendwie sah es ihm nicht ähnlich, dass er sich davor drückte.
Vor einer Viertelstunde hatte Markus ihr ins Ohr geflüstert, dass sie nun eigentlich gehen und die anderen allein weiterfeiern lassen könnten, und während er sich auf die Suche nach seinen Autoschlüsseln machte, war sie bereits hinausgelaufen. Sie hoffte, sie würden entkommen können, bevor jemand etwas merkte. Sie wollte kein Brimborium, bei dem man sie beide mit Reis oder Konfetti bewarf und anzügliche Bemerkungen machte, ihnen grinsend einen »Happy Honeymoon« wünschte. Der Tag war lang und anstrengend gewesen, sie sehnte sich danach, mit Markus allein zu sein.
Alexandra zog die weiße Strickstola enger um ihre Schultern. Erstaunlich, wie kalt es schon werden konnte nach einem warmen Tag. Sie hatte auf ein klassisches Brautkleid mit Schleier und Schleppe verzichtet und sich stattdessen ein cremefarbenes langes Sommerkleid gekauft; der weit schwingende Rock reichte bis zu den Knöcheln, das Oberteil hatte bauschige Ärmel und einen tiefen runden Ausschnitt. Ihre langen Haare fielen wie ein dunkler schwerer Schleier bis zur Taille.
»Du siehst aus wie ein Flower-Power-Girl aus Kalifornien«, hatte Felicia missbilligend am Morgen gesagt, »warum dieses Schlabbergewand? Ein elegantes Kostüm wäre viel besser gewesen!«
Sie hatte nur mit den Schultern gezuckt. Es fehlte gerade, dass Felicia auch noch bestimmte, was sie anzog. Sie hatte schon für genug Aufregung gesorgt, indem sie in allem, was die Hochzeit anging, ihren Willen durchzusetzen versuchte. Markus war beinahe auf die Barrikaden gegangen, als er von Alexandra erfuhr, ihre Großmutter habe auf einer Gütertrennungsvereinbarung vor der Eheschließung bestanden.
»Das kann doch nicht wahr sein! Was geht es sie an? Was will sie? Dass wir jetzt bereits vertragliche Vereinbarungen unsere eventuelle Scheidung betreffend festlegen?«
»Sie sagt, sie war zweimal verheiratet, und sie weiß, wovon sie spricht«, erwiderte Alexandra vorsichtig, »vielleicht ist der Vorschlag nicht so dumm. Ich denke nicht, dass irgendetwas bei uns schiefläuft, aber wenn doch, wäre es sehr mühsam, dann mit dem Auseinanderdividieren anzufangen!«
Er hatte sie tief verletzt angesehen, glaubte aber offenbar, sie finde einfach nicht die Kraft, sich gegen Felicia durchzusetzen, und akzeptierte zähneknirschend. Er hielt seine Braut mit dem feinen schmalen Gesicht und den langen Haaren für ein romantisches junges Mädchen, und es wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, dass sich eine gute Portion Sinn für Realität und eine ausgeprägte Fähigkeit zu nüchterner Kalkulation hinter ihrer hohen Stirn verbargen. Alexandra fand, dass er das keineswegs wissen musste, und so verschwieg sie, dass sie – obwohl verärgert über die Einmischung – Felicias Vorschlag für äußerst intelligent hielt.
Als Nächstes hatte die Großmutter darauf bestanden, dass Alexandra zwar am Vorabend der Hochzeit bereits die Sachen in Markus’ Bogenhausener Villa bringen, dann aber nach Breitbrunn zurückkehren und dort die Nacht über bleiben solle. Alexandra erschien das ziemlich konventionell, aber sie fügte sich. Allzu eilig hatte sie es ohnehin nicht, in ihrem neuen Münchner Domizil einzuziehen. Es war alles so schnell gegangen. Sie fühlte sich atemlos wie nach einem Hundertmeterlauf.
Als sie Schritte hörte, fragte sie: »Markus?« Aber dann trat ein anderer Mann in den Lichtkegel der Straßenlaterne, unter der sie stand, und überrascht sagte sie: »Ach, Dan, du bist es.«
Daniel Liliencron, der Sohn eines der besten Freunde von Felicia, ein dreißigjähriger Anwalt mit dem Ruf, seine Prozesse ziemlich skrupellos zu führen, sehr viel Geld zu verdienen und von den Frauen geradezu verfolgt zu werden. Auf den ersten Blick schienen er und Markus Leonberg einander zu ähneln, jedenfalls was Charakter und Lebensumstände anging, aber in Wahrheit trennten sie Welten. Hinter Leonbergs Ehrgeiz, hinter seiner oft kritisierten Brutalität im Geschäftsleben steckte eine tief verletzte, gequälte Seele, ein Mensch, der sich immer nach der beständigen Bindung an einen anderen gesehnt hatte, ohne in der Lage gewesen zu sein, diese Bindung einzugehen. Dan Liliencron hingegen hatte man nie verwundet. Er war selbstbewusst, optimistisch, sehr intelligent und jung, er wollte das Leben genießen und seine Grenzen erkunden – was Geld, Beruf, Frauen anging. In allem, was er tat, war er sorglos und unbekümmert, wie jemand, der es im Innersten nicht für möglich hält, dass ihm etwas zustoßen könnte. Darin unterschied er sich besonders krass von Leonberg. Markus witterte in jeder Sekunde alles mögliche Unheil, und sein Leben drehte sich darum, genug Geld anzuhäufen, um dahinter sicher zu sein.