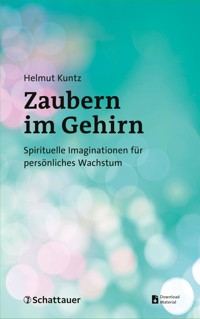33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sucht: Raus aus der Krise Suchthilfesystem bereichern durch alte Weisheiten und höheres Wissen Wichtigster Wirkfaktor auf dem Heilungsweg ist die Spiritualität Süchtig abhängige Menschen müssen häufig feststellen, wie wenig ihnen unser Suchthilfesystem zu helfen in der Lage ist. Menschen, die von ihrer Abhängigkeit frei werden durften, erklären häufig: »Wirkliche Hilfe habe ich von ganz anderer Seite her erfahren.« Entsprechend eröffnet dieses Buch ein erweitertes Verständnis des Phänomens Sucht – für direkt und indirekt Betroffene. Der Autor verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Drogen- und Suchtarbeit. Was ihm beim Umgang mit den therapeutischen Herausforderungen geholfen hat: Er greift zurück auf vergessene alte Wissensschätze und transferiert deren Verständnis von Krankheit wie Heilung ins Hier und Heute. Sowohl in der Selbsthilfe als auch in der psychosozialen und therapeutisch begleiteten Hilfe können somit ungewöhnliche und nachhaltige Wege aus der Sucht beschritten werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Helmut Kuntz
Sucht und Spiritualität
Abhängigkeit weiter denken, neu verstehen, verbundener behandeln
Schattauer
Impressum
Besonderer Hinweis:
Die in diesem Buch beschriebenen Methoden sollen psychotherapeutischen Rat und medizinische Behandlung nicht ersetzen. Die vorgestellten Informationen und Anleitungen sind sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Dennoch übernehmen Autor und Verlag keinerlei Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Anwendung oder Verwertung der Angaben in diesem Buch entstehen. Die Informationen sind für Interessierte zur Weiterbildung gedacht.
Kontakt zum Autor
Anfragen für Seminare, Workshops, Beratungen oder Therapien erreichen mich unter:
Weitere Informationen unter:
https://helmut-kuntz.de/
Dort finden sich unter »Termine« auch bereits datierte Veranstaltungen.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Schattauer
www.schattauer.de
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Gestaltungskonzept: Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von iStock/ROMAOSLO
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
Lektorat: Miriam Seifert-Waibel, Hamburg
Projektmanagement: Dr. Nadja Urbani
ISBN 978-3-608-40192-9
E-Book ISBN 978-3-608-12417-0
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20698-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1 Sucht: Weiter denken
1.1 Heilen ist mehr als Medizin: Von den Ursprüngen des Heilens als Heilkunst
1.1.1 Asklepios oder Äskulap: Der Gott der Heilkunst
1.1.2 Die Therapeuten der Antike: Überholte Vorbilder oder heilsame Sinnstifter für eine moderne Therapie der Sucht?
1.2 Die Krankheitslehre des Paracelsus und ihre Bedeutung für die süchtige Abhängigkeit
1.2.1 Die vier Säulen des medizinischen Wirkens bei Paracelsus
1.2.2 Die Lehre von den fünf Entien im Fokus der süchtigen Abhängigkeit
Ens Astrorum oder Ens Astrale
Ens Veneni
Ens Naturale
Ens Spirituale
Ens Dei
1.2.3 Paracelsus als Neuerer: Die Lehre von den Elementalen
2 Sucht: Neu verstehen
2.1 Daskalos und seine Lehre von den Elementalen im Fokus von Drogengebrauch und süchtiger Abhängigkeit
2.2 Wie ein Alkoholelemental zur Macht kommen kann
2.3 Individuelle und kollektive Elementale
2.4 Ein Suchtelemental lässt sich nicht bekämpfen
2.5 Elementale als unreine Geister
2.6 Hilfreiche dienstbare Geister zur Entkräftung dunkler Elementale
2.7 Ein kleiner Königsweg: Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Selbsthilfe
2.8 Heilsame Hilfen aus anderen Welten
2.9 Dharma oder das Eingebundensein in ein Drittes als Weg zum Ausstieg aus der süchtigen Abhängigkeit
2.10 Sucht als (Um-)Weg zur spirituellen Erweckung
2.11 Eine Vision als Ausweg aus der Sucht
2.12 Clean werden, sein, bleiben: Ein erweitertes Verständnis von Abstinenz
2.13 Die Kehrseite der Abstinenz
2.14 Clean werden auf innerer, mentaler Ebene
2.15 Angesammelte Schuldkonten und deren Ausgleich
2.16 Es gibt immer eine Wahl, oder: 80 Jahre sind 29 200 Lebenstage
2.17 Gleich und gleich gesellt sich gerne
2.18 Dienstbare Geister zur inneren Entgiftung und seelischen Reinigung
2.19 Das dienstbare Imaginale in der menschlichen Verfasstheit, oder: Der Mensch durchbricht das Himmelsgewölbe
2.20 Heilsame Methoden im Lichte der Verbundenheit
2.21 »Einbrüche« der geistigen Welt in den menschlichen Schöpfergeist
3 Sucht: Verbundener behandeln
3.1 Wissen, wer gemeint ist
3.2 Altes Heilwissen neu gedacht für Menschen im Hier und Jetzt
3.3 Unverzichtbar: Das Suchtelemental und seine Gestalt. Wache Präsenz auf allen Kanälen
3.4 Helle Methoden samt dienstbarer Geister zur Entbindung von einem Elemental
3.4.1 Die Lebens- und Willenskraft nähren
3.4.2 Sich in Dankbarkeit üben
3.4.3 Eine Wohnung im eigenen Herzen einrichten
3.4.4 Imagination in Licht und Liebe
3.4.5 Hand aufs Herz
3.4.6 Vergeben und Verzeihen als Wege zur Er-Lösung
Es freut sich in meinem Herzen …
Ein Vergebungsritual zur Aussöhnung
Ein Vergebungsritual, gerichtet an die eigene Person
Ein Vergebungsritual zur Reinigung von abträglichen Gedanken und Selbstzweifeln
3.4.7 Die Angst vor der Angst überwinden
3.4.8 Eine Hoffnung bleibt immer
3.4.9 Wie du mir, so ich dir …
4 Offenes Ende, oder: Eine Sucht wird nicht besiegt. Die Sucht gibt frei, wenn es erlaubt ist
Literaturverzeichnis
Es ist so erstaunlich, am Leben zu sein …
H. K.
Vorwort
Gedanken bewegen die Welt. Auch Ihre. Stellen Sie sich vor: Jeden neuen Tag, an dem Sie morgens aufwachen, gehen Sie voll innerer Freude an Ihren Arbeitsplatz im weiten Feld von Sucht und Drogen. Sie freuen sich auf jeden einzelnen Menschen, der für diesen Tag in Ihrem Terminkalender eingetragen ist. Aufgrund Ihrer inneren Haltung zu Ihrer Arbeit, zu Bereitwilligkeit und Hilfsbereitschaft ist es Ihnen gänzlich fremd, jemals zu denken, ein bestimmter Klient oder eine bestimmte Patientin1 möge doch lieber nicht erscheinen. Es wäre Ihnen gerade recht, wenn sie absagen oder noch besser gleich ganz wegbleiben würden. Sie sind einfach zu anstrengend. Nein, solche Gedanken sind Ihnen komplett fremd.
Denkbar oder gänzlich unvorstellbar? Denkbar ist so manches, doch in der Wirklichkeit der Suchtarbeit melden sich vielfach widerstreitende innere Stimmen zu Wort: »Alle Bemühungen und Arbeit im Bereich von Drogen und Sucht sind eine einzige freudlose, demotivierende Großveranstaltung«, klagt die Stimme der Bitterkeit aus dem Gefühlsgemenge von Anstrengung, Frustration, Enttäuschung und Ohnmacht heraus. »Das klingt so negativ. Aus meiner Perspektive ist all dieses Bemühen und Helfen eine riesige Chance für gutes Gelingen, Wandlung und Freude, manchmal sogar für Glück!«, erwidert die Liebe aus dem sicheren Gefühl von Verbundenheit, Zuversicht und innerem Frieden heraus. Und was sagen oder denken Sie als der Mensch, der Sie sind, mit Ihren ganz persönlichen Lebenserfahrungen, genau in diesem Moment?
In jedweder Rolle erfahren Sie das Leid der Sucht aus unterschiedlicher Perspektive – ob als Person in einem helfenden und heilenden Beruf oder in einer Institution des psychosozialen Versorgungssystems; ob als Mutter oder Vater eines Kindes, das sich durch seinen Drogengebrauch tiefgreifend in seinem Wesen verändert hat; ob als junger oder erwachsener Mensch, der selbst Drogenerfahrungen gesammelt hat; ob als direkt Betroffener, der die tiefsten Täler einer süchtigen Abhängigkeit2 durchschritten hat oder weiterhin in ihnen gefangen ist. In jedem Fall aber erfahren Sie es hautnah. Es ist ausgeschlossen, dass Sucht kein Leiden verursacht. Wohlgemerkt: Wir sprechen von Substanzmissbrauch und Sucht, nicht von einem situativen Gebrauch von Genuss- oder Rauschmitteln, der mit Spaß, Wohlbefinden, Ausgelassenheit oder einem spirituell eingebundenen Ritual einhergehen mag.
Wie wird die tägliche, vielfältige Arbeit in den zahlreichen ambulanten wie stationären Einrichtungen des etablierten Suchthilfesystems von den darin tätigen Menschen erlebt? Was ist die geforderte Leistung von Angehörigen, wenn Drogen und Sucht in die privatesten Winkel ihrer Beziehungsgefüge Einzug halten? Wie lässt sich diese Arbeit am und mit Menschen überhaupt sinnvoll bewerkstelligen in einer Gesellschaft, die selbst bis ins Mark hinein nach den Gesetzmäßigkeiten einer süchtigen Dynamik organisiert ist? Ist die Arbeit im weiten Feld von Drogen und Sucht ein Verschleiß menschlicher Ressourcen und ein Abgrund des Leids oder kann sie gar als menschliche Bereicherung sowie Quelle für Freude und Gelingen dienen? Da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Als widersprüchliche Positionen müssen sie aber in keiner Weise unvereinbar sein. Sie sind keine diametral entgegengesetzten Pole, stellen kein Entweder-oder dar. Zwischen ihnen befindet sich ein Kontinuum, in dem sich sämtliche Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Phänomen Drogen und Sucht befasst sind, je nach ihrem inneren Erleben wiederfinden.
Außerdem: Das etablierte Suchthilfesystem gibt es nicht. Was es gibt, ist ein heterogenes Feld, in dem die unterschiedlichsten Akteure und Akteurinnen zu den Bereichen Drogen und Sucht am Werk sind, und zwar eher divers gesplittet als sich im Denken und Handeln einig. Da finden wir eine Vielfalt an ambulanten Drogen- und Suchtberatungsstellen in unterschiedlicher Größe, Rechtsform, Trägerschaft und Finanzierungsstruktur mit reduzierten oder breit gefächerten Regelangeboten in den Bereichen Prävention, Beratung und Therapie, die personell stabil aufgestellt sind mit einem handlungsfähigen Team oder von fluktuierender Natur, wobei sämtliche Beschäftigte ihr eigenes Verständnis des Phänomens Sucht sowie ihre individuellen menschlichen Qualitäten wie fachlichen Qualifikationen und therapeutischen Ausrichtungen einfließen lassen, die wiederum mit dem Leitbild der Einrichtung unter einen Hut zu bringen sind. Die Länge meines Satzes entspricht der Komplexität dieser Strukturen. Eine zweite Säule im Suchthilfesystem bilden die stationären Versorgungseinrichtungen und Kliniken, ebenfalls in unterschiedlicher Trägerschaft und mit therapeutisch verschiedener Ausrichtung. Die Tendenz geht in Richtung großer Klinikverbände, die dem Primat des Wirtschaftlichen folgen oder, pointierter ausgedrückt, der Spur des Geldes. Um diese beiden Säulen eines Suchthilfesystems im engeren Sinne gruppieren sich all die sozialen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen, Institutionen und Behörden, die im sehr weiten Sinne dem psychosozialen Feld zuzurechnen sind. Sie lassen sich gar nicht alle aufzählen. Ihre Streuung reicht von Ämtern und kommunalen Beratungseinrichtungen über die Fülle an Hilfsangeboten in der Trägerschaft der großen Wohlfahrtsverbände bis hin zu spezifischen Angeboten unter der Leitung kleinerer eingetragener Vereine. Ebenso finden wir die organisierte Eltern-Selbsthilfe wie die Selbsthilfe von suchtmittelabhängigen Direktbetroffenen. In der Praxis bedeutet das: Auf dem Markt der Möglichkeiten bringen Hunderttausende Menschen jeden Tag ihre fachlichen wie menschlichen Kompetenzen, ihre Kraft, Gefühle, Gedanken, Worte und Taten, ihr privates Welt- und Menschenbild, ihr Vertrauen und ihren Glauben oder ihre Zweifel, ihre Liebe und ihren inneren Frieden oder ihre Frustration wie ihr Hadern mit an den Platz im System, an dem sie haupt-, neben- oder ehrenamtlich mit und am Phänomen Drogen und Sucht arbeiten. Wiederum entspricht die Länge meines Satzes der komplexen Gemengelage. Da tut Orientierung gut. Sie hilft, den Überblick zu bewahren.
Wer in welcher Rolle oder Form von Betroffenheit auch immer die sicherlich schwierigen Bedingungen in den Strukturen eines weitgefächerten Suchthilfesystems nicht bloß ertragen oder aushalten möchte, kann dem ein selbstwirksames kreatives Positiv gegenübersetzen. Das gelingt über eine selbstwirksame Regulierung der schwierigen Umstände, die sich nicht abhängig macht von nicht aus eigener Kraft veränderbaren Vorgaben, Strukturen und Widerständen in einem in großen Teilen selbst ver-rückten System. Akteure im System können einen solchen Perspektivwechsel durchaus in Eigenregie vollziehen, sofern sie gewillt sind, Sucht weiter zu denken, neu zu verstehen und verbundener zu behandeln.
Sucht und Spiritualität: Abhängigkeit weiter denken, neu verstehen, verbundener behandeln – wohnt einem solchen Buchttitel nicht ein falsches Versprechen inne, das gar nicht einzulösen ist? Wie soll Sucht heutzutage denn noch weiter gedacht und neu verstanden werden können? Wurde nicht längst alles über Sucht gesagt? Das Themenfeld Drogen und Sucht scheint bestens erforscht. Ursachen und Genese scheinen bis ins Kleinste nachvollziehbar erklärt zu sein: multifaktoriell, gesellschaftlich, psychosozial, hirnorganisch, biochemisch, biologisch, entwicklungspsychologisch, familiendynamisch, gar mehr- und transgenerational, beziehungstechnisch, individuell usw. Die Theoriebildungen erfassen in all ihrer Unterschiedlichkeit diverseste Aspekte des Themas, müssten zusammengenommen also doch auch ein Gesamtbild ergeben und das süchtige Geschehen vollumfänglich abbilden können. Was soll es da qualitativ noch Neues, bislang nicht Gedachtes oder nicht Gesagtes geben? Und was soll verbundener behandeln bedeuten? Müsste in den vielen therapeutischen Schulen, in den Behandlungskonzepten wie in den konkreten, durchstrukturierten Behandlungsplänen nicht alles bereits enthalten sein? Können sich da noch qualitativ andere Vorgehensweisen eröffnen? Machen Sie sich selbst ein Bild und lassen Sie die Anregungen des Buches ganz offen auf sich wirken.
Über 30 Jahre präventive, beratende und therapeutische Drogen- und Suchtarbeit mit jungen wie erwachsenen Menschen, mit Individuen, Paaren, Familien, Gruppen, Institutionen und Systemen, mit Angehörigen wie direkt Betroffenen, mit Neugiergebrauchern von Drogen wie mit schwer Abhängigen und mit vielen, vielen Menschen aus sozialen, helfenden und heilenden Arbeitsfeldern – und noch kein bisschen müde. Mein Denken über Drogen und Sucht, mein Erfahren wie Erfassen des Phänomens und mein therapeutisches Vorgehen haben sich im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder umorganisiert. Persönlich fühle ich mich auch nicht als derselbe Mensch oder als dieselbe Person wie zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe selbst etliche Hausaufgaben bewältigen müssen, um an den Punkt zu kommen, an dem ich aktuell angelangt bin. Dabei habe ich eine beachtliche Strecke zurückgelegt: von anfänglicher Aufbruchstimmung mit ungebremstem Tatendrang über sich einstellende Ernüchterung und manche Fassungslosigkeit zu einer hadernden Position, in der ich Sucht als ein schwieriges, mit mehr Frustrationen als Freuden verbundenes Arbeitsgebiet empfand. Da sich mit Hadern, Negativität und Freudlosigkeit in der Arbeit nicht gut leben lässt, übte ich mich konsequent in guter Selbstfürsorge. Ich suchte mir auf einem Weg der tausend Schritte das Rettende und Heilsame für eigene Wandlungsprozesse zusammen, bis ich an einem ruhenden Pol anlangte. Seither lasse ich mich von der heilsamsten aller Kräfte leiten: der wohl verstandenen bedingungslosen Liebe. Sie lässt mich die schwierige Arbeit im Suchtbereich als einen Quell für deutlich mehr Freude als Last erfahren.
Auf dem Weg der tausend Schritte musste ich nicht einmal das Rad neu erfinden. Im unerschöpflichen Fundus des menschlichen Wissens ist bereits alles vorhanden, was wir brauchen, um zu einer inneren Haltung zu gelangen, die von Verbundenheit und Liebe getragen wird. Auch Gedanken wie theoretische Verknüpfungen, die ich in diesem Buch unter »Sucht: Weiter denken« und »Sucht: Neu verstehen« vorstellen werde, brauchte ich nicht vollends neu zu denken oder gar zu erfinden. Was mir geholfen hat, war, bewährte alte – vergessene oder aus der Hand gegebene – Wissensschätze neu zu sichten, deren Tauglichkeit wie Nützlichkeit zu erwägen, dem Vergessen anheim gegebene Krankheitslehren ins Hier und Jetzt meiner eigenen psychosozialen und therapeutischen Arbeit zu transferieren, um deren Weisheiten für die Gegenwart zu erschließen. Darüber tun sich dann schon noch neue Welten auf, die es möglich machen, das Phänomen Sucht über alle Tellerränder hinweg weiter zu denken und neu im Sinne von anders zu verstehen; sowie Wege in der Behandlung zu beschreiten, die von einem etablierten Behandlungsdenken eher gemieden werden.
Das unfassbar Schöne, für manche Menschen bloß schwer Vorstellbare ist, dass es so einfach sein kann! Einfach, sobald wir bereit sind, unseren Geist, unser Denken wie unser Herz für Neues zu öffnen. Schön und wertvoll ist auch die Erfahrung, dass nicht bloß direkt Betroffene sowie deren Angehörige vom Neuland profitieren. Das Gewandelte geht einher mit einem höheren Maß an Leichtigkeit und Freude aufseiten derjenigen Menschen, die im Suchthilfesystem ihre alltägliche Arbeit verrichten.
»Ach was«, tönt der Zweifel, »wie soll das angehen? Ich bin selbst schon so lange im Geschäft und die Bedingungen sind so belastend, da gibt es nichts Leichtes. Ich jedenfalls glaube nicht mehr daran, dass sich da noch viel zum Guten verändert.« Der Weltschmerz stimmt mit ein: »Ich auch nicht. Die ganze Welt ist doch ein Tollhaus. Wir haben einfach keine Chance mehr. Die Menschen machen alles kaputt. Ich muss mir doch bloß anschauen, was überall in der Welt geschieht: Kriege, Klimakatastrophe, Flüchtlingswellen, Rassismus, Umweltzerstörung. Ausbeutung und Globalisierung richten alles zugrunde. Es geht nur noch ums Machen von Geld, Gier regiert die Welt. Die Leute sind sowieso alle süchtig: konsumsüchtig, mediensüchtig, geltungssüchtig. Da kiffe ich mich doch lieber besinnungslos zu. Weshalb aufhören? Lohnt sich doch nicht!« – »Stopp! Haltet ein«, ruft die Liebe. »Ich verstehe euch ja. Aber genug mit diesem ganzen Schwarzsehen! Öffnet eure Augen und schaut euch um: Die Welt ist voller Wunder. Wo ich bin, da ist die Freude, da ist Hoffnung, da ist Licht. Seht doch die Fülle an Pflänzchen überall auf der Welt, die das Gute und Schöne hervorbringen! Und außerdem, ganz unter uns gesagt: Als Liebe bin ich sowieso die beste Droge von allen. An mich reicht nichts heran. Ich stelle alles andere in den Schatten.«
Dieses kleine Gespräch gibt in seiner Pointierung recht gut wichtige Facetten meines jahrzehntelangen Arbeitsalltags im Drogen- und Suchthilfesystem wieder. Ich habe es täglich mit Zweiflern zu tun: mit Drogen missbrauchenden oder süchtig abhängigen Zweiflern, die unsicher sind, ob es ihnen jemals gelingen wird, ihrem Leben eine neue Richtung zu verleihen. Die Weltschmerzzweifler sind die hartnäckigsten. Sie stellen grundsätzlich infrage, dass es überhaupt einen Sinn machen könnte, keine Drogen zu gebrauchen oder keinen Alkohol zu konsumieren. »Wozu aufhören? Lohnt sich nicht!«
Ich habe auch mit Zweiflern und Skeptikerinnen in Familien und sozialen Systemen zu tun, die als Angehörige fast jeden Glauben daran verloren haben, dass sich am Drogengebrauch oder der Abhängigkeit des geliebten Menschen noch etwas ändern könnte. Ich habe des Weiteren in den vielen Feldern von sozialer Arbeit und heilenden Berufen mit zweifelnden wie verzweifelten Menschen zu tun. Sie drohen nicht selten, an der Macht von Drogen und Sucht zu verzweifeln; bisweilen noch mehr an den Strukturen einer Gesellschaft, in der soziale Krisen zum System gehören; und nicht zuletzt an den Grenzen, die ihnen häufig genug in ihren Arbeitsverhältnissen gesetzt werden. Sie könnten mit ihren menschlichen wie fachlichen Qualitäten so viel anders, besser, schöner, zufriedener, effektiver arbeiten, wenn man sie bloß ließe. Wer sich strukturell in seiner Arbeitsfreude gehemmt sieht, droht auf Dauer auszubrennen.
»Noch einmal«, ermutigt die Liebe, »wo ich bin, ist Kraft. Wo ich bin, ist Heilung möglich. Wo ich bin, ist Vertrauen – Vertrauen in die eigene Liebesfähigkeit, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, Vertrauen in das gute Gelingen eigenen Handelns, Vertrauen darauf, dass auf Leid Freude und auf Dunkel Licht folgt. Wer mich in sich trägt, wird nicht allein sein. Wer aus mir heraus lebt, wird seine Zweifel in Zuversicht wandeln.«
Das Vertrauen in die Kraft der Liebe, die alle Wunden heilt, ist eines der größten Probleme der Menschen. Vertrauen und Zuversicht werden auch zu einem Problem für das Herz einer jeden Mutter, eines jeden Vaters oder sonstigen Angehörigen, die aus Sorge vergehen könnten, wenn sie ohnmächtig miterleben und bezeugen müssen, wie ein geliebter Mensch sein Leben an Drogen und Sucht hängt. Wie und wo werden sie im Hilfesystem in ihrem Schmerz gehört und gesehen?
»Wenn eine Mutter ihrem Sohn zum hundertsten Mal erklärt, dass er mit seiner ständigen Kifferei seine gesamte Zukunft aufs Spiel setzt«, belehrt die Unverständigkeit, »wer hat dann das Verstehensproblem?« Die Liebe entgegnet: »Was für eine Frage! Wie sollte sich eine Mutter in heller Sorge durch diese Frage in ihrem Mutterherz nicht missachtet fühlen?«
Je nach Blickwinkel können wir die Frage der Unverständigkeit sicherlich ganz unterschiedlich verstehen. Guten Willens verstehen wir sie als spitzfindige paradoxe Intervention eines sich den systemischen Interventionstechniken verbunden fühlenden Therapeuten. Guten Willens gestehen wir ihm zu, dass er mit dieser Mutter eine bessere Idee erarbeiten möchte für die 101. Reaktion auf ihren Sohn als die beständig gleiche Ermahnung. Wohlwollend können wir in der Frage einen Spritzer Humor entdecken. Bei weniger gutem Willen können wir in der Frage eine beachtliche Dosis Überheblichkeit ausmachen. Bei noch weniger gutem Willen entlarven wir sie als subtil aggressiven Zynismus. Diese verschiedenen Möglichkeiten, obige – übrigens nahezu wörtlich zitierte – Frage der Unverständigkeit zu verstehen, sprechen sehr dafür, auf die Worte zu achten, die wir unserem Munde entschlüpfen lassen. Geht es um die Verstrickungen der Beziehungsbande bei Drogengebrauch oder süchtiger Abhängigkeit, ist Feingefühl angesagt. Das rührt so sehr an die privatesten Winkel aller Gefühle, dass aufgrund der Intimität dieser Gefühle das Innenleben wund ist, und folglich leicht verletzlich. Womöglich würde die Liebe ganz anders fragen.
»Wie gut für mich«, triumphiert die Sucht, »dass so viele Menschen so wenig Vertrauen in die Liebe haben, sonst könnte ich nicht so mächtig sein. Ich werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass sich daran so schnell nichts ändert. Sonst kann ich nicht weiter meine Herrschaft ausüben. Ich ernähre mich von den Gefühlen der Menschen, besonders von ihrer Angst. Sie ist das Gegenteil von Liebe. Nicht mehr lange, dann habt ihr euch alle in meinen Netzen verfangen. Ihr wollt es bloß nicht wahrhaben. Das ist ja gerade das Listige an mir. Ich habe euch schon lange im Griff und ihr wiegt euch in trügerischer Selbsttäuschung. Ach, ihr seid so leicht für mich zu kriegen!« – »Deine eigene größte Angst, Sucht, ist«, spricht die Liebe, »dass die Menschen mich stärker in sich aufleben lassen könnten. Dann bekommst du nämlich ein Problem. Denn wenn ich stärker werde, werden die Menschen mehr und mehr an das Gute in sich glauben. Sie werden ihr Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen und es hell leuchten lassen – zu hell für deine Finsternis.«
Genug der (keineswegs bloß) fiktiven Gespräche. Sie können als Leserin oder Leser die Richtung erahnen, aus der das Förderliche kommen wird. Wir tragen es allesamt als Menschen in uns, jeder einzelne von uns. Die Frage ist jedoch, wie offen oder verschlossen wir uns zeigen, der Liebe nicht bloß eine Stimme zu geben, sondern ihrer heilenden Kraft beharrlich zu folgen. Die Chancen in diesem Buch auf das Gute und Förderliche finden sich in drei Teilen:
Sucht: Weiter denken
Sucht: Neu verstehen
Sucht. Verbundener behandeln
Um weiter zu denken, neu zu verstehen und verbundener zu behandeln, muss ich das Rad also nicht neu erfinden, jedoch wieder ins Rollen bringen. In den Schatzkammern des kollektiven Wissens der Menschheit ist bereits alles angelegt, was Ihnen dient, um mit dem Phänomen Sucht einen anderen als den gegenwärtig vorherrschenden Umgang finden zu können.
Wenn ich Sucht weiter denke, stelle ich neue Verknüpfungen zu altem, bewährtem Heilwissen her, das wir fast gänzlich aus der Hand gegeben haben. Ich stelle es in den Kontext zum Hier und Jetzt, damit direkt von Sucht und Drogen Betroffene ebenso im heilsamen Sinne darauf zurückgreifen können wie helfende Dritte.
Wo ich Sucht neu verstehe, stelle ich die Theorie von Sucht als Elemental in den Raum. Ich bin in keiner Weise der Urheber der Theorie von den Elementalen. Mein Beitrag dazu ist, dass ich die Idee wieder ausgrabe, sie freischaufele von allen Deckschichten, die die Moderne darüber gehäuft hat. Die Moderne verfügt nicht über die ausschließlich klügsten oder stimmigsten Eingebungen, wenn es um sogenannte Krankheitslehren geht. Worüber sie verfügt, ist ein aufgeblähter Apparat von Zehntausenden Diagnosen, Schlüsseln und Codes, mit denen sie fassbares menschliches Leiden in unfassbar bürokratisierte Klassifizierungen zwängt und ihm einen Stempel aufprägt. Im Getriebe des gesundheitlichen Versorgungswesens mag das pragmatisch erscheinen, ist aber an keiner Stelle heilsam. Ältere Krankheitslehren sind in Vergessenheit geraten. Was war es mir doch für eine Bereicherung, die Krankheitslehre des Paracelsus wiederzuentdecken und ihre Sinnhaftigkeit besonders an den empfindlichen Punkten bestätigt zu finden, an denen unsere heutigen Denkmodelle, was Sucht sei, vielfach zu kurz greifen und daher die Misere der Suchttherapie im Schlepptau haben.
Paracelsus führte zu dem zypriotischen Heiler Daskalos, der der Theorie der Elementale einen neuzeitlicheren Schliff gab und mich davon überzeugte, mir das Thema Sucht aus seinem Blickwinkel neu anzuschauen. Das hat mir nicht bloß eine anders geartete Sichtweise eröffnet, sondern mir obendrein daraus hergeleitete andere Behandlungswelten in den therapeutischen Vorgehensweisen aufgezeigt. Vor allem hat es mir inneren Frieden und Zuversicht geschenkt: für meine Klientinnen und Patienten mit ihren Nöten; für deren Angehörige mit den ihrigen; und drittens für die vielen Menschen in helfenden und heilenden Berufen, die stets dem Risiko anheimgegeben sind, sich angesichts der Herausforderung von Drogen und Sucht als nicht genügend zu erleben.
Die Sucht als Elemental zu begreifen und zu behandeln, macht Mut. Die Beschäftigung mit den Elementalen hat mich außerdem auf dem schon länger eingeschlagenen Weg bestärkt, in konsequenter Befolgung des Gelassenheitsgebets des Theologen Reinhold Niebuhr nicht zu hadern mit den Umständen eines chaotischen Systems, die zu verändern mir nicht gegeben ist. Ich konzentriere mich in meiner Arbeit ausschließlich darauf, was veränderbar ist und über welche Mittel und Wege. Alles andere ist vergeudete Energie.
Wenn ich Sucht verbundener behandle, binde ich mich zurück an verbinde ich mich wieder mit ganz ursprünglichen Traditionen eines Wissens um heilsame Vorgänge. Und ich lasse die trügerische Illusion fahren, dass es in meiner willentlichen Macht stehen könnte, bei meinen Klienten oder Patientinnen Heilung zu bewirken. Selbstverständlich beherrsche ich mein Handwerkszeug mit gewachsener Erfahrung besser denn je. Aber ich erkenne meine Grenzen als Mensch an, der nicht über wundersame Heilkräfte verfügt. Im Wissen darum binde ich mich stattdessen an höhere Kräfte an, die mehr von Heilung verstehen als ich, die mir aber bereitwillig ihre An-Wesenheit zur hilfreichen Unterstützung zur Verfügung stellen, sofern ich darum bitte. So gesehen, ist mir die Arbeit im Bereich von Drogen- und Suchthilfe ein nicht versiegender Quell für Freude an der Arbeit geworden, nicht frei von Beschwernis, aber frei von Verstrickung in fremde Bürden.
Im Zuge von Fremdübernahmen vollziehe ich noch eine weitere Umkehr als Rückkehr. Ich verabschiede mich von dem selbstverständlichen Gebrauch der Bezeichnung Klient3 in meiner Arbeit. Die Übernahme des Wortes in die Sprachgepflogenheiten therapeutischer Kreise erfolgte aus vorwiegend systemischer Sicht seinerzeit in guter Absicht. Doch gute Absicht verhindert nicht, dass manches in diesem Sinne Gedachte plötzlich seltsame Blüten treibt, die »Heimisches« verdrängen. Ich habe die Bezeichnung Klient vor langer Zeit ebenfalls übernommen, weil es sich so eingebürgert hatte. Heute kehre ich zurück zu Patient. Die Menschen, die sich mit einem Anliegen an mich wenden, sind keine Geschäftskundinnen oder -kunden, die mich mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragen. Sie geben auch keine Bestellung zum Kauf einer Ware oder Dienstleistung bei mir ab, noch gehen sie ein Tauschgeschäft mit mir ein: Geld gegen Ware. Zu den seltsamen Blüten gehört heutzutage auch, dass sich manche Patienten in Behandlungen tatsächlich wie Kunden gebärden. Nach dem Motto »Der Kunde ist König« wollen sie die Regeln vorgeben, wie etwas aus ihrer Sicht zu laufen habe. Dann kommen sie als Klienten – die einen aus eigenem Antrieb, die anderen wurden in die Dienstleistungseinrichtungen des Suchthilfesystems geschickt.
Meine Patienten kommen als Menschen, die in der Regel an etwas leiden, für das sie nach Möglichkeit Linderung oder Heilung erfahren möchten. Drogen missbrauchende oder süchtig abhängige Menschen leiden vielfältig. Sie begeben sich in Beratung oder Behandlung. Folglich kommen sie in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes als Patienten, um eine heilsame Beratung oder eine Heilbehandlung erfahren zu können. Patient ist eine Substantivierung des lateinischen patiēns, was »erduldend«, »ertragend«, »fähig zu erdulden« bedeutet. Das wird dem Sachverhalt weit mehr gerecht. Jeder leidende Mensch trägt einen Schmerz, eine Bürde. Er erduldet, ist mehr oder weniger fähig, zu erdulden. Das hat auch mit Geduld zu tun. Auch das kommt näher an unsere Realitäten heran. Drogenmissbrauch oder süchtige Anhängigkeit erledigen sich nicht einfach im Vorbeigehen. Es erfordert bisweilen ein gerüttelt Maß an Geduld und Durchhaltevermögen, bis die Sucht einen Menschen freigibt. Alle sind sie geborene Menschen. Erst danach werden sie zu den Personen, mit denen wir es in der konkreten Arbeit zu tun haben: direkt Betroffene als Konsumierende von potenziellen Suchtstoffen oder als bereits massiv süchtig gebundene Menschen; sich sorgende Angehörige oder auch Tätige in helfenden und heilenden Berufen, die als Teilnehmende zu Fort- und Weiterbildungen, Workshops oder Supervisionen erscheinen. Letztere dürfen dann gerne weiterhin als Klienten kommen. Allesamt aber werden sie als Menschen auf Augenhöhe angenommen.
Es mag sein, dass Sie als Leser oder Leserin in manchen Passagen des Buches den Eindruck gewinnen, ich würde mich wiederholen. Nein, wiederholen werde ich mich nicht. Ich werde aber in verschiedenen Kapiteln ähnliches tun, indem ich Schicht für Schicht einer heilsamen »Substanz« jeweils eine weitere hinzufüge, so, als würde ich auf eine offene Wunde Schicht um Schicht eine heilkräftige Salbe auftragen; oder als würde ich einem frierenden Menschen eine Decke nach der anderen umlegen, bis er nicht mehr friert.
Ich erwarte nicht, dass alle, die das Buch in die Hände bekommen, sämtliche Inhalte auf Anhieb teilen mögen. Dafür ist die Vorstellung von den Elementalen zu unvertraut. Lassen Sie aber die daraus hergeleiteten imaginalen Methoden zu sich sprechen, werden Sie nicht unberührt bleiben. Es kann sein, dass Sie mit sich selbst in ein Gespräch kommen. Der Verstand wird so manches Gute und Förderliche bezweifeln wollen. Ihr mystisches Herz und Ihre Seele dagegen dürften Ihnen aus ihrer eigenen Weisheit heraus ihr freudiges Ja der Zustimmung geben wollen.
Helmut Kuntz
1 Sucht: Weiter denken
1.1 Heilen ist mehr als Medizin: Von den Ursprüngen des Heilens als Heilkunst
Seit es menschliche Wesen auf unserem Planeten gibt, machen sie durch alle Zeiten hinweg ihre Erfahrungen damit, wie Schmerz und Leid in ihr Leben eingreifen. Umgekehrt haben sie ihre Vorstellungen davon, welches »Kraut« gegen bestimmte Formen von Schmerz und Leid gewachsen und was unter Heilen zu verstehen sei. Was verstanden unsere Ahnen über die Generationen hinweg jeweils unter Heilung? Welchen Stellenwert maßen sie den medizinischen Künsten bei und wie sollte sich eine stimmige Therapie vollziehen? Die Vorstellungen vom Wechselspiel zwischen Leiden und Krankheiten wie Behandlungen und Genesung haben über die Jahrtausende hinweg mancherlei Wandlungen erfahren – manche im medizinischen wie therapeutischen Denken und Handeln sogar rasend schnell. In den Zeiträumen der menschlichen Geschichte gedacht, existieren Behandlungen von Krankheitsbildern, die heutzutage den psychotherapeutischen Disziplinen zugeordnet werden, erst seit einem Wimpernschlag. Und dennoch ist die heutige Psychotherapie kaum noch zu vergleichen mit den klassischen analytischen »Redekuren« zu Zeiten Sigmund Freuds, eher noch mit den Therapien im Geiste der Analytischen Psychologie eines Carl Gustav Jung. Selbst das noch recht junge Feld der Behandlungen von Sucht und Abhängigkeit hat in kürzester Zeit viele ganz unterschiedliche Versuche gesehen, dem Phänomen zu Leibe zu rücken.
Es ist kaum übertrieben, zu konstatieren, dass unser Zeitgeist an so manchem Scheideweg steht. Trotz ungezählter beachtlicher Fortschritte im Verstehen von Körper und Geist, trotz der Quantensprünge in der Medizintechnik, der Differenzierung medizinischer und therapeutischer Disziplinen steckt unser Verständnis von Gesundheit wie Krankheit in einer geistigen Krise. Allein Brandzeichen wie »Apparatemedizin«, »Medizinalbürokratie«, »Versorgungssystem« oder auch die berüchtigte Wortwendung von den »Halbgöttern in Weiß« machen deutlich, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Medizin steckt in einer Findungs- wie Schaffenskrise, am empfindlichsten ausgedrückt in ihrer ethischen Krise: dem Zwiespalt zwischen bestmöglicher Heilung und Therapie sowie dem Zwang zu Ökonomisierung und Rationalisierung. Die Menschen sind kaum gesünder geworden in den letzten Dekaden. Eher ist das Gegenteil der Fall. Zivilisationskrankheiten nehmen epidemische Ausmaße an, auf die unser Medizinverständnis keine Antworten mehr weiß. Mit manchen neuartigen Leiden kennt sich unsere sogenannte Schulmedizin gleich gar nicht mehr aus, sodass sich eine immer größere Zahl leidender Menschen auf sich selbst zurückgeworfen sieht. Sie ziehen sich notgedrungen aus dem schulmedizinischen Versorgungssystem zurück und suchen an vielen, vielen anderen Stellen ihr Heil – manchmal mit überraschenden Heilungserfolgen, manchmal in einer Endlosspirale von Hoffen und Scheitern. Das gilt auch für unzählige Menschen, Junge wie Erwachsene, Männer wie Frauen, die unter den wechselvollen Erscheinungsformen von Drogenmissbrauch oder gar süchtiger Abhängigkeit zu leiden haben. Da finden wir manches Gelingen, aber ungleich mehr Misslingen, wenn wir ehrlich bleiben.
Können wir angesichts von Scheidewegen sinnhaft fündig werden, wenn wir eintauchen in eine Vergangenheit, in der die Menschen noch wussten, dass Heilen weit mehr ist als Medizin? Können wir von dort Hilfreiches hinüberretten, um unser heutiges Verständnis von Heilen neu anzureichern? Macht ein Transfer alten heilkundlichen Denkens in die Moderne Sinn? Wenn wir erst gar nicht mehr fragen und uns suchend zu erinnern bemühen, versagen wir uns selbst mutwillig die Chancen auf hilfreiche Antworten. Wer aber fragt und sucht, der findet auch.
1.1.1 Asklepios oder Äskulap: Der Gott der Heilkunst
Die alten Griechen und Römerinnen hatten ein deutlich anderes Verständnis von der Behandlung kranker, leidender Menschen als unsere heutige moderne Medizin. Auf den Punkt gebracht, ist die medizinische Entwicklung über die Jahrtausende hinweg eine Gewinn-und-Verlustrechnung. Auf der Habenseite steht ein beachtliches Plus an differenzierten medizinischen Erkenntnissen und durchaus förderlich nutzbaren Medizintechniken. Der empfindlichste Verlust ist jedoch die Abkehr von den ursprünglichen Vorstellungen des Heilens. Für unsere Ahnen war Heilen weit mehr als Medizin. Es war eine hohe Kunst.
In der griechischen Mythologie steht für dieses besondere Verständnis des Heilens Asklepios, der Gott der Heilkunst. Asklepios entsprang der Verbindung des Gottes Apollon, dem Gott des Lichtes und der Reinheit, mit einer Sterblichen, Koronis, der Tochter des thessalischen Lapithenkönigs Phlegyas. Da selbst die Götter in Eifersucht entbrennen konnten, ermordete Apollon Koronis, als diese ihn mit einem Sterblichen betrog. Er rettete jedoch ihr Kind Asklepios aus dem Leib der Mutter und übergab ihn dem Kentaur Chiron in Obhut. Kentauren sind sagenumwobene Mischwesen der griechischen Mythologie, halb Pferd, halb Mensch. Der sanftmütige Kentaur Chiron lehrte Asklepios von Kindesbeinen an die Heilkunde. Es hieß sogar, Asklepios könne Tote wieder zum Leben erwecken. Damit zog er sich den Zorn des Zeus zu, der durch diese Fähigkeiten des Asklepios die kosmische Ordnung gefährdet wähnte. So schleuderte Zeus einen tödlichen Blitz auf den heilbringenden Asklepios. Nach seinem Tod wurde der Gott der Heilkunst in ein Sternbild verwandelt und ziert bis heute als »Schlangenträger« den Nachthimmel.
Familien- wie psychodynamisch hätte Asklepios erst einmal seine eigene Herkunft heilen und transformieren müssen, um seine Geschichte umzuschreiben. Das hat er mit vielen heutigen Menschen gemein, die ein schweres Erbe in Bezug auf ihre Herkunftsfamilie oder gar eine mehrgenerationale Erbgeschichte zu bewältigen, zu heilen und in ihr Leben zu integrieren haben. Nicht als Gottheit, aber als menschliche Wesen können sie aus bewältigtem Leid außerordentliche Fähigkeiten entwickeln.
In der römischen Mythologie heißt die Gottheit, die für den Geist des Heilens steht, Äskulap. Bis heute gehalten haben sich die symbolischen Darstellungen dieser Gottheiten. Wer kennt sie nicht, die Marmorstatuen oder steinernen Skulpturen von Äskulap als bärtigem, lorbeerbekränztem Mann mit dem berühmten Äskulapstab, um den sich eine Schlange windet? Manchmal sind es auch zwei Schlangen, die den Stab zieren. Der Asklepios- oder Äskulapstab wurde zu dem Symbol der Heilkunde. Das Symbol der Schlange weist Asklepios wie Äskulap den chtonischen, der Erde zugehörigen, Göttern zu. Als Götter der Heilkunst spenden sie Leben und Fruchtbarkeit und niemals Verderbnis. Sie sind die unübertroffenen Meister der ärztlichen Heilkunst, ausgestattet sogar mit magischen heilsamen Kräften. Es bildete sich ein regelrechter Asklepios-Kult aus, der in mannigfaltigen Verehrungsstätten und Tempeln praktiziert wurde. Die Heilbehandlung im Geiste des Asklepios bestand im Kern darin, dass Erkrankte im oft außerhalb einer Stadt gelegenen Tempel des Heilgottes »schliefen«. Der vermeintliche Schlaf führte sie in Trancezustände oder in einen erweiterten, für Heilung offenen Bewusstseinszustand. Während solcher Zustände erschien den Tempelschläferinnen und -schläfern im Traum dann Asklepios oder einer seiner Tempelheiler und ließ dem kranken Menschen seine heilenden Kräfte zuteilwerden. Entweder gab es Sofortheilungen oder die Erkrankten bekamen heilsame Anleitungen zu ihrer künftigen Lebensführung. Dieser therapeutische Heilschlaf ist in die mythologische Medizingeschichte eingegangen. Er weist im Übrigen große Ähnlichkeiten mit dem altägyptischen Tempelschlaf auf. Als Heilgott bezog Asklepios sein Wissen direkt aus dem göttlichen Bereich. Er überwand folglich die rein irdischen Kräfte. Sein Wissen gab er an seine Schüler weiter.
In einer seiner großen Tempelheilstätten, auf Kos, empfing auch Hippokrates seine medizinisch ärztliche Ausbildung zum Heiler. Hippokrates war kein Gott mit Heilkräften, sondern als Mensch aus Fleisch und Blut ein Meister der Heilkunde. Als solcher gilt er als Urvater der modernen Medizin. Lange Zeit mussten angehende Medizinerinnen und Mediziner den Eid des Hippokrates als ein Gelöbnis ärztlicher Ethik leisten. Mittlerweile wurde dieser Eid modernisiert. Die ursprüngliche spirituelle Verbindung zur geistigen Welt und das darin verwobene Mysterium des Heilens gingen weitgehend verloren.
Dem Andenken von Asklepios wird dennoch bis heute gedacht. Nach ihm ist Europas größte Klinikbetreiberfirma benannt. Zu diesem gigantischen Unternehmensverbund zählen auch namhafte ausgewiesene Suchtkliniken. Ob deren Unternehmenskultur noch dem Geist des Asklepios gerecht wird, ist eine andere Frage. Die geistige Überzeugung, dass Heilung zuvorderst im Bewusstsein und erst dann im Körper entsteht, ist längst nicht mehr die Grundlage klinisch- wie evidenzbasierter Medizin. Zu Zeiten von Asklepios oder Äskulap waren die vielfältigen Erscheinungsformen von Sucht noch nicht die Geißel der Menschen, die sie heute sind. Mit dem Fokus auf Sucht und Abhängigkeit bleibt jedoch unabweisbar, dass sämtliche Götter der Heilkunst darauf verweisen, dass jedwedem Heilen eine geistige spirituelle Dimension innewohnt. Wir werden sehen, was die Anerkennung dieser geistig-spirituellen Dimension bei der Behandlung suchtabhängiger Menschen von heute zu verändern vermag.
1.1.2 Die Therapeuten der Antike: Überholte Vorbilder oder heilsame Sinnstifter für eine moderne Therapie der Sucht?
In ambulanten wie stationären Suchttherapien spielen Psychotherapeuten und Suchttherapeutinnen eine entscheidende Rolle. Als Bezugstherapeutinnen der Patienten sind sie einer der Hauptfaktoren im Wirkungsgeflecht heilsam verändernder Prozesse. Doch wer sind diese Menschen, die sich der heilsamen Psychotherapie verpflichtet fühlen? Was ist ihr Selbstverständnis von sich als therapeutisch tätigen Menschen? Welches sind die Wurzeln einer psychotherapeutischen Tätigkeit über Sigmund Freud oder Carl Gustav Jung als Gründungsväter der neuzeitlichen Psychoanalyse und Psychotherapie hinaus? Finden sich historisch verbürgte Quellen für ein heilkundiges psychotherapeutisches Handeln?
Wer sucht, der findet. Oder er sieht sich geführt. Von einer der historischen Hauptquellen, die eine Gemeinschaft therapeutisch heilender Menschen beschreibt, sah ich mich mitten in meiner menschlichen wie therapeutischen Identität zutiefst berührt. Ähnlich wie in der antiken medizinischen Heilkunst verweist besagtes geschichtliches Zeugnis auf die Brücke zwischen den geistigen Kräften und Gaben des Heilens und den irdischen Lebenskräften.
Generell ist es meines Erachtens ein Zeichen von innerer Freiheit und Stärke, im Leben immer mal wieder über die Frage zu befinden, von wem wir uns im Leben etwas sagen lassen möchten. Nebenbei bemerkt: Es gehört zu den größten Schwierigkeiten Drogen gebrauchender oder süchtig abhängiger Menschen, sich von anderen etwas sagen zu lassen. Wem erlauben wir, Worte an uns zu richten, um im Anschluss zu entscheiden, was wir von deren Botschaft anzunehmen bereit sind und was nicht? Und welcher Instanz in uns selbst vertrauen wir eigentlich unsere Lebensgeschicke an? Unserem Verstand oder unserem fühlenden Herzen?
Sich von den Mysterien oder Eingebungen des Herzens leiten zu lassen, ist im Idealfall eine weise Richtschnur. Da unser Leben aber in aller Regel nicht ideal verläuft, bricht uns schon mal das Herz. Das Leben gerät aus dem Takt, wir erleiden Schmerzen. Möchten wir derartige Herzleiden physisch, psychisch oder seelisch heilen, begeben wir uns auf die Suche nach Menschen, deren Berufung die Therapie von Leib, Psyche und Seele ist. Um sich von einem Psychotherapeuten oder einer Heilerin möglichst gut behandelt fühlen zu können, macht es Sinn, etwas darüber zu wissen, was eigentlich die gewachsenen Wurzeln des Therapeutentums sind. Welche kundige Person möchte ich suchen und finden, um ein Leiden, und sei es ein Suchtleiden, zu lindern? Und wessen sollte die Person kundig sein?
Es existiert eine historisch verbürgte eindeutige Quelle über das Leben und Wirken heilkundiger Männer und Frauen, die gleichermaßen den Leib, die Psyche wie die Seele zu behandeln wussten: Philo von Alexandrias antike Schrift Das kontemplative Leben (De vita contemplativa). In diese Quelle tauchte ich bereitwillig ein: Die therapeutae, vom griechischen Wort therapeuèn für Gottes-Verehrer oder auch Gottes-Dienerinnen, waren eine der Mystik verbundene soziale Gemeinschaft von Männern und Frauen in Ägypten etwa Anfang des 1. Jahrhunderts vor Christus. Obgleich eine Gemeinschaft, lebte jede und jeder für sich. Männer und Frauen galten in der Gemeinschaft als gleichwertig und gleichberechtigt, was zu jener Zeit außerhalb jeder gültigen Konvention und von daher revolutionär war. Zusammen mit den Essenern in Palästina, einer weiteren mystischen Gruppierung, gelten die therapeutae als die Urform des kontemplativen Lebens und des christlichen Mönchtums. Ihre religiösen Lebensideale werden der antiken Gnosis zugerechnet. Die Gnosis umfasst vorchristliche wie christliche Wissenslehren um die Existenz des Übersinnlichen und sucht durch die wahre Erkenntnis des Göttlichen die Erlösung zu erlangen. Die therapeutae strebten durch Askese, Läuterung und »aufrechte Vernunft« im Alltag zeitlebens die Nähe zu Gott an. Das meiste, das wir heutzutage über die therapeutae der Antike wissen, stammt aus Philo von Alexandrias Schrift.
Vom jüdischen Amtspriestertum der Pharisäer und Sadduzäer wurden die therapeutae als Abweichlerinnen und Abweichler der Häresie bezichtigt und heftig angefeindet. Die therapeutae waren ihrem Selbstverständnis nach Mystiker, Visionärinnen und sogar Heiler. Heilen war für sie aber wesentlich mehr als das, was wir heutzutage in unserem reduzierten Verständnis des Begriffs erfassen. Philo beschreibt die Lebensform dieser besonderen Menschen sehr würdigend: »Die Gemeinschaft der Therapeuten aber, von Anfang an belehrt, immer das Sehvermögen zu gebrauchen«, strebt beständig nach »der Schau des Seienden«. Indem »sie sich über die sinnlich wahrnehmbare Sonne (Welt) erheben und niemals diesen Posten verlassen, der zum vollendeten Glück führt« (Alexandria 1963, S. 51), begehrten Männer wie Frauen gleichermaßen die Vision des Existenten. Eingeführt »in die Mysterien des heiligen Lebens« (ebd., S. 54) suchten die Mitglieder der Gemeinschaft, durch den Gebrauch des geistigen Sehvermögens die unmittelbare Erkenntnis der Wirklichkeit beziehungsweise des »Selbst-Existenten« hinter der vergänglichen Welt zu finden. Das Selbst-Existente, nie Geschaffene, ist gleich Gott. Zur Erlangung von Erkenntnis lasen die therapeutae auch die weisen und heiligen Texte. Folgerichtig waren sie im Gebrauch wie in der Deutung des Wortes geübt. Das Reich der therapeutae war einerseits von dieser Welt, ging aber in Visionen weit darüber hinaus. Sie suchten, das göttliche, mystische Ur-Licht in sich selbst zum Leuchten zu bringen. Als Heiler und Heilerinnen waren die therapeutae folglich auch vermittelnde Lehrende, die andere Menschen in Initiationen unterwiesen.
Ihre Vermittlungen transportierten auch das Wissen darum, dass alles Leiden, jedes Symptom der Ausdruck für ein tiefer liegendes Leiden ist, für einen Mangel, für das Vergessen dessen, was eigentlich unser Leben bedingt und weshalb wir auf diese Welt gekommen sind. Das Selbstverständnis der therapeutae war es deshalb seit ihren Ursprüngen, den Leidenden ihre Gesundheit zurückzugeben, indem sie sie in der Ganzheit unterwiesen, ohne Beschränkung auf ein Symptom. Ihr Heilen war stets eine körperliche, psychische und spirituelle Therapie, die einschloss, die Menschen zu initiieren, was den Sinn des Lebens wie des Leidens ausmacht. Als Gottes-Dienerinnen und -Diener handelten sie zum einen aus sich selbst heraus. Zum anderen und im Wesentlicheren aber zeigten sie sich offen dafür, dass Gott als etwas Größeres als sie selbst durch sie hindurch wirken durfte. Sie waren in Gott und Gott war in ihnen, und das war ihre aufrichtige innere Haltung, in der sie den Menschen begegneten.
Es kam die Zeit, da gingen die Prophezeiungen alter Schriften in Erfüllung, die auch den therapeutae bekannt waren. Es kam der größte Diener Gottes als sein eingeborener Sohn zur Welt: Jesus. Als er anfing, Wunder zu bewirken und zu heilen, sahen die Menschen in ihm den größten »Arzt«, wie es in den Evangelien heißt. Das Wort Arzt mutet in den uns bekannten biblischen Texten jedoch seltsam fremd an. Es passt kaum zur sonstigen Diktion in der Heiligen Schrift. Es kann dem Bemühen modernerer Bibelübersetzungen geschuldet sein, dass es so wenig passend anmutet. Im Kontext der damaligen Zeit dürften die Menschen in Jesus eher den größten Heiler mit den wundertätigsten Kräften gesehen haben. Sie pilgerten in Scharen zu ihm, um durch seine bloße Nähe Heilung von körperlichen Gebrechen oder geistigen Leiden erfahren zu dürfen.
Jesus gab seine wundersamen Kräfte gezielt weiter. Als ihr »Meister« initiierte er seine Jünger. Jesus legte ihnen die Hände auf, damit sein Wissen in sie einfließe. Ausgestattet mit Gabe und Glauben sandte er sie aus, »zu heilen die Kranken«, wie uns Lukas (9,2) erfahren lässt. Auch im von der katholischen Kirche nicht anerkannten Thomas-Evangelium lesen wir von der Aussendung der Jünger in die Welt durch Jesus, um in seinem Geiste zu wirken und Menschen heil werden zu lassen: »Die Kranken unter ihnen heilt!« (Logion 14). Doch niemand heilt, ohne dass Jesus ihm die Fähigkeit des Heilens überträgt oder ihm Heilungen erlaubt. Nach Jesus Tod legten seine Jünger anderen von ihnen Auserwählten die Hände auf, damit sie ihrerseits die geistige Gabe des Heilens von Körper, Geist und Seele empfingen. Je mehr sich indes über die folgenden Jahrhunderte der tiefe Glauben an Gott verlor, desto umfassender verlor sich mit ihm die Gabe des mystischen Heilens. Doch begnadete Ärzte und Heilerinnen finden sich bis in unsere Zeit, mögen die ihnen verliehenen Kräfte auch deutlich reduziert sein gegenüber den jeden Verstand übersteigenden Kräften des Höchsten aller Heiler. In ihrem ethischen Selbstverständnis wirken sie allesamt unverändert im Wissen darum, dass nichts allein aus ihnen selbst heraus geschieht, sondern durch ihre Verbundenheit mit einer höheren Kraft.
So verstanden, haben alle modernen Therapeutinnen und Therapeuten ihre geistigen Wurzeln im Urchristentum und in einem Vertrauen auf eine höhere wirkende Kraft in uns Menschen selbst. Im Nachhinein kann ich kaum einschätzen, wie viel ich zu einem früheren Zeitpunkt davon verstanden hätte, hätte ich in einer meiner therapeutischen Ausbildungen etwas über diese meine originären Wurzeln erfahren dürfen. Es wäre aber zumindest ein Fingerzeig und eine Chance gewesen. Kann sein, es hätte mir einiges an Umwegen erspart. Immerhin wurde mir später über meinen eigenen imaginativen und spirituellen Weg die nötige innere Führung zuteil, um zu diesen Wurzeln zurückfinden zu dürfen. Ich mochte einfach herausfinden, wie es um die geistigen Wurzeln aller Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen als Seelenpfleger oder Seelsorgerinnen in den Ursprüngen bestellt war. Für die mir gewährten Einblicke und Erkenntnisse bin ich unendlich dankbar. Wenn ich in meinem beruflichen Alltag aus mir heraus mit meinem erworbenen Handwerkszeug als Therapeut nicht weiterkomme, wenn ich an meine Grenzen stoße, dann übernimmt mittlerweile – freilich nach einem langen persönlichen Such- und Entwicklungsprozess – eine größere Weisheit in mir die Führung, gelegentlich von selbst, gelegentlich, weil ich ganz ausdrücklich darum bitte. Das ist kein gedankliches Konstrukt und auch keine innere Einbildung. Ich fühle mich dann verbunden mit einer größeren Kraft. Sie ist präsent in mir und wirkt durch mich hindurch. Ich stehe als ihr Kanal zur Verfügung, lasse mich führen. Oftmals tu ich dann etwas, ohne die Frage des Verstandes, weshalb ich es tue, beantworten zu können. Woher weiß ich in solchen Situationen, dass ich zusammen mit meinen Patienten auf einem guten Weg bin? Weil ich durch vermitteltes Wissen wie durch Erfahrung gelernt habe, mich anzuvertrauen, um eine höhere geistige Kraft durch mich wirken zu lassen. Und wie kann ich mir für mich selbst wie für meine Patienten sicher sein, dass es sich nicht um eine geistige Kraft des Bösen oder Dunklen im Leben handelt? Weil ich mich durchdrungen fühle von einer bedingungslosen Liebe, mit der meine Patienten augenblicklich in Resonanz gehen. Die finstere Seite der geistigen Welt kennt diese Liebe nicht und kann sie daher auch nicht imitieren.
Da mir das Arbeiten in dieser Liebe in Fleisch und Blut, in Geist und Seele übergegangen ist, darf ich immer öfter zutiefst dankbar verspüren, wie ich vor schwierigen Gesprächen oder besonderen Seminaren und Workshops geradezu aufgeladen werde von der geistigen Welt. Bitte ich um Schutz für mich und meine Patienten, bekomme ich eine erhöhte Wachheit, Klarheit und Sicherheit im Denken wie Handeln vermittelt, die meinem normalen rationalen Verstand allein nicht zugänglich ist. Ich fühle mich innerlich regelrecht vorbereitet, mehr zu sehen, mehr zu hören, mehr zu fühlen, präsenter zu sein für die Menschen, die sich meiner Arbeit anvertrauen. Wenn mir derartige Geschenke gewährt werden, kann ich sie nur im wohl verstandenen Sinne annehmen und das mir Mögliche tun, mich dieser Geschenke würdig zu erweisen. Im Grunde ist das ein schönes Anknüpfen, ein Mich-wieder-Verbinden mit der Tradition der originären therapeutae. Deren praktizierte Askese teile ich hingegen nicht. Menschen, die mit mir arbeiten, ist auch die Normalität an mir wichtig, der Ausgleich zwischen spiritueller Offenheit und irdischer Bodenhaftung. Es erhöht für sie meine Glaubwürdigkeit, dass ich mich rein weltlicher Sinnesfreuden nicht komplett enthalte. Bloß bemühe ich mich um ein rechtes Maß oder um einen mittleren Pfad, wie es eine Strömung des Buddhismus ausdrückt, zwischen den irdischen Gefilden und dem wachsenden Drang zum Himmel.
Vielleicht mögen Sie als Leserin oder Leser über eben diese Wurzeln des originären Therapeutentums etwas sinnieren, weniger mit Ihrem rationalen Verstand, sondern eher im Sinne eines Verstehens Ihrer eigenen inneren Resonanz auf dem Grunde Ihres Herzens. Sämtliche Psychotherapeutinnen und -therapeuten, die heutzutage ihren Dienst versehen, bedienen sich nach wie vor hauptsächlich des Wortes. In der Deutung wie Handhabung des Wortes sind sie bewandert. Damit knüpfen sie ganz neutral an die von Sigmund Freud so benannte »Redekur« an. Aber wissen sie auch noch um ihre antiken Ahnen sowie deren geistig-spirituelle Wurzeln, um die Deutung der Worte, die weit über Wörter hinausreicht? Möchten sie überhaupt um ihre Ahnen wissen in ihrem Welt- und Menschenbild? Wie weit öffnen sie sich über ihr Fachwissen hinaus noch mit ihrem »Sehvermögen« der »Vision des Existenten« wie dem Spirituellen? Ich finde es ungemein stärkend, stets aufs Neue bestätigt zu finden, dass nicht wenige therapeutische Kolleginnen und Kollegen im geschützten Rahmen von ihren Zugängen zu einer geistig-spirituellen Dimension ihres Lebens berichten, mit der sie sich verbunden fühlen. Auf einem Non-Profit-Symposium berichtete eine Kollegin, die viel mit Kindern und deren Eltern arbeitet:
»Meine eigene Geschichte hat mich dazu bewegt, mich immer wieder selber zu fragen, was es mir eigentlich bedeutet, Therapeutin zu sein. Was sind meine Wurzeln in diesem Beruf? Für mich ist das auch kein Beruf wie andere. Ich merke doch täglich, was diese Arbeit mit mir selbst macht, was in mir selbst in Bewegung gerät. Ich kann mir mich und wie ich die Geschichten der Kinder verstehe überhaupt nicht vorstellen, ohne daran zu denken, dass es da noch etwas viel Größeres geben muss, zu dem ich Kontakt habe und das zu mir Kontakt hat. Eigentlich haben mich das auch die Kinder gelehrt, die häufig noch so verbunden sind. Die Therapien mit ihnen, das, was wirkt und heilt, hat für mich einen spürbaren spirituellen Ursprung. Da sind immer die Gewissheit und Freude in mir, dass ich mich in meiner alltäglichen Arbeit davon getragen und gestützt fühle. Ohne das Wissen um diese Unterstützung könnte ich meine Arbeit überhaupt nicht so leisten, wie ich das tue. Ich möchte als engagierte Therapeutin unbedingt vervielfältigend dabei mitwirken, dass mehr Licht und mehr Liebe in die Welt kommen und gesehen werden dürfen. Das ist mir so wichtig. Und damit will ich mich auch nicht verstecken!«
Was würde unsere Welt im Ganzen gewinnen, wenn sich die Menschen – gleich welcher Hautfarbe, Herkunft, ideologischer Gesinnung oder welchen religiösen Glaubens – darauf besännen, welche die lebensbewahrendste und heilsamste menschliche Herzensqualität ist? Im Glauben an die Moderne haben wir das Wissen um den Lauf der Welten nicht gepachtet. Es gäbe so vieles, auf das wir uns zum eigenen Wohl wie zum Überleben der Menschheit besinnen könnten. Es wäre schon ungemein viel gewonnen, würden die Menschen mehr auf ihr Herz als auf die Worte der Verführung hören.
Bevor wir genau sehen werden, was dieser kleine Streifzug durch die Geschichte des Heilens mit unserem Thema – Drogen und Sucht – zu tun hat, schauen wir uns noch ein wenig weiter um, was große Ärzte und Heilerinnen dazu beigetragen haben, dass wir uns eine sehr andere Sicht auf das Phänomen Sucht eröffnen können, als sie derzeit in unserem Denken geläufig ist.
1.2 Die Krankheitslehre des Paracelsus und ihre Bedeutung für die süchtige Abhängigkeit
Mit dem Fokus auf Sucht brauche ich hier nicht das gesamte Leben des Paracelsus wiederzugeben, das wie eine lebenslange Wanderung anmutet. Was den Menschen und Heiler Paracelsus anbelangt, ist entscheidend, dass sein Verständnis von Krankheit und deren Heilung viel Ähnlichkeit aufweist mit dem Welt- wie Menschenbild der frühen therapeutae, selbst wenn er zu einer viel späteren Zeit als heilender Arzt tätig war. Nähe ist aber nicht gänzliche Gleichheit, und so verstand sich Paracelsus in seinem Blick auf den himmlischen Kosmos wie die irdische Welt zeitlebens als rastloser Neuerer.
Geboren als Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim im Jahr 1493 oder 1494 in Egg, Kanton Schwyz, und verstorben 1541 in Salzburg, war Paracelsus weit mehr als ein simpler Schweizer Arzt und Doktor der Medizin. Er war außerdem Philosoph, Alchemist, Astrologe, Theologe und Sozialethiker, Schreibender und rastloser Suchender zwischen den Welten. Heute würden wir sein Verständnis vom Menschen und seiner Eingebundenheit in die Bezüge der Welt wie des Kosmos »ganzheitlich universell« nennen. Alles in allem war er ein recht streitbarer Unruhegeist mit manch spektakulären Heilerfolgen. Da er sich vielfach, allein gegen alle, wider die damals herrschenden Lehrmeinungen stellte, machte er sich nicht wenige etablierte Ärzte und Apotheker seiner Zeit zu erbitterten Feinden, die mit allen erdenklichen Mitteln gegen ihn zu Felde zogen.
Paracelsus – diesen Beinamen gab er sich selbst, vermutlich abgeleitet aus einer Latinisierung seines Nachnamens Hohenheim – führte ein eigenes Wappen. Als Sinn- und Wahlspruch für das Leben erwählte er den Vers: »Nicht von einem anderen abhängig mache sich, wer sein eigener Herr zu sein vermag.« Das ist die lupenreine Gegenbotschaft zum süchtig abhängigen Lebensmodus, wie er heutzutage so verbreitet ist. Nicht von einem oder etwas anderem abhängig mache sich, wer sein eigener Herr zu sein vermag – das setzt eine Lebenskompetenz, ein inneres Vermögen als Können sowie eine Bereitschaft zur Freiheit voraus, die süchtig abhängige Menschen nicht aufbringen können oder wollen.