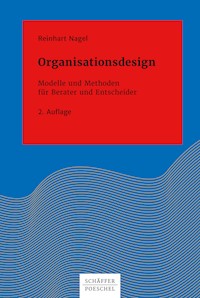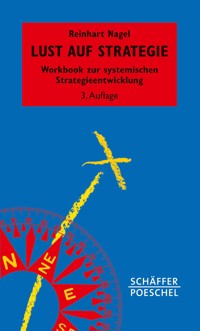43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
Der erfolgreiche Klassiker orientiert sich u.a. an folgenden Fragen: - Welcher Logik folgt ein Strategieprozess? - Wie kann dieser gesteuert werden? - Was sind die Grundprinzipien eines rekursiven Managementprozesses und was unterscheidet diesen von traditionellen Planungsritualen? - Wie hängen Strategie und zentrale Steuerungsaufgaben eines Unternehmens zusammen? - Was zeichnet den systemischen Strategie-Ansatz aus? Es werden aktuelle und viel diskutierte Strategiekonzepte und praktische Werkzeuge für deren Umsetzung vorgestellt. Die sechste Auflage wurde durchgängig aktualisiert und um das Thema Internationale Strategieentwicklung erweitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vorwort zur aktualisierten und ergänzten 6. Auflage
Einleitung
Warum ein weiteres Buch über Strategie?
Die Entstehung einer eigenen »Strategieindustrie«
Zunehmender Bedeutungsverlust der traditionellen »Königsdisziplin des Managements«
Die Innovation des systemischen Strategieverständnisses
Zum Aufbau dieses Buches
Spielarten der Strategieentwicklung
Die intuitive Strategieentwicklung
Charakteristika der intuitiven Strategieentwicklung
Theoretische Grundlagen des intuitiven Ansatzes
Das Pionierunternehmen als dominanter Organisationstyp
Ein starkes unternehmerisch getriebenes Zukunftsbild als zentrales Leitkonzept
Grenzen der intuitiven Strategieentwicklung
Resümee zur intuitiven Strategieentwicklung
Die expertenorientierte Strategieentwicklung
Charakteristika der expertenorientierten Ansätze
Theoretische Grundlagen der expertenorientierten Ansätze
Grenzen der expertenorientierten Strategieentwicklung
Resümee zu den expertenorientierten Strategieansätzen
Die evolutionären Formen der Strategieentwicklung
Charakteristika der evolutionären Strategieentwicklung
Theoretische Grundlagen der evolutionären Ansätze
Grenzen der evolutionären Strategieentwicklung
Resümee zur evolutionären Strategieentwicklung
Systemische Strategieentwicklung
Praxis der systemischen Strategieentwicklung
Die theoretischen Grundlagen der systemischen Strategieentwicklung
Resümee zur systemischen Strategieentwicklung
Der strategische Management-Prozess im Überblick
Die inhaltlichen Schritte des Managementprozesses
Die strategische Analyse
Der Blick auf benachbarte Systeme
Die Stakeholder-Analyse
Die Umweltanalyse
Die Analyse der Wettbewerbs- und Branchenlogik
Die Analyse der Wettbewerbsdynamik nach Porter
Die Konkurrenzanalyse nach Porter
Benchmarking
Grenzen der Wettbewerbsperspektive
Der Blick auf den Kunden
Die Substitutionsanalyse nach Gälweiler
Die Analyse des Kundennutzens
Der Blick in die Zukunft
Die Szenario-Methode
Der Industrievorausblick nach Hamel/Prahalad
Ein Blick auf Binnenverhältnisse und Ressourcen
Die Stärken-Schwächenanalyse
Die Schlüsselfunktion der Kernkompetenzen
Die zentralen Ergebnisse der Analysen
Die Zukunft erfinden
Die strategischen Alternativen
Das Neue beginnt mit der Vorstellung, dass es auch anders sein könnte
Die Zukunftsentwürfe bündeln
Theoretische Impulse für die Suche nach strategischen Alternativen
Der Blick auf den Marktanteil
Der Blick auf die Wettbewerbsvorteile
Der Blick auf die internen Ressourcen
Der Blick auf die Besten
Der Blick auf den Risikoausgleich
Ein Blick auf die Gesamtrentabilität
Checkliste für mögliche strategische Alternativen
Ein Blick auf das Geschäftsmodell
Zur Methode und zur Vorgehensweise
Überblick über aktuelle Geschäftsmodelle
Die Entscheidung für eine bestimmte strategische Ausrichtung des Unternehmens
Drei unterschiedliche Entscheidungsmaterien
Zum Entscheidungsbegriff
Die Besonderheit strategischer Entscheidungen: ihre Funktion als Entscheidungsprämissen
Typische Entscheidungsfehler in komplexen Situationen
Der Plausibilitätscheck
Die normativen Prämissen
Das Formulieren der Grundstrategien
Das Leitbild als normatives Orientierungsinstrument
Daimler – Beispiel eines strategischen Managementprozesses
Die Besonderheiten einer Internationalisierungsstrategie
Der Prozess zu einer internationalen Strategie
Prozessschritte zur Internationalisierung eines Unternehmens
Die besonderen Herausforderungen eines internationalen Strategieprozesses
Organisationsimplikationen für international tätige Unternehmen
Der strategische Umbau
Organisationsarchitekturen und deren besondere Führungsherausforderungen
Das Bauprinzip des funktionalen Organisationsdesigns
Das Bauprinzip der Selbstähnlichkeit
Das Bauprinzip der Projektorganisation
Das Bauprinzip der Prozessorganisation
Resümee
Das Wesen radikaler Veränderungen
Wer verändert? Und wer wird verändert?
Einige nichttriviale Konsequenzen
Die Quellen der Veränderungsenergie
Die Phasen einer radikalen Transformation
Das strategische Steuern
Neuere wertorientierte Controlling-Systeme
Die Grundprinzipien der Balanced Scorecard
Das Werttreiberkonzept
Das EFQM-Excellence Modell
Abgrenzungen der wertorientierten Steuerungssysteme
Die Besonderheiten der Balanced Scorecard
Die Besonderheiten des Werttreibermodells
Die Besonderheiten des EFQM-Modells
Die Gemeinsamkeiten wertorientierter Steuerungsinstrumente
Grenzen der wertorientierten Steuerungsinstrumente
Die Implementierung des strategischen Managementprozesses
Ist die Spitze an Bord des Strategieprozesses?
Die Vergemeinschaftung des »Case for Strategic Action«
Die Vernetzung der unterschiedlichen Hierarchieebenen
Die Mobilisierung der strategischen Intelligenz eines Unternehmens
Die Orientierung an einem inhaltlichen »roten Faden«
Die konzeptionelle Verschränkung des strategischen Managementprozesses mit anderen Steuerungsprozessen
Die zeitliche Taktung des Strategieprozesses
Der gezielte Einsatz von Projektmangement und Projektorganisation
Befähigen und Qualifizieren der am Strategieprozess beteiligten Personen
Systematische Intensivierung der Information und Kommunikation
Organisatorische und technische Supportsysteme
Die Lernfähigkeit des Unternehmens
Der osb-Navigator zur Strategieeinführung
Verwendete und weiterführende Literatur
Personenregister
Sachregister
Die Autoren
Systemisches Management
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
E-Book ISBN 978-3-7992-6873-8
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außer halb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Microverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2014 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft • Steuern • Recht GmbH
Einbandgestaltung: Dietrich Ebert/Melanie WeißSatz: pws Print und Werbeservice Stuttgart GmbH
Januar 2014
Schäffer-Poeschel Verlag StuttgartEin Tochterunternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt
Vorwort zur aktualisierten und ergänzten 6. Auflage
Besondere Herausforderungen für die Führung und die Strategieentwicklung von Unternehmen im Globalisierungsprozess
Was verändert sich durch die aktuelle Globalisierungsdynamik?
Wir sind seit Längerem Zeugen eines Prozesses, der unsere Welt zu einer in vielen Bereichen integrierten, einheitlichen Weltgesellschaft zusammenwachsen lässt. Die Auflösung der über die Jahrzehnte prägenden Dichotomie von Ost und West, der Wegfall der identitätsstiftenden Konkurrenz konfligierender Gesellschaftsentwürfe hat dieses Zusammenwachsen in den zurückliegenden Jahren enorm beschleunigt. Die gesellschaftlichen und sozialen Folgen, die mit diesem Strukturwandel verknüpft sind, sind durchaus mit den Zumutungen vergleichbar, die in Europa der Prozess der Industrialisierung im 19. Jhd. für eine primär agrarisch wirtschaftende, feudal verfasste Gesellschaft bedeutet hat.
Wenn wir von den Begleiterscheinungen der Globalisierung sprechen, dann meinen wir vor allem das Phänomen, dass das Identitätsstiftende des gemeinsamen Ortes, eines regional abgegrenzten sozialen Raumes weitestgehend verloren gegangen ist. Immer seltener bestimmen lokal eingrenzbare Gegebenheiten in einem dominanten Maße die entscheidenden Rahmenbedingungen für die Lebensführung der Menschen. Der Prozess der Globalisierung lässt inzwischen auch die hintersten Winkel der Welt nicht mehr unberührt. Die schützenden Grenzen vertrauter Zugehörigkeiten (räumlicher wie sozialer, ethnischer und kultureller Natur) sind wohl unwiederbringlich in sich zusammengebrochen und für immer verloren. »Genau dieses historisch einmalige Zusammenspiel von Gesellschaftlichkeit und Territorialität zerbricht« (Willke 2013, S. 62) und neue, Sicherheit gebende Orientierungsmöglichkeiten zeichnen sich noch nicht wirklich ab.
Besonders kennzeichnend für die zurückliegende Phase der Globalisierung ist der Umstand, dass dieser weltweite Integrationsprozess in bestimmten gesellschaftlichen Funktionssystemen wie der Wirtschaft, der Wissenschaft, dem Sport, der Kunst bereits sehr weit fortgeschritten ist, während andere Funktionssysteme wie die Politik, das Recht, die Bildung und die Erziehung, die Gesundheit und wohlfahrtsstaatliche Sicherung noch weitestgehend innerhalb der tradierten nationalstaatlichen Grenzen operieren (vgl. Stichweh 2000). Gerade aus dieser Ungleichzeitigkeit erklären sich viele Spannungsfelder, die schon seit Jahren in unterschiedlicher Intensität die Öffentlichkeit bewegen. Ein Beispiel für diese Ungleichzeitigkeiten und ihre Begleiterscheinungen bieten die aktuellen Dynamiken in der europäischen Union bzw. in der Eurozone, wo eingespannt zwischen den unkontrollierbaren Wechselwirkungen einer Bankenkrise, einer ausufernden Staatsverschuldung, verunsicherter Finanzmärkte, stagnierender realwirtschaftlicher Wachstumstraten versucht wird, eine die beteiligten Mitgliedsstaaten übergreifende wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit zu gewinnen und die dafür erforderlichen institutionellen Rahmenbedingungen Schritt für Schritt zu schaffen. Gerade die Dynamik der Finanzmarktkrise 2008/2009 und die daran anschließende Weltwirtschaftskrise haben uns gelehrt, wie verflochten inzwischen die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind und wie sehr nationale Ungleichgewichte im gesamteuropäischen Kontext problemgenerierend wirken. Was ein entfesselter, weitgehender deregulierter, weltweit hochvernetzt operierender Finanzsektor auslösen kann und wie stark das politische System im Grunde genommen als krisenverstärkendes Moment in diese Dynamik eingebaut ist, ist in den letzten Jahren für den aufmerksamen Betrachter eindrucksvoll zu beobachten (vgl. dazu die gleichermaßen anschauliche wie profunde Analyse von Rajan 2012).
Eine Vielzahl anderer Beispiele lassen sich in der internationalen Sicherheitspolitik, in der Entwicklungszusammenarbeit, in den Auseinandersetzungen um das Phänomen des Klimawandels, der Energie- und Rohstoffversorgung etc. beobachten. Helmut Willke bringt die hier angedeutete Ungleichzeitigkeitsproblematik der globalen Entwicklung treffend auf den Punkt: »Die soziologische und soziale Problematik von Globalisierung und Globalität liegt darin, dass die bislang nationalstaatlich verfassten Gesellschaften durch die Herauslösung bestimmter Funktionssysteme – wie etwa Ökonomie, Wissenschaft oder Kunst – aus dem Kontext territorialer Einbindung und gesellschaftlicher Selbststeuerung in ihren Fundamenten erschüttert werden, während neue Formen der Restabilisierung noch nicht erkennbar sind« (ders. 2013, S. 61).
Angesichts dieses Befundes müssen wir realistischer Weise auch in Zukunft vor allem mit Blick auf die zyklische Eigenlogik des Finanzsystems mit wiederholten krisenhaften Verwerfungen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung rechnen. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, in einer größeren Detailschärfe der Frage nachzugehen, ob überhaupt und in welche Richtung sich die Grundmuster des Globalisierungsgeschehens gerade ändern. Im Globalisierungsdiskurs wird nämlich oft eingewendet, dass hier ein gesellschaftliches Phänomen und seine umwälzenden Folgen beschworen werden, das historisch gesehen überhaupt nicht neu ist. Dem ist durchaus zuzustimmen. Schon im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert beobachten wir einen Grad an internationaler Vernetzung der wirtschaftlichen Austauschbeziehungen, der auch aus dem Blickwinkel der Gegenwartsgesellschaft höchst erstaunlich war. Bedingt durch die Folgen der beiden Weltkriege wurde dieses Niveau erst wieder in den letzten Jahrzehnten des 20. Jhd. erreicht. Ungeachtet dieser langen Vorgeschichte der Globalisierung gehen wir im Moment von der Annahme aus, dass wir uns in der allerjüngsten Zeit auf einen massiveren weltwirtschaftlichen Strukturwandel zubewegen, der es berechtigt erscheinen lässt, von einem grundlegenden Musterwechsel in der Internationalisierungsdynamik von Unternehmen zu sprechen.
Was genau ist da in Veränderung begriffen?
Dass Unternehmen in der Vergangenheit über ihre schon eingespielten Exportaktivitäten hinaus weitere Internationalisierungsschritte unternommen haben, hatte lange Zeit relativ simple strategische Gründe. Es ging vielfach darum, einerseits ganz bestimmte Faktorkostenvorteile, die sich durch die globalen Entwicklungsunterschiede boten, zu lukrieren (Lohnkosten, Steuervorteile, Zugang zu Rohstoffen etc.). Zum anderen winkten durch die Internationalisierung zusätzliche Wachstumschancen, indem es galt, für das eigene Produktportfolio neben dem Heimmarkt weitere Absatzmärkte zu erschließen. Diesen klassischen Treibern des Internationalisierungsgeschehens wurde durch die enormen Innovationen in den Informations- und Kommunikationstechnologien sowie durch die Produktivitätssprünge in der Logistik schrittweise die letztlich auch heute noch erfolgskritischen Rahmenbedingungen geschaffen. Diesem Internationalisierungsgeschehen der letzten Jahrzehnte lagen ganz bestimmte Annahmen zu den Grundstrukturen einer globalen wirtschaftlichen Arbeitsteilung zugrunde. Folgt man diesen Annahmen, dann passiert die eigentliche Wertschöpfung in der entwickelten Welt. Dorthin fließen folgerichtig auch die Gewinne zurück. Der Rest der Welt kann nur in Abhängigkeit dazu an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung teilhaben.
Spätestens seit der jüngsten Weltwirtschaftskrise ist unübersehbar, dass sich diese klare Asymmetrie aufzulösen beginnt und sich die weltwirtschaftlichen Gewichte deutlich verschieben. In den gesellschaftlich hochentwickelten Weltregionen hat sich die Wachstumsdynamik merklich abgeflacht. Vor allem in Europa ist auf mittlere Sicht nicht davon auszugehen, dass sich die gewohnten Wachstumsraten der zurückliegenden Jahrzehnte wieder einstellen werden. Skeptiker sprechen bereits von einer »Postwachstumsgesellschaft« (vgl. dazu Seidl/Zahrnt 2010) und stellen sich die Frage, ob wir uns nicht insgesamt von der Vorstellung verabschieden müssen, dass ein permanentes Wirtschaftswachstum die unabdingbare Voraussetzung für eine gedeihliche Wohlstandsentwicklung ist. In den USA kämpft man mit den Folgen eines schon lange währenden Deindustrialisierungsprozesses, im Zuge dessen das wettbewerbsbestimmende Produktions-Know-how in vielen Industrien nach Asien abgewandert ist. Zwar wird die veränderte Energiesituation in den Staaten (Stichwort Erdgasgewinnung aus tieferen Gesteinsschichten) aller Wahrscheinlichkeit nach in der US-amerikanischen Wirtschaft eine gewisse Re-Industrialisierung befördern. Das wird aber mit großer Sicherheit an den bereits erfolgten Umschichtungen der Wirtschaftskapazitäten im globalen Maßstab nichts Grundlegendes ändern. Weltwirtschaftlich betrachtet liegen die relevanten Wachstumspotenziale heute in den sogenannten Schwellenländern bzw. in jenen Ländern (z. B. Afrikas), die sich gerade am Sprung auf deren Entwicklungsniveau befinden. Dorthin haben sich die strategischen Schwerpunkte verlagert.
Diese Veränderungen verschaffen den Schwellenländern in den sich weiter intensivierenden Wettbewerbsauseinandersetzungen zwischen den einzelnen Weltregionen eine ganz andere Position, als das bislang der Fall war (vgl. Ghemawat 2010). Die Grundstrukturen weltweiter Wertschöpfungsaktivitäten verlieren ihre jahrzehntelang eingeübte Asymmetrie. Die unternehmerische Dynamik und damit verbunden auch die wirtschaftspolitischen Einflussgewichte beginnen sich dramatisch zu verschieben. So haben sich etwa die Anteile am Weltmarkt in den letzten Jahren deutlich zuungunsten des europäischen Wirtschaftsraumes verlagert, wie die EU-Kommission kürzlich bedauernd festgestellt hat. Dies ist nicht zuletzt auch an dem Umstand zu beobachten, dass in der Tendenz seitens der Unternehmen zunehmend weniger in den besonders wettbewerbsintensiven und gleichzeitig wachstumsschwachen Heimmärkten investiert wird.
Diese »tektonischen» Verschiebungen in weltweitem Maßstab werden künftig ihre Fortsetzung erfahren. Der sich beschleunigende Urbanisierungsprozess lässt gerade in den Schwellenländern ganz neue Metropolregionen entstehen. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Menschheit in großen Städten. Das McKinsey Global Institute geht in seinen Recherchen davon aus, dass in den nächsten 15 Jahren 40 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachstums von den heute vielfach noch ganz unbekannten Millionenstädten der Schwellenländer generiert werden wird (vgl. Dewhurst u. a. 2012, S. 1). Dieser rasante gesellschaftliche Strukturwandel, weg von den dörflichen Strukturen mit ihren agrarisch dominierten Verhältnissen hin zu städtischen Konglomeraten mit einer stark expandierenden industriellen Infrastruktur, ist in diesen Ländern zweifelsohne ein ganz zentraler Wachstumsmotor.
Unterstützt wird dieser durch eine bemerkenswerte demografische Entwicklung, die die beschriebenen Unterschiede zwischen den Weltregionen noch erheblich verstärkt. Während in der entwickelten Welt (die USA ausgenommen) der Alterungsprozess weiter zunimmt, können die Schwellenländer noch auf längere Sicht auf eine Situation zurückgreifen, in der sich der weit überwiegende Teil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter befindet. So wird etwa in 2020 das Durchschnittsalter Indiens 29 Jahre betragen im Vergleich zu Westeuropa mit seinen 45 und Japan mit seinen 48 Jahren (vgl. dazu Stewart 2011, S. 48). David Bloom von der Harvard School of Public Health nennt diesen markanten Unterschied in der Bevölkerungsentwicklung »a demographic dividend« (ders. u. a. 2003). Jährlich drängen Millionen gut ausgebildeter, hochqualifizierter junger Menschen auf den Arbeitsmarkt und befeuern mit ihren Wohlstandserwartungen die Wachstumsdynamik in diesen Ländern, während in den entwickelten Weltregionen der Kampf um qualifiziertes Personal schon aus demografischen Gründen immer schärfer wird. Diese bevölkerungsstrukturelle »Dividende« ist in ihrer Bedeutung für die hier angesprochenen Verschiebungen in den weltwirtschaftlichen Gewichten nicht hoch genug einzuschätzen.
Unmittelbar in Verbindung mit diesen Demografiefragen muss man auch jene Transformationsprozesse sehen, die seit Längerem bereits mit dem Umbau unserer Wirtschaft in Richtung einer wissensbasierten Ökonomie beschrieben werden. Inzwischen hegt niemand mehr Zweifel daran, dass die Ressource Wissen mit Blick auf fast alle Formen der Wertschöpfung die klassischen Faktoren Boden, Arbeit und Kapital längst an Bedeutung überholt hat. Klar ist, dass dieser epochale Bedeutungszuwachs des Faktors Wissen ohne die Errungenschaften der digitalen Revolution undenkbar ist. Beide Veränderungsdynamiken unserer modernen Gesellschaft bedingen und stimulieren einander. So sind die Produktion, die Nutzung und der Schutz dieser Ressource in einer wissensökonomisch geprägten Welt zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Deshalb gewinnen Auseinandersetzungen um »intellectual property rights« auf der globalen Bühne in der Zwischenzeit so sehr an Bedeutung.
Es zählt nun zur besonderen Eigenart der Ressource Wissen und ihrer spezifi-schen Knappheitsausprägungen, dass sie eine hervorragende Treiberfunktion in der Globalisierung wesentlicher gesellschaftlicher Bereiche (Wirtschaft, Wissenschaft, etc.) einnimmt und den Internationalisierungsprozess der in diesen Funktionssystemen operierenden Organisationen (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, etc.) anleitet. Diese sich gerade herausbildende Wissensgesellschaft »wird die erste Form der Gesellschaft sein, die fundamental von der Dynamik der Globalisierung geprägt und gleichzeitig von globalen Risiken des Nichtwissens geschüttelt sein wird« (Willke 2013, S. 57). Wir können diese These gut an jenen Phänomenen erhärten, die sich zur Zeit auf der Ebene der Unternehmen mit Blick auf ihre Internationalisierungsbemühungen beobachten lassen.
Der globale Strukturwandel und seine unternehmerischen Bewältigungsformen
Es liegt auf der Hand, dass die geschilderten strukturellen Veränderungen in der Weltwirtschaft die beteiligten Unternehmen zu einer Weiterentwicklung ihrer bislang gewohnten Internationalisierungsstrategien zwingen.
Während Internationalisierung in der Vergangenheit vielfach bedeutet hat, die auf den Heimmärkten bewährten Erfolgsmuster einfach in die Welt hinaus zu verlängern, so stellen sich jetzt für Unternehmen oft ganz neue Strategiefragen. Genügt es, in den neuen Wachstumsregionen primär die »urban elite«, die sich europäische Markenprodukte im Premiumsegment leisten kann, als Zielgruppe ins Visier zu nehmen? Und dies nur, weil es bedeutet, dass man somit an der eigenen bisherigen Produktphilosophie nicht viel ändern muss?
Unternehmen, die an der Wachstumsdynamik der in ihrer Eigenart doch recht unterschiedlichen Schwellenländer erfolgreich teilhaben wollen, werden sich mit dem Umstand anfreunden müssen, dass es für die eigene Wettbewerbsfähigkeit künftig nicht mehr reichen wird, bislang Vertrautes aus den Heimmärkten heraus in alle Welt zu exportieren. Die Erfahrung lehrt, dass die spezifischen Besonderheiten der Märkte in den einzelnen Wirtschaftsregionen in strategischer Hinsicht immer stärker an Bedeutung gewinnen. »Managing those differences is the primary challenge« (Ghemawat 2010, S. 56).
Folgt man dieser Einsicht, dann zwingt es Unternehmen, sich in ihrer Strategieentwicklung sehr viel eingehender mit den Unterschieden in diesen Wachstumsmärkten zu beschäftigen und eigene Geschäftsmodelle, eigene Produktinnovationen, ganz eigene Vertriebslösungen dafür zu entwickeln. »Galten etwa China und Indien früher als Ergänzung, deren abgewandelte Produkte zusätzliche Umsätze brachten, so sind diese Länder heute eine wesentliche Nachfragequelle mit ganz eigenen Kundenanforderungen, die es zu berücksichtigen gilt« (Kumar/Puranam 2012, S. 75). Erfolgreiche Unternehmen entwickeln in den jeweiligen Schwellenmärkten für die dortigen Verhältnisse oft gemeinsam mit regionalen Partnern innovative Produkte, mit deren Hilfe sie dann auch auf ihren Heimmärkten wieder auf eine ganz neue Weise punkten können (Prinzip des »reverse innovation«). Als Beispiel dafür kann etwa der österreichische Motorradhersteller KTM gelten, der mit seinem starken indischen Partner hochinnovative Fahrzeuglösungen entwickelt hat, die inzwischen nicht nur in Indien, sondern weltweit vertrieben werden.
Die vielfach beobachtbare Pfadabhängigkeit der bisherigen Internationalisierungsanstrengungen von Unternehmen aus den entwickelten Weltregionen heraus steht solchen strategischen Repositionierungsentscheidungen und ihren weitreichenden organisatorischen Implikationen zumeist entgegen. »Viele internationale Konzerne haben ihre F&E-Abteilungen nicht ermuntert, an Innovationen für das enorm große mittlere Marktsegment in den Schwellenländern zu arbeiten oder auch einfach nur zu versuchen, Produkte an die lokalen Verhältnisse anzupassen« (Kumar/Puranam 2012, S. 78).
Aber selbst wenn die neuen strategischen Herausforderungen, die heute mit den veränderten weltwirtschaftlichen Konstellationen verbunden sind, erkannt werden, so sind die damit verbundenen organisatorischen Konsequenzen nicht leicht zu realisieren. Mit Blick auf geeignete Organisations- und Führungsstrukturen wird zur Zeit in sehr vielen Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Lösungen experimentiert. Solche organisatorische Umbauten machen nicht davor halt, das Headquarter einzelner Geschäftsbereiche in diese Wachstumsmärkte zu verlagern, wie dies Bayer mit seiner Policarbonat-Sparte in Richtung Shanghai kürzlich realisiert hat. Es ist naheliegend daran zu denken, die F&E-Aktivitäten, d. h. den ganzen Produktentwicklungsprozess, völlig neu zu denken und auf unterschiedliche Subzentren weltweit zu verteilen. So baut etwa die Audi AG in China und in den USA im Moment neue Entwicklungszentren auf, ein Schritt, der dazu zwingt, einen sorgfältig konzipierten Verbund an weltweit verteilten, intern und extern angesiedelten Entwicklungsaktivitäten entstehen zu lassen.
Es ist außerdem plausibel, alle kundennahen Funktionen möglichst zu regionalisieren, um die Spezifika der jeweiligen Wachstumsmärkte unternehmerisch voll auszuschöpfen. Kundenfernere Funktionen können demgegenüber nach anderen Kriterien weltweit in organisatorische Einheiten gebündelt werden, etwa nach dem Prinzip: dort, wo die entwickeltsten Kompetenzen zu den niedrigsten Kosten anzutreffen sind.
Nimmt man diese ganz unterschiedlichen Gestaltungstrends zusammen, dann wird sichtbar, dass letztlich ein völlig neues Verständnis von Konzernstrukturen im Entstehen ist, das über die seinerzeit von Bartlett und Ghoshal (2002) formulierten Modellvarianten deutlich hinausgeht. Durch den beschriebenen Musterwechsel im Internationaliserungsgeschehen erklimmt die Zahl der in den Organisations- und Führungsverhältnissen heute zu berücksichtigenden Gestaltungsdimensionen ein neues Komplexitätsniveau, das noch durch den Umstand gesteigert wird, dass eine Reihe von Internationalisierungsschritten das Eingehen von strategischen Allianzen, von Joint Venture-Lösungen und ähnlichen Partnerschaften nahe legt.
Diese organisationsinternen Komplexitätsverhältnisse verbieten es, an das allein gültige Organisationsdesign zu glauben, an den »one best way«, der zu der gesamten Vielfalt unternehmerischer Herausforderungen internationalisierter Unternehmen passt. Die zutiefst widersprüchlichen Anforderungen aus dem Internationalisierungsgeschehen nehmen merklich zu und stellen ganz neue Anforderungen an das, was wir »Paradoxietauglichkeit« von Unternehmen nennen (vgl. Wimmer 2012).
Das lenkt den Blick auf die sorgfältige Gestaltung der Führungsprozesse und des Kommunikationsgeschehens sowie auf die gezielte Nutzung von Interkulturalität und Diversity in solchen Unternehmen. Hier gewinnen Maßnahmen zu einer, einzelne Geschäftsbereiche und Regionen übergreifenden Führungskultur, zu einer HRPolitik, die die unterschiedlichen Begabungspotenziale und Arbeitsmarktbedingungen in diesen Wachstumsregionen voll ausschöpft, enorm an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund erhält auch die Frage nach der spezifischen Qualität von Leadership angesichts eines hohen Internationalisierungsgrades von Unternehmen zweifelsohne ihre Berechtigung (zur Frage »global leadership« vgl. Mendenhall u. a. 2008).
Was bedeutet das aktuelle Internationalisierungsgeschehen für den Prozess der Beratung?
»Es ist sicherlich eine der wichtigsten – und schwierigsten – Aufgaben von Organisationsberatern, die Transformation von Organisationen im Kontext einer sich ausbildenden Wissensgesellschaft und einer weltweit integrierten Wissensökonomie zu unterstützen« (Willke 2013, S. 57). Dem ist nur zuzustimmen.
Aber wie lässt sich die Idee einer Wissensgesellschaft, die heute angesichts ihrer unübersehbaren ökologischen wie sozialen Herausforderungen nur mehr in einem weltgesellschaftlichen Kontext gedacht werden kann, auf der Ebene ihrer Organisationen (d. h. von Unternehmen, von Forschungseinrichtungen, von transnationalen politischen Organisationen, etc.) konkretisieren und beraterisch in professioneller Hinsicht angemessen begleiten? Die vorangegangenen Überlegungen sollten eine Idee davon vermitteln, dass sich unsere Organisationen in Zukunft einer weiteren Steigerung ihrer Binnenkomplexität ausgesetzt sehen. Einige Hinweise in Richtung Strategie, Organisationsgestaltung und der Entwicklung geeigneter Leadershipverhältnisse sollten diese Steigerung verdeutlichen.
Es ist die These des vorliegenden Buches, dass die Art und Weise, wie externe Strategieberatung ihre Unterstützungsleistungen begreift und konzipiert, den heute anzutreffenden Komplexitätsverhältnissen zu korrespondieren hat. Das aktuelle Internationalisierungsgeschehen fügt den jeweils zu bearbeitenden Unternehmensthemen zweifelsohne erhebliche Komplexitätsdimensionen hinzu, von denen in der Beratung nicht risikolos abgesehen werden kann.
Im Prozess der Strategieentwicklung gibt es weitere Dimensionen miteinzubauen, die alle von einem hohen Maß an Nichtwissen und entsprechenden Risiken begleitet sind. Ähnliches gilt für alle Fragen des Organisationsdesigns und des Change Managements. Hier gilt es, die Vielfalt der organisationsintern jeweils abzubildenden Dimensionen in den Blick zu nehmen und maßgeschneiderte Organisationslösungen zu finden, die die unvermeidlicher Weise eingebauten Zielkonflikte mit Blick auf die Überlebungsbedingungen des Gesamtunternehmens immer wieder aufs Neue bearbeitbar machen.
Dies sind letztlich die Gründe dafür, warum wir die 6. Auflage unseres Buches um einen eigenen Internationalisierungsschwerpunkt ergänzen.
Wien, im Frühjahr 2014Rudolf Wimmer und Reinhart Nagel
Einleitung
Brauchen Sie für Ihr Unternehmen eine Strategie? Nein. Denn Sie haben bereits eine.
Wann immer ein Unternehmen in einem bestimmten Markt Fuß gefasst und über einen gewissen Zeitraum seine Überlebensfähigkeit unter Beweis gestellt hat, dann verfügt es auch über eine Strategie, vielleicht nicht explizit und in Worte gegossen, aber im konkreten Tun, im Vollzug des täglichen Geschäfts erfolgreich zum Ausdruck gebracht. Sie äußert sich in der höchst spezifischen Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, das heißt in dem für dieses Unternehmen charakteristischen Businessmodell. Sie ist in die vielfach unausgesprochenen, meist gemeinsam geteilten Grundüberzeugungen derjenigen Entscheidungsträger eingelassen, welche die Linie des Unternehmens bestimmen. Dazu zählen Bilder über die Besonderheiten der eigenen Kunden, der Lieferanten, der Wettbewerber, der Kapitalgeber etc. Dazu zählen aber auch Vorstellungen, worauf es in Zukunft eigentlich ankommt, was in den zu bearbeitenden Märkten Erfolg verspricht und welche Risiken eher zu vermeiden sind.
Dies ist die zentrale Ausgangsthese dieses Buches: Jedes am Markt existierende Unternehmen verfügt bereits über eine ganz bestimmte Form der strategischen Orientierung.
Die Art und Weise, wie diese Orientierung zustande kommt – ob es sich um ein explizit erzeugtes Wissen handelt oder ob sich dieses eher auf evolutionärem Wege herausbildet und wieder korrigiert –, ist unmittelbarer Ausdruck der historisch gewachsenen Organisationsverhältnisse und der dazu passenden Führungsstrukturen. So ist eben das Grundmuster der Zukunftsbewältigung in einem eigentümergeführten Familienunternehmen deutlich anders als das eines börsennotierten Großkonzerns. Oft sind die eingespielten Muster, wie diese Orientierung zustande kommt, und die zumeist implizit getroffenen identitätsbestimmenden Festlegungen für die Zukunft den Herausforderungen eines Unternehmens nicht mehr angemessen. Dies ändert aber nichts an dem Umstand, dass jedes Unternehmen ganz bestimmten handlungsleitenden Prämissen in seiner geschäftspolitischen Reproduktion folgt.
Mit dieser Ausgangsthese unterscheiden wir uns dezidiert von der großen Fülle präskriptiver Strategieliteratur, die in unterschiedlichen Varianten darauf abzielt, den Unternehmen die »richtige« Form des Vorgehens und der strategischen Positionierung zu vermitteln, das heißt einen »strategielosen« Zustand so zu verändern, dass das Management wie die Mitarbeiter in ihrem alltäglichen Entscheiden auf eine tragfähige strategische Ausrichtung zurückgreifen können. Aus unserer Sicht gibt es diesen strategielosen Zustand nicht. Es kann also nur um die Frage gehen, ob die historisch gewachsene und aktuell praktizierte Form der Auseinandersetzung mit sich ändernden Umfeld- und Marktgegebenheiten auch in der Zukunft noch in der Lage ist, das eigene Überleben als Unternehmen erfolgreich zu sichern.
Warum ein weiteres Buch über Strategie?
Wenn man davon ausgeht, dass jedes Unternehmen über eine Strategie verfügt, wozu dann ein weiteres Buch über Strategieentwicklung? Die einschlägige Literatur ist ohnehin nicht mehr zu überblicken und die Vielfalt bzw. Widersprüchlichkeit der angebotenen Konzepte ist weiter am zunehmen. Deshalb ist diese Frage durchaus berechtigt und in der Tat gar nicht so leicht zu beantworten. Wir beginnen mit einem ersten Begründungsversuch.
Ein Buch für reflexionsgewohnte Entscheider und Berater
Die vorliegende Arbeit bietet den Lesern eine Art Leitfaden zur gezielten Beobachtung und Reflexion der eigenen strategischen Praxis im Unternehmen an (diese reflexionsorientierte Hinwendung zur unternehmerischen Praxis prägt in der Zwischenzeit auch eine immer breiter werdende Bewegung in der Strategieforschung. Dazu Johnson, u. a. 2007). Diese Praxis kann in der Orientierungssuche von verantwortlichen Entscheidungsträgern auf den verschiedensten Ebenen eines Unternehmens bestehen. Sie kann aber auch in einem spezifischen beraterischen Tun ihren Ausdruck finden, wenn es also darum geht, Organisationen bei der Bewältigung ihrer strategischen Herausforderungen aus einer externen Beratungsperspektive heraus professionell zu unterstützen. Insofern haben wir eine ganz bestimmte Nutzergruppe vor Augen. Es geht uns um Funktionsträger, die in ihrem Alltag aus einem professionellen Selbstverständnis heraus in steuernder Absicht auf hochkomplexe soziale Systeme Einfluss nehmen und gleichzeitig wissen, dass dies mit der tradierten hierarchiebetonten Führungsmentalität nicht mehr erfolgreich zu leisten ist. Wir wenden uns deshalb explizit an Entscheidungsträger, an Führungskräfte, an Experten, aber auch an alle anderen, die in der Beratung tätig sind und die publizistische Überflutung mit vereinfachenden Kochrezepten satt haben.
Dabei eignet sich das Thema Strategie ganz besonders für diese Art von toolboxgefüllten Veröffentlichungen. Die wissenschaftliche Tradition des strategischen Managements war durchweg von dem Forscherehrgeiz geprägt, unmittelbar für die Unternehmenspraxis verwertbares, instrumentell einsetzbares Wissen zu produzieren (kritisch dazu Mintzberg 1994 sowie insbesondere Nicolai 2000). Vor diesem Hintergrund sehen wir es als eine besondere Herausforderung, für eine Zielgruppe zu schreiben, die selbstbewusst mitten in der Auseinandersetzung mit ihren praktischen Herausforderungen steht und für die Bewältigung genau dieser Herausforderungen an fundierten, praxistauglichen Hinweisen interessiert ist.
Wie kann man dem Orientierungswunsch dieser Zielgruppe gegenüber nachkommen und dabei gleichzeitig auf das vordergründige Versprechen einer leichten Instrumentalisierung einfach verwertbaren Steuerungswissens verzichten? Kann das zusammengehen?
Oszillieren zwischen Vermittlung klassischer strategischer Denkhilfen und deren Bewertung aus einer Metaposition heraus
Wir wollen uns bewusst der Paradoxie stellen, die diesem Anspruch innewohnt. Denn auch in der Praxis stoßen wir in vermehrtem Ausmaß auf Funktionsträger, welche die Grenzen jener Machbarkeitsillusionen längst ausgetestet haben, wie sie von vielen Managementmoden nach wie vor suggeriert werden. Genau diese skeptische, in der Zwischenzeit reflexionsgewohnte Zielgruppe ist es, die weiß, dass sie selbst mit eben dieser Paradoxie tagtäglich fertig werden muss: Es gilt, ständig von neuem durchaus risikoreiche Entscheidungen herbeizuführen, die selektiv bestimmte Begründungszusammenhänge in den Vordergrund schieben, um ein logisch stringentes Fundament an Rationalität entstehen zu lassen – wohl wissend, dass alles auch ganz anders möglich wäre und wahrscheinlich auch anders kommen wird. Dieses ständige, sich auf Rationalität berufende Herstellen von Gewissheit bei gleichzeitigem Wissen um die Unausweichlichkeit von Unsicherheit ist zum Kerngeschäft von Führung geworden. Sie muss unausweichlich mit Rationalitätsprämissen operieren, vereinfachende Kausalitätserwartungen in die Welt setzen (wenn wir uns so entscheiden, wird mit Sicherheit dies oder jenes passieren), dies alles aber mit dem Hintergrundwissen, dass die Welt viel komplexer ist und wir eigentlich viel weniger wissen, als wir zu wissen vorgeben. Strategieentwicklung ist ein besonders prominentes Anwendungsfeld für dieses faszinierende Oszillieren zwischen Wissen und Nichtwissen im Herbeiführen von Entscheidungen, die als orientierungstiftende Prämissen für weitere Entscheidungen im Alltag fungieren sollen (wir stützen uns hier auf das Luhmann’sche Organisations- und Entscheidungsverständnis, ders. 2000).
An diesem Grundproblem orientiert sich das vorliegende Buch. Es diskutiert einerseits durchaus bewährte Denkinstrumente und Entscheidungshilfen aus der klassischen Tradition des strategischen Managements. Hier ist inzwischen eine Vielzahl an sehr brauchbaren Analysewerkzeugen und Entscheidungshilfen erarbeitet worden. Mit diesen zu operieren widerspricht keineswegs einer konstruktivistischen Grundhaltung. Gleichzeitig möchten wir aber dem Leser augenzwinkernd vermitteln, dass es sich dabei lediglich um Sehhilfen und Rationalitätskrücken handelt, deren Ergebnisse keine letzte »objektive« Entscheidungssicherheit vermitteln. In diesem Sinne oszillieren die im Buch angestellten Überlegungen selbst zwischen ganz konkreten Denkwerkzeugen, die den Prozess der Strategiefindung in seinen unterschiedlichen Phasen unterstützen können, und eher allgemeineren Reflexionsangeboten, die dem Leser zu einer Distanz schaffenden Metaposition in Fragen der Strategieentwicklung verhelfen sollen. Dieser Spannungsbogen zwischen unterschiedlichen Abstraktionsniveaus spiegelt gleichzeitig die heutige Arbeitsrealität gerade jener Entscheidungsträger gut wider, die in ihrem Aufgabengebiet unternehmerische Verantwortung zu tragen haben (eine Reihe recht anschaulicher Beispiele für die Praxis dieses Oszillierens im Führungsalltag bekannter Unternehmen bieten Doz/Kosonen 2008).
Die Entstehung einer eigenen »Strategieindustrie«
Bis in die späten 1980er-Jahre dominierten im Bereich der Strategieentwicklung, soweit sich Unternehmen überhaupt explizit auf diese Fragen eingelassen haben, jene Ansätze und Verfahrensweisen, die prinzipiell auf die Planbarkeit künftiger Entwicklungen setzten und dementsprechend Wert auf eine möglichst gründliche Analyse der unterschiedlichen Einflussfaktoren im Umfeld von Unternehmen legten. Von den Denkkonzepten her war diese Art von Praxis vornehmlich von der Tradition des »strategischen Managements« geprägt, die sich in relativ kurzer Zeit – beginnend mit den 1960er-Jahren – zur Königsdisziplin der betriebswirtschaftlichen Fachgebiete entwickelt hat. Das Paradigma der strategischen Planung verdankte seine Entstehung zwar den intellektuellen Leistungen einiger Wissenschaftler (wie Ansoff, Andrews, Chandler, Porter, Gälweiler u. a.). Popularisiert wurden diese Denkkonzepte aber durch die bekannten Business Schools sowie durch die großen amerikanischen Beratungsunternehmen, die selbst nennenswerte Beiträge zur Know-how-Entwicklung auf diesem Gebiet geleistet haben (man denke etwa nur an die berühmte Portfoliomatrix der Boston Consulting Group). Insgesamt war in diesem Zeitraum in dem Wechselspiel zwischen Wissenschaft, Beratung und den einschlägigen Managementtrainings in den Business Schools so etwas wie eine eigene »Strategieindustrie« (vgl. zu diesem Begriff ausführlicher Nicolai 2000) entstanden, die über die »adäquaten« mentalen Modelle sowie über die Standards des »richtigen« strategischen Vorgehens wachte (eine eindrucksvolle Analyse der Prägekraft dieser Industrie insbesondere der sozialisatorischen Wirkungen der etablierten Business Schools bietet Mintzberg 2004).
Das Rationalitätsparadigma als dominantes mentales Modell
Die Grundannahmen dieser Denktradition fußen wie gesagt in der Idee der Planbarkeit, der Berechenbarkeit von Entwicklungen; sie wurzeln in der Vorstellung vergleichsweise stabiler Branchen- und Umweltkonstellationen, deren genaue analytische Kenntnis die strategische Positionierung von Unternehmen ermöglicht und dadurch mit einiger Sicherheit überdurchschnittliche Erfolge erwartbar macht (Die Arbeiten und Denkkonzepte von Michael E. Porter haben in diesem Zusammenhang weltweit zweifelsohne den größten Einfluss genommen). Seinen Höhenflug verdankt dieses gut durchdachte Repertoire an analytischen Diagnose- und Entscheidungsprozeduren seinem Versprechen, die unübersehbaren Risiken der Unternehmenssteuerung durch das Herausarbeiten rational eindeutig begründbarer Optionen, die auf dieser Grundlage logisch nachprüfbare Wahlentscheidungen ermöglichen, beherrschbar zu machen. Der »Rational-Choice-Ansatz« dieser Tradition bezog seine große Suggestivkraft aus der Annahme, die für strategische Weichenstellungen erforderlichen Informationen ließen sich mit Hilfe eines adäquaten Vorgehens möglichst vollständig gewinnen. Die eigentliche Entscheidung ist dann lediglich eine Frage des logisch stringenten Denkens. Dieses Versprechen erwies sich insbesondere für angestellte Manager attraktiv, die sich durch die vom Kapitalmarkt vorangetriebene Ausdifferenzierung der Manager- und Eigentümerrolle einem wachsenden Erklärungs- und Rechtfertigungsbedarf für ihre Unternehmenspolitik gegenübersahen.
Delegation an Strategieexperten
Ein Teil dieser Attraktivität lag wohl auch in dem Umstand, dass der in dieser Tradition weitgehend standardisierte Prozess der Strategiebearbeitung selbst die entscheidungsverantwortlichen Manager in den Unternehmen sehr entlastete. Die eigentliche Arbeit machten Experten (unternehmensinterne Stäbe oder von außen zugekaufte Berater). Deren Strategiekonzepte landeten dann auf dem Schreibtisch der zuständigen Topmanager, die sich mit den Ergebnissen anfreunden konnten oder eben auch nicht.
Für ihre Entscheidungsfindung, so zumindest die Annahme, war es nicht notwendig, die hinter den Strategiekonzepten liegende Denkarbeit selbst zu leisten. Dafür hatte man ja seine Fachleute, die über die erforderliche analytische Kompetenz wie auch über das passende Methodenwissen verfügten. Auf diesem Wege entstand eine eigentümliche Arbeitsteilung zwischen einem hochspezialisierten Expertentum in Strategiefragen einerseits und den Entscheidungsträgern im Linienmanagement andererseits, die sich in ihren Entscheidungen auf die in Anspruch genommene Expertise als Begründungshintergrund stützen konnten, ohne sich selbst in der Erarbeitung unterschiedlicher Optionen und strategischer Festlegungen nennenswert selbst engagieren zu müssen.
Strategie als Mittel zum Zweck
Ein fester Bestandteil dieses Zusammenspiels zwischen Strategieexperten und Top-Management war außerdem die einhellige Meinung, der eigentliche Part der Unternehmensführung bestehe in dieser Form der Strategiefindung, im richtigen »Design« der strategischen Festlegungen. In dieser Leistung wird die eigentliche Kernherausforderung der Unternehmensführung gesehen. Die Umsetzung dieser Festlegungen sei dann normales Führungsgeschäft. Sie liege hauptsächlich in der Verantwortung der zweiten und dritten Führungsebene, die letztlich nur den strategischen Vorgaben zu folgen brauche, um das Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten. Diesem Verständnis korrespondiert die beliebte US-amerikanische Differenz von Leadership und Management, die folgerichtig den Leadern eine außergewöhnliche strategische Bedeutung einräumt (exemplarisch dazu Kotter 1997). Diese Sichtweise, die dem Implementierungsproblem einen vergleichsweise nachrangigen Stellenwert einräumt, spiegelt ein Organisationsverständnis wider, demzufolge das Unternehmen als solches lediglich als Instrument zur Verwirklichung vordefinierter Zwecksetzungen und Ziele fungiert. Am Eindrucksvollsten kommt diese Zweck/ Mittelrelation im Shareholder-Value-Ansatz zum Ausdruck, der sich in der Zwischenzeit vor allem in kapitalmarktorientierten Konzepten der Unternehmensführung weitgehend durchgesetzt hat (dazu grundlegend Rappaport 1999 sowie Jensen 2001. Zur Kritik dieses Führungsverständnisses vgl. Wimmer 2002). Dieses instrumentelle Verhältnis von Strategie in Relation zu anderen Führungsdimensionen wie der Organisationsgestaltung, dem Personalmanagement, der Markenführung etc. macht deutlich, warum den Umsetzungsfragen in der planungsorientierten Tradition des strategischen Managements eine deutlich untergeordnete Rolle zugedacht war. Genau diese Geringschätzung der unternehmensinternen Gegebenheiten bildete neben der Planungsgläubigkeit den entscheidenden Ansatzpunkt, an dem sich in Forschung und Praxis an dieser präskriptiven Tradition des strategischen Managements die entscheidende Kritik entzündete.
Zunehmender Bedeutungsverlust der traditionellen »Königsdisziplin des Managements«
Spätestens in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre hat die eben kurz skizzierte Denktradition sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ihren Zenit überschritten. Unterschiedliche Faktoren haben diesen Höhenflug der klassischen Strategieindustrie gebremst.
Zum einen nahmen bestimmte Forschungsanstrengungen zu, die empirisch nachweisen konnten, dass viele aufwendig erarbeitete Strategiepapiere in der Praxis wenig bewirkten (vgl. dazu etwa die Arbeiten von Whittington 2001, Johnson/Scholes 2002, Browman/Helfat 2001, Schreyögg 2000). Zum andern zeigt ein genauerer Blick in das reale Geschehen in Unternehmen überdeutlich, dass die tatsächlich realisierten strategischen Orientierungen in den allermeisten Fällen auf ganz anderen Wegen zustande kommen, als dies das Rationalitätsparadigma der strategischen Planung unterstellt. Eben diese Erfahrungen waren es letztendlich auch, die den prozessorientierten Forschungen enormen Auftrieb gegeben haben (beispielhaft für diese Richtung Mintzberg/Quinn/Ghoshal 1998 oder auch Brown/Eisenhardt 1998).
Am Ende war in diesem Zeitraum das Wirtschaftssystem als Ganzes, vor allem ganz bestimmte Branchen und in ihnen die beteiligten Unternehmen in eine Veränderungsdynamik geraten, die es immer weniger sinnvoll erscheinen ließ, zur eigenen Zukunftsbewältigung auf die Konzepte des klassischen strategischen Managements zurückzugreifen. Die Grundannahmen dieser Denktradition erwiesen sich für den Komplexitätsgrad, der mit der rapide zunehmenden Globalisierungsdynamik und den Veränderungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien stimuliert worden ist, als nicht mehr passend. (Mit diesem dramatisch veränderten Komplexitätsniveau und seinen Konsequenzen für die Steuerung von Unternehmen setzen sich vor allem auseinander: Brown/Eisenhardt 1997, Stacey 2000 und Burgelman 2002).
Dominanz produktivitätsorientierter Managementkonzepte
Ein verschärfter Wettbewerb in weitgehend gesättigten Märkten hat am Beginn der 1990er-Jahre den Fokus der Unternehmensführung überwiegend auf kurzfristige Produktivitätsgewinne gelenkt. Aus dieser Ecke wuchs dann der Druck auf die etablierten Organisations- und Führungsstrukturen vor allem jener größeren Unternehmen, die über lange Zeit funktional gegliedert mit schnell gewachsenen Stabsbereichen, vielen Führungsebenen und hierarisch-bürokratischen Koordinationsmechanismen versucht hatten, den wachsenden Herausforderungen am Markt gerecht zu werden. Diese jahrzehntelang äußerst stabilen Organisationsprinzipien sind in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne einer neuen, wesentlich flexibleren, aber auch komplexeren Organisationsarchitektur gewichen. Dementsprechend hat in den 1990er-Jahren das Problem der Organisationstransformation die professionelle Aufmerksamkeit des Managements stark dominiert. Fragen der Strategieentwicklung waren in den Hintergrund getreten (Porter hat diese Aufmerksamkeitsverschiebung eingehend kritisiert und sie für die Wettbewerbsintensivierung mitverantwortlich gemacht; ders. 1996). Tatsächlich konnten ganz erstaunliche Produktivitätsgewinne erzielt werden, nicht zuletzt deshalb, weil der rapide technologische Wandel bei den Informations- und Kommunikationstechnologien diese Entwicklungen enorm begünstigte.
Viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum haben in diesem Zusammenhang ihre Hausaufgaben weit besser erledigt, als dies so manche am Beginn dieser Transformationsperiode prognostiziert hatten:
Das Internationalisierungsniveau hat in der Zwischenzeit deutlich zugenommen.
Die Dichte der weltweiten Vernetzung ist mit dem Stand von der ersten Hälfte der 1990er-Jahre überhaupt nicht zu vergleichen.
Die Optimierung der Kernprozesse aus der Perspektive der Kunden wurde vorangetrieben. Erhebliche Produktivitätssprünge waren vielfach mit einer durchgängigen Prozessorientierung in den organisationsinternen Kooperationsbeziehungen realisierbar.
Die Dezentralisierung unternehmerischer Verantwortung ist in vielen Unternehmen zur Normalität geworden.
Die Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen sowie die Kooperation in Unternehmensnetzwerken entlang der Wertschöpfungskette waren weitere Ansatzpunkte für entscheidende Produktivitätsgewinne.
All diese Elemente zählen heute zum Standardrepertoire der Organisationsgestaltung und der Unternehmenssteuerung (vgl. dazu im Einzelnen Wimmer 2004) und sorgen dafür, dass die Effizienzorientierung in allen Bereichen der Organisation aufrecht bleibt. Alle sind mit großer Anstrengung darum bemüht, immer perfekter darin zu werden, die Dinge richtig zu machen. Aber sind die Unternehmen immer auch mit den richtigen Dingen befasst, um eine berühmte Unterscheidung von Peter Drucker aufzugreifen? Darauf tragfähige Antworten zu finden, ist in der jüngsten Geschichte allerdings immer schwieriger geworden.
Neue Herausforderungen für die Überlebenssicherung von Unternehmen
Gerade die schwere Krise der globalen Finanzmärkte und deren Konsequenzen für die Realwirtschaft, die Ende 2008 unübersehbar geworden sind, führen uns vor Augen, dass trotz unleugbarer Erfolge in der Zunahme an Produktivität die zentralen Probleme der Überlebenssicherung von Unternehmen erhalten geblieben, und ganz neue dazugekommen sind:
Der hohe Druck auf die Produktivitätsentwicklung hat sich durch die Wettbewerbsdynamik gegenüber früher eher noch verstärkt.
Das Veränderungstempo in den Umwelten von Unternehmen hält sein hohes und sich beschleunigendes Niveau. Der weitere gesellschaftliche Kontext und seine schwerwiegenden Veränderungsthemen (massive Verschiebungen in den weltpolitischen Machtkonstellationen, sich verschärfende Engpässe in der Rohstoffversorgung, neue politische Konfliktfelder und Formen der militärischen Auseinandersetzung, unleugbare ökologische Risiken – Stichwort Klimawandel, kaum revidierbare demografische Verschiebungen, sich weiter verschärfende Migrations- und soziale Integrationsprobleme, die Grenzen der Finanzierbarkeit eines weiteren Ausbaus der sozialen Sicherungssysteme, die großen Herausforderungen, vor denen unsere Bildungssystem steht, etc.) haben für die Zukunftsbewältigung von Unternehmen enorm an Bedeutung gewonnen (dies betont Peter Drucker nachdrücklich in einem seiner letzten Bücher; ders. 2002. Ähnlich auch Vaupel 2008). Wir stehen deshalb vor der Notwendigkeit, uns mit dem Thema Wachstum auf eine ganz neue Weise auseinander setzen zu müssen. Der wirtschaftswissenschaftliche Mainstream geht nach wie vor ungebrochen davon aus, dass unsere wirtschaftlichen wie auch die politischen Verhältnisse nicht ohne ein permanentes Wirtschaftswachstum auskommen werden. Kann diese Grundüberzeugung angesichts der Endlichkeit verfügbarer Ressourcen und angesichts der näher rückenden ökologischen Belastungsgrenzen für die Zukunft auch aufrecht erhalten werden? (vgl. etwa Santarius 2012 oder Jackson 2011). Die Themen der Nachhaltigkeit werden wohl von der Strategieagenda von Unternehmen nicht mehr verschwinden.
Die ungebrochen turbulente Entwicklung in den Märkten insgesamt wie in den einzelnen Branchen, zumeist angestoßen durch technologische Innovationen, macht einigermaßen verlässliche Prognosen schier unmöglich.
Früher stabile Branchengrenzen werden immer durchlässiger. Dies macht es zusehends schwieriger, Wettbewerbsdynamiken verlässlich einzuschätzen.
Die durch die fortschreitende weltweite Vernetzung organisationsintern gestiegene Komplexität macht Unternehmen schon wegen ihrer kulturellen Vielfalt und aufgabenbezogenen Heterogenität kaum mehr in den tradierten Bahnen steuerbar.
Die stärkere Koppelung der Unternehmen (vor allem der börsennotierten) an die Eigendynamik des Kapitalmarktes schafft neuartige Zielkonflikte zwischen der konsequenten Ausrichtung am Shareholder-Value und den längerfristigen Überlebensinteressen der Unternehmen.
Die konsequente Umsetzung der Regeln zur Unternehmensfinanzierung, wie sie der neue Baseler Akkord (Basel II und Basel III) vorsieht – ein Prozess, der durch eine wesentlich restriktivere Risikopolitik der Banken noch verschärft wird, wird die bisherigen Finanzierungsmöglichkeiten von eigentümergeführten Unternehmen grundlegend auf den Kopf stellen (vgl. dazu die Studie Wimmer 2013).
Die Internetrevolution schreitet voran und schafft beispielsweise ganz neue Zugangsmöglichkeiten für die Kunden, auch wenn die seinerzeit so hohen Erwartungen in die außerordentlichen Ertragspotenziale der sogenannten New Economy wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen sind. Der »Point of Sale« verlagert sich zusehends ins Netz, ein Prozess, der die vertrieblichen Konzepte in vielen Branchen gerade extrem fordert.
Die ungebremste Fusionswelle hat zwar mit den schweren Verwerfungen auf den Finanzmärkten im Verlauf des Jahres 2008 eine heftige Abschwächung erfahren, trotzdem wird das Geschäft mit Unternehmen, das Kaufen und Verkaufen derselben ungeachtet aller destruktiven Folgen in der Postmergerphase weiter blühen. Die heutige Wettbewerbsdynamik erzwingt in vielen Branchen weitere Konsolidierungsschritte.
Die geschilderten Phänomene stimulieren die Suche nach neuen Orientierungsmustern für die Steuerung von Unternehmen, die ihre Eigenkomplexität offensichtlich immer weiter steigern, um den veränderten Umweltgegebenheiten gewachsen zu sein.
Die dominanten Managementleitbilder der vergangenen zwei Jahrzehnete haben ihre Orientierungskraft allerdings weitgehend eingebüßt. Denn viele ihrer Grundgedanken sind längst zur Routine geworden.
Renaissance der Strategie?
Das Thema Strategie besitzt hingegen wieder Konjunktur. Ist eine Renaissance der klassischen Antworten zu erwarten? In manchen Unternehmen ja. Überall dort, wo man glaubt, gerade in unsicheren Phasen die eigene Autorität als Entscheidungsträger durch den Rückgriff auf externe, durch besondere Reputation unterfütterte Expertise stützen zu müssen, dort werden die aus der Tradition bekannten Muster des strategischen Managements wieder verstärkt zur Geltung kommen. Ihre innerbetriebliche Orientierungskraft wird stark davon abhängen, wie sehr alle Beteiligten an die Basisannahmen dieser Tradition und an die darin eingebauten Versprechen der Unsicherheitsbewältigung glauben (Berechenbarkeit, Planbarkeit, Trivialisierung der Organisation). Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen für das erfolgreiche Operieren von Unternehmen und der damit verbundenen oft schmerzhaften Erfahrungen ist der Glaube an dieses Muster im Umgang mit hoher Unsicherheit und Komplexität allerdings stark im Erodieren begriffen. Der Kreis jener Entscheidungsträger in Management und Beratung wird größer, die den alten Antworten und Gewissheiten misstrauen. Ihnen ist dieses Buch gewidmet.
Die Innovation des systemischen Strategieverständnisses
Eine Abkehr von traditionellen Grundüberzeugungen
»Der Abschied vom Ideal der plandeterminierten Unternehmenssteuerung« (Schreyögg 1999b, S. 389) impliziert auch die Abkehr von drei zentralen Grundüberzeugungen, auf denen die Denkwerkzeuge und Vorgehensprinzipien aller präskriptiv ausgerichteten Schulen des strategischen Managements fußen. Gemeint ist damit:
Die Umwelt von Unternehmen ist nicht durchschaubar
Die Intransparenz der Umwelt ist prinzipiell nicht überwindbar. Mit dieser Einsicht relativieren sich alle Versuche, mit analytischer Präzision dem Umweltgeschehen Gesetzmäßigkeiten zu entlocken, an denen sich Unternehmen mit einiger Sicherheit ausrichten können. »Das Konzept stabiler Markt- und Branchenstrukturen, wie es der Industrieökonomik als empirische Annahme zugrunde liegt«, verliert damit seine Halt gebende Funktion (Schreyögg 1999b, S. 392). Mit dieser Einsicht wird auch das Fundament für die Formulierung von »generischen« Strategien, von »Normstrategien« nachhaltig erschüttert. Verliert die Annahme, man könne als Unternehmen die Dynamik seiner relevanten Umwelten mit analytischen Mitteln »objektiv« durchdringen, an Plausibilität, dann gilt es, die Art und Weise, wie sich Unternehmen ein Bild von ihrer Umweltentwicklung machen, und warum sie dies tun auf eine neue Grundlage zu stellen.
Die Zukunft ist und bleibt ungewiss
Die jeweils eigene Zukunft kann nicht als berechenbar vorausgesetzt werden. Trotz ungebrochener Sehnsucht nach verlässlichen Prognosen hat diese These gerade durch die jüngsten Erfahrungen viel an Plausibilität gewonnen. Unternehmen legen sich in ihren Entscheidungen immer wieder auf eine Zukunft fest, die sie nicht kennen können. Diesem Dilemma kann man im Grunde nicht entkommen. Diese Ungewissheit ist letztlich jene Ressource, aus der unternehmerisches Handeln und die dazugehörige Verantwortungs- und Risikoübernahme ihren Sinn gewinnt. Organisationen im Allgemeinen und Unternehmen im Speziellen befinden sich in einem Dauerzustand der Unsicherheit über sich selbst im Verhältnis zu ihrer Umwelt wie hinsichtlich der künftigen Bedingungen ihres Überlebens. Sie nutzen diesen Zustand der Unruhe für ihre Selbstorganisation des Anknüpfens von Entscheidungen an Entscheidungen, die jeweils nur für eine ganz bestimmte Situation Unsicherheit absorbieren, um auf dieser Basis weitere Schritte der Unsicherheitsbewältigung aufsetzen zu können. »Die Prämisse von Organisation ist das Unbekanntsein von Zukunft und der Erfolg der Organisation liegt in der Behandlung dieser Ungewissheit« (Luhmann 2000, S. 10).
Akzeptiert man diese Grundherausforderung unternehmerischen Handelns, dann wird Strategieentwicklung zu jener Führungsdimension, die mit diesem nicht auflösbaren Widerspruch einen gezielten Umgang finden muss. Das heißt aber, sich von allen Vorstellungen an eine exakte Kalkulierbarkeit künftiger Entwicklungen zu verabschieden. Strategische Festlegungen operieren notgedrungen mit einem hohen Anteil an Nichtwissen. Sie sind folglich immer riskant. Denn ihre Grundlagen lassen sich ungeachtet des hohen analytischen Aufwandes nicht wirklich errechnen. Strategiefindung ist kein logisches Ableiten der eigenen Position aus intelligent durchschauten Gesetzmäßigkeiten des Marktes und der eigenen Branche.
Das Unternehmen als komplexes soziales Gefüge ist keine triviale Maschine
Organisationen lassen sich nicht einfach so umbauen und verändern, wie manche Strategiepläne nach dem Willen ihrer Architekten es sich so vorstellen. Sie folgen keiner ingenieurmäßigen, technischen Logik. Es handelt sich dabei nicht um Maschinen, sondern stets um hochkomplexe, eigensinnige, lebendige, soziale Einheiten, die ihren historisch gewachsenen Erfolgsmustern folgen. In ihrer Entwicklung gehorchen sie ihrer eigenen, »selbstkomponierten« Melodie und sind in diesem Sinne unweigerlich pfadabhängig. Diese eingespielten Selbstorganisationsmuster sind letztlich dafür ausschlaggebend, wie Veränderungsimpulse – woher sie auch immer kommen mögen – unternehmensintern verarbeitet werden. Die eingehende Beobachtung von Organisationen lehrt uns heute, ihnen einen wesentlich höheren Grad an Eigenständigkeit zu attestieren und sie nicht als durch einen externen Willen direkt steuerbar anzusehen (zu diesem für unser Strategieverständnis grundlegenden Organisationsbegriff vgl. neben Luhmann 2000 vor allem die Arbeiten von Baecker 1993, 1999a und 2003 sowie von Willke 1998 und 1999 und Wimmer 2012). In diesem Sinne ist die Vorstellung von Organisationen als einem willfährigen Instrument in der Hand von Strategen eine verführerische Vereinfachung, die den komplexen Zusammenhang zwischen dem Prozess der Strategiefindung in Unternehmen und deren Umgestaltung allzuleicht übersieht.
Dieser blinde Fleck verstellt den Zugang zur zentralen Einsicht, dass die strategische Neuorientierung und der Prozess ihrer Realisierung äußerst eng miteinander verzahnte Abläufe sind, die auf dieselben strukturellen Gegebenheiten zurückgreifen und sich deshalb nicht in ein triviales zeitliches Nacheinander aufspalten lassen. Die Weichen für die Umsetzung werden bereits sehr früh bei der Erarbeitung gestellt, vor allem durch die gewählte Form der Strategiefindung. Der zugrunde liegende Prozess präjudiziert die Möglichkeiten und Grenzen der Implementierung. Berücksichtigt man diesen Grundgedanken, dann ist Strategie nicht mehr nur die Sache der Unternehmensspitze in Zusammenarbeit mit (externen) Experten, sondern eine Führungsaufgabe, an der unterschiedliche Funktionsträger auf verschiedenen Hierarchieebenen zu beteiligen sind. Strategiearbeit ist ureigenstes Führungsgeschäft der Linienverantwortlichen und kann nicht ohne erhebliche Folgekosten an interne oder externe Experten delegiert werden.
Der Abschied von jenen Steuerungsvorstellungen, die den klassischen Konzepten des strategischen Managements zugrunde liegen, hat sichtlich weitreichende Konsequenzen. Er impliziert in einigen wichtigen Dimensionen den Umbau unserer mentalen Modelle hinsichtlich der Art und Weise, wie wir Unternehmen als soziale Systeme konzipieren, wie Unternehmen ihr Verhältnis zu ihren relevanten Umwelten gestalten, wie sie ihr Festgelegtsein aus der Vergangenheit aufbrechen und sich letztlich von einer selbstgewählten Zukunft aus führbar machen (ausführlicher dazu Wimmer 2009 und 2012). Einige dieser Aspekte seien in dieser Einleitung bereits angedeutet, um zu verdeutlichen, warum dieses Buch seine aktuell anzutreffende Form gewonnen hat und mit welchen Denkkonzepten es sich an das Problem der Zukunftsbewältigung von Unternehmen annähert.
Die Wiedereinführung des »Unternehmerischen« in die Strategieentwicklung
Worauf können sich Entscheidungsträger stützen, wenn sie sich in ihren strategischen Festlegungen von Vorstellungen der Planbarkeit, der Kalkulierbarkeit von Entwicklungen, der Beherrschbarkeit von Prozessen trennen? Hat dies zur Konsequenz, einfach mit den wirtschaftlichen und sozialen Geschehnissen des eigenen Umfeldes zeitnah mitzuschwingen und auf jede Form einer gezielten vorausschauenden Zukunftsgestaltung zu verzichten? Dies würde bedeuten, in der Gestaltung des Unternehmens in erster Linie auf seine Lernfähigkeit zu setzen und darauf zu vertrauen, dass die kollektive Kompetenz wächst, »das Unerwartete zu managen« (Weick/Sutcliffe 2003). In der aktuellen Strategiedebatte gibt es durchaus Tendenzen, die Aufgabe der Strategiefindung mit der Problematik des organisationalen Wandels zu verschmelzen (dazu Schreyögg 1999b, Müller-Stewens/Lechner 2005 sowie Seidl/Kirsch/Linder 2005).
Es gibt jedoch gute Gründe, dies nicht zu tun. Voraussetzung dafür ist allerdings der Rückgriff auf in der Vergangenheit bereits durchaus bewährte Prinzipien des Unternehmertums (die Grundmuster erfolgreicher Enterpreneure vor allem in der Gründungsphase untersucht Amar Bhidé in einer eindrucksvollen Studie, ders. 2000). Was ist damit gemeint?
Erfolgreiche Unternehmer entdecken in ihrem Umfeld Lücken, Bedürfnisse, Problemstellungen, für die im eingespielten Leistungsspektrum von Unternehmen bislang keine adäquaten Antworten gefunden wurden. Das heißt, sie sehen etwas, das sich dem Auge sonst entzieht, und sind in der Lage, überraschende Lösungen anzubieten (vielfach verbunden auch mit technischen Innovationen), die eine entdeckte Lücke schließen. Enterpreneure nutzen somit ein ökonomisches Ungleichgewicht für ihre gestalterischen Ideen und stoßen damit häufig den berühmten Schumpeterschen Prozess der kreativen Zerstörung an (Schumpeter 1926 und 1928). Worauf immer diese Fähigkeit zurückgeführt werden kann (auf Intuition, auf das berühmte unternehmerische Gespür etc.), die spezifische Leistung besteht darin, den blinden Fleck eingespielter Normalität zu nutzen und genau dort Chancen zu entdecken, wo andere bislang nicht hingesehen haben (zum Verständnis von Intuition in solchen Entscheidungszusammenhängen vgl. die interessante Arbeit von Gigerenzer 2007 sowie neuerdings ders. 2013). Genau betrachtet wird damit ein ganz spezifischer Umgang mit der Undurchschaubarkeit von Marktzusammenhängen und der Nichtberechenbarkeit künftiger Entwicklungen gewählt. Ungewissheit wird nicht als bedauerliches Problem gesehen, das es eigentlich zu eliminieren gilt. Im Gegenteil: Sie ist die Quelle allen unternehmerischen Tuns, sie hält ein Chancenpotenzial bereit, aus dem Unternehmen die erfolgreiche Fortsetzung der eigenen Existenz als Unternehmen gewinnen, wenn die verantwortlichen Entscheidungsträger die damit verbundenen Risiken auf eine kontrollierte Art zu übernehmen bereit sind. Strategieentwicklung so gesehen verschafft dem »Unternehmerischen« im Prozess der strategischen Positionierung wiederum seinen angemessenen Platz, ohne zur leeren Worthülse im Anforderungsprofil von Führungskräften zu verkommen.
Die Ungewissheit in Gewissheit verwandeln
Diese Umdeutung des Stellenwerts von Ungewissheit wird durch eine zentrale organisationstheoretische Einsicht gestützt. Organisationen zählen zu jenem Typus sozialer Systeme, die geradezu darauf spezialisiert sind, ihr Festgelegtsein durch die Vergangenheit bzw. durch ganz bestimmte, eingerastete Zukunftsvorstellungen zu unterbrechen. Sie bedienen sich dafür der Möglichkeit des Entscheidens. Organisationen produzieren in jedem Moment Situationen, in denen die Dinge anders gemacht werden können als bislang. Die Gegenwart ist damit potenziell in jedem Moment der Beginn einer neuen Geschichte. Das Verpassen dieser Chance für Weichenstellungen zählt zu den Todsünden in Organisationen. Diese können natürlich immer erst im Nachhinein festgestellt werden, also retrospektiv, wenn die Zukunft bereits Vergangenheit geworden ist. Durch das Entscheidenkönnen wird die Vergangenheit ihrer Bestimmtheit beraubt. Bislang Bewährtes legt nicht mehr fest, und die Zukunft verliert ihr Unbestimmtsein. Man will ja in Abgrenzung zum Bisherigen etwas Bestimmtes erreichen. Organisationen leben gleichsam von dieser Form der eigenen Reproduktion. Sie sind dazu da, im Prozess des Entscheidens Ungewissheit in Gewissheit zu verwandeln, um auf der Basis dieser selbstgeschaffenen Orientierung die eigene Handlungsfähigkeit im Sinne eines stetigen Sich-Ermöglichens neuer Freiheitsgrade immer wieder zu erneuern (zu dieser Fähigkeit von Organsationen, die Wirkungsrichtung des eigenen Festgelegtseins von der Vergangenheit auf Zukunft umzupolen, vgl. insbesondere Luhmann 2000).
Strategieentwicklung ist nichts anderes als die konsequente Systematisierung dieses Grundsachverhaltes. Sie bringt jene Entscheidungsprämissen hervor und sorgt gleichzeitig für ihre Korrekturfähigkeit, die Unternehmen brauchen, um im alltäglichen Vollzug ihrer Leistungsprozesse nicht ständig ungelöste Grundsatzfragen über ihre geschäftspolitische Ausrichtung und die damit verfolgten Ziele mitbearbeiten zu müssen.
Dabei muss man sich im Klaren sein, dass die Grundlagen für diese Entscheidungsprämissen in zweifacher Weise aus einer prinzipiell nicht versiegenden Quelle der Unsicherheit gewonnen werden müssen. Sowohl die Orientierung in der Sache (mit welchem Leistungsangebot wollen wir in einem nicht wirklich durchschaubaren Marktgeschehen reüssieren?) als auch die Orientierung in der Zeit (wie werden sich die für unser erfolgreiches Überleben entscheidenden Parameter in der Zukunft entwickeln?) gilt es auf dem gemeinsamen Nenner des Nichtwissens zustande zu bringen. Diese beiden Dimensionen (Umwelt und Zukunft), an denen sich jeder Strategieprozess abarbeiten muss, treten heute zueinander hinsichtlich ihres Ungewissheitspotenzials in ein seltsames Steigerungsverhältnis. Wir erleben sowohl die aktuelle Dynamik in den für unsere Unternehmen relevanten Umwelten als zunehmend turbulenter und unkalkulierbarer als auch die Frage, wohin uns die gemeinsame Reise in die Zukunft letztlich führen wird, als immer schwerer zu prognostizieren. Genau diese Grunderfahrung eines wechselseitigen Steigerungsverhältnisses von Quellen des Nichtwissens macht Strategieentwicklung heute weniger zu einem Problem des Errechnens richtiger Lösungen, sondern zu einer Frage des kreativen Erfindens einer attraktiven Zukunftsperspektive, die nur durch die Übernahme eines erheblichen unternehmerischen Risikos zu gewinnen ist. Der Schaffungsprozess einer erstrebenswerten geschäftspolitischen Identität, auf die ein Unternehmen sich künftig hinentwickeln will, fußt wie gesagt auf einem subtilen Wissen im Umgang mit Nichtwissen, ein Umgang, der aus unserer Sicht den eigentlichen Kern des Unternehmerischen ausmacht. Damit plädieren wir in der berühmten Gegegenüberstellung des tieferen Sinns von Strategie von »fit« einerseits (im Sinne einer Passung von Unternehmen und Marktdynamik) und »stretch« andererseits im Sinne einer Dehnung seines Leistungsvermögens auf ein attraktives Zukunftsbild hin unmissverständlich für letzteres (in enger Anlehnung an die Position von Hamel/Prahalad 1997).
Unternehmer waren immer schon Experten im Umgang mit Nichtwissen. Deswegen legen wir so viel Wert darauf zu betonen, dass Strategieentwicklung als Führungsdimension die konsequente Wiedereinführung des Unternehmerischen ins Unternehmen bedeutet und nicht dessen Eliminierung, wie dies die Denkansätze des tradierten strategischen Managements nahelegten, weil der Aspekt des Unternehmerischen im Rationalitätsparadigma nicht wirklich unterzubringen ist.
Die Zukunft kreativ selbst erschaffen
Geht man mit dieser Umdeutung der Funktion von Ungewissheit an das Problem der Zukunftsbewältigung heran, dann ändert sich auch die Art und Weise, wie ein Unternehmen sein eigenes Verhältnis zu seinen relevanten Umwelten definiert. Während man früher eher danach trachtete, Strategieentwicklung dafür zu nutzen, Unternehmen besser an gegebene Umweltbedingungen anzupassen, so hat sich in der Zwischenzeit die Betrachtungsweise eher umgekehrt. Nicht die Angepasstesten überleben, sondern diejenigen, denen es gelungen ist, sich in wichtigen Leistungsdimensionen eine Einmaligkeitsstellung zu erobern, jene also, die aktiv ihren eigenen Markt mit hervorgebracht haben und dessen Entwicklung und Spielregeln entscheidend mitprägen. Hinter diesem Perspektivenwechsel steht die Einsicht, dass Unternehmen durch ihre eigenen geschäftlichen Aktivitäten die für sie relevanten Umwelten mithervorbringen. Sie schaffen sich im täglichen Austausch mit den Kunden, Lieferanten und anderen Systempartnern ein ganz bestimmtes Markenimage, im Sinne von stabilen Erwartungsstrukturen, die sie durch ihr Weitertun entweder bestärken und weiter aufladen oder beschädigen. Was dadurch entsteht, ist immer eine Umwelt bezogen auf ein ganz bestimmtes Unternehmen. Beide Seiten der Unterscheidung erzeugen sich wechselseitig. Unternehmen prägen daher im Laufe ihrer Existenz in ihrem Inneren Strukturen und Routinen aus, sie bauen Fähigkeitspotenziale auf (organisational capabilities), die diesen aktiven Auseinandersetzungsprozess mit den für ihr Überleben wichtigen Umwelten widerspiegeln. Diesen wechselseitigen Hervorbringungsprozess von System und Umwelt kann man ausschließlich seiner eigentümlichen evolutionären Dynamik überlassen oder in einem gewissen Rahmen gezielt gestalten. Letzteres ist heutzutage der eigentliche Gegenstand von Strategieentwicklung (eine ähnliche Position vertreten auch Roberts 2004 sowie Doz/Kosonen 2008. Einen ausgesprochen kreativen Rahmen für dieses kollektive Selbsterfinden aus der Perspektive der Zukunft bieten neuerdings auch Scharmer, Kaufer 2013).
Strategieentwicklung als Rahmen für den Selbsterschaffungsprozess
Strategieentwicklung dient aus unserer Sicht dazu, diesem ständigen Selbsterschaffungsprozess einen bewussten Rahmen zu setzen. Sie ist der Ort, an dem der eingeschwungene Zustand eines Unternehmens in seinem Verhältnis von Innen und Außen angesichts erwartbarer Veränderungen in den relevanten Umwelten und den damit verbundenen Chancen und Risiken auf den Prüfstand gestellt wird. Vor dem Hintergrund dieses gründlichen Prüfungsprozesses kommen Unternehmen zu ganz bestimmten Festlegungen ihrer eigenen Identität sowie der dazu passenden Entwicklungsziele, mit deren Hilfe die angestrebte Zukunft erreicht werden soll. In der Regel sind dies Festlegungen, die einen deutlichen Unterschied zum aktuell realisierten Entwicklungsstand eines Unternehmens bedeuten. Strategien schaffen damit bewusst Differenzen. Sie unterscheiden den aktiv angestrebten Zukunftsentwurf von sich selbst gegenüber dem, was andernfalls ohne eine solche gemeinsame Weiterentwicklungsanstrengung einträte. Genau dieses aktive Anstreben einer selbstgewählten künftigen Identität, die den aktuellen Zustand eines Unternehmens unter Veränderungsdruck bringt, macht den entscheidenden Unterschied aus zu eher evolutionären Strategiekonzepten, die dazu tendieren, dezentral bereits bewährte Innovationen im Nachhinein als Strategie zu verkünden. Nur das gezielte Aufmachen der angesprochenen Differenzen kann innerhalb des Unternehmens der Ausgangspunkt eines in der Gegenwart eingeleiteten Selbstveränderungsprozesses sein, der genau jene unternehmensinternen Strukturen, Prozesse und Leistungspotenziale weiterentwickelt, die die Realisierung der angestrebten künftigen Identität ermöglichen. Strategieentwicklung ist demnach jener bewusst gestaltete Managementprozess, der den Spannungsbogen zwischen gegenwärtig realisierter und künftig angestrebter Identität immer wieder von Neuem erzeugt und damit rund um das in der Realität gelebte Businessmodell die Lernfähigkeit des Unternehmens sicherstellt. In diesem Sinne ist Strategiefindung keine einmalige Angelegenheit, angesichts deren Ergebnisse man sich auf Jahre hinaus wiederum ausschließlich den operativen Fragen widmen kann. Sie ist eine Systemfähigkeit im Sinne einer personenunabhängigen »organizational capability« (zu diesem Begriff vgl. Schreyögg/Kliesch-Eberl 2008), die dem Management routinemäßig zur Verfügung steht.
Periodische Anlässe zur Selbstreflexion
Das Aufspannen von grundlegenden Differenzen durch im System verankerte strategische Festlegungen besitzt darüber hinaus noch eine weitere Funktion. In Strategieentwicklungsprozessen geht es unter anderem auch darum, ein Unternehmen zur expliziten Profilierung von Erwartungshorizonten bzw. zu periodischen Korrekturen derselben zu befähigen. Denn nur an Erwartungen bzw. an daran geknüpfte Ziele und an deren Bestätigung bzw. Enttäuschung kann die eigene Situation eingebettet in eine komplexe Umwelt abgelesen werden. Das heißt, im Prozess der Strategieentwicklung werden erst jene Sehwerkzeuge geschaffen, die die eigene Entwicklung in einer nicht kalkulierbaren Umwelt beobachtbar machen. Mit dem Erarbeiten ausgereifter Vorstellungen, in welche Richtung ein Unternehmen sich hineinentwickeln will, verschafft es sich ausreichend sensible Antennen für Unerwartetes, für überraschende Neuentwicklungen, für plötzliche Brüche. Das impliziert auch die Fähigkeit des Wartenkönnens auf günstige Gelegenheiten. Nur darüber wird ein System feinfühlig genug für zufällige Ereignisse von strategierelevanter Bedeutung. Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit solcher Sehwerkzeuge ist allerdings, dass die getroffenen strategischen Festlegungen in das Selbstbeobachtungsprogramm für das operative Geschehen (z. B. in die Zielvereinbarungsprozesse, in die Balanced Scorecard etc.) eines Unternehmens konsequent mitaufgenommen werden. Ist dies der Fall, dann versorgt sich ein Unternehmen mit jenem Wissen, mit dessen Hilfe es entscheiden kann, welchen beobachteten Umweltentwicklungen es letztlich Sinn verleihen will und welchen nicht.
Das Ergebnis eines gelungenen Strategieentwicklungsprozesses besteht folglich sowohl in der Neudefinition des eigenen Existenzgrundes als Unternehmen (weswegen gibt es uns? Welche Kundenprobleme lösen wir?) als auch der angestrebten Ziele (Ertrags- und Wachstumsziele) letztlich auch in der Festlegung der wichtigsten Schritte auf dem Weg dorthin (Produktpolitik, Kooperationen, Markenpolitik, neue Geschäftsfelder, etc.). Eine gut geführte Auseinandersetzung über die brennenden Strategiefragen, die die wesentlichen Schlüsselspieler gezielt einbindet, lässt eine einheitstiftende Vorstellung davon entstehen, wie man als Unternehmen in einer ungewissen Zukunft bestehen kann. Es wird das Unternehmen mit gemeinsam getragenen Bildern einer attraktiven Zukunft ausgestattet, auf die mit Engagement und Energie hinzuarbeiten allen Beteiligten Sinn macht (»enacted future«, vgl. dazu auch Ortmann 2010, S. 30). In diesem Sinne erzeugen solche Prozesse die zentralen geschäftspolitischen Entscheidungsprämissen, die ein Unternehmen braucht, um bei allen Unwägbarkeiten des Alltags eine sinnstiftende Fokussierung aufrechterhalten zu können. So entsteht Nachhaltigkeit in der eigenen Entwicklung. Gleichzeitig gilt es aber, genau diese Entscheidungsprämissen in periodischen Abständen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und sie angesichts beobachteter Veränderungen revisionsfähig zu halten. Versteht man Strategieentwicklung in dem hier explizierten Sinne, dann ist klar, dass es sich dabei nicht um eine anlassbezogene Veranstaltung von Experten handeln kann. Ziel muss es sein, einen hierarchieübergreifenden Managementprozess zu bauen, der in der Lage ist, die angesprochenen Orientierungsleistungen kontinuierlich hervorzubringen und sie organisch mit den Führungsprozessen des operativen Geschäfts zu verzahnen.
Die Strategieentwicklung als zentraler Hebel für die Lernfähigkeit eines Unternehmens
Diese Art von Strategieentwicklung ist der Kernbaustein dessen, was wir mit der Lernfähigkeit von Organisationen meinen (dazu ausführlicher Wimmer 2007). Sie mobilisiert rund um die Existenzfragen des Unternehmens immer wieder Entscheidungsnotwendigkeiten zur Bearbeitung der Differenz Lernen oder Nichtlernen als Organisation:
In welchen Punkten halten wir an bislang Bewährtem fest, auch wenn es den einen oder anderen Hinweis auf Veränderungsnotwendigkeiten gibt?
In welchen Dimensionen wollen wir uns jedoch ernsthaft verändern, um uns auf das angestrebte Zukunftsbild konsequent hinzuentwickeln und um für neue Herausforderungen in unseren relevanten Umwelten antwortfähig zu bleiben?
Diese Art von Lernfähigkeit hält die Spannung zwischen einer Ausrichtung an den aktuellen Erfolgsbedingungen und denen, die man für die Zukunft erwartet, aufrecht. Das Lebendighalten dieses Spannungsbogens sorgt sowohl für die Vertiefung der bereits entwickelten als auch für den gezielten Aufbau neuer Kernkompetenzen.
Vor dem Hintergrund des hier in einer ersten Annäherung skizzierten Strategieverständnisses ist der Aufbau des vorliegenden Buches zu verstehen.
Zum Aufbau dieses Buches
Wie bereits ausgeführt, richten sich diese Ausführungen an Berater und an Entscheider, eine Lesergruppe, der wir sowohl praktische Anregungen für die konkrete Strategieentwicklung als auch eine theoretische Fundierung ihrer Strategiearbeit anbieten möchten.
Es liegt auf der Hand, dass für diese Leser ein Buch über ein neuartiges Prozessmuster der Strategieentwicklung kein triviales Vorhaben sein kann. Mehrere Ebenen mussten miteinander verwoben werden.
Eine Orientierung in der aktuellen Strategiediskussion
Die Disziplin der Strategie ist dadurch gekennzeichnet, dass eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Publikationen zu diesem Thema vorzufinden ist. Die Stellung des strategischen Managements als »Königsdisziplin des Managements« bringt es mit sich, dass viele Autoren sowohl aus dem Wissenschaftssystem als auch aus der Beraterzunft ihre Beiträge zur Weiterentwicklung dieser Disziplin leisten. Es handelt sich dabei um Konzepte, die in sehr unterschiedlicher Qualität und auf sehr unterschiedlichen Abstraktionsebenen Impulse zu diesem zentralen Managementthema geben.
Auch wenn wir Strategieentwicklung für eine höchst individuelle Systemleistung halten, erscheint es uns schon aus Diagnosezwecken sinnvoll, diesbezüglich nach Grundmustern der unterschiedlichen praktischen und theoretischen Herangehensweise zu suchen. Im ersten Hauptkapitel »Die Spielarten der Strategieentwicklung« versuchen wir eine Orientierung über die verschiedenen theoretischen und praktischen Zugänge zur Strategiedebatte aus unserer Sicht zu leisten. Denn trotz der unbestrittenen Vielfalt möglicher Zugänge lassen sich unserer Beobachtung einige unterscheidbare Grundtypen der Bewältigung von Zukunftsfragen erkennen, die ihre jeweiligen ganz spezifischen Vor- und Nachteile aufweisen. Wir wählen hier bewusst eine deskriptive Herangehensweise, die sich in die Tradition der Prozessforschung eingebettet sieht und das Erkenntnisinteresse und die Neugierde der Bewegung »Strategy as Practice« teilt (dazu Johnson/Langley/Melin/Whittington 2007).
Konzeption des Prozessmusters der systemischen Strategieentwicklung
Wie vorher ausgeführt, zeigt sich, dass viele dieser strategischen Prozessmuster angesichts der beschriebenen einschneidenden Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld seit den späten 1980er-Jahren der aktuellen Steuerungsproblematik in den Unternehmen nicht mehr entsprechen. Eine schnelllebige Welt mit plötzlichen Brüchen scheinbar stabiler Marktkonstellationen erfordert auch neue Formen der Strategieentwicklung (ähnlich auch Doz/Kosonen 2008).