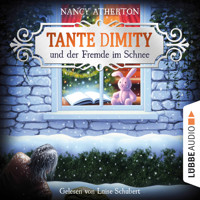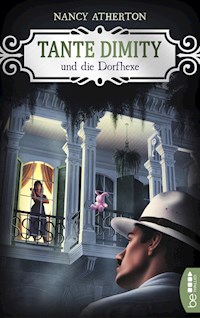7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Es ist Sommer und die Rosen stehen in voller Blüte - aber in Finch braut sich etwas Unheilvolles zusammen. Schon seit Monaten stehen mehrere Cottages leer und Lori Shepherd kann nicht verstehen, warum niemand in das beschauliche Dörfchen ziehen möchte. Verschreckt die Immobilienmaklerin absichtlich potenzielle Mieter? Und was hat der geheimnisvolle Arthur Hargreaves, der von allen nur der Sommerkönig genannt wird, damit zu tun? Zusammen mit Tante Dimity geht Lori den verdächtigen Machenschaften auf den Grund.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Harriets Schwarzweißgebäck.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Harriets Schwarzweißgebäck
Über dieses Buch
Es ist Sommer und die Rosen stehen in voller Blüte – aber in Finch braut sich etwas Unheilvolles zusammen. Schon seit Monaten stehen mehrere Cottages leer und Lori Shepherd kann nicht verstehen, warum niemand in das beschauliche Dörfchen ziehen möchte. Verschreckt die Immobilienmaklerin absichtlich potenzielle Mieter? Was hat der geheimnisvolle Arthur Hargreaves, der von allen nur der Sommerkönig genannt wird, damit zu tun? Zusammen mit Tante Dimity geht Lori den unrechten Machenschaften auf den Grund.
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Barbara Röhl
beTHRILLED
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Monika Köpfer
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez und Montreeboy
Illustration: © Ommo Wille
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3511-8
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the Summer King« bei Viking Penguin, a member of Penguin Group (USA) LLC, 2015.
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Nancy T. Atherton
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Chloë und Emma,die immer meine Kätzchen sein werden.
Kapitel 1
Jede Nebenstraße ist für jemanden die Hauptstraße. Ganz gleich, wie holprig oder entlegen sie ist, eine Straße führt immer irgendwo hin, und für irgendeinen Menschen ist dieser Ort sein Zuhause.
Ich wohnte an einer Nebenstraße, einer schmalen, gewundenen Gasse, die von Hecken, saftigen Wiesen und schattigen Wäldchen gesäumt war. Mein Heim war ein honigfarbenes Cottage in den Cotswolds, einer Landschaft mit wogenden Hügeln und einem Flickenteppich von Feldern in den englischen West Midlands, und meine kleine Straße wurde hauptsächlich von meiner Familie, meinen Freunden und meinen Nachbarn genutzt.
Dann und wann klopften verwirrte Fremde an meine Tür, um nach dem Weg zu fragen, kehrten dem Ort jedoch so schnell wieder den Rücken, wie sie gekommen waren. Sie hatten keinen Grund zu verweilen — keine Burg, keine Kathedrale, kein bronzezeitliches Hügelgrab und keine Strandpromenade zogen ihr Interesse auf sich. Abgesehen von seiner beschaulichen Schönheit und dem ewigen Kreislauf des Landlebens war nichts Besonderes an diesem Winkel in den Cotswolds.
Mein Mann Bill, ich und unsere neunjährigen Zwillinge Will und Rob waren Amerikaner, aber wir lebten schon so lange in England, dass wir von unseren Nachbarn als Einheimische ehrenhalber akzeptiert wurden. Unser Cottage lag in der Nähe des Dörfchens Finch, eines Orts, der so winzig und so bedeutungslos für die Welt war, dass die meisten Kartografen vergaßen, ihn auf ihre Karten einzuzeichnen.
Für uns, die wir dort lebten, war Finch natürlich von enormer Bedeutung. Es war der Mittelpunkt unseres Universums, die Achse, um die wir uns drehten. Wir waren vielleicht nicht in der Lage, den Namen des angesagtesten Prominenten zu nennen, doch übereinander wussten wir alles, was es zu wissen wert war.
Nur Augenblicke, nachdem sich die jeweilige Katastrophe ereignet hatte, waren wir im Bild darüber — wessen Hund sich Flöhe eingefangen, wessen Dach eine undichte Stelle aufwies und wessen Chrysanthemen sich die tödliche Wurzelfäule zugezogen hatten. Wir wussten, bei welcher Person man sich darauf verlassen konnte, dass sie für den Kuchenverkauf beim Blumenwettbewerb sechs Dutzend makellose Erdbeertörtchen lieferte, und welcher Person man nicht das Backen einer einzigen Makrone überlassen konnte, ohne dass sie den Ofen in Flammen aufgehen ließ. Wir wussten, wessen Kinder und Enkel entzückend waren und welche man wie die Pest meiden musste, und wir teilten unser Wissen mit einem Eifer, der jedes soziale Netzwerk in den Schatten stellte.
Dorfklatsch war die Lebensader von Finch; ein Sport, eine Kunstform und eine Währung, die niemals ihren Wert einbüßte. Zu unserer Zerstreuung benötigten wir keine Prominenten. Wir fanden einander unendlich faszinierend.
Finch wäre nichts für jeden gewesen – wer sich nach Privatsphäre sehnte, der würde deren Fehlen schwer erträglich finden —, aber für Bill und mich war der Ort wie geschaffen. Bill leitete von einer Kanzlei mit Blick auf den Dorfanger die europäische Niederlassung der angesehenen Bostoner Anwaltskanzlei seiner Familie; Will und Rob besuchten im nahegelegenen Marktflecken Upper Deeping die Morningside School, und ich jonglierte eine Vielzahl von Rollen — Ehefrau, Mutter, Nachbarin, ehrenamtliche Helferin bei Gemeindeveranstaltungen, Klatschsammlerin und ergebene Schwiegertochter.
Bills Vater, William Willis senior, lebte weiter unten an unserer Straße im Fairworth House, einem prachtvoll restaurierten georgianischen Herrenhaus, das inmitten eines tadellos gepflegten Anwesens lag. Willis senior hatte den Großteil seines Erwachsenenlebens in Boston verbracht und den Hauptsitz der Kanzlei geleitet, war jedoch, nachdem er in den Ruhestand gegangen war, nach England gezogen, um seinen Enkeln näher zu sein.
Mein Schwiegervater ist ein altmodischer, vornehmer Gentleman, ein gutaussehender Witwer und liebenswürdiger Großvater. Ich himmelte ihn an, genau wie fast jede Witwe oder unverheiratete ältere Dame in Finch. Manch ein Herz war gebrochen worden, als Willis senior das seine der berühmten Aquarellmalerin Amelia Thistle geschenkt hatte. Es hatte fast zwei Jahre gedauert, bis Amelia seine Gefühle erwidert hatte, aber schließlich zahlte sich Willis’ senior geduldige Brautwerbung aus. Er hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht, sie hatte angenommen, und das Datum für die Hochzeit war festgesetzt worden.
Bill war entzückt. Er brannte ebenso darauf, als Trauzeuge seines Vaters zu fungieren, wie ich mich darauf freute, Amelias Trauzeugin zu geben. Etwas weniger begeistert waren Will und Rob von ihrer zukünftigen Rolle als Ringträger ihres Großvaters, aber Amelia hatte sich ihre Kooperation erkauft, indem sie ihnen versprochen hatte, eine Handvoll ihrer Lieblingsplätzchen in ihrem Brautstrauß zu verstecken. Für eine Frau, die nie eigene Kinder gehabt hatte, konnte Amelia erstaunlich gut mit Neunjährigen umgehen.
Obschon Willis senior nicht mehr der familieneigenen Kanzlei vorstand, war er noch immer das Familienoberhaupt, und kein Verwandter wollte sich seine Hochzeit entgehen lassen. Heerscharen von Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen würden in Bälde über Finch hereinbrechen, um dem pater familias die Ehre zu erweisen, ein Ereignis, dem Bill nicht mit ungetrübter Freude entgegensah. Zwar kam er gut mit den meisten seiner Verwandten aus, doch zwei seiner Tanten konnte er nicht ausstehen. Er bezeichnete sie als Harpyien, allerdings nur, wenn Will, Rob und sein Vater außer Hörweite waren.
Tante Honoria und Tante Charlotte waren seit vielen Jahren verwitwet — beide waren mit Männern aus ihren eigenen gesellschaftlichen Kreisen verheiratet gewesen. In ihren Augen hatte Bill seinen schwerreichen, alteingesessenen Bostoner Familienclan vor den Kopf gestoßen, als er eine Frau aus der Chicagoer Mittelschicht geehelicht hatte. Hätten sie sich mir gegenüber offen feindselig verhalten, hätte Willis senior ihnen ordentlich den Marsch geblasen; daher verbargen sie ihre Geringschätzung, indem sie mich, die bedauernswerte Außenseiterin, mit vorgetäuschter Besorgnis behandelten.
Sie kritisierten meine Haltung, meine Tischmanieren, meinen Modegeschmack und meine Sprechweise; doch das taten sie so aufrichtig bemüht, als klärten sie eine Wilde auf, die auf einer einsamen Insel von einer Horde Paviane aufgezogen worden war. Willis senior, der für gewöhnlich Hintergedanken auf eine Meile Entfernung witterte, war gegenüber den Intrigen seiner Schwestern blind. Während er Charlotte und Henrietta durch eine rosarote Brille betrachtete, sah mein sonst so entspannter Gatte bei den beiden rot.
Bills Tanten waren noch nie über unsere englische Schwelle getreten — sie verließen Boston nur selten —, und er freute sich nicht gerade auf ihren ersten Besuch. Als wir eines Tages, drei Wochen vor der Hochzeit meines Schwiegervaters, unsere kleine Straße entlangspazierten, verlieh er seinen Bedenken Ausdruck.
Es war ein herrlicher Samstagmorgen Anfang Juni. Nachdem er die Zwillinge beim hiesigen Reitstall abgesetzt hatte, wo sie ihre wöchentliche Reitstunde nahmen, hatte Bill beschlossen, den liegen gebliebenen Papierkram, der ihn in seinem Büro in Finch erwartete, abzuarbeiten. Normalerweise ging er nicht zu Fuß ins Dorf, und normalerweise begleitete ich ihn nicht, aber das Wetter war grandios, und wir hatten beide Lust, uns die Beine zu vertreten.
Als Bill das Wort ergriff, war ich in Gedanken woanders, sodass seine Worte wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel kamen.
»Wenn die Harpyien dir gegenüber unverschämt werden«, verkündete er, »erwürge ich sie.«
»Das will ich doch hoffen«, sagte ich leichthin, doch ein Blick in die düstere Miene meines Angetrauten verriet mir, dass er nicht zum Scherzen aufgelegt war. »Wie kommst du jetzt auf deine Tanten?«
»Ein Anruf von Vater«, erwiderte er. »Honoria und Charlotte treffen am Montag in Fairworth House ein.«
»Am Montag?« Ein mulmiges Gefühl beschlich mich. »Warum so früh?«
»Sie behaupten, dass sie Amelia bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen wollen, aber wir beide wissen, dass sie nur mäkeln und nörgeln werden.« Bill lachte verbittert. »Ich würde ihnen sogar zutrauen, dass sie die nächsten drei Wochen versuchen werden, Vater die Hochzeit mit Amelia auszureden.«
»Na dann viel Glück«, meinte ich verächtlich.
»›Eine Künstlerin in der Familie‹«, ahmte Bill Honorias penetrant näselnde, affektierte Stimme nach. »›Was in aller Welt hast du dir dabei gedacht, William? Wir könnten ja verstehen, wenn sie ein wenig im Malen dilettieren würde. Alle dilettieren in etwas. Aber sie verkauft ihre Bilder. Für Geld. Das gehört sich einfach nicht, mein Lieber!‹«
»Sie wären doch nicht so dumm, vor deinem Vater so zu reden, oder?«, fragte ich ungläubig.
»Ich wünschte beinahe, sie würden es tun«, sagte Bill. »Ich würde nur zu gern zusehen, wie Vater sie aus Fairworth hinauswirft.«
»Wenn sie in Bezug auf Amelia Gift verspritzen, wird er das«, sagte ich. »Und bei uns können sie nicht unterkommen, weil wir kein Gästezimmer mehr haben.«
»Noch ein Grund, meiner schönen Frau dankbar zu sein«, erwiderte Bill, »und meiner wunderschönen Tochter.«
Bills Laune und Haltung besserte sich schlagartig, als er auf den kostbaren Passagier hinuntersah, den ich im Kinderwagen vor mir herschob. Seine Schultern entspannten sich, seine Fäuste öffneten sich, und seine Gewittermiene wich einem Ausdruck purer Anbetung. Bill war verliebt wie noch nie zuvor, und ich verspürte nicht den leisesten Anflug von Eifersucht, denn ich war ihr ebenfalls verfallen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir liebten unsere Söhne über alles, aber unsere kleine Tochter war uns geschenkt worden, nachdem wir die Hoffnung auf ein weiteres Kind lange aufgegeben hatten. Ihre späte Geburt hatte ihr einen besonderen Platz in unseren Herzen gesichert. Ihretwegen hatte Bill das Undenkbare getan: Er hatte sein Arbeitspensum reduziert, um fortan weniger nach der Pfeife seiner anspruchsvollen Klienten zu tanzen und mehr Zeit zu Hause bei seiner Familie zu verbringen. Eine Entscheidung, für die die Harpyien niemals Verständnis aufbringen würden. Ich aber schon, und ich stand von ganzem Herzen dahinter.
Unsere Tochter war nach meiner verstorbenen Mutter und einer lieben Freundin Elizabeth Dimity getauft, aber Will und Rob nannten sie vom ersten Tag an Bess. Wie ich argwöhnte, um des Vergnügens willen, sie später mit Bessy Boots, Messy Bessy und anderen Spitznamen zu titulieren, wie große Brüder es gern tun — wie auch immer, von diesem Tag an hieß sie für alle nur Bess.
Bess war eines Abends Ende Februar mitten in einem Schneesturm zur Welt gekommen, also vor gerade einmal fünfzehn Wochen, aber wir hatten das Gefühl, sie seit Ewigkeiten zu kennen. Sie besaß die samtbrauen Augen ihres Vaters, meinen rosigen Teint und einen flaumig-seidigen und sanft gelockten dunkelbraunen Haarschopf.
»Sie ist wunderschön, nicht wahr?«, säuselte ich.
»Sie ist unvergleichlich schön«, pflichtete Bill mir bei, »und hochintelligent.«
»Und von ausgeglichenem Gemüt«, setzte ich hinzu.
»Und gesund und kräftig und gut gelaunt«, fuhr Bill fort.
»Und freundlich und geduldig und klug.«
»Unsere Bess«, schloss Bill, »ist so vollkommen, wie ein perfektes Kind nur sein kann.«
Wir sahen einander an und lachten. In der Öffentlichkeit erlaubten wir uns nicht, andere mit Lobhudeleien auf unser Baby zu langweilen, aber wenn wir unter uns waren, stand es uns frei, Lobeshymnen auf Bess zu singen, und wir konnten uns in der Gewissheit wiegen, dass jedes Wort, das wir sagten, wahr war.
»Außerdem ist sie vorausschauend«, hob ich hervor. »Hätten wir unser Gästezimmer nicht zu einem Kinderzimmer für sie umfunktioniert, hätten wir es einer deiner Cousinen anbieten müssen.«
»Wir danken Gott für diese kleine Gabe«, murmelte Bill und strahlte Bess an. »Keine Ahnung, wo Vater alle unterbringen will«, setzte er kopfschüttelnd hinzu. »Fairworth House ist groß, aber nicht groß genug, um alle auswärtigen Gäste aufzunehmen, und dazu noch die von Amelia.«
»Er könnte jemanden im alten Kinderzimmer einquartieren«, schlug ich im Scherz vor. Willis senior hatte, sobald sich bei uns weiterer Nachwuchs angekündigt hatte, das Kinderzimmer in Fairworth House renovieren lassen. Es war in der Tat praktisch, wenn es während eines unserer Besuche Zeit für Bess‘ Nickerchen war, aber für Erwachsene eignete sich das Zimmer freilich nicht.
»Ist das dein Ernst?«, fragte Bill und musterte mich zweifelnd.
»Nein, ich wollte einfach nur witzig sein«, sagte ich seufzend. »Ein Versuch, der offensichtlich gescheitert ist. Die ernsthafte Antwort lautet: Amelia hat für diejenigen, die ihre Einladung ohne lange zu zögern angenommen haben, Hotelzimmer in Oxford und Upper Deeping reserviert. Die Nachzügler werden hingegen sehen müssen, wo sie bleiben.«
»Vielleicht könnten sie sich in den leer stehenden Cottages einmieten«, sagte Bill.
Ein unbehagliches Gefühl stieg in mir auf. Die leeren Cottages bereiteten mir weit mehr Sorgen als Bills Tanten. Honoria und Charlotte würden kurz nach der Hochzeit wieder abreisen, aber die Cottages waren Teil einer beunruhigenden Entwicklung.
In Finch standen zwei Cottages zum Verkauf, und zwar schon seit fünf Monaten. Ihre ehemaligen Besitzer waren verstorben beziehungsweise weggezogen, und obwohl die kleinen Häuschen ansehnlich und in gutem Zustand waren, hatten sich bislang noch keine neuen Besitzer für sie gefunden.
Mir war das ein Rätsel. Finch mochte ja klein sein, aber es wurde doch einiges geboten. Taxman’s Gemischtwarenladen führte alles von gebackenen Bohnen bis hin zu Sommersprossencreme, der Peacock, ein Pub, war bekannt für seine herzhaften Gerichte und seine Biere, und in Sally Cooks Teestube kamen Gebäck- und Kuchenliebhaber ganz auf ihre Kosten. Finch besaß eine eigene Kirche, ein Postamt und einen Gemüseladen und konnte sich des besten Handwerkers der Grafschaft rühmen. Mr Barlow, ein pensionierter Automechaniker und unser Küster, war ein handwerklicher Alleskönner.
Finch hatte sogar eine internationale Fraktion. Bree Pym stammte aus Neuseeland, Jack MacBride aus Australien, und meine Familie vertrat die Vereinigten Staaten, genau wie meine beste Freundin Emma Harris, die ein Stück weiter oben an unserer Straße im Anscombe Manor wohnte, wo sie die Reitschule führte, die Will und Rob besuchten. Unser Dorf war auf seine ganz eigene Art ziemlich kosmopolitisch.
Nun gut, wir hatten keine Schule, aber das alte Schulhaus wurde noch rege als Gemeindesaal benutzt. Der Blumenwettbewerb, das Krippenspiel und zahlreiche Kuchenbasare fanden dort statt, und dort tagten auch die jeweiligen Komitees, um übers Jahr die Aktivitäten im Dorf zu planen.
Finch war von Feldern und Wiesen umgeben, aber nach Oxford war es nicht weit und nach Upper Deeping, der nächsten Kleinstadt, nur ein Katzensprung. Eine kurze Autofahrt zur Arbeit war in meinen Augen ein kleiner Preis für ein Heim in einer so wunderschönen Umgebung.
Passionierte Angler konnten ihre Köder im Little Deeping River auswerfen, Radfahrer in Frieden über nicht überlaufene Wege strampeln, Wanderer nach Herzenslust herrliche Pfade erkunden, und Kinder konnten sicher auf dem Dorfanger spielen, während die Senioren auf der Bank am Kriegerdenkmal Geschichten austauschten. Alles in allem hatte Finch eine Menge zu bieten.
Trotzdem standen die beiden Cottages immer noch leer.
»Eigentlich dürfte es gar keine leeren Cottages in Finch geben«, sagte ich. »Solche Schnäppchen hätten schon vor Ewigkeiten weggehen müssen. Was ist bloß los mit den Leuten, Bill? Warum will denn niemand hier wohnen?«
»Keine Ahnung«, sagte Bill. »Und der Tag ist zu schön, um sich wegen eines Problems, das wir nicht lösen können, den Kopf zu zermartern.«
Ich sagte nichts mehr dazu, zermarterte mir aber weiter den Kopf. Es betrübte mich, Ivy Cottage und Rose Cottage unbewohnt zu sehen. Ihre leeren Fenster schienen die Passanten vorwurfsvoll anzuschauen, als hätte das Dorf sie irgendwie im Stich gelassen. Amelias Cottage mit dem klingenden Namen Pussywillows — Palmkätzchen — würde ebenfalls bald zum Verkauf stehen, und ich konnte mich der Frage nicht erwehren, ob es einen Käufer finden würde. Der Gedanke an drei entzückende Cottages, die über Monate leer standen, war ebenso bedrückend wie verwirrend.
Während wir an Emma Harris‘ langer, geschwungener Einfahrt vorbeispazierten, an Bree Pyms rotem Backsteinhaus und dem schmiedeeisernen Tor, das den Eingang zu Willis‘ senior Anwesen hütete, redete Bill über alles Mögliche, nur nicht über die unbewohnten Cottages. Ein paar Meter vor der Buckelbrücke, die sich über den Little Deeping spannte, blieb ich stehen.
»Hier trennen sich unsere Wege«, erklärte ich Bill und wies mit einer Kopfbewegung auf das Wäldchen zu unserer Rechten. »Wenn du die Augen zusammenkneifst, kannst du einen alten Feldweg erkennen, der sich dort verbirgt. Bess und ich brechen in unbekannte Gefilde auf.«
Bill schob die Zweige des buschigen Lorbeerbaums beiseite, hinter denen sich der Eingang zu dem schmalen Pfad verbarg.
»Nur gut, dass ich einen geländegängigen Kinderwagen gekauft habe«, sagte er und beäugte zweifelnd die tiefen Spurrillen, die sich in den Weg eingegraben hatten. »Hast du dein Handy dabei, für den Fall, dass du dich verläufst?«
»Ja, habe ich«, sagte ich, »aber ich werde es nicht brauchen. Laut Emma führt der Weg dicht an der Nordgrenze des Anwesens deines Vaters vorbei, ich kann mich also unmöglich verlaufen.«
Emma Harris war nicht nur eine gute Freundin und ausgezeichnete Reiterin. Sie war auch eine meisterhafte Kartenleserin. Sie hatte den nicht mehr benutzten Feldweg auf einer alten Karte der nationalen Landesvermessungsbehörde entdeckt, hatte ihren Fund selbst jedoch noch nicht erkundet. Die Vorstellung, dass Bess und ich kühn in Gefilde vordringen würden, in die selbst Emma noch nie ihren Fuß gesetzt hatte, heiterte mich auf.
»Geh nicht zu weit«, ermahnte mich Bill.
»Vierzig Minuten hin, vierzig Minuten zurück«, erwiderte ich zuversichtlich. »Es sei denn, der Weg ist davor zu Ende, dann drehen wir früher um.«
»Ein vernünftiger Plan«, sagte Bill. »Wenn du dich nur daran halten würdest …«, setzte er halblaut hinzu. Er gab mir einen Kuss und bückte sich, um auch unserer schlafenden Tochter einen Kuss auf die Stirn zu hauchen. Doch kurz vor der Buckelbrücke konnte er nicht widerstehen, mir über die Schulter zuzurufen: »Ruf mich an, falls du dich verläufst!«
Ich warf ihm einen missmutigen Blick zu und steuerte den Kinderwagen durch die Öffnung zwischen den Bäumen und auf den holprigen Pfad. Bill brauchte mich nicht daran zu erinnern, dass mein Geschick im Kartenlesen nicht so hoch entwickelt war wie bei Emma, aber ich brauchte auch keine Karte lesen zu können, um den beiden Fahrrinnen des alten Feldwegs zu folgen. Und keine Karte auf der Welt hätte mich — oder Emma — davor warnen können, was uns bevorstand.
Niemand von uns hätte ahnen können, dass Bess und ich kurz davorstanden, das seltsame und geheimnisvolle Reich des Sommerkönigs zu betreten.
Kapitel 2
Als ich Emmas neu entdeckten Weg betrat, ergriff mich ein beinahe schwindelerregendes Gefühl von Freiheit. Endlich waren der heftige Wind und der strömende Regen, die mich den März, April und Mai hindurch praktisch ans Haus gefesselt hatten, einer sanften Brise und strahlendem Sonnenschein gewichen.
Die Luft war von den zarten Düften nach Veilchen und Schlüsselblumen erfüllt. Wilde Erdbeeren rankten sich an den Hecken empor, ein blauer Teppich aus Glockenblumen überzog den Waldboden, Butterblumen vergoldeten die Wiesen, und in den Bäumen zwitscherten Vögel. Der Frühling stand an der Schwelle zum Sommer, und ich war bereit, ihn mit offenen Armen zu empfangen.
Nicht nur das unfreundliche Wetter hatte mich viele Wochen lang ans Cottage gefesselt. Nach einem Monat strenger Bettruhe, gefolgt von einer langen, komplizierten Geburt, hatte ich ein erfreulicherweise gesundes Baby zur Welt gebracht. Doch für meinen einundvierzigjährigen Körper war es dennoch eine Strapaze gewesen. In gewissem Sinn genoss ich es sogar, dass meine postnatale Kraftlosigkeit es mir gestattete, ohne schlechtes Gewissen unzählige Stunden allein mit meinem kleinen Mädchen zu verbringen.
Während eine Heerschar von Freundinnen und Nachbarn meinen Kühlschrank mit Aufläufen füllte, meine Hausarbeit übernahm und Bill bei der Versorgung der Jungs unterstützte, tappte ich vom Schlafzimmer ins Kinderzimmer und wieder zurück und war mir der Welt jenseits unserer gemeinsamen kaum bewusst. Ganz allein waren Bess und ich freilich nicht. Bill wechselte Bess die Windeln öfter als ich, während Will und Rob, unsere selbsternannten fahrenden Ritter, uns mit einem unablässigen Strom von Plätzchen, Zeichnungen und Dinosauriern versorgten.
Doch wenn unsere Männer unterwegs waren, genoss ich den Luxus, Bess für mich ganz allein zu haben. Meine allererste Zeit mit den Zwillingen war wie in einem Nebel aus der Panik einer frisch gebackenen, unerfahrenen Mutter und lähmender Erschöpfung an mir vorbeigezogen, und ich wollte nicht, dass sich diese Erfahrung wiederholte. Ich wusste, Bess würde mein letztes Kind sein, und schätzte die Gelegenheit, mich ihr während der ersten flüchtigen Wochen ihrer Kindheit mit Körper und Seele zu widmen.
Den Großteil des Tages zu ruhen war allerdings nicht der beste Weg, um nach einer schwierigen Schwangerschaft wieder in Form zu kommen; ein Umstand, der mir schmerzlich bewusst geworden war, als ich bei einer Anprobe versucht hatte, in mein Trauzeugin-Kleid zu schlüpfen. Amelias Brautjungfern, ein Quartett graziler Kunststudentinnen, die halb so alt wie ich waren und noch nie etwas Umfangreicheres als eine Idee in die Welt gesetzt hatten, waren bei der Anprobe ebenfalls zugegen. Ich war zwar nicht übermäßig eitel, doch es entging mir nicht, dass die Schneiderin ihre Kleider enger steckte während sie meines bis auf den letzten Millimeter auslassen musste.
Mir war klar, dass ich nie wieder gertenschlank sein würde, aber ich hatte auch nicht die Absicht, eine matronenhafte Trauzeugin abzugeben. Die Anprobe spornte mich an, meinen Allerwertesten hochzubekommen, ehe er noch breiter wurde. Sobald das Wetter sich beruhigte, begann ich mit Bess lange Spaziergänge durch die Landschaft zu unternehmen und das Netz aus Wegen und schmalen Landstraßen zu erkunden, das sich vom Dorf aus in alle Richtungen erstreckte. Ich war so froh, endlich wieder an der frischen Luft zu sein, und konzentrierte mich ganz auf meine kleine Begleiterin, dass ich manchmal das Zeitgefühl verlor und nicht wusste, wie viele Meilen ich zurückgelegt hatte. Und wo ich war.
Einmal — aber nur einmal — hatte es mich auf einen mir unbekannten, verlassenen Bauernhof verschlagen, und ich war zu erschöpft gewesen, um weiterzugehen. Nur gut, dass ich mein Handy dabei hatte, aber Bill hatte mich nie vergessen lassen, wie viele Höfe er hatte absuchen müssen, bis er Frau und Tochter fand, ganze sieben Meilen von zu Hause entfernt und im Schatten eines Kuhstalls fest schlafend.
Ein bisschen schob ich die Schuld an meinem Bauernhofabenteuer auf den geländegängigen Kinderwagen, den Bill mir gekauft hatte, nachdem ich ihm von meinem neuen Sportprogramm erzählt hatte. Der Kinderwagen war ein Wunderwerk der Technik — wandelbar, zusammenklappbar, leicht und doch stabil und so einfach zu manövrieren, dass er mich dazu verführte, meine Kondition zu überschätzen. Seine drei überdimensionalen Räder waren den Schlaglöchern, Steinen und Spurrillen auf »Emmas Weg« absolut gewachsen, und seine ausgeklügelte Federung und sein Gurtsystem bescherten Bess eine ruckelfreie, sichere Fahrt. Und das Beste war, dass die Blickrichtung des Wagens frei wählbar war. Ich zog die Ausrichtung nach hinten vor, sodass ich mich von Angesicht zu Angesicht mit Bess unterhalten konnte, die an ihrem Kinderwagen genauso viel Spaß hatte wie ich.
Diesmal war ich jedoch fest entschlossen, mich nicht noch einmal in die Irre führen zu lassen.
In dem Moment, als Bill aus meinem Blickfeld entschwand, stellte ich den Wecker an meinem Handy auf exakt vierzig Minuten ein. Ich erklärte Bess, dass wir beim ersten Piepser nach Hause umkehren würden, und machte mich dann in dem sicheren Gefühl auf den Weg, Bill nicht noch einmal Veranlassung dazu zu geben, jedem, der es hören wollte, zu erzählen: »Sechs Bauernhöfe musste ich abklappern! Sechs!«
Mein Fitnessprogramm diente nicht nur meinem eigenen Nutzen. Ich hatte den Eindruck, dass ein während eines Schneesturms geborenes Baby der Sonnenwärme mehr bedurfte als andere Menschen. Nach so vielen Wochen im Haus, sagte ich mir, würde die freie Natur Bess’ Sinne beleben. Hier draußen konnte sie die Lerchen hören, den wilden Thymian riechen und in der großen Welt jenseits des Cottages mehr Farben entdecken als in einer Schachtel Buntstifte. Vielleicht würde sie sich nicht an die Einzelheiten unserer ersten gemeinsamen Spaziergänge erinnern, aber ich hoffte, sie würden in ihr eine lebenslange Liebe zur Natur wecken.
»Oder aber du wirst ein Rockstar, wenn du groß bist«, sagte ich zu ihr, während ich den Wagen vorsichtig über ein Geflecht aus Baumwurzeln steuerte, das sich quer über den Pfad erstreckte.
Nachdem ich soviel Zeit im Cottage verbracht hatte, genoss ich die Herausforderungen, die der alte Feldweg mir stellte. Mit der gleichen stürmischen Energie, mit der Will und Rob auf ihren Ponys querfeldein ritten, umfuhr ich tiefe Radfurchen, duckte mich unter fast bis auf den Boden hängenden Ästen durch, platschte durch Wasserläufe und schob wuchernde Büsche beiseite. Als der alte Pfad nach links abbog, folgte ich ihm, und als der Wecker des Handys klingelte, schaltete ich ihn aus und ging weiter. Ich war viel zu sehr in meinem Element, um umzukehren.
Nach und nach stiegen zu beiden Seiten des Wegs grasbewachsene Böschungen an, aber sie waren mit einer solchen Fülle an Wildblumen bewachsen, dass es mir nichts ausmachte, den Überblick über meine Umgebung zu verlieren. Abgesehen davon schirmten die Böschungen uns auch gegen einen auffrischenden Wind ab, der von Westen heranwehte.
Als es Zeit wurde, Bess die Windel zu wechseln und sie zu stillen, breitete ich ihre Decke auf einer blumenübersäten Böschung aus. »Deine Brüder haben auch ihre geheimen Stellen«, murmelte ich Bess zu, »und dieser Ort soll unserer sein — deiner und meiner.« Ich dachte einen Moment nach. »Wobei wir Emma schon erlauben sollten, uns gelegentlich zu begleiten«, setzte ich dann nachdenklich hinzu.
Ich hatte kurz überlegt umzukehren, aber meine Neugier siegte. In der Ferne konnte ich die Ecke einer Steinmauer erkennen. Ein Teil der Mauer verlief parallel zu der grasbewachsenen Böschung zu meiner Rechten, während der andere Teil im rechten Winkel davon abbog und in einer Baumgruppe verschwand. Die Mauer war fast zweieinhalb Meter hoch und schien sich meilenweit fortzusetzen. Ich fragte mich, wessen Anwesen sie abschirmte.
»Jedenfalls nicht das deines Großvaters«, erklärte ich Bess, während wir uns dem beeindruckenden Bollwerk näherten. »Großvaters Mauern sind vom Tor aus gesehen nur ungefähr fünfzig Meter lang. Diese hier muss seinem Nachbarn gehören.«
Während ich die Worte aussprach, wurde mir erschrocken klar, dass ich nicht wusste, wer der Nachbar von Willis senior war. Er hatte nie einen Nachbarn erwähnt, und ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, ob es jenseits seines Grundstücks ein weiteres bewohntes Anwesen gab. Mein Mangel an Fantasie war mir regelrecht peinlich.
»Ich sage dir das jetzt nicht gern, Bess, aber manchmal vergisst deine Mutter, ihr Hirn zu benutzen. Jeder hat Nachbarn, also auch Grandpa William, und es war blöd von mir, etwas anderes anzunehmen.« Nachdenklich schürzte ich die Lippen. »Ich frage mich, warum er nie über sie spricht.«
Stimmen hallten über die Mauer, die wir jetzt passierten; schrille Kinderstimmen, das Geplapper von Jugendlichen und die tiefere Stimme eines erwachsenen Mannes, die genauso aufgeregt klang wie die der Kinder.
»Drei … zwei … eins … los!«, rief der Mann.
Instinktiv blickte ich nach oben und sah entzückt, wie sechs Drachen in rascher Folge in den Himmel aufstiegen. Einer fantasievoller als der andere. Ein roter Drache tanzte neben einem skelettartigen Doppeldecker mit Fledermausflügeln in dem auffrischenden Wind. Unter einem großen Schiff mit prallen Segeln schlängelte sich ein Goldfisch in die Lüfte. Und ganz oben segelten zwei mehrteilige farbenfrohe Kastendrachen; fasziniert verfolgte ich die Bewegungen dieser geometrischen Formen. Ich konnte die Menschen, die die Drachen steigen ließen, nicht erkennen, war ihnen jedoch dankbar, dass sie diesen bereits magischen Tag um ein so wunderbares Schauspiel bereicherten.
Wäre ich nicht so hingerissen von dem Drachenballett gewesen, hätte ich dem Schlagloch vielleicht ausweichen können. Doch so schob ich den Kinderwagen geradewegs in eine Vertiefung zwischen den Baumwurzeln hinein, das eine Vorderrad traf in einem unglücklichen Winkel auf die schartige Kante, blieb darin hängen, und ich sah hilflos zu, wie es sich von seiner Achse verabschiedete und munter über den Weg vor uns davonhüpfte.
Bess schrie erschrocken auf. Um sie nicht noch zusätzlich zu ängstigen, schluckte ich meinen eigenen Schreckensschrei herunter, der zu einem erstickten Klagelaut verebbte. Die heftige Erschütterung und der beängstigende Laut, den seine Mama ausgestoßen hatte, waren mehr, als ein Baby ertragen konnte. Bess begann zu weinen.
Ich stützte die radlose Vordergabel des Kinderwagens auf den Böschungsrand, löste Bess‘ Gurt und nahm sie auf den Arm. Dann setzte ich mich mit ihr neben den defekten Kinderwagen, flüsterte ihr beruhigende und zutiefst bedauernde Worte zu und wiegte sie.
Während meine Tochter ihre Fassung wiedergewann, dachte ich über unsere Notlage nach. Der Gedanke, einen zweirädrigen Kinderwagen den weiten Weg in die Zivilisation zurückzuschieben, gefiel mir nicht, aber der, Bill anzurufen, noch weniger.
»Der Weg ist zu holprig für ein Auto, deswegen wird er einen Hubschrauber schicken, um uns zu retten«, sagte ich betrübt zu Bess. »Jeder in Finch wird ihn über dem Dorf kreisen sehen, und bevor es Abend wird, werden alle wissen, dass ich uns wieder einmal in Schwierigkeiten gebracht habe. Sechs Bauernhöfe und ein Helikopter?« Voller Selbstmitleid stöhnte ich auf. »Das schmiert er mir für den Rest meines Lebens aufs Butterbrot.«
Derart in meinen düsteren Gedanken versunken, hörte ich kaum die schabenden Geräusche und das angestrengte Stöhnen, das von der anderen Seite der Mauer zu hören war, bis mich von oben eine tiefe Stimme ansprach.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Ich blickte auf und sah einen Mann oben auf der Steinmauer sitzen. Sein kurzes Haar war ebenso weiß wie sein kurz geschnittener Vollbart, und Krähenfüße rahmten seine grauen Augen ein, aber er war nicht gekleidet wie ein alter Mann. Sein zerknittertes blaues Hemd, seine grasfleckige Khakihose und die schmutzigen Turnschuhe erinnerten eher an die Anziehsachen meiner energiegeladenen kleinen Söhne. Aber am verblüffendsten an ihm war der Kranz aus trockenem, mit Butterblumen durchwobenem Weinlaub, den er auf dem Kopf trug wie eine Krone.
Der Anblick der bekränzten Gestalt, die sich vor einem Himmel voll tanzender Drachen abhob, verschlug mir kurzzeitig die Sprache. Während ich stumm und staunend nach oben sah, betrachtete der Mann mich höflich, als kletterte er regelmäßig über Mauern, um stillende Mütter in Nöten zu retten.
»Ich habe ein Baby schreien gehört«, fuhr er fort, »und dachte, ich könnte vielleicht irgendwie helfen.«
»Danke«, sagte ich und bemühte mich, seinen Kranz nicht anzustarren, »aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie etwas für uns tun können.« Mit einer Hand schob ich den Kinderwagen zurück und drehte ihn so, dass er die Ursache meiner Notlage erkennen konnte. »Können Sie das reparieren?«
Einen Moment lang musterte der Mann die radlose Vordergabel und nickte dann.
»Rühren Sie sich nicht von der Stelle«, sagte er und zwinkerte freundlich. »Bin gleich wieder da.«
Bevor ich ihn nach seinem Namen fragen konnte, war er auf der anderen Seite der Mauer wieder hinuntergesprungen.
Ich blickte zu der Stelle hinauf, wo der Mann gerade noch gesessen hatte, und fragte mich, ob ich ihn mir vielleicht eingebildet hatte. Die laute Stimme, mit der er den Drachenfliegern riet, »die Leinen straff zu halten«, bestätigte mir zwar, dass er keine Ausgeburt meiner Fantasie war, aber ich war mir nicht sicher, was ich von ihm halten sollte. Ob er wohl in der Lage war, den Kinderwagen zu reparieren? Würde er dafür sorgen, dass ich auf eigenen Füßen und hocherhobenen Hauptes nach Hause zurückkam?
Ich betrachtete Bess und beschloss, optimistisch zu sein. Dass ein Mann seines Alters einen Weinlaubkranz trug, war zwar ein wenig eigenartig, aber ich hätte es vermutlich auch in Kauf genommen, wenn er in Bastrock und Melone wieder aufgetaucht wäre; solange er mir die Demütigung ersparte, Bill zu Hilfe zu rufen, würde er für immer mein Freund sein, entschied ich.
Ich stützte die Gabel des Kinderwagens wieder an der Böschung ab und sah zu Bess hinunter.
»Der Nachbar deines Großvaters scheint mit Bacchus verwandt zu sein«, sagte ich. »Bacchus ist, zu deiner Information, der Gott des Weines und der wilden Partys. Vielleicht spricht Grandpa William deswegen nie von ihm. Dein Großvater steht nämlich nicht auf wilde Partys.«
Bess war zu beschäftigt, um eine Meinung zu äußern, also sang ich ihr etwas vor, um uns die Zeit zu vertreiben. Als das Stillen und das Hätscheln sie wieder beruhigt hatten, legte ich sie in den Wagen zurück, löste den Kinderwagenaufsatz vom Rahmen und setzte ihn behutsam auf den Boden.
»Ich bereite mal eben die Reparatur vor«, erklärte ich ihr, während ich die unverzichtbare Wickeltasche vom Rahmen löste und neben den Aufsatz stellte. »Wir wollen ja nicht, dass unser geheimnisvoller Mechaniker uns für vollkommen nutzlos hält.«
Ich hatte kaum zu Ende gesprochen, als der Weißhaarige in einiger Entfernung aus einer Öffnung in der Mauer auftauchte. Er saß auf einem altmodischen Ballonrad mit einem Kastenanhänger. Mit seinem blauen Hemd, das im Wind wehte und seinem mit Butterblumen geschmückten Kranz, der immer noch fest auf seinem Kopf saß, strampelte er gemächlich einher, und die holprige Beschaffenheit des Wegs schien ihm nichts auszumachen.
»Ich hoffe, er ist besser darin, Schlaglöchern auszuweichen, als ich«, murmelte ich Bess zu.
Der Mann hielt mehrmals an, um das auf Abwege geratene Rad des Kinderwagens und etwas, das wie Bruchstücke der Achse aussah, aufzulesen, fuhr dann ohne Zwischenfälle weiter und kam ein paar Schritte vor dem Schlagloch, das mir aufgelauert hatte, erneut zum Stehen. Sein faltiges Gesicht und sein schneeweißes Haar hatten mich annehmen lassen, er sei im Alter meines Schwiegervaters, aber bei näherem Hinsehen fand ich, dass er jünger wirkte — wie Anfang sechzig vielleicht. Er schien sich in keiner Weise seiner ungewöhnlichen Kopfbedeckung bewusst zu sein, und ich wollte ihn auch nicht darauf ansprechen. Ich würde bestimmt keinen Mann beleidigen, der mir vielleicht die Schande ersparen konnte, mit Bess in einem defekten Kinderwagen nach Hause zu rumpeln.
»Hallo nochmals«, sagte ich, als er mit dem Rad in der Hand abstieg. »Sie waren so schnell weg, dass ich mich gar nicht vorstellen konnte. Ich heiße Lori Shepherd, aber alle …«
»Alle nennen Sie Lori«, warf er ein und nickte lächelnd.
»Das stimmt«, sagte ich. »Woher wussten Sie das?«
Er runzelte die Stirn, als hätte ich ihn mit einer schwierigen Frage verwirrt, aber die Falten verschwanden fast so schnell, wie sie gekommen waren.
»Nun, eine spontane Annahme«, gab er zurück. »Sie kommen mir nicht vor wie eine Frau, die viel von Förmlichkeiten hält, Lori. Ich übrigens auch nicht. Ich meine, ich halte nichts von Formalitäten. Ich heiße Hargreaves«, fuhr er fort und legte eine Hand auf die Brust. »Arthur Hargreaves, aber nennen Sie mich doch bitte Arthur. Sie kommen aus Finch, stimmt’s?«
»So langsam glaube ich, Sie können Gedanken lesen, Arthur«, sagte ich.
»Nein, nein«, sagte er bescheiden. »Ich kenne mich einfach nur gut auf den hiesigen Nebenwegen aus und habe eine wohlbegründete Vermutung angestellt. Oder irre ich mich etwa?«
»Nein«, sagte ich. »Ich wohne mit meiner Familie tatsächlich ein bisschen außerhalb von Finch.«
»Dann liege ich ja richtig mit meiner Vermutung.« Er schlenderte zum Kinderwagenaufsatz und spähte hinein. »Das jüngste Familienmitglied, nehme ich an?«
»Wieder richtig geraten«, sagte ich. »Ihr Name ist Bess, und sie wird bald vier Monate alt.«
»Entzückend.« Er beugte sich tief hinunter und hielt Bess seinen kleinen Finger hin. Sie gluckste freundlich und griff danach. »Ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Bess.«
»Wohnen Sie … hier?«, fragte ich und wies mit einer Kopfbewegung in Richtung Steinmauer.
Arthur folgte meinem Blick, löste sanft seinen Finger aus Bess’ Griff und richtete sich auf.
»Ja«, antwortete er. »Hillfont Abbey ist seit über hundert Jahren der Sitz der Familie Hargreaves.«
»Oh, dann befinden wir uns also auf dem Grund und Boden von Hillfont Abbey?«, fragte ich interessiert. »Ich bin noch nie in diese Richtung gegangen, daher bin ich nicht vertraut mit den Grundstücksgrenzen. Das Anwesen meines Schwiegervaters grenzt, glaube ich, an ihres. Sein Name ist William Willis, und ihm gehört Fairworth House.«
»Ach ja«, sagte Arthur. »Der pensionierte Anwalt mit einer Leidenschaft für Orchideen. Er heiratet demnächst, nicht wahr?«
»Ja«, sagte ich lächelnd. »Ich wusste nicht, dass Sie ihn kennen.«
»Das tue ich auch nicht«, sagte Arthur. »Ich habe mir schon oft vorgenommen, mich bei ihm vorzustellen, mich aber irgendwie noch nie freimachen können.«
Ich blinzelte ihn verwirrt an. »Wenn Sie William nie begegnet sind«, sagte ich gedehnt, »woher wissen Sie dann, dass er pensionierter Anwalt und Orchideenliebhaber ist?«
»Nun, wie hält man sich auf dem Land auf dem Laufenden?«, fragte Arthur leichthin. »Man hält die Ohren offen.«
»Ich bin eine ziemlich gute Zuhörerin«, sagte ich, »habe aber noch nie von Ihnen gehört.«
»Wenn Sie in Tillcote wohnten«, sagte er, »hätten Sie das bestimmt. Er sprach von einem Dorf fünfzehn Meilen nördlich von Finch. »Die Straße von Hillfont nach Tillcote ist asphaltiert und wird gut instand gehalten. Auf das Sträßchen von Hillfont nach Finch trifft weder das eine noch das andere zu. Ich bevorzuge die Straße, auf der ich mich sicherer fühle.«
»Kann ich Ihnen nicht verübeln«, erwiderte ich. »der unbefestigte Straßenabschnitt ist abenteuerlich.«
»In der Tat.« Arthur hielt das von ihm aufgehobene Rad hoch. »Sollen wir es versuchen?«
»Unbedingt«, sagte ich.
Arthur krempelte die Ärmel hoch und machte sich an die Arbeit. Er stellte den Rahmen des Kinderwagens auf den Kopf, tastete mit den Fingern die Vordergabel ab, fuhr mit den Fingerspitzen in die geölten Löcher, die die Achse beherbergt hatten, schob das Rad in die Gabel und zog es wieder heraus. Dann wischte er sich die ölverschmierten Finger an der Hose ab und drehte sich zu mir um.
»Die gute Nachricht ist«, sagte er, »dass weder die Gabel noch das Rad beschädigt sind. Die schlechte ist, dass die Achse gebrochen ist.«
»Oje, ich hätte besser auf den Weg achten sollen!«, sagte ich schuldbewusst.
»Es ist nicht Ihre Schuld«, versicherte Arthur mir. »Die Achse muss schon zuvor schadhaft gewesen sein, bestimmt ein Serienfehler. Sobald ich hier fertig bin, greife ich zum Hörer, um dem Hersteller eine Rückrufaktion nahezulegen. Sie könnten die Firma natürlich verklagen wegen …«
»Nein, kann ich nicht«, unterbrach ich ihn. »Mein Mann und ich halten nichts davon, leichtfertig die Gerichte anzurufen. Bess und ich haben uns erschreckt, das schon, aber keine von uns ist wirklich zu Schaden gekommen. Wenn der Hersteller einer Rückrufaktion zustimmt, habe ich nicht die Absicht, ihn zu verklagen.«
»Gut«, sagte Arthur. »Dann brauche ich das Beweisstück nicht aufzubewahren.«
»Von mir aus dürfen Sie das Beweisstück in einem tiefen, dunklen Loch vergraben«, erklärte ich ihm, »aber meinen Sie, Sie können die Achse notdürftig reparieren?«
»Nein, ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen, aber ich kann sie durch eine bessere ersetzen.«