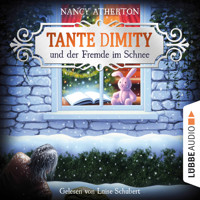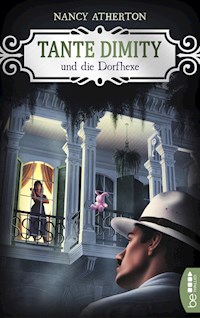5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
"Als ich von Tante Dimitys Tod hörte, war ich fassungslos. Nicht weil sie tot war, sondern weil ich bis dahin nicht wusste, dass es sie gegeben hatte."
Lori Shepherd ist frisch geschieden und pleite. Als auch noch ihre geliebte Mutter stirbt, glaubt sie vollends den Boden unter den Füßen zu verlieren. Da erhält sie die Nachricht von einer Anwaltskanzlei: Lori soll das Erbe ihrer Tante Dimity antreten. Hat es Tante Dimity, die Figur aus den Gutenacht-Geschichten ihrer Kindheit, wirklich gegeben? Zusammen mit dem jungen Anwalt Bill Willis macht sich Lori auf den Weg nach England und findet in dem kleinen Dörfchen Finch Tante Dimitys Cottage, ihr ungewöhnliches Erbe - und das größte Abenteuer ihres Lebens.
Märchenhafte Spannung mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Beths Haferflockenplätzchen.
"Einer der liebeswertesten Romane, die man heutzutage lesen kann." (Mystery Guide)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
beTHRILLED Digitale Neuausgabe »be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln eBook-Erstellung: readbox publishing GmbH, Dortmund ISBN: 978-3-7517-0326-0Nancy Atherton
Tante Dimity und das geheimnisvolle Erbe
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Beths Haferflockenplätzchen
Über dieses Buch
Lori Shepherd ist frisch geschieden und pleite. Als auch noch ihre geliebte Mutter stirbt, glaubt sie vollends den Boden unter den Füßen zu verlieren. Da erhält sie die Nachricht von einer Anwaltskanzlei: Lori soll das Erbe ihrer Tante Dimity antreten. Hat es Tante Dimity, die Figur aus den Gutenacht-Geschichten ihrer Kindheit, wirklich gegeben? Zusammen mit dem jungen Anwalt Bill Willis macht sich Lori auf den Weg nach England und findet in dem kleinen Dörfchen Finch Tante Dimitys Cottage, ihr ungewöhnliches Erbe – und das größte Abenteuer ihres Lebens.
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten „Tante Dimity“ Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Christiane Naegele
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3369-5
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity’s Death« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 1992 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2006
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für den schönen Prinzen
Kapitel 1
ALS ICH VON Tante Dimitys Tod hörte, war ich fassungslos. Nicht weil sie tot war, sondern weil ich bis dahin nicht wusste, dass es sie gegeben hatte.
Vielleicht sollte ich das erklären.
Als ich ein kleines Mädchen war, erzählte meine Mutter mir gern Geschichten. Sie deckte mich zu, nahm Reginald auf den Schoß und erzählte eine Geschichte nach der anderen, bis mir die Augen zufielen und ich eingeschlafen war. Dann legte sie Reginald neben mich und deckte ihn ebenfalls zu, sodass sein Gesicht das Erste war, was ich morgens beim Aufwachen sah.
Reginald war mein Kuschelhase. Früher hatte er einmal zwei Knopfaugen gehabt, und sein Fell war aus rosa Flanell gewesen, aber in meinen Diensten war er erblindet und grau geworden, bis auf den lila Fleck neben seinem aufgestickten Schnurrbart, der daran erinnerte, dass er einmal meinen Traubensaft probieren durfte. (Er mochte ihn nicht.) Reginald war ungefähr zwanzig Zentimeter groß, und soviel ich wusste, war er am selben Tag wie ich auf die Welt gekommen, denn er war schon immer an meiner Seite gewesen. Reginald war mein Vertrauter und der Kamerad meiner Abenteuer – es war sein Verdienst, dass ich mir nie wie ein Einzelkind vorgekommen war.
Auch meine Mutter fand Reginald recht praktisch. Sie unterrichtete die dritte und vierte Klasse an einer Grundschule im Nordwesten von Chicago, wo wir damals wohnten, und wusste, wie nützlich Hilfsmittel manchmal sein konnten. Wenn ich, die Weltmeisterin im Trampolinspringen, zur Schlafenszeit einfach nicht zur Ruhe kommen wollte, wandte sie sich einfach an Reginald auf ihrem Schoß. »Also, wenn Lori nicht zuhören will, dann erzähle ich dir eben die Geschichte, Reginald.« Nie verfehlte diese Bemerkung ihre Wirkung.
Meine Mutter wusste, dass ich Geschichten über alles liebte. Sie las mir die üblichen Kindergeschichten vor: Wie der Elefant seinen Rüssel bekam, Pu der Bär, Grimms Märchen und all die anderen klassischen Kinderbücher. Aber meine Lieblingsgeschichten (ebenso wie die von Reginald) waren diejenigen, die sie nicht vorlas, sondern mit ihrer Stimme, mit ihren Händen und ihren Augen erzählte.
Das waren die Geschichten von Tante Dimity. Sie waren die besten; sie erzählte sie, wenn sie mir eine besondere Freude machen wollte, und speziell an jenen Abenden, wenn sie mich auch durch intensives Rückenstreicheln nicht zum Einschlafen bringen konnte. Ich muss ein schrecklich ruheloses Kind gewesen sein, denn es gab unzählige Tante-Dimity-Geschichten: Tante Dimitys Cottage, Tante Dimity und ihr Garten, Tante Dimity kauft eine Taschenlampe. Besonders diese letzte Geschichte liebte ich über alles.
Wie schon die Titel vermuten ließen, waren Tante Dimitys Abenteuer weder großartig noch gefährlich. Sie alle spielten in einem unbekannten Zauberland, wo gewöhnliche Dinge mitunter andere Namen hatten als bei uns und wo Tee eine Art Allheilmittel zu sein schien. Die Geschichten selbst waren jedoch eher alltäglich. Tante Dimity war die normalste Heldin, die mir je begegnet war, und auch ihre Abenteuer waren schrecklich normal. Und dennoch bekam ich nie genug davon.
Eine meiner Lieblingsgeschichten war Tante Dimity geht in den Zoo. Ich wollte sie immer und immer wieder hören, bis ich sie selbst hätte erzählen können (was ich jedoch nie tat, denn gerade die Art, wie meine Mutter sie zum Besten gab, war ja einer der wichtigsten Bestandteile dieser Geschichten).
Die Geschichte fing an: »An einem wunderschönen Frühlingstag beschloss Tante Dimity, in den Zoo zu gehen. Die Osterglocken wiegten sich im Wind, die Sonnenstrahlen tanzten auf den blanken Fensterscheiben, und der Himmel war so blau wie ein Strauß Kornblumen. Und als Tante Dimity in den Zoo kam, entdeckte sie auch den Grund dafür: Hier nämlich hatte sich der Regen der ganzen Welt angesammelt und wartete auf sie. Er hatte sich zu einer großen, schwarzen Wolke zusammengeballt, die über dem Zoo schwebte und nur darauf lauerte, dass Tante Dimity durchs Tor trat.«
Aber ließ Tante Dimity sich davon abschrecken? Niemals! Sie öffnete lediglich ihren großen, verlässlichen Regenschirm, trat dem schlimmsten aller Wolkenbrüche entschlossen entgegen – und fand es großartig. Sie hatte den großen Zoo ganz für sich allein und beobachtete, wie die Tiere mit dem Regen fertig wurden: wie einige sich zurückzogen, bis er wieder aufhörte, und andere nach Herzenslust badeten und herumplanschten und sich die Tropfen aus dem Fell schüttelten. »Als sie alles gesehen hatte, was sie sehen wollte«, fuhr meine Mutter fort, »ging Tante Dimity nach Hause, wo sie sich am Kamin wärmte, ihr leckeres Butterbrot aß und ihren Tee trank. Und als sie an ihren herrlichen Tag im Zoo dachte, strahlte sie übers ganze Gesicht.«
Ich glaube, was mich an Tante Dimity so fesselte, war ihre Fähigkeit, den Unbilden des Lebens ein Schnippchen zu schlagen. Zum Beispiel die Geschichte Tante Dimity kauft eine Taschenlampe: Tante Dimity geht »ausgerechnet zu Harrod’s«, um eine Taschenlampe zu kaufen. Sie macht jedoch den Fehler, das Kaufhaus am letzten Wochenende vor Weihnachten aufzusuchen, als von oben bis unten ein Riesengedränge herrscht. Die meisten Verkäufer sind Aushilfskräfte, die ihr nicht einmal sagen könnten, wo die Taschenlampen sind, selbst wenn sie Zeit dazu hätten. Die haben sie aber nicht, weil der Andrang so groß ist, und so kommt Tante Dimity schließlich auch nicht dazu, eine Taschenlampe zu kaufen. Für jeden anderen wäre es ein irritierendes Erlebnis gewesen. Nicht aber für Tante Dimity. Für die war es nur ein weiteres Abenteuer, das mit jedem Stockwerk des Kaufhauses bunter und verrückter wurde. Und am Ende geht sie nach Hause, um sich vor dem Kamin zu wärmen, ihr leckeres Butterbrot zu essen und Tee zu trinken. Und leise in sich hineinzulachen, während sie an ihren Tag bei Harrod’s denkt. Ausgerechnet bei Harrod’s.
Tante Dimity war auf eine sehr normale Art unerschütterlich. Nichts hielt sie davon ab, Spaß zu haben, wo man Spaß haben konnte. Nichts hielt sie davon ab, etwas zu tun, wenn sie es tun wollte. Sie ließ sich von nichts unterkriegen, denn für sie war alles ein Abenteuer. Ich war wie verzaubert von ihr.
Später, als ich bereits ein Teenager war, fiel mir auf, dass es zwischen Tante Dimity und meiner Mutter eine gewisse Ähnlichkeit gab. Wie Tante Dimity so konnte sich auch meine Mutter an den kleinen Dingen des Alltags erfreuen. Und genau wie sie hatte auch meine Mutter eine außergewöhnliche Portion an gesundem Menschenverstand mitbekommen. Diese Eigenschaften sind eine kostbare Gabe für jeden, dem sie in die Wiege gelegt werden, für meine Mutter indes sollten sie sich als geradezu überlebenswichtig erweisen. Mein Vater starb kurz nach meiner Geburt, und nachdem die magere Prämie der Lebensversicherung aufgebraucht war, geriet meine Mutter finanziell in ziemliche Bedrängnis.
Sie war gezwungen, unser Haus und den Großteil der Einrichtung zu verkaufen und viel früher wieder als Lehrerin zu arbeiten, als sie es geplant hatte. Es muss schmerzlich für sie gewesen sein, in eine bescheidene Wohnung zu ziehen, aber noch viel schmerzlicher, mich jeden Morgen bei der Nachbarin im Erdgeschoss abzugeben, bevor sie zur Schule ging. Sie hat es sich nie anmerken lassen. Sie war eine alleinerziehende Mutter, ehe alleinerziehende Mütter von sich reden machten, und sie hat ihre Sache gut gemacht. Mir hat es nie an etwas gefehlt, und als ich beschloss, Chicago zu verlassen, um in Boston aufs College zu gehen, hat sie sofort eingewilligt und auch meinen Weggang verschmerzt. Wenn wir zusammen waren, war sie immer fröhlich, umsichtig und unternehmungslustig. Genau wie Tante Dimity.
Meine Mutter war eine kluge Frau, und Tante Dimity war eines ihrer größten Geschenke an mich. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft Tante Dimity mich in ärgerlichen Situationen vor Schlimmerem bewahrt hat. In späteren Jahren, wenn mir etwa eine kurzsichtige alte Dame mit ihrem Einkaufswagen über die Zehen fuhr, brauchte ich nur daran zu denken, wie ein großer, dicker Mann Tante Dimity bei Harrod’s auf den Fuß getreten war. Wobei sie sein Gewicht bis auf fünf Pfund genau erraten hatte, denn später ergab sich die Gelegenheit, dass sie ihn nach seinem genauen Gewicht fragen konnte. Bei dieser Szene konnte ich mich immer wieder ausschütten vor Lachen, so oft Mutter sie mir auch erzählte. Wenn ich mich nun daran erinnerte, versuchte ich, die Brillenstärke der alten Dame mit dem gefährlichen Einkaufswagen zu erraten, und obwohl ich es nie fertiggebracht hätte, mir meine Schätzung von ihr bestätigen zu lassen, musste ich bei dem Gedanken doch lachen, anstatt zu schimpfen.
Nach allem, was man mir erzählt hat, muss ich ein recht fröhliches Kind gewesen sein, und die Geschichten von Tante Dimity hatten bestimmt ihren Teil dazu beigetragen. Aber es gibt Zeiten im Leben, wo selbst der vergnügteste Mensch in Stimmungstiefs verfällt. Meine Stimmung sackte schlagartig in den Keller, als ich mich plötzlich in Situationen fand, die es in den Geschichten von Tante Dimity nie gab: als kein Holz für das wärmende Feuer und keine Butter für das leckere Butterbrot da waren, als all die heiteren Tage plötzlich düster geworden waren. Es waren keine besonderen Ereignisse, es war nichts Dramatisches oder Aufregendes, nichts, was nicht Millionen von anderen Menschen ebenfalls passierte. Aber dieses Mal passierte es mir, und zwar alles auf einmal, ohne Pausen zum Luftholen dazwischen. Ich befand mich in einer Abwärtsspirale, wie sie sich manchmal einfach ergeben. Und plötzlich war gar nichts mehr lustig.
Es fing damit an, dass meine Ehe in die Brüche ging. Nicht einmal auf besonders schmutzige Art und Weise, aber dennoch schmerzhaft. Als wir uns endlich zusammensetzen konnten, um alles zu regeln, wollte ich nur noch eine schnelle, saubere Trennung – und mehr bekam ich auch nicht. Ich hätte noch um Unterhalt oder um meinen Anteil am gemeinsamen Besitz kämpfen können, aber da war ich schon zu müde zum Kämpfen, zu müde, um meinen Platz noch länger zu behaupten. Mehr als alles andere jedoch war mir der Gedanke zuwider, mich von einem Mann ernähren zu lassen, mit dem ich nicht mehr zusammenlebte.
Ich stellte mich darauf ein, dass auch für mich jetzt wohl die unvermeidlichen Wanderjahre anfangen würden, die anscheinend das Schicksal jeder frisch geschiedenen Frau sind, aber mir fehlte jegliche Abenteuerlust. Ich war fast dreißig, hatte wenig Geld, noch weniger Energie und nicht den blassesten Schimmer, was ich jetzt anfangen sollte. Ehe ich mit meinem Mann nach Los Angeles gezogen war, wohin sein Arbeitgeber, eine Steuerberatungsfirma, ihn versetzt hatte, hatte ich in der Bibliothek meiner Uni gearbeitet, in der Abteilung für alte und bibliophile Bücher. Ich zog also zurück nach Boston, aber noch ehe ich dort ankam, hatte meine alte Stelle aufgehört zu existieren – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Anlage zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit, mit großem Aufwand installiert, um die kostbaren alten Bände zu erhalten, hatte verrückt gespielt, und der dadurch entstandene Kurzschluss hatte ein Feuer verursacht, das auch die größte Luftfeuchtigkeit nicht mehr hätte löschen können. Die Bücher waren in Flammen aufgegangen und mit ihnen auch meine Aussichten auf einen Job.
In einer anderen Bibliothek eine vergleichbare Stellung zu finden war aussichtslos. Ich hatte keine formale Ausbildung, und der Kurator, der mir mehr beigebracht hatte, als ich in sechs Studiengängen hätte lernen können, war ein rechthaberischer Eigenbrötler. Eine persönliche Empfehlung von Dr. Stanford J. Finderman bewirkte also eher, dass etwaige offene Türen sich einem vor der Nase schlossen. Ich stellte schnell fest, dass der Stellenmarkt für Spezialisten wie mich, noch dazu ohne formale Ausbildung, genauso hoffnungslos war wie mein Optimismus, mit dem ich mir eingebildet hatte, davon leben zu können. Hätte ich gewusst, was die Zukunft für mich bereithielt, dann wäre ich Motorradmechanikerin geworden.
Meine Mutter wollte, dass ich nach Hause käme, zurück in die Sicherheit unserer Wohnung in Chicago, aber davon wollte ich nichts wissen. Die einzige mütterliche Zuwendung, die ich annahm, waren regelmäßige Lieferungen selbstgebackener Plätzchen, mit Federal Express geschickt und so verpackt, dass sie auch eine Atomexplosion überlebt hätten. Ich habe nie durchblicken lassen, wie oft diese Plätzchen das Einzige waren, das meinen knurrenden Magen besänftigte.
Bis meine Scheidung rechtskräftig war, wohnte ich bei einer Freundin vom College, Meg Thomson. Sie machte mich mit der wunderbaren Welt der Zeitarbeit vertraut, und kaum war ich bei einer seriösen Firma in Boston registriert, suchte ich mir eine eigene Bleibe. Fortan gehörte ich zu der ständig wachsenden Zahl der »Großstadtpioniere«, und zwar deshalb, weil die einzigen Wohnungen, die ich bezahlen konnte, eben in jenen berüchtigten Gegenden lagen, die von den Maklern schönfärberisch als »Randgebiete« bezeichnet werden.
Ich kann auch bestätigen, dass niemand so arm ist, dass nicht ein noch Ärmerer versuchen würde, ihn zu bestehlen. Zwei Wochen nach meinem Einzug wurde meine Wohnung verwüstet. Als der Einbrecher sah, dass ich auch nicht mehr besaß als die anderen Nachbarn, muss er einen Wutanfall gehabt haben. Beim Nachhausekommen fand ich einen Haufen zerrissener Kleidung vor, meine Möbel waren zertrümmert, und was ich an Essensvorräten gehabt hatte, klebte als bunter Regenbogen an den Wänden.
Es war ziemlich deprimierend, aber am schlimmsten war der Anblick Reginalds. Der treue Gefährte meiner Kindheit war vom Watteschwanz bis zum Schnurrbart aufgeschlitzt, seine Füllung war herausgerissen und im Zimmer verstreut. Ich brauchte drei Tage, bis ich sein rechtes Ohr gefunden hatte. Mir war so übel, dass ich es nicht geschafft hatte, ihn zu reparieren. Ohnehin wusste ich, dass meine ungeschickte Näherei auch nie die feinen, winzigen Stiche ersetzen konnten, denen er sein langes, abenteuerliches Häschenleben zu verdanken hatte. Daher legte ich ihn, so wie er war, in einen Schuhkarton. Am vierten Tag nahm ich den Schuhkarton und zog aus. Es war der Auftakt zu einer langen Reihe von Umzügen in Behausungen verschiedenster Art, die, wenn sie auch nicht direkt elend zu nennen waren, so doch weit von dem entfernt, was ich in meinem früheren Leben gewohnt war. Im April desselben Jahres fand ich durch eine Anzeige einen Platz in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen Frauen in einer ruhigen Straße in West Somerville. Gerade als ich anfing, mich heimisch zu fühlen, starb meine Mutter.
Es kam ohne Vorwarnung. Der Arzt sagte mir, sie sei friedlich im Schlaf gestorben, was mich ein wenig tröstete, aber nicht genug. Ich hatte das Gefühl, ich hätte bei ihr sein müssen, dass ich etwas hätte tun müssen, irgendetwas, um ihr zu helfen. Bis dahin war ich nach jeder Niederlage immer wieder ohne größere Blessuren auf die Beine gekommen, aber dieser Schlag streckte mich nieder.
Ich flog sofort nach Chicago. Um die Beerdigung brauchte ich mich nicht zu kümmern, meine Mutter und Pater Czerczinski hatten für alles gesorgt.
Viele ihrer ehemaligen Schüler kamen zur Trauerfeier in der St.-Bonifatius-Kirche, jeder von ihnen wusste eine Geschichte zu erzählen oder hatte eine liebevolle Erinnerung an sie. Zwischen den zahlreichen Blumen steckte ein Strauß weißer Flieder, der ohne nähere Angabe des Absenders in England bestellt worden war. Ich sah ihn lange an und dachte über die vielen Menschenleben nach, die meine Mutter mit geformt hatte und über die ich nichts wusste.
Meine Mutter hatte auch veranlasst, dass die Heilsarmee ihre Möbel und Kleider abholen würde. Sie wusste nur zu gut, dass ihre geniale Tochter weder Platz dafür haben würde noch das nötige Geld, um die Sachen einzulagern. Ich verbrachte eine Woche in ihrer Wohnung, um ihre restlichen Habseligkeiten einzupacken – Andenken, Fotoalben, Bücher – und eingegangene Rechnungen zu bezahlen. Sie hatte gerade genug Geld hinterlassen, dass es für die Beerdigungskosten reichte und ich samt meiner Habe wieder nach Boston zurückfahren konnte, viel mehr war nicht übrig. Ich war weder überrascht noch enttäuscht. Grundschullehrerinnen werden mit Liebe und Zuneigung bezahlt, die ihnen entgegengebracht werden, nicht mit Geld, und ich hatte nie erwartet, etwas zu erben.
Als ich zurückkam, nahm ich so viel Arbeit an, dass ich jeden Tag Überstunden machte, und das nicht nur aus finanziellen Gründen. Erschöpfung ist ein wunderbares Schmerzmittel, sie betäubt die Gefühle und hält vom Denken ab, und ich wollte nicht denken. Die Monate verschwammen ineinander. Ich vernachlässigte meinen Freundeskreis, hörte auf, Briefe zu schreiben, und sprach kaum noch mit Kolleginnen und Mitbewohnerinnen. Als sich im April mein Einzug in die Wohngemeinschaft jährte, sprach ich nur noch mit Meg Thomson, aber nur, weil sie den Kontakt aufrechterhielt, ich bemühte mich nicht darum. Und selbst ihr gelang es nicht, mich dazu zu bringen, über den Tod meiner Mutter zu sprechen. Hatte ich von einer Abwärtsspirale gesprochen? Sie drehte sich inzwischen so schnell abwärts, dass sie kurz davor war, sich in die Erde hineinzubohren.
Und dann bekam ich den Brief, in dem man mir mitteilte, dass Tante Dimity gestorben sei.
Kapitel 2
ES WAR DER krönende Abschluss eines perfekten Tages. Das Aprilwetter hatte sich bisher von seiner schlechtesten Seite gezeigt, und ich hatte gerade wieder eine Woche in einer neuen unbekannten Firma überlebt, wo ich mich mit einer neuen, futuristisch anmutenden Telefonanlage herumschlagen (man stelle sich den Kontrollraum im Kennedy Space Center vor) und einen neuen, dynamischen Managerstil über mich ergehen lassen musste (»Guten Morgen! Uuund?? Sind wir alle frisch und munter an diesem neuen, wun-der-ba-ren Tag?«). Ich war seit sechs Uhr morgens unterwegs und hatte auf das Mittagessen verzichtet, um mit der Ablage fertig zu werden, als man mir mitteilte, dass man mich am Nachmittag nicht brauchte, weil der Chef Geburtstag hatte und das Büro um drei Uhr schließen würde. Einen ziemlich mageren Scheck in der Hand, schleppte ich mich in dem kalten, mit Schnee vermischten Nieselregen nach Hause. Mir graute vor den leeren Stunden, die jetzt vor mir lagen, und ich fragte mich, wie viele dieser wun-der-ba-ren Tage ich noch würde aushalten können.
Als ich ankam, war die Wohnung verwaist, so wie sie es fast immer war. Die eine Mitbewohnerin machte gerade ein Praktikum, die andere studierte Medizin und hatte Bereitschaftsdienst, und so war ich aufgrund der unkonventionellen Arbeitszeiten der beiden meist allein in der Wohnung, was mir durchaus recht war.
Es war zwar nicht das Ritz – nein, nicht mal ein Mittelklassehotel –, aber diese Art zu wohnen kam mir zurzeit am meisten entgegen. Mein Mobiliar bestand aus einer Matratze auf dem Fußboden, einem geliehenen Kartentisch, einem Stuhl, den ich vom Sperrmüll gerettet hatte, und einer Holzkiste, auf der meine einzige Lampe stand. Reginalds Schuhkarton stand im Einbauschrank, aber meine Kleidung lagerte noch immer in den Kartons, die ich bei all meinen Umzügen verwendet hatte. Das sparte Zeit beim Packen. Die wenigen Sachen meiner Mutter, die ich behalten hatte, waren noch immer verpackt, so wie sie aus Chicago angekommen waren; die Kartons standen aufgereiht an der Wand.
Ich knipste das Licht im Flur an, zog meine nassen Turnschuhe und die Jacke aus und griff nach meiner Post, die im Korb auf dem Tischchen im Flur lag. Ich zog mir trockene Jeans und ein weites Flanellhemd an und sah die Post durch, wobei ich mich innerlich schon auf die gewohnten Mahnungen der verschiedenen Kreditkartenfirmen einstellte, die nicht viel von meiner unregelmäßigen Zahlungsweise hielten. Abgesehen von Werbebriefen war es die einzige Art von Post, die ich seit dem Tod meiner Mutter erhielt.
Der unbedruckte Briefumschlag, der sich da zwischen all den Rechnungen verbarg, war wahrscheinlich wieder so ein unwiderstehliches Sonderangebot, und ich betrachtete es misstrauisch. Genau was ich brauchte: vielleicht die Einladung, einen Timeshare-Anteil an einer Wohnung auf den Bermudas zu erwerben, wobei meine einzige Beziehung zu den Bermudas wohl die Bermudashorts bleiben würden, die ich am vergangenen Wochenende auf dem Flohmarkt gekauft hatte.
Stattdessen enthielt der Umschlag einen Brief von einer Rechtsanwaltskanzlei, deren eleganter Namenszug auf dem Briefkopf prangte: Willis & Willis. Das wär’s also, dachte ich, und mir wurde ein wenig flau im Magen. Die Kreditkartenfirmen verklagen mich. Was würden sie machen, meine Matratze pfänden? Mit gemischten Gefühlen las ich weiter.
In höflichen, gesetzten Worten entschuldigte man sich, dass man mich erst jetzt erreicht habe, was sich dadurch erkläre, dass man etwas Mühe gehabt habe, meine augenblickliche Adresse ausfindig zu machen (was mich nicht überraschte, da ich im letzten Jahr sechs Mal umgezogen war). Willis & Willis fuhren fort, indem sie mir erklärten, dass sie mich leider über das Ableben von Miss Dimity Westwood informieren müssten, die mir zweifellos als Tante Dimity bekannt sei. An dieser Stelle verschwanden sämtliche Gedanken an Kreditkartenfirmen und Werbebriefe, und ich musste mich schnell setzen.
Tante Dimity? Tot?
Ich war tatsächlich wie vom Schlag getroffen. Nein, mehr noch, ich war zu Tode erschrocken. Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich niemals jemandem von Tante Dimity erzählt. Sie hatte mir und meiner Mutter gehört und war viel zu kostbar, um irgendjemanden an ihr teilhaben zu lassen, außer Reginald natürlich. Aber der war nicht im Stande gewesen, mit Anwaltskanzleien über sie zu sprechen. Schnell überflog ich den Rest des Briefes.
Willis & Willis würden sich freuen, wenn ich so bald wie möglich in ihrer Kanzlei vorsprechen würde, um eine Angelegenheit zu besprechen, die in meinem Interesse sei. Es sei nicht nötig, einen Termin zu vereinbaren, man würde mich jederzeit empfangen. Mit tief empfundenem Beileid verblieben sie, stets zu meinen Diensten, William Willis etc.
Ich legte den Brief auf den Kartentisch und starrte ihn an. Das Briefpapier war wirklich. Die Worte darauf waren es auch. Aber vollkommen unwirklich erschien mir die Botschaft, die sie enthielten. »Also, Reginald?«, sagte ich mit einem Blick auf die Schranktür. »Was hältst du davon? Ziemlich verrückt, was?«
Ich erwartete keine Antwort. Seit langem schon hatte ich mir überlegt, dass der Tag, an dem Reginald anfangen würde, mir zu antworten, der Tag sei, an dem ich mich freiwillig in die nächste Klapsmühle begeben würde. Aber andererseits war gerade eine Märchengestalt aus meiner frühen Kindheit aufgetaucht und hatte mir auf die Schulter getippt. Wenn ich richtig hinhörte, würde ich Reginald vielleicht ebenfalls reden hören.
Ich las den Brief noch einmal, diesmal ganz langsam. Dann begutachtete ich ihn aus fachmännischer Sicht. Das Papier war cremefarben, dick und schwer. Wenn man es gegen das Licht hielt, erkannte man seine Qualität am Wasserzeichen und an den Linien, die sich quer darüber zogen. Der Brief war nicht mit einem modernen Drucker ausgedruckt worden, sondern er war mit einer richtigen Schreibmaschine geschrieben und mit einem richtigen Füllhalter unterschrieben. Ich hatte den Eindruck, dass Willis & Willis beabsichtigt hatten, dass ich dies bemerke; man wollte mir zeigen, dass ich ihnen mehr Anstrengung wert sei als das übliche Maß an computergestützter Routine. Ich fragte mich, ob die allerbesten Anwaltskanzleien vielleicht bis heute immer noch Schreiber beschäftigten, nur um die Korrespondenz mit den allerwichtigsten Klienten handschriftlich zu führen und damit ihre besondere Sorgfalt unter Beweis zu stellen.
Bestimmte Satzteile schienen hervorzuspringen, als ob sie fett gedruckt seien. Miss Dimity Westwood. Kein Termin notwendig. William Willis. Und, was am interessantesten war, diese »Angelegenheit, die in Ihrem Interesse ist«, über die zu sprechen sei. Es kam mir seltsamer und seltsamer vor. Ich sah auf meine Uhr, sah nochmals auf den Brief und sah dann die Schranktür an.
»Ach was, Reginald«, sagte ich. »Schließlich habe ich heute Nachmittag ja nichts vor. Und, wie Tante Dimity gesagt hätte, es ist ein Abenteuer.«
Wie es bei vielen Abenteuern der Fall ist, fing auch dieses nicht so an, wie ich es vorgehabt hatte. Die Anwaltskanzlei war einige Straßen südlich des Postplatzes, und ich hatte mir gerade die Busverbindung dorthin überlegt. Es war nicht schlimm – einmal umsteigen und eine kurze Strecke zu Fuß, insgesamt nicht mehr als eine Stunde, wunderbar. Aber natürlich hatte ich noch nicht aus dem Fenster gesehen.
Ich weiß nicht, was an einem Schneesturm im April das Schlimmere ist: die Tatsache, dass der Schnee so nass und matschig ist, oder die Tatsache, dass es schon April ist. Kein Wunder, dass man ihn den schrecklichsten Monat nennt. Für die Busfahrt und die kurze Strecke zu Fuß brauchte ich zwei Stunden, in denen ich mich durch schneidenden Wind, prasselnden Hagel und knöcheltiefen Schneematsch kämpfte. Im zweiten Bus funktionierte außerdem die Heizung nicht. Hätte ich über genügend warme Winterkleidung verfügt, dann hätte ich alle Widrigkeiten nur achselzuckend zur Kenntnis genommen, aber ich hatte gerade lange genug in Los Angeles gelebt, um mich meiner warmen Pullover, meiner Daunenjacke und Schneestiefel zu entledigen, und bisher noch nicht genug Geld verdient, um sie zu ersetzen. Meist machte mir das nichts aus, denn ich hielt mich absichtlich so wenig wie möglich im Freien auf.
Aber diesmal machte es mir etwas aus. Meine dünne Windjacke und meine Turnschuhe waren dem Wetter nicht gewachsen, und als ich Willis & Willis endlich gefunden hatte, war ich bis auf die Haut durchnässt, meine Wangen waren vom Wind blau gefroren, und ich zitterte vor Kälte. Wenn ich nicht Angst gehabt hätte, an Unterkühlung zu sterben, hätte ich es nicht gewagt, wie ein Häufchen Elend die Kanzlei zu betreten.
Was für eine Tür. Man konnte sie nicht gleich sehen, denn zuerst musste man das Tor passieren. Das Tor in der Mauer. Die Mauer, die das Grundstück vom Bürgersteig abgrenzte und eine Messingplatte trug, auf der Name und Adresse in den gleichen Lettern wie auf dem Briefkopf eingraviert waren. Ich vergewisserte mich mehrere Male, dass dies auch die richtige Adresse war. Dann drückte ich auf den Klingelknopf, wurde von der Überwachungskamera erfasst und tatsächlich, aus welchem Grund auch immer, öffnete sich das Tor, und ich wurde eingelassen. Erst auf halbem Wege sah ich die Haustür.
Sie war das genaue Gegenstück zu dem eleganten Briefpapier: massiv und auf Hochglanz poliert, mit einem Löwenkopf als Türklopfer, der im treibenden Schnee matt glänzte. Der Sturm schien einen Augenblick den Atem anzuhalten, sodass ich diesen goldenen Löwen bewundern konnte und das Haus, über das er wachte.
Kapitel 3
ES WAR KLAR, dass die Anwaltskanzlei Willis & Willis für Glas und Edelstahl genauso wenig Verwendung hatte wie für Laserdrucker. Das hier war kein Büro, es war ein Herrenhaus. Eine edle, alte Villa, umgeben und überragt, jedoch nicht im Geringsten unterdrückt von den Bürotürmen auf allen Seiten. Weiß der Himmel, wie dieses Haus hierhergekommen war, und erst recht, wie es hier überlebt hatte. Aber es war hier – eine Oase voller Charme und Würde inmitten einer Wüste aus Stahlbeton.
Na toll, dachte ich. Willis & Willis und das kleine Streichholzmädchen treffen aufeinander. Ich stolperte die Stufen hinauf und ergriff den glänzenden Löwenkopf. Dabei war mir völlig klar, dass ich aussah wie etwas, das nicht einmal eine selbstbewusste Katze ins Haus zerren würde.
Nach zweimaligem Klopfen erschien ein etwas zerknittert aussehender Mann an der Tür. Er war etwa Mitte dreißig, hatte einen kurzen, sauber gestutzten Bart und trug ein ausgebeultes Tweedjackett und Kordhosen. Wenn ich einen Sinn fürs Dramatische gehabt hätte, dann hätte ich diesen Moment gewählt, um ohnmächtig in seine Arme zu sinken – er war ein stattlicher Mann und sah aus, als könne er damit ganz gut umgehen. Er sah mich sprachlos an, während die Schneeflocken auf seinen Brillengläsern zu kleinen Tropfen schmolzen und mir das eiskalte Wasser von der Nasenspitze tropfte. Dann lächelte er, so plötzlich und so strahlend, dass ich mich unwillkürlich umdrehte, um zu sehen, was ihn so entzückt hatte.
»Hallo«, sagte er mit einer Wärme und Begeisterung, die in dieser Situation völlig übertrieben schienen.
»Hallo«, sagte ich etwas unsicher.
»Sie müssen Lori sein«, sagte er, noch immer strahlend. Meine Antwort war ein erneutes, unkontrolliertes Zittern. Es schien zu genügen. Er öffnete die Tür, und mit einer einladenden Geste forderte er mich auf einzutreten.
»Es tut mir leid, dass ich hier herumstehe, während Sie sich zu Tode frieren. Bitte, kommen Sie rein, kommen Sie rein, und wärmen Sie sich erstmal auf.« Er nahm mich beim Ellenbogen und führte mich ins Foyer. »Geben Sie mir Ihre Jacke. Ich werde dafür sorgen, dass man sie zum Trocknen aufhängt. Bitte, setzen Sie sich doch. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Einen Kaffee? Oder Tee?«
»Ein Tee wäre wunderbar«, sagte ich. »Aber wie wussten Sie, wer ich ...«
»Bin gleich zurück«, sagte er kurz und verschwand.
Ich fragte mich, welcher Willis er war, wenn er tatsächlich einer sein sollte (ob wohl ein Willis &/oder Willis seine Tür selbst öffnete?), und warum ein Willis überhaupt so froh sein sollte, dass ich gekommen war. Ich blickte ihm nach, bis er verschwunden war, dann sah ich mich um. Ich hatte es ein Foyer genannt, aber es war viel großartiger, mehr wie eine Empfangshalle mit hoher Decke, mit Ölgemälden an den Wänden und einem riesigen orientalischen Teppich, der bereitwillig das Schmelzwasser aufnahm, das mir aus den Haaren und von Jeans und Schuhen tropfte.
Eine prächtige zweiseitige Treppe schwang sich in großem Bogen um das Sofa mit Gobelinstickerei herum, auf dem ich mit immer noch klappernden Zähnen saß. Vor mir stand ein niedriger Tisch, den eine hohe Vase mit dunkelblauen Schwertlilien schmückte. Ich liebte Schwertlilien, sie waren eine hochwillkommene Erinnerung daran, dass trotz aller Gegenbeweise dort draußen der Frühling nicht mehr weit war. Ein kalter Wassertropfen lief mir am Hals herunter, aber beim Anblick der Blumen tröstete ich mich damit, dass es eines Tages auch wieder warm sein würde.
Mein Gastgeber räusperte sich. Ich sah auf und bemerkte, dass er einen Arm voll Kleidungsstücke trug – ein Sweatshirt mit Kapuze und eine dazu passende Trainingshose, beides in Dunkelrot. Harvard, dachte ich.
»Bitte«, sagte er, indem er mir die Kleidungsstücke reichte.
Ich sah die Sachen an, ohne zu verstehen.
»Ich dachte, Sie würden vielleicht gern etwas Trockenes anziehen?«, half er nach. »Ich habe diese Sachen immer hier, für den Fall, dass ich Lust habe, in den Sportclub zu gehen, und ich kann Ihnen versichern, dass sie sauber sind.« Er klopfte sich auf den nicht gerade sportlich gestählten Bauch. »Ich ziehe sie nicht so oft an, wie ich sollte. Natürlich werden die Sachen Ihnen nicht besonders gut passen, aber ich wusste nicht ...« Er sah mich von oben bis unten an, doch auf eine Art, die man wirklich nicht anzüglich nennen konnte. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ich wenigstens gewusst, woran ich war.
»Größe sechsunddreißig?«, fragte er.
Ich nickte, weil mir keine andere Antwort einfiel.
Sein Gesicht hellte sich auf. »Das werde ich mir merken. Aber im Moment ist dies das Beste, was ich Ihnen anbieten kann. Würden Sie die Sachen einstweilen annehmen, zusammen mit meiner Entschuldigung? Sie können sie im Umkleideraum anziehen, gleich hier entlang, wenn ich Sie bitten dürfte.«
Ich zögerte. Normalerweise nahm ich keine Gefallen von Fremden an. Aber dann sah ich meine blau gefrorenen Finger und beschloss, dieses eine Mal eine Ausnahme zu machen. Ich folgte ihm durch die Halle, dann durch eine große Doppeltür und ein elegantes Büro, bis wir den Raum erreicht hatten, den er als Umkleideraum bezeichnet hatte. Er legte einen Stapel Handtücher zurecht und ging hinaus, wobei er die Tür hinter sich schloss.
Der Umkleideraum war von einem normalen Badezimmer ungefähr so weit entfernt wie das Tadsch Mahal von einer Dorfkapelle. Ich wäre mit Vergnügen hier eingezogen und hätte den Rest meines Lebens hier gewohnt. Der Raum war genauso elegant ausgestattet wie die Eingangshalle und mehr als groß genug, um alle meine Besitztümer aufzunehmen. So etwas hatte ich noch nie gesehen: eine Duschkabine und eine Badewanne mit Whirlpool in grauem Marmor, jede Menge Schrankraum, ein Liegesessel aus Leder, ein Massagetisch, mannshohe Spiegel, Telefon, Stereoanlage, Fernseher mit Videoanlage – einfach alles. Aber am schönsten war der Teppich: Er war so dick, dass sich meine Zehen fast darin verloren. Ich nahm mir Zeit mit dem Umziehen. Ich genoss es, in dieser Umgebung zu sein, die offensichtlich nicht nur dem körperlichen Wohlbefinden diente, sondern auch dem seelischen. Als ich fertig war, ging ich auf Zehenspitzen ins Büro zurück.
Mein Gastgeber saß auf der Schreibtischkante. Als er mich sah, sprang er herunter.
»Socken«, sagte er.
»Wie bitte?«
»Socken – ich habe trockene Socken vergessen. Hier, nehmen Sie diese und geben Sie mir Ihre nassen Sachen. Ich bin gleich zurück.« Wir tauschten, und er verschwand abermals. Der Mann war ein lebender Zaubertrick – gerade war er noch da, im nächsten Moment weg.
Ich zog die Socken an und ging noch einmal in den Umkleideraum, um mein Ensemble zu betrachten. Es war ungefähr, wie ich es erwartet hatte, wenn man bedenkt, dass der Besitzer der Sachen fast zehn Zentimeter größer und um einiges schwerer war als ich. Die Trainingshose war geräumig genug für zwei von meiner Größe, das Sweatshirt mit dem Wappen von Harvard reichte mir bis über den Po, und die Fersen der Socken befanden sich irgendwo oberhalb meiner Knöchel. Meine kurzen dunklen Locken kräuselten sich, während die Haare allmählich trockneten, und vervollständigten das Bild. Nicht schlecht, falls man auf den Typ »Armes Waisenkind« stand.
»Fühlen Sie sich besser?«, fragte die inzwischen vertraute Stimme. Vor Schreck sprang ich auf. Mein Gastgeber sah durch die offene Tür herein.
»Ja, vielen Dank«, antwortete ich. »Ich bin wirklich sehr froh über die trockenen Sachen, aber ... könnten Sie mir vielleicht sagen, wer Sie sind?«
»Hoppla! Das tut mir wirklich Leid, aber Sie sahen so verdammt erfroren und unglücklich aus, dass ich dachte, das Vorstellen könnte warten.« Er lachte leise. »Ich wette, Sie haben mich für den Butler gehalten ...« Sein Lachen ging in ein Husten über, als er mein Gesicht sah, das ihm deutlich zeigte, dass ich nicht die leiseste Ahnung hatte, was ich denken sollte.
»Ich bin Bill Willis«, sagte er schnell. »Nicht William, das ist mein Vater. Wir sind Partner dieser Firma. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie Lori nenne?«
»Nein«, sagte ich.
»Großartig«, sagte er. »Wunderbar. Ich kann Ihnen kaum sagen, wie froh ... Aber bitte, kommen Sie in das Büro nebenan und setzen Sie sich und trinken Sie Ihren Tee. Ich habe Vater Bescheid gesagt, dass Sie hier sind, und er wird gleich kommen. Er freut sich ebenfalls sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir waren beide so gespannt, Sie kennen zu lernen, Sie können es sich kaum vorstellen.« Dieser unerwartete Ausbruch von Begeisterung schwappte wie eine Welle über mich. Ich muss etwas geschwankt haben, denn er war sofort an meiner Seite.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Mir geht’s gut«, sagte ich und wartete, dass der Raum aufhörte, sich zu drehen. Das war schon ein paar Mal vorgekommen, wenn ich nichts gegessen hatte, aber es war peinlich, dass es mir ausgerechnet jetzt wieder passieren musste, vor diesem reichen Rechtsanwalt und Harvard-Absolventen. Sehr aufrecht ging ich an ihm vorbei in den Büroraum nebenan und setzte mich in einen der beiden hohen Ledersessel, die vor dem Schreibtisch standen. »Mir geht es ... sehr gut.«
»Wenn Sie meinen«, sagte er zweifelnd, indem er an den Schreibtisch trat, wo ein silbernes Teeservice stand. Er goss Tee in eine Tasse und brachte sie mir. »Vielleicht sollte ich auch etwas zu essen bestellen.« Er griff nach dem Telefon, aber ich hob abwehrend die Hand.
»Bitte, nicht meinetwegen«, sagte ich in dem Versuch, einen letzten Rest Selbstrespekt zu wahren. »Es ist wirklich nicht nötig. Ich sagte doch, mir geht es gut. Wirklich.«
Nachdenklich strich er sich über den Bart, dann nickte er kurz. »Okay. Ganz wie Sie wünschen. Aber dann trinken Sie wenigstens den Tee. Mein Vater soll nicht denken, dass ich unhöflich gewesen bin, er muss jeden Moment hier sein.«
Das Allheilmittel tat, wie immer, seine Wirkung, und als William Willis senior ins Zimmer trat, war ich imstande, ihm fast gelassen entgegenzusehen. Es war schwer, sich vorzustellen, dass er mit Bill verwandt war. Ein schmächtiger, glatt rasierter Mann Anfang sechzig, mit hoher Stirn und kühn geschwungener Nase, in makellosem dunklem Anzug mit Weste. Nicht nur zog sich Willis senior besser an als sein Sohn, es gab noch einen Unterschied. Denn während Bill seit dem Augenblick, an dem ich über die Schwelle gestolpert war, mich mit Freundlichkeit überschüttet hatte, benahm sich sein Vater so formell, als wäre er gerade einem Benimmbuch entstiegen. Es schien, als wisse er genau, wie viel Kraft, in Pfund pro Quadratzentimeter, sein Händedruck nicht nur bei diesem, sondern auch bei jedem anderen Anlass auszuüben habe. Peinlichst auf Höflichkeit bedacht, merkte man ihm nicht gerade an, dass er sich über irgendetwas freute. Was konnte Bill gemeint haben? Der hatte es sich in dem anderen Ledersessel bequem gemacht und war beim Eintreten seines Vaters still geworden, beobachtete ihn jedoch mit vor Erregung glänzenden Augen.
Nachdem er mich mit dem wohldosierten Händedruck begrüßt hatte, setzte sich Willis senior hinter den Schreibtisch, schloss die mittlere Schublade auf und nahm eine Akte heraus, die er sorgfältig vor sich auf der Tischplatte platzierte. Dann öffnete er sie und sah sich den Inhalt einen Augenblick nachdenklich an, worauf er sich räusperte und seinen Blick auf mich richtete. »Ehe ich anfange, meine junge Dame, muss ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Bitte antworten Sie wahrheitsgemäß, wobei ich Sie darauf hinweisen muss, dass Falschaussagen mit hohen Strafen belegt werden.«
Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, Bill Hilfe suchend anzusehen, aber ich unterdrückte es. Bill seinerseits blieb stumm.
»Könnte ich bitte Ihren Führerschein sehen?«
Ich zog meine Brieftasche aus der Tasche des Sweatshirts und reichte ihm das Gewünschte.
»So«, sagte Willis senior. »Würden Sie mir jetzt bitte Ihren vollen Namen und Ihren Geburtsort nennen?«
So fing das an, was ich später das große Frage-und-Antwort-Quiz nannte – Willis senior stellte die Fragen, ich gab die Antworten. Was war der Mädchenname meiner Mutter? Wo war ich zur Schule gegangen? Wo war mein Vater geboren? Wo hatte ich gearbeitet? Wer waren meine Taufpaten? Und so ging es immer weiter, fast wie eine rituelle Handlung. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, und noch immer folgte Frage auf Frage. Aus dem Augenwinkel konnte ich Bill sehen, dessen Gesichtsausdruck mir unverständlich war. Es hatte mit einem unmerklichen Lächeln angefangen, welches immer freudiger wurde, bis es schließlich in ein großes, wenn auch nicht sehr intelligentes Strahlen überging. Willis senior schien meine Verwunderung zu teilen, denn als er einmal kurz von seinen Papieren aufsah und die Miene seines Sohnes bemerkte, geriet er einen Moment ins Stocken. Abgesehen davon zeigte Willis senior jedoch keinerlei Gefühlsregungen, weder beeilte er sich, noch zögerte er bei seinen Fragen. Nur wenn er umblättern musste, entstand eine Pause.
Meine Erschöpfung musste mich gefügig gemacht haben, denn ich kam nicht einmal auf den Gedanken, ihm eine Gegenfrage zu stellen, wie zum Beispiel »Was geht Sie das alles an?« oder »Wer zum Teufel sind Sie, mich auf diese Art ins Kreuzverhör zu nehmen?«. Die Situation war so unwirklich, dass es mir schien, als spielte ich eine Rolle in einem Stück. Ich war sogar etwas stolz darauf, wie gut ich meinen Text beherrschte. Der hypnotische Rhythmus des Frage-und-Antwort-Quiz hatte mich in eine Art bereitwillige Gleichgültigkeit versetzt, bis Willis senior mir die letzte Frage stellte.
»Und nun, junge Dame, würden Sie meinem Sohn und mir bitte die Geschichte Tante Dimity kauft eine Taschenlampe erzählen?«
Plötzlich saß ich kerzengerade, dann stotterte ich ein paar zusammenhangslose Silben – und wurde ohnmächtig. Der Schock, diese Worte aus dem Mund eines Fremden zu hören, hatte bewirkt, was meine Expedition in Schnee und Kälte nach einem hektischen Tag ohne etwas zu essen nicht vermocht hatte: Das Drama hatte mich eingeholt. Ich erinnere mich nur noch, dass ich nach Luft schnappte, dann lag ich auf einem Sofa und sah verschwommen das Gesicht von Willis senior über mir.
»Miss Shepherd, können Sie mich hören?«, fragte Willis senior, indem er sich zu mir herunterbeugte und mich ansah. »Ah, Sie sind aufgewacht. Gut, gut.«
Ich erkannte ihn kaum wieder. Die kühle Freundlichkeit in seinen Augen war einem Ausdruck warmer Fürsorge gewichen, eine Strähne seines weißen Haars war ihm in die Stirn gefallen, und die Hand, die meine mit so viel Zurückhaltung geschüttelt hatte, legte jetzt eine warme Decke um mich. Plötzlich sah ich die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn ganz deutlich.
»Es tut mir schrecklich leid«, sagte Willis senior mit besorgtem Gesicht. »Ich hatte keine Ahnung, dass es Sie so stark berühren würde. Aber die Bedingungen des Testaments sind ganz klar, und ich musste sicher sein, dass Sie diejenige sind, die Sie zu sein behaupten. Ich hatte genaue Anweisungen, sehen Sie, aber ich hätte mir nie träumen lassen ...«
»Woher wussten Sie es?«, fragte ich benommen. »Woher wussten Sie von Tante Dimity?«
»Ich denke, wir sollten erst mal zu Abend essen. Es sieht aus, als ob Ihnen eine Mahlzeit gut täte«, sagte er. »Und dann werde ich zur Abwechslung Ihre Fragen beantworten. Das wird viel angenehmer für mich sein, und für Sie sicher auch.« Er strahlte mich an. »Ich bin so froh, dass Sie hier sind, meine Liebe. Mir ist, als ob ich Sie schon seit Jahren kenne.«
So sehr es mir auch missfiel, dass meine Fragen abermals abgeschmettert wurden, musste ich doch zugeben, dass etwas zu essen jetzt vielleicht eine wünschenswerte Unterbrechung sei. Ich hatte mich gerade aufgesetzt, als Bill einen Servierwagen ins Zimmer schob.
»Na, bestimmt geht’s uns sehr gut, nicht wahr?«, fragte er spitzbübisch, und ich merkte, dass ich rot wurde. Er schob den Wagen in Reichweite an mich heran und brachte Stühle für sich und seinen Vater. »Wenn es Ihnen noch besser gegangen wäre, hätten wir womöglich einen Krankenwagen rufen müssen.«
»Jetzt ist nicht der Moment für dumme Scherze, mein Junge«, mahnte Willis senior leise. »Wenn du Miss Shepherd etwas zu essen gegeben hättest, als sie ankam, dann wäre uns dieser unglückliche Zwischenfall erspart geblieben.«
»Du hast ganz Recht, Vater. Es war meine Schuld«, sagte Bill, und ich bemühte mich, etwas tiefer in das Sofa zu sinken.
»Bitte, Miss Shepherd, kosten Sie etwas von der Rinderbrühe«, sagte Willis senior. »Es gibt nichts Besseres nach so einer Aufregung. Und dann, wenn Ihnen danach ist, vielleicht eine Scheibe vom Braten ...«
Während sich die beiden Männer um mich bemühten und mir immer wieder den Teller füllten, erzählte ich ihnen zwischen den einzelnen Happen die Geschichte, wie Tante Dimity eine Taschenlampe kaufen wollte. Es war ein komisches Gefühl, dieses Stück meiner Kindheit hier vor diesen beiden Fremden zur Prüfung auszubreiten. Aber Willis senior beruhigte mich, dass es ein wichtiger Punkt des großen Frage-und-Antwort-Quiz sei. Also erzählte ich die Geschichte, Wort für Wort, genau wie meine Mutter sie mir erzählt hatte. Der einzige Unterschied war, dass diesmal statt der Zuhörer die Erzählerin einschlief. Obwohl es erst acht Uhr war, glitt ich, den Dessertteller noch auf dem Schoß, in einen tiefen Schlummer.
Kapitel 4
IN DEN FRÜHEN MORGENSTUNDEN wachte ich auf. Im Zimmer war es noch stockdunkel, aber ich brauchte kein Licht, um zu merken, dass ich nicht in meinem eigenen Bett lag. Die Matratze war fest, und die Kopfkissen waren weich, statt andersherum wie bei mir. Als ich mich reckte, stießen meine Hände an etwas, das sich wie das Kopfende eines Bettes anfühlte, und auf einer Seite ertasteten meine Hände einen Nachtschrank und eine Lampe. Ich schaltete das Licht an.
Nein, es war nicht mein Zimmer. Ein großer Lehnsessel mit Tweedbezug stand in einer Ecke und in der anderen ein kleiner, zierlicher Schreibtisch von der Art, wie man sie in Schaufenstern exquisiter Antiquitätenläden sieht und die in etwa die Hälfte unseres Bruttosozialeinkommens zu kosten scheinen. Auf dem Nachttisch standen eine Kristallkaraffe mit Wasser und ein Glas. Das Fußende des Bettes war aus demselben edlen Holz wie das Kopfende und der Schreibtisch. Die Bettwäsche war in einem männlichen Marineblau gehalten, und auf den Kopfkissenbezug war ein Monogramm in silberner Kursivschrift eingestickt: »W« – für Willis.
Ich setzte mich auf. Plötzlich standen die Ereignisse vom vorigen Tag wieder vor mir, meine Verwirrung klärte sich, und ich kehrte in die ... ja, wohin kehrte ich zurück? Gestern früh war ich noch ein ganz normaler Mensch gewesen, der sich ohne festen Job mühsam durchs Leben schlug und auf einer Matratze am Boden schlief. Und heute früh fand ich mich als verwöhnter Gast eines ehrbaren Rechtsanwalts in einem eleganten Schlafzimmer wieder. »Und was kommt jetzt?«, fragte ich mich leise, als ich mich im Zimmer umsah. »Eine goldene Kutsche und ein schöner Prinz?«
Bei dem Gedanken erschrak ich, denn mit einem Mal kam mir eine andere Erinnerung, eine halb geträumte Erinnerung, wie ich auf Armen, die dem Sohn jenes ehrbaren Rechtsanwalts gehörten, eine lange Treppe hinaufgetragen wurde, demselben Sohn, der mich ... Schnell warf ich einen Blick unter die Decke und sah mit Erleichterung das Wappen von Harvard. Es war peinlich genug, dass man mich wie ein hilfloses Kind ins Bett gebracht hatte, aber es hätte noch schlimmer sein können.
Trotzdem hatte ich noch viele Fragen, aber die konnten warten, bis der Rest des Hauses erwacht war. Inzwischen ... Ich schwang die Beine über die Bettkante. Wenn ich ganz leise und vorsichtig war, könnte ich mich vielleicht etwas umsehen. Schließlich wacht man nicht jeden Morgen mit der Chance auf, ein solches Haus zu erkunden.
Vorsichtig machte ich die nächstbeste Tür auf und entdeckte ein geräumiges Ankleidezimmer mit leeren Wäschefächern, leeren Kleiderbügeln und einem leeren Toilettentisch. Die Handtücher in dem angrenzenden Badezimmer dufteten frisch gewaschen, und auch sonst schien alles nagelneu zu sein: eine unbenutzte Tube Zahnpasta, eine Zahnbürste, noch in ihrer Verpackung, und auf der Ablage zwischen den beiden Waschbecken ein wohlriechendes Stück Sandelholzseife. In der Dusche hingen frisch gefüllte Spender für Shampoo und Duschgel, und auf dem Marmorabsatz lag ein riesiger Luffaschwamm, der aussah, als wäre er gerade eben vom Meeresgrund heraufgeholt worden.
Eine zweite Tür führte in ein hübsch eingerichtetes Wohnzimmer, das von einem breiten Glasschrank beherrscht wurde. Auf Zehenspitzen näherte ich mich dem Möbelstück und sah, dass eine Anzahl von Trophäen und Medaillen darin aufgereiht waren, die für alle möglichen Leistungen verliehen worden waren – von rhetorischen Fertigkeiten bis zu gutem Abschneiden in Griechisch. Es waren auch einige Sportpokale darunter, für gutes Abschneiden in ausgefallenen Disziplinen wie Squash und Fechten, aber die meisten Auszeichnungen waren für akademische Leistungen verliehen worden. Sie alle waren blitzblank geputzt, und auf jeder war der Name William Willis eingraviert. Den Daten nach zu urteilen hatte Bill sie bekommen, nicht sein Vater, und ein ziemlich junger Bill obendrein. Es waren Erinnerungen an die Siege seiner Kindheit und Jugend, die hier in diesem privaten Raum schlummerten.
Beim Anblick des Glasschranks musste ich an den Schiffskoffer denken, den ich in der Hinterlassenschaft meiner Mutter gefunden hatte. Ein Koffer, in dem die Preise und Pokale meiner eigenen Schulzeit sorgfältig verwahrt waren, und es waren nicht wenige gewesen. Der Inhalt hatte mir einen schmerzhaften Schlag versetzt, es war, als ob ich einen Koffer voll unerfüllter Träume gefunden hätte. Träume, die meine Mutter für mich geträumt hatte. Ich betrachtete die Preise hier im Glasschrank und beneidete Bill. Er hatte das Versprechen seiner frühen Jahre eingelöst, während die Tochter der Lehrerin aus Pappkartons lebte.
Ich wandte mich von dem Schrank ab, und als ich meine Kleider vom Vortag entdeckte, verflüchtigten sich meine traurigen Gedanken. Die Sachen lagen säuberlich gefaltet auf dem kleinen Tischchen, nachdem sie zuvor gereinigt, getrocknet und gebügelt worden waren. Es amüsierte mich, dass man meinen alten Klamotten so viel Respekt entgegengebracht hatte, aber es war mir auch etwas peinlich. Bill hatte bestimmt noch nie so fadenscheinige Jeans oder solch schäbige Turnschuhe gesehen. In einem der Schuhe steckte ein Stück Papier. Ich faltete es auseinander, die Worte darauf waren in Großbuchstaben gedruckt und unterstrichen:
BITTE RUFEN SIE 7404 AN,SOBALD SIE AUFGEWACHT SIND!JE EHER, DESTO BESSER!
Ich sah auf die Uhr und stellte fest, dass es fast vier war, dann blickte ich wieder auf den Zettel und zuckte die Schultern. Vielleicht würde ich ja meine Antworten eher bekommen, als ich dachte. Ich nahm also den Hörer vom Telefon, das auf dem Tisch stand, und wählte die Nummer.
Bill antwortete beim ersten Klingeln. »Lori? Wie geht es Ihnen?«
»Gut«, sagte ich, »aber ...«
»Wunderbar. Sie sind auf? Und schon angezogen?«
»Ja, aber ...«
»Gut. Ich komme sofort runter.«
»Aber was ...«, fing ich an, doch er hatte schon aufgelegt. Ich schlüpfte in meine Turnschuhe, und ehe ich sie zugebunden hatte, stand Bill schon an der Wohnzimmertür, rosig und etwas atemlos, in einem Parka mit pelzbesetzter Kapuze.
»Ich hatte gehofft, dass Sie sich vor Sonnenaufgang melden würden«, sagte er. »Kommen Sie jetzt mit, wir müssen uns beeilen. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.«
»Was denn?«
»Das werden Sie gleich sehen.« Sein Gesicht strahlte, als er auf dem Absatz kehrtmachte und durch den Flur davonstürmte. Ich hastete hinterher, und bei meinem Versuch, ihn einzuholen, stießen wir an der ersten Ecke fast zusammen, weil ich gleichzeitig auch noch meine Umgebung in Augenschein nehmen wollte. Aber wer hätte es mir verübeln können?
Meine Suite ging auf einen getäfelten Korridor, in dem Gemälde mit Jagdszenen hingen. Der Läufer auf dem Boden zeigte ebenfalls eine Jagdszene mit Hunden, die den Gang entlangrasten und einen hochmütig dreinschauenden Fuchs anbellten, der außerhalb ihrer Reichweite im äußersten Winkel saß.
Als wir um die Ecke bogen, kamen wir in einen weiteren langen Korridor, dessen Wände mit Stillleben bedeckt waren. In den Läufer hier waren vor einem Hintergrund aus gebrannter Umbra Birnen, Pfirsiche und blassgrüne Trauben eingewebt. Es ging um eine weitere Ecke, und wir eilten eine Treppe aus heller Eiche hinauf, um deren Pfosten sich geschnitztes Weinlaub rankte, ebenso wie um die Balustrade. Jeder Treppenabsatz war etwa so groß wie mein Schlafzimmer. Wenn Bill vorgehabt hatte, mich zu beeindrucken, dann war es ihm gelungen.
»Siehe, das Haus der Willis«, sagte ich leise.
Bill hatte meine Worte gehört. »Gefällt es Ihnen?«, fragte er. »So was entsteht, wenn man von einem uralten Hamstergeschlecht abstammt. Vor über zweihundert Jahren brachten wir all unsere Habe aus England hierher, und soweit ich weiß, hat seitdem kein Familienmitglied jemals etwas weggeworfen. Es würde mich gar nicht wundern, wenn sich herausstellte, dass diese Töpfe hier einmal in den Gräbern unserer Vorfahren Verwendung fanden.« Der »Topf«, den er meinte, war eine hellblaue Porzellanschale, die bis an den Rand mit Orchideen gefüllt war. Die Blumen allein hatten wahrscheinlich mehr gekostet, als ich in einer Woche verdiente.
Schließlich kamen wir am Fuße einer schmalen Treppe an. Sie hatte ein schlichtes schmiedeeisernes Treppengeländer, und die weißen Wände hier waren ohne jeglichen Schmuck. Bill drehte sich um und flüsterte: »Das ist die Wohnung der Dienstboten. Hier schläft man noch.«
Leise gingen wir die Treppe hinauf und einen kurzen Korridor entlang, bis wir einen kleinen Raum erreicht hatten. Er war leer bis auf ein paar Garderobenhaken, an denen verschiedene Jacken hingen, und einen Tisch, auf dem mehrere warme Pullover lagen. Eine Wendeltreppe in der Mitte des Raums führte zu einer Falltür in der Decke. Ich lehnte mich gegen die Wand, während Bill den Haufen von Pullovern durchwühlte. Er wählte einen dicht gewebten Norwegerpullover und gab ihn mir. »Größe acht«, sagte er. »Ziehen Sie ihn an.« Bill hatte schon den Fuß auf die unterste Stufe der Leiter gesetzt und sah mich aufmerksam an. »Geht’s Ihnen gut?«
»Ja«, sagte ich schnaufend. »Es ist nur ... all diese Treppen.«
»Wir können einen Moment hier ausruhen, wenn Sie möchten ...«
»Nein, ich bin okay.«
»Ganz bestimmt?«
»Ja, wirklich«, sagte ich etwas genervt. »Wir können weitergehen.«
Er stieg die Wendeltreppe hoch und kletterte durch die Falltür, und als ich ebenfalls in der Morgenkälte auf dem dunklen Dach stand, schloss er die Tür. Der Mond war nicht zu sehen, aber der Sturm hatte sich ausgetobt und die Wolken vertrieben, sodass der Himmel von Sternen übersät war. Vage konnte ich die Umrisse von Schornsteinen und Abzugsschächten ausmachen. Und dann war da noch etwas ... Ich glaubte zu erkennen, was es war, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was es hier oben machte.
»Kommen Sie.« Bill führte mich ohne Umschweife auf das seltsame Ding zu, das wie ein Zahnarztstuhl aussah, aber unmöglich einer sein konnte. Aber es war einer. Daneben lag etwas, das wie ein wasserdichter Überzug aussah.
»Den habe ich schon seit meiner Collegezeit«, sagte Bill und klopfte liebevoll auf die Kopfstütze. »Hab ihn in einer Versteigerung ergattert. Ich wusste genau, wo ich ihn hinstellen würde. Nehmen Sie Platz.«
Ich sah Bill an, dann den Stuhl, und einen Augenblick hatte ich die verrückte Vorstellung, dass sich irgendwo hinter den Schornsteinen eine Schar von Bediensteten verstecken könnte, die auf Bills Kommando hervorspringen und »April, April!« rufen würde.
»Schnell«, sagte er. »Es ist fast vorbei.«
Seine Dringlichkeit steckte mich an, rasch kletterte ich auf den Stuhl. Er war wie die Sitze eines teuren Sportwagens mit Schaffell überzogen, ein hochwillkommenes Stück Luxus an diesem kalten Morgen. Bill ergriff den Hebel und ließ das Kopfteil zurücksinken, bis ich direkt in den sternenübersäten Himmel sah.
»Wonach soll ich Ausschau halten?«, fragte ich.
»Das werden Sie merken, wenn Sie es sehen«, erwiderte er.
Ich blickte weiter in den Himmel. Die hohen Gebäude ringsum und die dunklen Lücken dazwischen gaben mir ein Gefühl, als sei ich ein ganz kleiner Käfer in einer großen Flasche. Ich hatte nichts dagegen, als Bill mir die Hand auf die Schulter legte und flüsterte: »Ein bisschen Geduld.«
Dann sah ich sie. Sternschnuppen. Nicht nur eine oder zwei, sondern ein Dutzend, silberne Schweife, die über den samtig-dunklen Himmel huschten und verschwanden, als ob das All uns eine geheime Botschaft senden wollte. Ich umklammerte die Stuhllehne und hatte das Empfinden, als ob Bills Hand auf meiner Schulter das Einzige war, das mich davor bewahrte, hinauf in die unendliche Dunkelheit zu fallen, und dabei schwindelte mir etwas.
Es hörte so plötzlich auf, wie es angefangen hatte.
Einen Augenblick war es still, dann sagte Bill: »Es gibt ein paar Dinge auf der Welt, die wirklich nicht auf einen warten, und dazu gehört auch ein Sternschnuppenschwarm. Ich halte es für ein gutes Omen, dass sich die Wolken rechtzeitig verzogen haben, sodass Sie in den Genuss dieses Anblicks kamen.«
Die Wärme in seiner Stimme brachte mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich stellte fest, dass ich mich mitten in Boston auf einem Zahnarztstuhl sitzend auf dem Dach eines Herrenhauses befand, einen völlig fremden Mann an meiner Seite. Und dass dieser völlig fremde Mann mit mir in einem Tonfall sprach, den man normalerweise nur gegenüber sehr guten Freunden an den Tag legt. Argwöhnisch sah ich ihn an, als er den Stuhl wieder aufrecht stellte.
»Machen Sie das mit allen Ihren Klienten?«, fragte ich.
»Nein, das tue ich nicht.« Seine Stimme klang amüsiert. »Das hier ist mein privates Reich. Aber ich möchte Ihnen noch etwas zeigen, wenn wir schon mal hier oben sind – falls Sie sich dazu in der Lage fühlen.«
»Falls ich mich ...« Ich ignorierte seine ausgestreckte Hand und sprang allein von dem Stuhl. »Sie sollten eines wissen, Bill. Trotz meiner jämmerlichen Vorstellung gestern Abend bin ich keine Invalide.«
»Natürlich nicht.« Er zog den Überzug über den Stuhl. »Sie wiegen nur zwanzig Pfund zu wenig, und wenn Sie schnell eine Treppe hinauflaufen, schnaufen Sie wie eine Dampfmaschine, aber Sie sind ganz bestimmt keine Invalide. Kommen Sie.«
Ich sah ihn fassungslos an, bis er schon fast in der Dunkelheit verschwunden war, dann setzte ich ihm nach. Am liebsten hätte ich ihm meine Meinung gesagt, aber es ging um Schornsteine und Abzugsschächte herum bis zu einer kleinen Kuppel mitten auf dem Dach. Und noch ehe ich ein Wort sagen konnte, hatte er sich durch eine niedrige Tür geduckt, dann trat er zurück, um mich ebenfalls eintreten zu lassen. Er machte die Tür zu und zündete eine Öllampe an – und die Wände um uns herum wurden mit einem Schlag lebendig.
Die gesamte Fläche, vom Fußboden bis zur Decke, war mit Bildern bemalt: die Zwillinge Castor und Pollux, Orion mit Gürtel und Schwert sowie die Königin Kassiopeia, um nur ein paar zu nennen. In die Gemälde waren geschliffene Kristalle eingelassen, die wie winzige Sternbilder funkelten, und mitten im Raum stand ein altes, auf Hochglanz poliertes Messingteleskop. Bill hob die Lampe hoch und genoss sichtlich den Anblick meiner vor Staunen weit aufgerissenen Augen.
»Mein Gott«, brachte ich schließlich hervor, »das ist ja unglaublich. Haben Sie das gebaut?«
»Das Einzige, was ich hier gemacht habe, war, einen Telefonanschluss hineinzulegen. Alles andere« – er ließ seinen Blick über die glitzernde Kuppel schweifen – »beruht auf einem Einfall von meinem Urgroßonkel Edmund.«
»Urgroßonkel Edmund?«
»Na ja, jede Familie hat so einen Urgroßonkel, und wir hatten eben Edmund.« Bill hielt mir die Laterne hin, kramte in einem Schrank und zog ein Ledertuch heraus. »In England hätte man ihn einen Exzentriker genannt«, sagte er, indem er mit dem Tuch über die glänzende Oberfläche des Teleskops wischte, »aber hier hielt man ihn für völlig übergeschnappt. Die Familie fiel von einer Ohnmacht in die andere, weil er das ganze schwerverdiente Geld für seine Sternenguckerei ausgab, aber ich zumindest bin dem alten Kauz sehr dankbar. Es stimmt schon, als Observatorium ist es heute nicht mehr zu gebrauchen, es stehen zu viele Gebäude in der Nähe, und die Stadt ist jetzt viel zu hell. Aber als er es baute, war dieses Haus das höchste im Umkreis, und nachts war die Stadt kaum beleuchtet. Die einzigen Lichtquellen waren eher von dieser Art.« Er deutete auf die Öllampe. »Das sanftere Licht eines sanfteren Zeitalters.«
»Es ist zu meinem Versteck geworden«, fuhr er fort. »Ich entdeckte es, als ich ein Junge war, und hier bin ich immer hergekommen, wenn ich das Bedürfnis hatte, allein zu sein. Nur die Sterne und ich. Und jetzt Sie.«
Da war sie wieder, diese Wärme in seiner Stimme, und wieder wurde mir unbehaglich. »Danke, dass Sie es mir gezeigt haben«, sagte ich. Und um die eingetretene Stille zu unterbrechen, fügte ich hinzu: »Eigentlich verdiene ich es nicht, nachdem ich Sie bei Ihrem Vater in ein schlechtes Licht gerückt habe.«
»Was meinen Sie damit?«
»Nun, als er gestern Abend meinte, dass Sie mir etwas hätten zu essen geben sollen. Sie hatten es ja versucht, und ich hätte es ihm sagen müssen.«
»Ach das.« Er faltete das Ledertuch zusammen und legte es in den Schrank zurück. »Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen.«
»Nein, wirklich, es tut mir leid, dass ich ihn in dem Glauben ließ, Sie hätten mir nichts angeboten.«
»Es ist schon in Ordnung.«
»Nein, es ist nicht in Ordnung. Ich hätte ...«
»Ich verstehe ja, aber es war wirklich nicht nötig ...«
»Bill!« Dachte er etwa, er allein hätte die guten Manieren gepachtet? Einerseits zeigte er mir hier alle diese wunderschönen Dinge, und andererseits ließ er es nicht einmal zu, dass ich etwas so Selbstverständliches wie eine Entschuldigung für mein schlechtes Benehmen loswurde.
»Wenn ich sagen will, dass es mir leid tut, dann werde ich es sagen, okay? Ich verstehe nicht, warum Sie das nicht ...«
»Angenommen«, sagte er.
»Was?«
»Ich nehme Ihre Entschuldigung an.«
»Also ... dann ist es ja in Ordnung«, murmelte ich. Er hatte mir völlig den Wind aus den Segeln genommen.