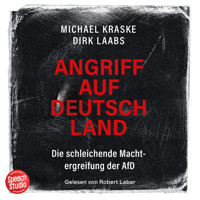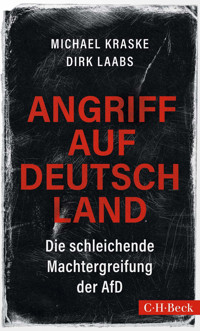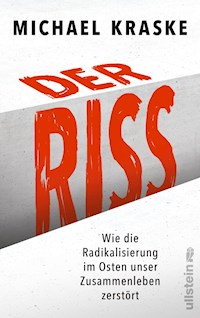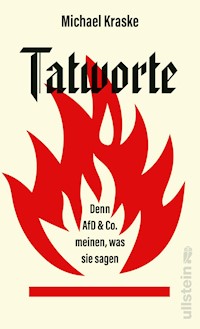
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die AfD fällt immer wieder mit hetzerischen, anti-muslimischen und demokratiefeindlichen Aussagen auf. Reden vom »Bevölkerungsaustausch« oder die Verunglimpfung »alimentierter Messermänner« sind der Vorläufer von rassistischer Gewalt sowie Rechtsterrorismus. Gauland, Höcke, Weidel & Co. sind ideologische Überzeugungstäter, die Sprache ganz bewusst einsetzen, um ihre radikalen politischen Ziele durchzusetzen. Michael Kraske untersucht Zitate von AfD-Politikern, Pegida-Aktivisten und Verschwörungserzählern, die vom Vormarsch rechten Denkens und völkischer Ideologie zeugen. Verachtung und offener Hass gegen Andersdenkende, Ermächtigungsfantasien und unverhohlene Drohungen gehören für sie zum Standardrepertoire. Es ist höchste Zeit, die verbalen Brandstifter beim Wort zu nehmen und sie zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tatworte
Der Autor
MICHAEL KRASKE, Jahrgang 1972, ist Journalist und Autor von Sachbüchern und Romanen. Sein politisches Sachbuch Der Riss. Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört (Ullstein 2020) wurde mit dem Otto-Brenner-Preis Spezial für kritischen Journalismus ausgezeichnet.Als Journalist arbeitet er u. a. für Spiegel Online, Die Zeit, Tagesspiegel, MDR.
Von Michael Kraske ist in unserem Hause bereits erschienen:Der Riss. Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört. Ullstein 2020
Das Buch
Die AfD fällt immer wieder mit hetzenden, anti-muslimischen und demokratiefeindlichen Aussagen auf. Mit Hate Speech und Geschichtsrevisionismus schafft sie einen Handlungsrahmen, der rassistische Gewalttaten und antidemokratischen Widerstand legitimiert und als neue Normalität zu etablieren versucht.Michael Kraske untersucht Reden, Aussagen und Posts von einschlägigen Politikern, Polit-Aktivisten, Prominenten und Trittbrettfahrern, die den Vormarsch rechter Verschwörungstheorien, völkischer Ideologie und anti-demokratischer Überzeugungen belegen. Verachtung und offener Hass gegen Andersdenkende, Ermächtigungsfantasien und unverhohlene Drohungen gehören für sie zum Standardrepertoire. Durch seine genaue Analyse bekannter und unbekannter Tatworte gibt er uns das Rüstzeug, die Grenzverletzer zu stellen und den Diskurs in demokratische Bahnen zu lenken.
Michael Kraske
Tatworte
Denn AfD & Co. meinen, was sie sagen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage März 2021© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung: Brian Barth, BerlinAutorenfoto: © Paul MaurerE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-2520-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Von Worten und Taten
Verrohung der politischen Kultur und offener Hass
Rassistische Feindbilder, Anti-Islam und Antisemitismus
Die Revision deutscher Geschichte
Zwischen rechter Verschwörungsideologie und völkischem Denken
NS-Sprache reloaded
Ermächtigungsfantasien und unverhohlene Drohungen
Bürgerlicher Rassismus und populistische Trittbrettfahrer
Nehmt sie beim Wort!
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Von Worten und Taten
Von Worten und Taten
Aus Worten werden Taten. Mit jeder Mobilisierung von rechts, nach jedem neuen Terroranschlag wird die Formel im politischen Diskurs reflexhaft bemüht. Nach Heidenau und Chemnitz war das so, nach Halle und Hanau. Aus Worten werden Taten. Wie genau und welche bleibt meistens offen. Die richtige, aber abgenutzte Formel führt jedoch nicht dazu, Radikalisierungsprozesse politisch und gesellschaftlich angemessen zu analysieren und wirkungsvolle Gegenstrategien zu entwickeln. Das öffentliche Entsetzen über Gewalt und rechten Terror verebbt immer schneller. Der mörderische NSU-Terror hat das Land noch erschüttert. Es folgten parlamentarische Untersuchungsausschüsse, ein Mammut-Prozess in München und intensive Berichterstattung in den Medien. Nachdem im Februar 2020 ein Täter in Hanau aus rassistischen Motiven neun Menschen in und vor Shisha-Bars ermordete, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete, gingen Politik und Medien schon nach wenigen Tagen ohne intensive Ursachenforschung wieder zur Tagesordnung über. Obwohl oder gerade weil der Terroranschlag und versuchte Massenmord an Juden in Halle durch einen jungen Antisemiten und Rassisten erst wenige Monate zurücklag.
Der Umgang mit verbalen Tabubrüchen sowie radikaler und enthemmter Sprache folgt einem ähnlichen Muster. Mittlerweile hat sich die Gesellschaft angesichts einer systematischen sprachlichen Hemmungslosigkeit der radikalen Rechten daran gewöhnt, dass Politiker wie Alexander Gauland (AfD) den Nationalsozialismus als »Vogelschiss« verharmlosen oder ankündigen, politische Gegner »jagen« zu wollen. Diese Normalisierung des vormals Unsagbaren hat einen gefährlichen Effekt: Die Gesellschaft stumpft ab und wird unsensibel für Verrohungen. Generell wird öffentlich geäußerte Sprache als Träger von Ideologie und Orientierungshilfe für unser Handeln permanent unterschätzt.
Wie Worte unser Denken und letztlich auch Handeln bestimmen, zeigen zwei Experimente auf eindrucksvolle Weise. Einmal wurden Probanden folgende Sätze vorgelegt: »John wollte das Vogelhaus reparieren. Er schlug auf den Nagel, als sein Vater hinzukam.« Anschließend gab über die Hälfte der Probanden an, das Wort »Hammer« gelesen zu haben – das ja gar nicht im Text vorkam. In einem zweiten Versuch wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekam einen Text vorgelegt, in dem Wörter wie »aggressiv« und »unfreundlich« standen. Im Artikel der zweiten Gruppe ging es darum, andere zu »respektieren« und »höflich« zu sein. Nach der Lektüre gab es eine Diskussion – mit einem verblüffenden Ergebnis. Während diejenigen, die etwas über einen freundlichen Umgang gelesen hatten, sich respektvoll an der Debatte beteiligten, ohne andere zu unterbrechen, platzten die anderen unwirsch in die Gespräche, um sich Gehör zu verschaffen. Die Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling wertet die Experimente als Beleg dafür, wie eng Worte, Gedanken und Taten miteinander verknüpft sind.1
Eine wichtige Erkenntnis der Forschung ist, dass Aussagen nicht isoliert für sich stehen. Jede Aussage aktiviert vielmehr einen bereits vorhandenen Deutungsrahmen, sogenannte frames, und liefert ein ganzes Bündel semantischer Vorstellungen. Diese frames sind hochgradig selektiv, sie werten und interpretieren sprachliche Inhalte. Und sie beeinflussen, wie wir handeln. Der Begriff »Flüchtlingswelle« weckt beispielsweise das apokalyptische Bild einer Naturkatastrophe und entmenschlicht Individuen. Menschen werden zu einer amorphen, bedrohlichen Masse degradiert. Der angebliche »große Bevölkerungsaustausch« behauptet, dass die einheimische Bevölkerung durch Migranten ersetzt werden soll und schürt auf diese Weise existenzielle Ängste. So werden aus Worten tatsächlich Taten. Besonders mächtig sind Sprachbilder, durch die wir uns die Welt erschließen. Um komplexe Wirklichkeit überhaupt erfassen zu können, greifen wir üblicherweise auf Metaphern zurück, die sich nach und nach in unseren Sprachgebrauch einschleichen und festsetzen, bis sie irgendwann völlig unreflektiert und wie selbstverständlich benutzt werden, siehe »Flüchtlingswelle«. Und damit verbunden auch die dahinterstehenden Ideen und Vorstellungen. Viele davon sind harmlos, einige hingegen toxisch.
Im öffentlichen Diskurs kommt zu kurz, dass politischer Verbalradikalismus kein Zufall ist, sondern von Akteuren bei AfD, Pegida und anderen rechten Gruppierungen als kalkulierte Strategie eingesetzt wird: um die Gesellschaft an rassistische oder rechtsextremistische Ideologie zu gewöhnen und autoritäre, diskriminierende Politik gegen Minderheiten legitim erscheinen zu lassen. Im Alltagsgeschäft ist es gängige Praxis zu vieler Medienwissenschaftler*innen und Journalist*innen geworden, rassistische Aussagen von AfD-Politikern als »Provokation« und »Stöckchen«, über die man nicht springen dürfe, zu verharmlosen, als ob es den Radikalen ausschließlich um Aufmerksamkeit gehe und sie eigentlich gar nicht meinen, was sie sagen. Diese Strategie, Rassismus, Geschichtsrevisionismus und Demokratieverachtung vorauseilend kleinzureden, entlässt die vermeintlichen Provokateure aus der Verantwortung. Ja, wenn Alice Weidel in einer Bundestagsrede von »Kopftuchmädchen« spricht, ist das auch ein populistischer Trick, um maximale Erregung und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber eben nicht nur. Der ideologische, in diesem Fall rassistische Kern solcher Botschaften muss endlich klar benannt und ernst genommen werden. Wie er wirkt, wem er schadet. Muslim*innen, Jüd*innen, People of Color – Minderheiten berichten davon, permanent einem zunehmend offen ausgelebten Antisemitismus und Alltagsrassismus ausgesetzt zu sein. Diese schleichende Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas folgt auch aus Hasssprache und der Mobilisierung von Vorurteilen und Abwertungen jenen gegenüber, die angeblich nicht nach Deutschland gehören. Wir dürfen Rassismus, Häme, Hass und Ermächtigungsfantasien inklusive Gewaltandrohungen nicht mehr als Provokation abtun, sondern sollten den naheliegenden Schluss ziehen: Die meinen, was sie sagen.
Die vergangenen Jahre waren geprägt durch Radikalisierungsprozesse auf verschiedenen Ebenen. Während der sogenannten Flüchtlingskrise explodierte die Gewalt gegen Geflüchtete. Im Jahr 2016 registrierten die Behörden etwa 3500 Angriffe, davon allein etwa 1000 auf deren Unterkünfte.2 Der Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke wurde als erster Politiker in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mutmaßlich von einem Rechtsextremisten ermordet. Es gab die antisemitischen und rassistischen Terroranschläge von Halle und Hanau, darüber hinaus bildeten sich neue terroristische Vereinigungen wie »Revolution Chemnitz«, die darauf zielten, einen Bürgerkrieg zu provozieren und das verhasste demokratische System an einem Tag X abzuschaffen. Der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick warnt davor, dass sich unterdessen ganz verschiedene gesellschaftliche Milieus politisch radikalisieren, wie sich auch an den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen deutlich gezeigt hat.3 Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Interessen erscheint beispielsweise rechtspopulistisch eingestellten Bürgern zunehmend akzeptabel.4 Wenn jemand bereit ist, Gewalt zu tolerieren, betrifft das aber nicht nur seine Einstellung, sondern auch die Handlungsebene. Spätestens da wird es gefährlich: Seit Jahren nehmen Drohungen und Angriffe auf jene zu, die sich politisch engagieren: als Bürgermeister*innen, Politiker*innen, in Vereinen und Initiativen. Der Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, wurde aus rassistischen Motiven niedergestochen. Der sächsische SPD-Chef Martin Dulig erhielt per Post eine Gewehr-Attrappe als Warnung. Dieter Spürek, CDU-Bürgermeister von Kerpen in NRW, erklärte nach einer Drohung gegen seine Kinder den Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Vielen ergeht es ähnlich, ohne dass ihre Geschichten publik werden. Konfliktforscher Zick warnt vor einer wachsenden Bedrohung durch Personen und Gruppen, die sich durch Emotionalisierung und Ideologisierung radikalisieren: »Wir wissen aus der Forschung, dass eine hoch emotionalisierte ideologische Orientierung eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in Gewalt zu münden, als weniger emotionalisierte Ideologien.«5 Die Bedeutung von Ideologie, Rassismus und Vorurteilen gegen ganze Gruppen von Menschen wird hierzulande routinemäßig unterschätzt, so der Sozialpsychologe Zick.
Die gesellschaftliche Radikalisierung zeigt sich in den sozialen Medien, wo via Twitter, Facebook oder Telegram gepöbelt, gedroht und gehetzt wird. Sie zeigt sich lokal genauso wie international, wenn sich rechtsterroristische Mörder im neuseeländischen Christchurch und später in Halle an der Saale auf ähnliche Verschwörungsideologien beziehen. Sie zeigt sich mittlerweile auch in den deutschen Parlamenten, in die mit der AfD ein schneidender, verächtlicher Ton eingezogen ist. Die Sozialforschung registriert seit einigen Jahren, dass zwar geschlossen rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung eher abgenommen, zugleich aber vor allem in der gesellschaftlichen Mitte die Vorurteile gegen Minderheiten wie Migranten und Muslime massiv zugenommen haben. Während solche Einstellungen über viele Jahre eher im Verborgenen wirkten und von keiner Partei bedient wurden, betraten mit der Pegida-Bewegung und der AfD politische Akteure die Bühne, die das Ressentiment seither ganz bewusst schüren. Rassistische, geschichtsrevisionistische und antipluralistische verbale Angriffe und Diskurse gegen Muslime, Migranten, das »Merkel-System« oder einfach »die da oben« werden maßgeblich von AfD-Politikern initiiert und befeuert. Ihnen gebührt daher in diesem Buch die größte Aufmerksamkeit.
Bei meiner Untersuchung politischer Aussagen auf ihren Inhalt sowie die innewohnende Ideologie und Wirkung ist wichtig, dass kein simpler Reiz-Reaktions-Mechanismus behauptet wird. Radikale Sprache ist kein Knopf, dessen Betätigung automatisch eine einzige mögliche Wirkung erzeugt. Wie beschrieben erzeugt Sprache zunächst einen Rahmen des Sagbaren, Denkbaren und schließlich auch Machbaren. Björn Höcke geht es eben nicht ausschließlich darum, maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen, indem er mit Reizwörtern provoziert. Vielmehr versucht er, eine neue Wirklichkeit zu erzeugen, in der das Undenkbare denkbar wird. Die allermeisten halten es derzeit wohl für undenkbar, Menschen mit Migrationshintergrund, die hier seit vielen Jahren bestens integriert leben, zu entrechten und gegen ihren Willen abzuschieben, was einer Deportation gleichkäme. Gleichwohl droht AfD-Politiker Björn Höcke ein »großangelegtes Remigrationsprojekt« an und raunt über eine »Politik der ›wohltemperierten Grausamkeit‹«. Der Jenaer Rechtsextremismusexperte Matthias Quent weist darauf hin, dass eine Segregation von Menschen wegen ihrer Abstammung, Herkunft, Kultur oder Religion ohne ungeheuerliche Gewalt gar nicht denkbar ist. Solche Konsequenzen gilt es bloß zu legen und kontinuierlich davor zu warnen.
Sozialforscher Quent spricht von einer »Bildsprache der Unmenschlichkeit«, die von der radikalen Rechten forciert werde.6 Zwar würden nur wenige letztlich zu Vollstreckern physischer Gewalt. Diesen gewaltbereiten Aktivisten aber kann Hasssprache und die Stigmatisierung von Minderheiten als Legitimation für Taten dienen. Die an Verrohung Gewöhnten wiederum kann die kontinuierliche Desensibilisierung davon abhalten, die gesellschaftlich überlebensnotwendige Ächtung von Diskriminierung und Gewalt zu organisieren. So werden die demokratischen Grundlagen in einem schleichenden Prozess geschwächt. Konfliktforscher Andreas Zick ist sich sicher, dass etwa Wahlkämpfe, in denen Politiker menschenfeindliche Vorurteile gegen einzelne Gruppen bedienen, nicht folgenlos bleiben. Wenn primär Opfergruppen für gesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht werden, so Zick, münde das garantiert in Aggression und Gewalt.7
Forscher des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld haben für eine Studie den Zusammenhang zwischen Hasstaten und Wahlstimmen für die AfD untersucht.8 Dazu glichen sie Daten der Bundestagswahl von 2017 aus 401 deutschen Kreisen und Städten mit registrierten Gewaltstraftaten ab. Das Ergebnis: Die AfD war vor allem dort erfolgreich, wo die Arbeitslosigkeit hoch und der Ausländeranteil gering war. Darüber hinaus wurden in diesen AfD-Hochburgen besonders viele Angriffe gegen Geflüchtete angezeigt. Rassistische Rhetorik und Szenarien, die Menschengruppen zu einer existenzbedrohenden Gefahr stilisieren, sind offenkundig ein idealer Nährboden für Gewalt.
Es lohnt sich, noch einmal in Erinnerung zu rufen, was wir alles zu hören bekamen, seit die AfD immer erfolgreicher und radikaler wurde. Es wurde behauptet, dass man notfalls an der Grenze auch auf Frauen und Kinder schießen müsse und wir uns nicht von großen Kinderaugen erpressen lassen dürften. Unsere Erinnerungskultur, die den Holocaust als bleibende Verantwortung unserer Staatsräson begreift, gehöre um 180 Grad gedreht, also ins Gegenteil verkehrt. Eine türkischstämmige Politikerin solle in Anatolien »entsorgt« werden. Man will sich das Land und Volk von den sogenannten Altparteien zurückholen. Dann, ja dann, werde richtig »ausgemistet«. Bis es so weit ist, wolle man die Bundeskanzlerin »jagen«. Oder noch besser einsperren, wie bei rechten Demos gefordert wird.
Die Anlässe und verbalen Brandstifter, die solche Ungeheuerlichkeiten verbreiten, werden regelmäßig öffentlich entschuldigt und aus dem diskursiven Kurzzeit-Speicher gelöscht. Meistens reicht die halbherzige Schutzbehauptung: Das war ja gar nicht so gemeint. Aber damit ist das Gesagte nicht aus der Welt. Im Gegenteil. Es bleibt im kollektiven Gedächtnis – und verändert die politische Kultur. Nicht selten wird Kritik an menschenverachtender Politrhetorik auch noch systematisch delegitimiert, indem sie als Ausdruck einer political correctness geschmäht wird, die angeblich die freie Rede bedroht. Absurderweise geht die Behauptung eines eingeschränkten »Meinungskorridors«, innerhalb dessen überhaupt nur argumentiert werden dürfe, mit einer beispiellosen Entgrenzung einher.
Das hat auch mit der Unsicherheit von Journalist*innen und Redaktionen zu tun, die zu oft nicht wissen, wie sie mit Demokratiefeindlichkeit und offenem Rassismus umgehen sollen. In Interviews überließen Redaktionen AfD-Politikern wie Alexander Gauland regelmäßig das letzte Wort, anstatt verbale Grenzverletzungen zu kritisieren. Typisch ist in der Medienlandschaft auch, auf schwammige Floskeln wie »umstritten« zurückzugreifen oder sich vor einer eigenen Analyse zu drücken, etwa indem eindeutiger Rassismus wie Höckes Gerede vom »afrikanischen Ausbreitungstyp« nicht als solcher benannt, sondern lediglich berichtet wird, es gebe Kritik daran. Härteste Aussagen, gefolgt von medialem Wischiwaschi. AfD-Politiker sagt dies, Politiker XY kritisiert das, die Kritisierten dürfen dann noch mal ihren Kritikern widersprechen. Das war’s dann.
Dieses Buch ruft einerseits drastische Aussagen ins Gedächtnis zurück, die folgenlos den demokratischen Minimalkonsens verlassen und damit den politischen Diskursraum verschoben haben – indem sie beispielsweise rassistische oder geschichtsrevisionistische Argumente enttabuisiert und normalisiert haben. Darüber hinaus holt es aber auch weit weniger bekannte Statements bekannter und unbekannter verbaler Brandstifter ans Licht, die belegen: Hass, Verächtlichkeit gegenüber Menschen und Institutionen, Rassismus und Ermächtigungsfantasien sind keine zufälligen Ausrutscher, sondern strategische Instrumente der radikalen Rechten. Da gehen nicht im Eifer des Wahlkampfgefechts oder in der Euphorie einer politischen Versammlung die Pferde mit besonnenen Denkern und Rednern durch, sondern ihre Radikalität ergibt sich zwangsläufig aus völkisch-nationalistischer Ideologie und der Ablehnung fundamentaler Spielregeln der pluralistischen Demokratie. Oder vereinfacht gesagt: Die meinen es bitter ernst.
Wer sich genauer anschaut, was Alice Weidel, Björn Höcke, Jörg Meuthen oder Alexander Gauland über Muslime, unsere Erinnerungskultur oder die Verfasstheit unserer Gesellschaft zu sagen haben, kommt zu verblüffenden Ergebnissen: dass nämlich Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten in Ton und Inhalt die oft getroffene Unterscheidung in vermeintlich Gemäßigte und Radikale in der AfD mehr als fragwürdig erscheinen lassen. Wenn der von vielen Redaktionen immer noch wie ein bürgerlicher Politiker behandelte Ehrenvorsitzende der Partei, Alexander Gauland, darüber spricht, dass die Deutschen angeblich gegen Migranten ausgetauscht werden sollen, klingt er seinem Parteifreund Björn Höcke zum Verwechseln ähnlich. Höcke wiederum wird auch von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang als Rechtsextremist eingestuft.9 Zu lange kamen jene, die mit Worten zündeln, damit durch.
Sprachliche Verrohung geht aber längst nicht immer nur vom erstarkten rechten Rand aus. Immer wieder bedienen auch Politiker und Persönlichkeiten, die sich selbst in der politischen Mitte verorten, rassistische Stereotype oder verbreiten wohlkalkuliert populistische Parolen. Sie heißen Söder, Seehofer oder Lindner, sind in der CSU oder der FDP. Diese populistischen Trittbrettfahrer schüren bisweilen Ressentiments und tragen mit radikalen Worten effektheischend rechte Diskurse in ihre Wählerschaft. Einige wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder haben ihren zwischenzeitlich strammen Rechtskurs mittlerweile korrigiert, aber ihre Worte wirken nach. Anders ist es bei Thilo Sarrazin, der nicht als Trittbrettfahrer, sondern als entscheidender Impulsgeber und Anstifter für neue völkische und rassistische Diskurse gelten kann. Doch egal, ob aus taktischem Kalkül oder aus Überzeugung: Stimmungen gegen Minderheiten zu schüren, vergiftet das politische Klima, stellt Menschen kollektiv an den Pranger und senkt die Hemmschwelle für Gewalt gegen Minderheiten. Rassismus bleibt Rassismus, unabhängig davon, ob er in der AfD, der SPD oder der CDU / CSU, von Grünen oder Linken geäußert wird.
Jede Demokratie braucht Streit, Diskurs und offene Worte. Dazu gehört aber unbedingt auch Widerspruch gegen Demokratie- und Menschenfeindlichkeit. Oder um es frei nach Karl Popper zu sagen: Keine Toleranz für Intoleranz!