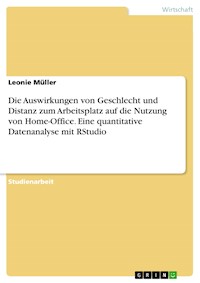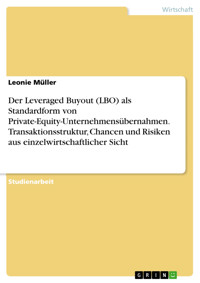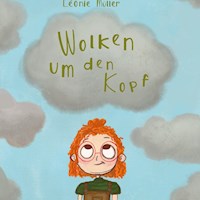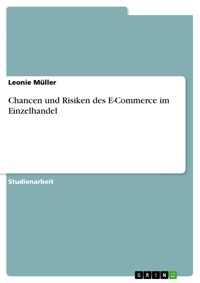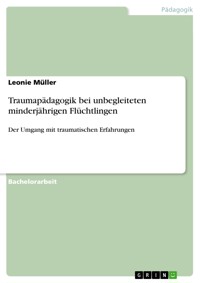12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die vermutlich bekannteste Bahnfahrerin der Welt: Zugnomadin Leonie Müller berichtet von allem, was sie in ihrem abenteuerlichen Jahr auf der Schiene herausgefunden hat Seit Leonie Müller ihre Wohnung aufgegeben hat, pendelt sie durch ganz Deutschland. Statt aufregende Reiseabenteuer nur an wenigen freien Tagen im Jahr zu erleben, schafft es die Studentin, dass sich sogar die Wartezeit auf verspätete Züge anfühlt wie eine Pause vom Alltag. In "Vom Versuch, nirgendwo zu wohnen und überall zu leben" lässt sie uns an ihren klugen Gedanken teilhaben: Sie erzählt davon, wie es ist, wenn alles, was man braucht, in einen 40-Liter-Rucksack passt. Sie fragt sich, was Heimat in unserer multilokal lebenden Gesellschaft eigentlich noch bedeutet. Wie fühlt es sich an, dauerhaft unterwegs zu sein? Wo ist eigentlich Zuhause? Warum hat der Begriff "Heimat" eigentlich immer noch keinen Plural? Und wo ist der Ernst des Lebens so plötzlich hergekommen und wie schicken wir ihn wieder dahin zurück? "Das Land da draußen, das sonst in Da-würd-ich-gern-mal-wieder-hin-Städte und Für-ein-Wochenende-lohnt-sich-das-nicht-Orte eingeteilt war, erscheint auf einmal gar nicht mehr so weit weg. Bisher habe ich jede Reise, jeden Ausflug als eine Ausnahme verstanden, eine Ausnahme vom Alltag. Ist das nicht ziemlich komisch?"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Leonie Müller
Tausche Wohnung gegen BahnCard
Vom Versuch, nirgendwo zu wohnen und überall zu leben
Über dieses Buch
Seit Leonie Müller ihre Wohnung aufgegeben hat, pendelt sie durch ganz Deutschland. Statt aufregende Reiseabenteuer nur an wenigen freien Tagen im Jahr zu erleben, schafft es die Studentin, dass sich sogar die Wartezeit auf verspätete Züge anfühlt wie eine Pause vom Alltag.
In »Vom Versuch, nirgendwo zu wohnen und überall zu leben« lässt sie uns an ihren klugen Gedanken teilhaben: Sie erzählt davon, wie es ist, wenn alles, was man braucht, in einen 40-Liter-Rucksack passt. Sie fragt sich, was Heimat in unserer multilokal lebenden Gesellschaft eigentlich noch bedeutet. Wie fühlt es sich an, dauerhaft unterwegs zu sein? Wo ist eigentlich Zuhause? Warum hat der Begriff »Heimat« eigentlich immer noch keinen Plural? Und wo ist der Ernst des Lebens so plötzlich hergekommen und wie schicken wir ihn wieder dahin zurück?
»Das Land da draußen, das sonst in Da-würd-ich-gern-mal-wieder-hin-Städte und Für-ein-Wochenende-lohnt-sich-das-nicht-Ausflüge eingeteilt war, erscheint auf einmal gar nicht mehr so weit weg. Bisher habe ich jede Reise, jeden Ausflug als eine Ausnahme verstanden, eine Ausnahme vom Alltag. Ist das nicht ziemlich komisch?«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Vorgeschichte 1
Vorgeschichte 2
Prolog Der Ernst des Lebens
Kapitel 1 Grünes Licht
Kapitel 2 Dreieinhalb Chihuahuas oder: mobil statt möbliert
Kapitel 3 Ta-da
Kapitel 4 Vielleicht ist Heimat was für Leute, die immer an einem Ort sind
Kapitel 5 A german concept
Kapitel 6 Vier Zipfel to see before you die
Kapitel 7 Hier stehe ich: Die Erfindung der Sesshaftigkeit
Kapitel 8 Pizza Margherita
Kapitel 9 Oben, unten, links, rechts
Kapitel 10 Mit Hesse im Tchibo
Kapitel 11 Hello, my name is
Kapitel 12 Ich war da
Kapitel 13 Am liebsten alle oder: Die Perfektion frisst ihre Kinder
Kapitel 14 Oben, unten, links, rechts
Kapitel 15 Die Abhängigkeit der Anderen
Kapitel 16 Beethovens Fünfte
Kapitel 17 Ich kann dein Held sein, Baby
Kapitel 18 Oben, unten, links, rechts
Kapitel 19 Da sein 2.0
Kapitel 20 Leben ist tödlich
Kapitel 21 B-Seite
Kapitel 22 Im Rad
Kapitel 23 Nicht-Ich
Kapitel 24 Bavarian Beauty
Kapitel 25 Die Aussicht auf Leben oder: Warten in Dortmund
Kapitel 26 Oben, unten, links, rechts
Kapitel 27 Die fabelhafte Welt des Max Mustermann
Kapitel 28 Zurück in der Zukunft
Kapitel 29 Zuhause to go
Kapitel 30 Liebes Pendeln (Kein Liebesbrief)
Kapitel 31 Nicht-Warten
Kapitel 32 Jedem Ende
Epilog
Danksagung
Für die, die mir helfen zu werden, wer ich bin.
»Frau Müller, wie finden Sie das denn, dass Ihre Enkelin ihre Wohnung aufgegeben hat und jetzt für ein Jahr im Zug wohnen möchte?«, fragt der Redakteur vom WDR.
»Ja, das ist ja mal ganz interessant, ne!«, lächelt meine 94-jährige Großmutter verschmitzt in die Kamera und fügt bedacht hinzu:
»Meine Mutter sagte immer: Junge Menschen müssen sich den Wind um die Nase wehen lassen, die müssen von zu Hause weggehen und das Leben erst lernen.«
»Sei achtzehn«, hatte er gesagt. Ich weiß nicht mehr, worum genau es ging, aber als wir abends mit Freunden auf den Stufen am Stuttgarter Rathausplatz saßen und ich auf seine Frage nach meinem Alter »achtzehn« geantwortet hatte, sagte er, weise lächelnd, »Sei achtzehn.«
Ich glaube nicht, dass ich mit achtzehn wusste, wie man achtzehn ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand genau weiß, wie man mit achtzehn ist oder sein sollte oder sein kann, aber diese Worte sind in meinem Kopf hängengeblieben wie dieser eine wundervolle Moment, in dem der lila Scheinwerfer runde Strahlen über das DJ-Pult warf und mir versicherte, dass es sich lohnt, sein Leben zu leben, und ich habe seitdem oft an sie gedacht.
Vielleicht müssen wir gar nicht genau wissen, wie man achtzehn ist. Vielleicht reicht es schon zu wissen, wie man nicht mit achtzehn ist, und im Zweifel müssen wir davon dann einfach das Gegenteil tun.
PrologDer Ernst des Lebens
Der Ernst des Lebens scheint ein ungeduldiger Mann zu sein. Deswegen hat er Leute rekrutiert, die stets seine, na ja, weniger frohe Botschaft im Volk verbreiten sollen. Ich stelle ihn mir wie einen Fürsten aus dem 16. Jahrhundert vor: ein breiter Hut, brokatbesetzte Kleider, Strumpfhosen und streng erhobener Zeigefinger. Von dem, was ich so gehört habe, habe ich den Eindruck, er präferiert Käse und Lebensläufe mit möglichst wenig Freiräumen, tut die ganze Zeit nur schrecklich vernünftige Dinge, und die Welt ist für ihn genau dann in Ordnung, wenn sie langweilig oder ernüchternd ist. Vielleicht ist ihm auch selbst langweilig, oder er wird nach Erfolgsquote bezahlt, auf jeden Fall scheint es ihm ein Anliegen zu sein, dass wir sein Bildnis in einem goldenen Rahmen am schwarzen Brett unseres Bewusstseins hängen haben.
Ich weiß das sehr genau, weil ich ein junger Mensch bin – mit Anfang zwanzig war man früher mal schon fast tot, gehört aber heutzutage ja unbestreitbar zur jüngeren Bevölkerung unseres Landes –, und junge Menschen hören sehr viel vom Ernst des Lebens. Fast genau in dem Moment, in dem unser Umfeld aufhört, vom Weihnachtsmann zu erzählen, fängt es an, vom Ernst des Lebens zu reden, was zunächst auch interessant erscheint, aber dann mit weniger Lichterketten und Keksen und mehr mysteriösem »Erwachsensein« zu tun hat; und je älter ich werde, desto stärker habe ich das Gefühl, ich soll mit jemandem verkuppelt werden, den eigentlich keiner mag, der mir aber trotzdem nahegelegt wird, »weil das so ist«, »weil man das so macht« oder »weil wir das immer schon so gemacht haben«. Würde Sonja Zietlow die 25 schlechtesten Gründe, irgendetwas auf diesem Planeten zu tun, präsentieren, dürften diese drei Begründungen fragwürdiger argumentativer Tiefe von mir aus stolz auf dem Top-3-Treppchen ihre Nase in die Luft strecken. Sie sind geradezu der beste Indikator dafür, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit das Bedürfnis verspüren werde, das genaue Gegenteil dieser Sache zu tun oder sie zumindest so gründlich zu hinterfragen wie jede Porenreinigungswaschgelwerbung im Fernsehen.
Dass der Ernst des Lebens auch auf mich einige seiner Botschafter angesetzt hatte, wurde mir spätestens klar, als ich zwanzig wurde. Nach dem freiwilligen sozialen Jahr nach dem Abi entschloss ich mich dazu, mein Studium auf nach der Weltreise zu verschieben. Ich wanderte barfuß durch fijianischen Dschungel, lenkte ein Boot auf dem braunen Wasser des Mekong, feierte glitzernd schwüle Weihnachten in Saigon, begab mich auf die Spuren der Hobbits in Neuseeland und der Jurassic-Park-Dinos auf Hawaii. Während ich in Flipflops durch die Weltgeschichte stiefelte und an Teenagerhorden vor Justin Biebers finnischem Hotelzimmer sozioethnologische Beobachtungsstudien durchführte, war der Ernst des Lebens irgendwie immer dabei. Er lebte in Sätzen wie »Klasse, da erlebst du bestimmt viel« mit dem optimistischen Zusatz »So frei bist du ja auch nie wieder«, und, während statt mir nur die Monate ins Land gingen, in der unauffälligen Nachfrage »Und was machst du so, wenn du wieder da bist?«. Wie das Damoklesschwert schien er über der Schiebetür am Flughafen zu hängen, in der ich nach neun Monaten Reiseleben meinen ersten Schritt auf deutschen Boden setzen würde. Was genau diese Freiheit war, die ich da jetzt ein bemerkenswertes erstes und letztes Mal gleichzeitig genießen durfte, verriet mir niemand, aber »wieder da« zu sein klang bedrohlich und gruselig, als hätte ich einen Ausflug durch die schön geputzte Matrix unternommen und käme nun zurück in die dunkle, dreckige, gewitterwolkige Realität.
Fast zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich Isa und Kathi hinter der Schiebetür des Stuttgarter Flughafens winken sah und erleichtert lächelte. Vielleicht ist es noch nicht der Ernst des Lebens, der sich seitdem in mein Leben geschlichen hat, aber doch der Ernst des Studentenlebens, der, seitdem er auf Geschäftsreise in Bologna war, auch nicht mehr das ist, was er mal war: Seit fast zwei Jahren wohne ich wieder in meiner Wohnung in Stuttgart, sitze mehrmals die Woche in der Regionalbahn zwischen Stuttgart und Tübingen, um vorgegebene Kurse zu besuchen, und trage auffällig selten Flipflops. Der Alltag hat seine Krallen um mich gelegt, die Semesterferien sind mein Refugium der Freiheit, und obwohl ich meine Wohnung mag und gerne zur Uni fahre, ist da irgendwie dieses Gefühl, von dem ich doch nie wollte, dass es da ist: Ich bin unzufrieden. Nun könnte ich in den Wald gehen und von Würmern und Beeren leben, aber ich studiere ja keinen Bachelor of Baumhausbuilding, sondern Geisteswissenschaften – und wer zwingt mich, mich zwischen dem Zauber des Reisens und der unbestreitbaren Vernünftigkeit eines vernünftigen Lebens zu entscheiden? Meine Generation hat von den Marketingleuten eines Baumarkts gelernt, dass man auf alles Rabatt bekommen kann, außer auf Tiernahrung –, und ich möchte versuchen, Rabatt auf den Ernst des Lebens zu bekommen. Auf den Alltag, die Routine, die Unzufriedenheit. Mir wieder den Wind um die Nase wehen lassen. Und was wäre da nahe liegender, als das zur Grundlage meines Alltags zu machen, womit ich selbstverständlich meine Freizeit verbringe? Es wundert mich fast ein bisschen, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin.
Kapitel 1Grünes Licht
Jede gute Idee beginnt mit einem bescheuerten Moment. Ein Moment wie eine Kreuzung, nachts um drei. Leere Straße, rote Fußgängerampel, stehen bleiben. Ein Steppenläufer rollt durchs Bild. Die Ruhe vor dem Sturm? Rote Ampeln sind eine gute Sache. Wenn Autos da sind. Und Kleinkinder, denen man ein Vorbild sein sollte. Keine Kinder, keine Autos. Nur die rote Ampel, die leere Straße und ich. Innehalten.
Wollte ich jetzt wirklich darauf warten, dass die Ampel grün wird? Ungläubig starre ich in die Nacht. Diese plötzliche Offensichtlichkeit: Ein System, das Sinn hat, es ergibt nur gerade keinen Sinn, sich daran zu halten.
In dem bescheuerten Moment, mit dem diese Geschichte anfängt, hatte ich eine Jogginghose an und war sauer. Vielleicht ist das grundsätzlich gar kein schlechter Anfang für eine Geschichte: Es gibt definitiv viele verschiedene Gründe dafür, Jogginghosen zu tragen und sauer zu sein, und definitiv viel Potential, beides zu ändern. Theoretisch jedenfalls war es ein entspannter Tag der Semesterferien, deswegen die Jogginghose, praktisch ärgerte ich mich über eine Auseinandersetzung mit meiner Vermieterin in Stuttgart. »Wie oft bist du eigentlich zu Hause?«, fragte mein Freund, in der Küche seiner WG in Köln sitzend, durch die ich auf und ab stampfte. Wir waren erst vor kurzem zusammengekommen, und er wusste, dass ich viel unterwegs war. Dann war die Idee da, und sie ging einfach nicht mehr weg. Und jetzt ist aus der Idee ein Anfang geworden.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat Hermann Hesse mal geschrieben. Vielleicht ist er nie umgezogen, oder er hatte deutlich weniger Kram als ich, aber ich bin mir sicher, dass er das meinte, was nach einem Umzug kommt.
Am Ende des sechsten Tages, als Gott kurz davor war, Feierabend zu machen, klappte er noch mal seinen Laptop auf und schrieb ins Dokument der universellen Gesetze: »Ein jeder Umzug hat unglaublich anstrengend zu sein. Die sollen mal schön konfrontiert werden mit all dem Zeug, das sie sich gekauft und nie gebraucht haben. Egal ob die Mathe im Abi hatten oder nicht, sie müssen auf jeden Fall die Anzahl der benötigten Umzugskisten falsch einschätzen, und es muss immer alles wesentlich länger dauern als gedacht. Und macht da mal ein bisschen Regen rein. Es muss auf jeden Fall regnen.«
Ein paar Jahrtausende später stehe ich an einem grauen Stuttgarter Frühlingstag zusammen mit zwei Freunden in einem fünfunddreißig Quadratmeter großen Schlachtfeld aus Klamottenstapeln, offenen Schränken und halbausgeräumten Schubladen. Ich habe die Anzahl der benötigten Umzugskisten mehr als unterschätzt, alles verspätet sich, und gerade als wir anfangen, den Transporter zu beladen, fängt es an zu regnen. Auszüge sind mit Abstand das beste Argument, um nie wieder irgendwo einzuziehen oder es zumindest möglichst lange zu lassen. Und genau das werde ich jetzt auch erst mal machen. Denn: Ich verlasse meine Wohnung für ein Leben in und mit der Deutschen Bahn. Vielleicht denken Sie jetzt an die gläserne Berliner Firmenzentrale oder an einen ausgemusterten Intercity-Waggon an einem einsamen Waldrand – doch für mindestens zwölf Monate möchte ich die Hunderten fahrenden ICEs, Intercitys, Eurocitys und S-Bahnen dieses Landes zu meinem Hauptlebensmittel machen, das neue Nudeln mit Tomatensoße, sozusagen. Mein Mietvertrag? Das All you can drive-Ticket der DB: die BahnCard100, die weniger verbreitete große Schwester der BahnCards 25 und 50. Ein schwarzgrünes Jahresticket im Scheckkartenformat, Eintrittskarte für alle Fernverkehrszüge, Regionalbahnen und den öffentlichen Nahverkehr in 120 Städten, gültig für ein Jahr. Schlafen werde ich bei Freunden und Verwandten im ganzen Land, regelmäßig meiner Uni in Tübingen einen Besuch abstatten und ansonsten das tun, was ich vorher auch schon immer getan habe: unterwegs sein und Deutschland erkunden. Nur eben ohne eine eigene Wohnung, zu der ich trotz aller Gemütlichkeit doch immer wieder nur zurückkomme, weil ich irgendwann mal dort eingezogen bin.
Das ist ja eine totale Schnapsidee, denken Sie sich jetzt, und da kann ich Ihnen nur zustimmen. Doch wie sagte schon der heilige IKEA:
»Wohnst du noch, oder lebst du schon?«
Zeit zu leben.
Kapitel 2Dreieinhalb Chihuahuas oder: mobil statt möbliert
»Aha?!«, fragt Kathi überrascht-liebevoll durchs Telefon.
Die drei viel zu lang dauernden Wochen zwischen Idee und Auszug verbringe ich mit der universell festgelegten Umzugsvorbereitung: Freunde informieren, Post umleiten und mich fragen, wie ich jemals den ganzen Kram wieder loswerde, der unter noch nicht vollständig geklärten Umständen seinen Weg zunächst in meinen Besitz und dann in meine Wohnung finden konnte.
»Du weißt schon, dass Berlin–Tübingen und Bielefeld– Tübingen sechs Stunden dauert und Köln–Tübingen auch vier?«
Kathi und ich haben zusammen in Bielefeld Abi gemacht und sind beide im Schwabenländle gelandet, sie durchs Studium, ich durchs FSJ. Seit dem Beginn meines Studiums vor drei Semestern schlafe ich in der Vorlesungszeit ein, zwei Nächte die Woche bei ihr, so dass sich an unserem obligatorischen montäglichen Mädelsabend in Tübingen eigentlich gar nichts ändert, außer dass ich währenddessen nicht mehr meine Stuttgarter Wohnung leer zurücklasse. »Na du kommst ja auf Ideen«, schreibt meine Mutter und schickt ihrer SMS zwei Minuten später ein »Hast du wahrscheinlich von mir« hinterher. Auf meine Facebook-Ankündigung, in Kürze freiwillig wohnungslos zu sein, hagelt es neben diversen Verrücktheitsbekundungen Einladungen auf Sofas in die verschiedensten Städte. So richtig überrascht von meinem Vorhaben scheint keiner zu sein, irgendwie sind sich alle einig: bescheuert, aber passt. »Eine gute Entscheidung!«, kommentiert auch der grinsende Beamte im Kölner Bürgerbüro den Entschluss, meinen Wohnsitz von Stuttgart nach Köln umzumelden, damit mein Freund dort die Post entgegennehmen kann.
Wie es sich für einen vernünftigen Umzug gehört, baue ich bereits vor meinem Einzug um und hole mir einen Handyvertrag bei der Telekom, die die Hotspots in den ICEs betreibt, um mein zukünftiges Wohn- zum Arbeitszimmer zu erweitern. Die Zeit im Zug wird auch Freizeit sein, aber eben auch die Zeit, in der ich Texte lesen, Referate vorbereiten und an Hausarbeiten schreiben werde. Zwischen gutbeleuchteten, aufgereihten Handys drückt der Telekom-Mann mir meine Vertragsunterlagen in einer Mappe mit der Aufschrift Zuhause und mobil werden eins in die Hand, und für einen kurzen Moment unterstellt mein Gehirn ihm hellseherische Fähigkeiten. Als Ergänzung zur Bahn melde ich mich bei einer Reihe Car- und Bike-Sharing-Diensten an, mit denen ich für einen Minutenpreis Fahrzeuge mieten kann, und, was ich nie für mein Leben vorgesehen hatte, bei einer Fitnessstudiokette: zu verlockend die Möglichkeit, überall in Deutschland trainieren, duschen und in der Sauna rumhängen zu können. Damit ich den Familienkeller nicht überfülle und vor allem weil ich nicht weiß, wann ich sie wieder brauchen werde, vermache ich Kathi in Tübingen meine Lieblings-IKEA-Lampe, meiner Mutter in Berlin, nicht ganz uneigennützig, meinen Schlafsessel und einer anderen Freundin mein Lieblings-Werkzeugset – nicht, dass ich irgendwann aus Langeweile oder übergreifenden Heimatgefühlen auf die Idee komme, kaputte Zugsitze zu reparieren oder Bilder an die Zugwand zu nageln.
Viel mehr Spaß, als Kisten zu packen, habe ich daran, mein Gepäck für den neuen Lebensabschnitt zusammenzustellen. Mit fast weltreisegleicher Vorfreude krame ich meinen graugrünen 40-Liter-Rucksack, Kabinengröße im Flugzeug, aus der Ecke meines Kleiderschranks: Ich hatte ihn nach meiner Weltreise gekauft, mit dem Versprechen an mich selbst, nie wieder mit zu viel Kram unterwegs zu sein. Langsam füllt er sich mit ein paar Kosmetikartikeln, meinem Notizbuch, Laptop und wenigen analogen Uniunterlagen, mehr brauche ich nicht. Möchte ich nicht brauchen. Kann ich nicht brauchen: Bis auf ein paar bei Freunden stationierte Klamotten trage ich nun jedes Gramm meiner materiellen Bedürfnisse täglich mit mir herum. Auch meine Vorliebe für dunkelblaue Kleidung hat nun endlich ihren Sinn gefunden: Mit ihnen werde ich mich wie ein Chamäleon den dunkelblauen Sitzen der zweiten Klasse anpassen – und kann alles miteinander kombinieren.
Betreten Sie die Welt der Mobilität, begrüßen mich die dicken, weißen Buchstaben auf dem knallschwarzen Umschlag, den ich mit einem freudigen »Hallöchen!« aus dem Briefkasten ziehe. Neongrüne Streckenlinien erhellen vielversprechend den Umriss der Bundesrepublik auf dunklem Hintergrund: Ein ganzes Netz wartet auf Sie. Jetzt bin ich Teil der 45000 Menschen, geradezu elitären 0,06 Prozent der deutschen Bevölkerung, die diese Karte ihr Eigen nennen. Ob ich vorher schon mal zu einem Zweitausendstel dieses Landes gehört habe? Vielleicht waren es ja so viele wenige, deren Meerschweinchen aus dem Tierheim Sissi und Franz hießen. Franz war gescheckt und blind und Sissi grau und übergewichtig, sie waren ein unheimlich süßes Paar …
… noch nie habe ich für ein harmlos scheinendes Stück Plastik so viel Geld ausgegeben: 4090 Euro im Jahr, 340 Euro im Monat für eine offene Bahn-Beziehung statt monogamer Zugbindung. Ich kann es mir nicht verkneifen, kurz zu recherchieren, was ich stattdessen von dem Geld kaufen könnte, finde aber weder dreieinhalb Chihuahuas auf einer zwielichtigen Website noch einen Schreibtisch mit integriertem Laufband, oder ist es ein Laufband mit integriertem Schreibtisch?, überzeugend genug, meinen Plan zu ändern. Vielleicht sollte ich dauerhaft bei IKEA einziehen und die 11,20 Euro täglich in Hotdogs und Nachfüllcola aus dem Schwedenshop hinter den Kassen investieren? Diese bisher noch nie ernsthaft bedachte Möglichkeit erscheint mir auf einmal verlockend verführerisch: Nachts wäre ich beneidete Regentin des Bällebads, unangefochtene Rekordhalterin des Einkaufswagenrennens in der Markthalle im Erdgeschoss, und ich könnte endlich mal unbeobachtet ausprobieren, ob ich noch durch die Minirutschen beim Übergang zur Kinderabteilung passe. Andererseits würden dann tagsüber Tausende Menschen durch mein weitläufiges, zweistöckiges Anwesen latschen, um auf HESSENG und HYLLESTAD Probe zu liegen, und das fände ich doch deutlich nerviger als die täglichen Kontrollen meines Mietvertrages in der Bahn. Und schließlich investiere ich den Betrag ja nur um: von der Miete und dem ein Sechstel der BahnCard kostenden Semesterticket Stuttgart-Tübingen in eine kleine, schwarze Karte. Mein neues Motto: mobil statt möbliert.
Ein paar Tage nach meinem Auszug bin ich zum letzten Mal in meiner alten Wohnung, durchputzen, Schlüsselübergabe, gedankliches Seufzen. Ein letztes Mal gehe ich durch den hölzernen Türrahmen, die Treppe runter, durch den schmalen Weg im Garten. Bei den netten Leuten im kleinen Tante-Emma-Laden um die Ecke habe ich mich neulich schon verabschiedet, mehr gibt es hier nicht zu tun. Ich denke an meinen Einzug vor vier Jahren und den Gedanken, den ich zwischen damals und jetzt mal hatte: Irgendwann werde ich hier ausziehen, und das wird komisch sein. Ich lächle, als ich um die Ecke biege: Das hier ist nicht komisch. Es ist einfach nur richtig. Ein neuer Abschnitt beginnt, und ich habe und kann absolut keine Ahnung haben, was mich noch erwartet – aber ich weiß, dass das hier das ist, was ich tun möchte. Und ich bin dankbar, dass ich es tun kann.
Meinen Rucksack auf den Rücken und den Helm auf den Kopf geschnallt, klappe ich das Visier herunter und düse mit dem Fahrtwind um die Nase unter dem vielversprechenden abendlichen Frühsommerhimmel mit meinem Roller in Richtung Bahnhof. Ein letztes Mal lassen wir uns die steile Straße runterrollen, bremsen an der Kreuzung, nehmen Anlauf Richtung Hauptstraße. In meinem Kopf läuft eine Reggaemelodie, zu der ich fröhlich auf meinem Sitz hin und her wippe. Was schiefgehen könnte? Zugegeben, einiges: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer könnte sich jede Woche einen neuen Grund für einen Bahnstreik ausdenken, ich könnte meinen Rucksack irgendwo stehen lassen, Bahnfahren auf Dauer ziemlich nervig finden, meine ziemlich frische Beziehung könnte zu Ende gehen, ich könnte meinen Freunden oder mir selbst auf die Nerven gehen … aber dann geht es schief, und dann weiß ich, dass es schiefgegangen ist. Auf jeden Fall werde ich mich in zwanzig Jahren nicht fragen, was wohl gewesen wäre, wenn ich in meinem Bachelorstudium diese verrückte Wohnungslosigkeits-und-BahnCard100-Idee ausprobiert hätte – ich möchte dem, was passiert, wenn es nicht schiefgeht, genauso die Möglichkeit geben zu passieren. Irgendwas geht halt immer schief, und das ist in Ordnung, beschließe ich. Wahrscheinlich.
Als ich um die Ecke biege und der vertraute Stuttgarter Hauptbahnhof auf mich zutanzt, beschleicht mich das wohlig-warme Gefühl frisch gebrühter Freiheit. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages lenken meinen Blick auf die geschwungenen Neonbuchstaben am braunen Sandstein der Bahnhofsfassade.
… daß diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist, glüht dort. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
»Ach komm schon«, grinse ich nach oben in Richtung Universum. »Das ist doch jetzt echt ein bisschen zu kitschig.«
Kapitel 3Ta-da
»Läuft bei dir!«
Es ist der vierte Tag meiner freiwilligen Lebensgemeinschaft mit der Deutschen Bahn. Nach dem Auszug am Freitag habe ich meinen Kram in den Familienkeller in Bielefeld gestellt, den restlichen Samstag in Stuttgart und den Sonntag in Köln verbracht. Jetzt ist es Montagmorgen, ich muss zum ersten Mal in diesem neuen Lebensabschnitt zur Uni, und ta-da: Die Lokführer streiken. Hesses Zauber wird mich dank sporadisch eingesetzter Ersatzzüge zwar fast problemfrei zur Uni nach Tübingen kommen lassen, mir aber keineswegs die genüsslich hämischen Kommentare aus meinem Umfeld ersparen, ob ich mir sicher sei, dass die Nummer mit dem Bahnwohnsitz wirklich so eine geniale Idee war.
Trotz des suboptimalen Anfangs meiner Wohnraumlosigkeit bin ich zuversichtlich, das richtige Abenteuer zur richtigen Zeit gewagt zu haben, und hopse enthusiastisch die letzten Stufen der Rolltreppe zum Gleis hoch. Kein stundenlanger Flug, kein Jetlag, kein Einreiseformular: Mein neuer Lebensabschnitt hat ungewohnt unspektakulär begonnen. Während sich der Kölner Bahnsteig mit genervten Pendlern und das bundesrepublikanische Internet mit »Sänk ju for traweling«-Posts füllt, strahlt die morgendliche Frühlingssonne mit mir um die Wette. Dass die Strecke von irgendwo über Stuttgart nach Tübingen in den kommenden drei Monaten noch meine Stammstrecke sein wird, bevor ich ab dem Herbst weniger Zeit in der Uni verbringen werde, ist mir irgendwie ziemlich egal. Das Gewusel aus Menschen, Stimmen und der Melodie der ständigen Lautsprecherdurchsagen verströmt den so geliebten und vermissten Hauch eines Abenteuers in mir, und wie ein Schneckenhaus schmiegt sich mein Rucksack an meinen Rücken. Das Schneckenhausgefühl, wie es meine Ma beim Campen mal nannte: die Freiheit, überallhin zu können, und die wunderbare Gewissheit, alles dabeizuhaben, was ich brauche. Und eben auch eine Menge Dinge nicht zu brauchen. Seit ich denken kann, habe ich dieses Gefühl genossen, und es jetzt bei dem dabeizuhaben, was mein neuer Alltag sein soll, fühlt sich so vertraut wie neu, so verrückt wie beruhigend gut an.
»Als Deutscher im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich benehmen muss oder ob schon mal Deutsche da gewesen sind«, lautet ein Kurt Tucholsky unterstelltes Zitat. Mich im Vorteil wähnend, als Deutsche in Deutschland ja weiterhin als Einheimische getarnt zu sein, bringe ich unauffällig bei einer Zugbegleiterin das Geheimnis freier Sitzplätze in Erfahrung: Die ICE-Waggons mit der Zwanziger-Nummerierung würden zuerst mit Reservierungen gefüllt, dementsprechend seien die Dreißiger-Waggons meist leerer. Sofort winkt mich ein freier Fensterplatz zu sich, in den ich mich genüsslich fallen lasse. Ich klebe meine Nase ans Fenster und schicke meinen Blick den 400 Meter langen Zug entlang. Eins steht jetzt schon fest: Das ist definitiv der günstigste Quadratmeterpreis, den ich je bezahlt habe und bezahlen werde.
Unbeeindruckt von ihrer Sitzfläche hat es sich eine Taube auf dem Denkmal von Kaiser Wilhelm II. gemütlich gemacht. An ihr vorbei beginnt mein Zug gemächlich über die Hohenzollernbrücke zu rollen, unter mir glitzert der Rhein, auf der Brücke dort hinten entwickelt sich eine der jährlich 500000 Staumeldungen in Deutschland. Mein romantischer Ausblick wird jäh unterbrochen: Es klingelt. Auf Telefonieren im Zug, habe ich schon jetzt eigentlich so gar keine Lust, fühle mich durch die unbekannte Nummer aber unter Druck gesetzt, etwas Wichtiges verpassen zu können, und flüstere mit einem von Mr. Bean inspirierten, unmotivierten Gesichtsausdruck ein nuscheliges »Hallo?« in mein Handy. Das Gespräch dauert nicht lange: Es ist ein Telekom-Mitarbeiter, der mir als Erweiterung zu meinem kürzlich erworbenen Handyvertrag einen Festnetzanschluss verkaufen möchte. Ich erspare ihm die genauen Umstände meiner Absage und lege am Ende der Brücke dankend wieder auf. Den einzigen Festnetzvertrag, den ich brauche, habe ich schließlich schon in meiner Tasche.
Gleichermaßen zufrieden wie aufgeregt schaue ich mich zwischen den blauen Sitzen und bunten Koffern um: Das ist jetzt also mein rollender Lebensmittelpunkt. Ich krame mein Notizbuch aus meinem Rucksack und schreibe feierlich zum ersten Mal die Nummer meines Zuges in das Feld, in dem bisher immer die klassische Ortsangabe in Form eines Städtenamens stand. Das Land da draußen, das sonst in Da-würd-ich-gern-mal-wieder-hin-Städte und Für-ein-Wochenende-lohnt-sich-das-nicht-Ausflüge eingeteilt war, erscheint auf einmal gar nicht mehr so weit weg. Bin ich jetzt eine Nomadin? Irgendwie schon. Irgendwie auch nicht. War ich vorher sesshaft? Irgendwie schon. Irgendwie auch nicht. Bisher habe ich immer irgendwo gewohnt, weil man das halt so macht, und habe dementsprechend jede Reise, jeden Ausflug als eine Ausnahme verstanden, eine Ausnahme vom Alltag. Ein komischer Umstand: Spätestens seit Alex von Humboldt sämtliche sich gutversteckende Insektenarten Lateinamerikas aufgespürt hat, scheint das Unterwegs für uns nur noch Luxus oder notwendiges Übel zu sein, je nachdem ob wir in den Urlaub oder zur Arbeit fahren – eine Auszeit vom Alltag oder die volle Portion von ihm. Wir waren noch nie so viel unterwegs, sind noch nie so viel gependelt, umgezogen und in den Urlaub gefahren wie heutzutage, und gleichzeitig wohnt unserer restlichen Sesshaftigkeit die so tragische wie scheinbar unumgehbare Tatsache inne, dass wir aufhören, etwas akut interessant zu finden, sobald es vor unserer eigenen Haustür liegt. Keine Haustür mehr zu haben beziehungsweise eine, die ständig die Landschaft vor ihren Treppenstufen wechselt, dürfte ein guter Anfang sein, um das zu ändern.