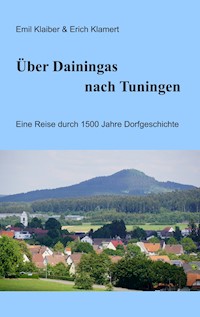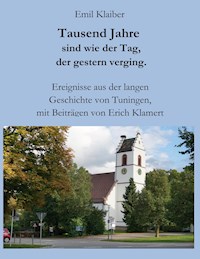
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das große Geschichtsbuch von Tuningen trägt den Titel "Tausend Jahre sind wie der Tag, der gestern verging". Es beschreibt viele seither unveröffentlichte Ereignisse aus der 1250-jährigen Ortsgeschichte. Das Buch erklärt die anfänglichen Verbindungen zum Kloster St. Gallen, zum früheren Herrschaftshaus der Herren von Lupfen und stellt den seither unbekannten Ortsadel und dessen Burg vor. Die ereignisreiche Geschichte des Grenzdorfes zwischen Baden und Württemberg berichtet von vielen Belästigungen, denen die Bewohner von Tuningen über Jahrhunderte ausgesetzt waren. Der Einfluss, der lange Zeit von den streng katholischen Villinger Bürgern, danach vom Magistrat der großherzoglich badischen Stadt, über das Zehnt- und Patronatsrecht, auf das württembergische evangelische Dorf ausgeübt wurde, war an keinem anderen Ort des Landes gegeben. Keine andere katholische Stadt hatte über 300 Jahre lang das Patronat eines evangelischen Dorfes, das zudem noch zu einem anderen Land gehörte. Das neue Geschichtsbuch von Tuningen berichtet über vielerlei Auswirkungen, die aus diesem Sachverhalt hervorgingen. Nicht nur die Tuninger Pfarrei, auch die zehntpflichtigen Bürger waren davon betroffen. Trotz der Patronatsverpflichtungen kam es zu Überfällen, zu Zerstörungen, Entführungen und zum Glockenraub. Die für eine Kirche ungewöhnliche Bauweise der heutigen evangelischen Kirche von Tuningen und ihr deutlich älterer Turm, der bis 1728 zu einem im Verhältnis zu kleinen Kirchengebäude gehörte, ließen seither Fragen offen, die sich durch die neuen Rechercheergebnisse beantworten lassen. Ereignisse vor, während und nach des Zweiten Weltkrieges, besonders die Vorgänge, die der Nationalsozialismus in Tuningen verursachte, werden in diesem Buch erstmals veröffentlicht. Es wird aufgezeigt, warum am 24. April 1945 in Tuningen, beim Durchbruch der im Schwarzwald eingeschlossenen deutschen Truppen, kein Schuss fiel, während in manchen Nachbarorten heftig gekämpft wurde. Das Geschichtsbuch beschreibt auch die Entwicklung der örtlichen Landwirtschaft und zeigt auf, wie sich dieser Ort in wenigen Jahren von einem stattlichen Bauerndorf zu einer der modernsten Industriegemeinden wandelte. Das neue Geschichtsbuch beschreibt eine historisch bedeutsame Ortsgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Klamert († 2021) zum Gedächtnis
Noch lange nach dem Erscheinen der Heimatchronik Tuningen im Jahr 1997, sammelte der langjährige Tuninger Geschichtsforscher und Chronist Erich Klamert weitere geschichtliche Ereignisse von Tuningen. Doch wie sollten diese der Nachwelt erhalten bleiben? Bei der Prüfung dieser Frage fanden sich weitere Geschichtsquellen, die ebenfalls nicht erfasst waren. Durch die Sammlung aller damals auffindbaren Geschichtsdaten von Tuningen erstellte ich, in Zusammenarbeit mit Erich Klamert, den Digitalen Zeitspiegel, der im September 2019 erschien. Dieser und die weiter zunehmende Digitalisierung von historischen Dokumenten und Dateien lieferte in neuerer Zeit über das Internet zusätzlich den Zugang zu weiteren Geschichtsdaten, die zuvor unbekannt waren. Die Fülle der dadurch zur Verfügung stehenden Quellen ermöglichte nun die Ausarbeitung und Herausgabe dieses neuen Geschichtsbuches von Tuningen, als Ergänzung zur Heimatchronik von 1997. Erich Klamert gab bereits 2016 die erste Anregung dafür. Er legte damit den Grundstein für dieses Buch.
Inhaltsverzeichnis (Themenübersicht)
Vorwort
Einleitung
Tuningen, das Dorf im geographischen Mittelpunkt der Baar
Kapitel 01. Frühgeschichte
Zeugnisse aus vorgeschichtlicher Zeit
Funde aus der Frühzeit
Bauliche Zeugnisse
Kapitel 02. Siedlungsgeschichte
Die Baar
Die Alemannen oder Alamannen
Die Bekehrung der Alemannen und die Gründung von Klöstern
Verbindungen zum Kloster St. Gallen und die erste Erwähnung des Ortsnamens
Kapitel 03. Die Gründung von Tuningen und das alte Dorfbild
Die Erstnennung der Orte der Baar
Die Endsilben in den Ortsnamen geben Auskunft über die Zeit der Entstehung
Der Ortsname Tuningen
Die neun Urhöfe, aus denen sich später Ortsteile bildeten
Die Ortsteile und ihre Verbindungswege
Die Bedeutung der Namen der Ortswege
Das alte Dorfbild
Kapitel 04. Die Verwalter des klösterlichen Vermögens und ihre Burg
Der Ortsadel von Tuningen
Die Tuninger Burg
Kapitel 05. Die Herrschaft der Herren von Lupfen
Die Stammbäume der Herren von Lupfen
Kapitel 06. Über die Zehnt- und Patronatsrechte von Tuningen und über die Tuninger Besonderheiten
Die Rechte im Besitz des Klosters St. Gallen und der Herren von Lupfen
Für Tuningen begann eine katastrophale Abhängigkeit
Die Elendjahrszeitpflege Villingen kaufte die Tuninger Zehntrechte auf
Die Tuninger wollten die alte Last ablegen
Endgültige Auseinandersetzung und Entlastung der Zehntgemeinschaft
Der Tuninger Zehntstreit
Kapitel 07. Die Tuninger Kirchen und die Reformation
Die vorreformatorische Pfarrei in Tuningen
Die St. Galluskirche
Der Ablassbrief von Papst Benedikt XII.
Die Tuninger wollten evangelisch werden
Die Reformation in Tuningen
Die Württembergische Landeskirche
Die Tuninger Dorfkirche, vor dem Jahr 1650 und ihr Turm
Der Rhythmus im Tagesablauf bestimmten damals die Turmuhr und die Glocken
Die Tuninger Glockenwirte
Der Bau der Michaelskirche in den Jahren 1728 bis 1731
Die evangelische Kirche war lange Zeit ohne Namen
Der große Umbau der Kirche im Jahr 1901
Spätere Baumaßnahmen an der Kirche
Die Glocken der Michaelskirche.
Die Evangelischen aus Sunthausen
Kapitel 08. Die Pfarrei Tuningen.
Das alte Pfarrhaus
Das neue Pfarrhaus
Das große Stiftungsvermögen und die Landwirtschaft der Pfarrer
Die Pfarrscheuer
Das Gemeindehaus
Kapitel 09. Aus dem Gemeindeleben der evangelischen Kirchengemeinde
Bemerkenswertes über einige Pfarrer in der Zeit vor 1940
Ereignisse allgemeiner Art, vor 1945
Die Chöre
Der Pietismus
Die Gemeinschaften
Das Blaue Kreuz
Der Evangelische Jünglingsverein Tuningen
Evangelische Jugendarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg
Kapitel 10. Andere christliche Kirchen im Dorf
Die Evangelisch-Methodistische Kirche (EmK)
Die Katholische Kirche
Das Missionswerk der Gemeinde Gottes e. V.
Kapitel 11. Schulen und Kindergärten
Als das gemeine Volk das Lesen und das Schreiben lernte
Die Gründung von Schulen
Die Schulordnung von Johannes Brenz
Christliche Lerninhalte
Die Schulmeister
Der erste Tuninger Schulmeister Johannes (Hanns) Glöckler
Der Beginn der Tuninger Schulgeschichte
Die Tuninger Schulgebäude
Schulstiftung, Winterabendschule
Meine Zeit in der Tuninger Schule
Schule nach der Befreiung durch die französischen Truppen
Kindergärten
Der erste Kindergarten in Tuningen
Die Kleinkinderpflegerinnen
Der neue evangelische Kindergarten
Der katholische Kindergarten
Der Heustadl-Kindergarten
Das Familienzentrum
Kapitel 12. Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen, Besatzungen vor dem 20. Jahrhundert
Der Bauernkrieg
Der Dreißigjährige Krieg
Im Österreichischen Erbfolgekrieg
Die Koalitionskriege
Das Revolutionsjahr 1848
Das Gefecht von Tauberbischofsheim
Der Deutsch-Französische Krieg.
Kapitel 13. Die Kriege des 20. Jahrhunderts, der Nationalsozialismus und die erste Zeit danach
Der erste Weltkrieg
Zwischen den beiden Weltkriegen
Der Zusammenbruch der Währung, verbunden mit einer schweren Wirtschaftskrise
Der Nationalsozialismus
Ereignisse in Tuningen vor der Machtergreifung.
Nach der Machtübernahme
Die Zwangsauflösung der Vereine
Verschiedene Vorgänge nach der Machtübernahme
Die Hitlerjugend (HJ) und der Reichsarbeitsdienst (RAD)
Die Tuninger Bürgermeister in der NS-Zeit: Ihr Schicksal
Kindergarten und Schule in der NS-Zeit
Damals herrschte Zwangswirtschaft
Ereignisse während des Zweiten Weltkrieges
Die letzten Angriffe und die Besetzung des Dorfes
Die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
Das Ende des Deutschen Reiches und das neue Deutschland
Die neue Tuninger Gemeindeverwaltung
Die Entnazifizierung im Dorf
Die Verhältnisse zwischen 1945 und 1948, teilweise bis 1950
Ab 1947 stellten sich langsam die ersten Verbesserungen ein
Es begann eine rege Vereinstätigkeit
Kapitel 14. Die Land- und Forstwirtschaft
Die Landwirtschaft der alemannischen Siedler
Die größten und die kleinsten landwirtschaftlichen Betriebe vor dem 18. Jahrhundert
Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in ha
Die um 1879 angebauten landwirtschaftlichen Erzeugnisse
Das bäuerliche Leben im Jahr 1900
Tierhaltung, teilweise nach der Oberamts-Beschreibung 1879
Über den Obstanbau und über die erste Mosterei
Löhne in der Landwirtschaft in den Jahren 1901 und 1903
Kinderbeschäftigung in der Landwirtschaft
Die technische Entwicklung in der Landwirtschaft
Landwirtschaft vor und anfangs der Industrialisierung
Die Nebenerwerbslandwirte
Die Flurbereinigungen und die Aussiedlerhöfe
Bürger und Bürgernutzen
Klimakatastrophen im 19. und im 20. Jahrhundert
Forstwirtschaft
Die Holzernte vor den 1950er Jahren
Waldwegebau
Waldflurbereinigung
Schäden im Wald nach 1920
Der Tuninger Bannwald.
Der Mahnwald, ein ökologisches Projekt
Vereine und Genossenschaften der Tuninger Land- und Forstwirtschaft
Landwirtschaftsfeste
Kapitel 15. Berufe, Gewerbe, Handel und Industrie
Entstehung der Handwerkerberufe
Die Entstehung von Gewerbebetrieben
Die Tuninger Mühlen und die Müller
Die früheren Tuninger Gasthöfe und ihre Wirte
Die Tuninger Brauereien
Die gewerblichen Bäckereien
Handelsunternehmen
Beginn der Industrialisierung in Tuningen
Kapitel 16. Transport und Verkehr
Brief- und Paketbeförderung ab dem Mittelalter
Die Personenbeförderung
Die Güterbeförderung
Kapitel 17. Katastrophen, Epidemien, Notzeiten.
Die großen Brände
Epidemien, Seuchen und andere Krankheiten
Notzeiten führten zu Auswanderungen
Die in Tuningen spürbaren Erdbeben in jüngerer Zeit
Kapitel 18. Gesundheitswesen
Barbiere, Chirurgen und Wundärzte
Die Krankenpflegestation der Gemeinde und der Krankenpflegeverein
Die Tuninger Ärzteschaft
Kapitel 19. Die Geschichte der Tuninger Feuerwehr
Die Alarmierung im Brandfall und die Nachtwächter
Die Pflichtfeuerwehr
Freiwillige Feuerwehr Tuningen
Gründung der Jugendfeuerwehr Tuningen
Das erste Feuerwehrgerätehaus
Gründung der Altersabteilung
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses
Kapitel 20. Einrichtungen zur Versorgung und Entsorgung Versorgung
Die Gründung der Elektrischen Überlandzentrale
Die Elektrifizierung in Tuningen
Die ersten Straßenbeleuchtungen
Die Solartechnik in Tuningen
Die Wasserversorgung
Erdgas in Tuningen
Telekommunikation und Internet
Online-Informationsdienste der Gemeinde
Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft (Müllentsorgung)
Kapitel 21. Das neue Dorfbild und seine Entwicklung nach 1860
Der Wiederaufbau nach dem Brand von 1860
Baumaßnahmen an Brücken, Bächen und Straßen nach 1880
Die ersten Neubaugebiete entstanden in den 1920er-Jahren
Das neue Dorfbild und seine Entstehung nach dem Zweiten Weltkrieg
Die Tuninger Gewerbegebiete
Flächenverbrauch zwischen 1989 und 2015
Kapitel 22. Tuninger Geschichten
Kapitel 23. Von besonderen Persönlichkeiten
Tuninger Ehrenbürger
Vögte, Schultheißen und Bürgermeister.
Einige Nachkommen von Pfarrer Bernhard Baumeister
Tuninger Missionare, vor dem Zweiten Weltkrieg
Lehrer, Wissenschaftler
Musiker, Komponisten und Dichter
Mitglieder der Widerstandskette
Sportler
Sonstige Persönlichkeiten
Kapitel 24. Namen in der Tuninger Geschichte
Flurnamen mit vermutlich geschichtlichem Hintergrund
Personennamen
Die Kirchenbücher
Ahnenforschungsinstitute
Kapitel 25. Die alten Tuninger Familiennamen
Herkunft und Bedeutung von 19 alten Tuninger Familiennamen
Quellenverzeichnis
Bildnachweise
Berichtigungen, Ergänzungen, Anregungen
Vorwort
Am 30. Juli 797 n. Chr. wurde das Dorf Tuningen erstmals erwähnt. Es waren die Klosterbrüder, die damals schreiben konnten. Durch ihre Erwähnung im Kloster St. Gallen wissen wir, dass es Tuningen im Jahr 797 n. Chr. bereits gab. Das tatsächliche Datum der Gründung kennen wir nicht. Vieles ist in den 1225 Jahren geschehen, aber es ist nicht viel, was wir aus der alten Zeit wissen. Das änderte sich erst im 16. Jahrhundert, als nach der Reformation Schulen gegründet wurden und das Volk lesen und schreiben lernte.
Was bedeuten im Rückblick 1000 Jahre Geschichte? Was wissen wir? Schon der Psalmist schrieb in Psalm 90: „Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.“ Der in Österreich geborene Pianist und Sänger Udo Jürgens, Sohn deutscher Eltern, sang vor Jahrzehnten: „Tausend Jahre sind ein Tag“. In diesem Lied heißt es: „Sag', warum der Regen fällt? Wo ist das Ende dieser Welt? Was war hier vor tausend Jahren? Warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? So viele Fragen hat ein Kind...“.
Heute sind viele Dinge erklärbar. Die Raumfahrer sehen mit eigenen Augen, wie es sich mit Tag und Nacht und mit den Jahren der Erde verhält. Aber die Frage von Udo Jürgens, der sich selbst als Atheist bezeichnete, „Wo ist das Ende dieser Welt?“, können sie nicht beantworten. Juri Alexejewisch Gagarin war am 12. April 1961 als erster Mensch im Weltraum. Er konnte dort keinen Gott sehen. Menschen, die Gott auf der Erde nicht finden, können ihn im unendlichen Weltraum ganz sicher auch nicht finden.
Aber doch: Es ist sehr viel, was die Menschen, von denen die meisten vor 450 Jahren noch nicht lesen und schreiben konnten, in der Vergangenheit erreichten. Besonders in den letzten 80 Jahren entwickelte sich die zivilisierte Menschheit rasant. Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es einen annähernd hohen Lebensstandard. Doch ist jetzt, so fragen sich viele, der Höhepunkt erreicht? Was wird morgen sein? Der Psalmist schrieb weiter: „Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, das am Morgen blüht und sprosst und des Abends welkt und verdorrt.“ Sind wir uns dessen bewusst?
Tuningen, eines der ältesten Dörfer der Baar und heute eines der modernsten im ganzen Land, hat eine historisch bedeutsame Vergangenheit. Die Geschichte von Tuningen zeigt, dass die Bevölkerung viel Leid und Not ertragen musste. Das prägte die Menschen dieses Dorfes. Dies geht auch aus den alten Versen eines unbekannten Verfassers hervor, die nachfolgend wiedergegeben werden. Wie sehr verwandelte sich doch dieses Dorf und seine Bewohner!
Tuningen in der Baar
In der weiten Welt kennt niemand Deinen Namen, so klein bist Du!
Selten hat Dich jemand gesehen oder durchwandert, so abgelegen bist Du!
Aber eine köstliche, herrliche Heimat bist Du uns geworden!
Wohl liegst Du auf rauer Höhe, aber in der weichen Mulde
des welligen Berglandes liegst Du doch geborgen und warm.
Wohl umstürmen Dich scharfe Winde; aber der hohe Tannenwald
hält gute Wacht und gibt Dir Schutz.
Einsam liegst Du; Nachbardörfer sind weit und Städte noch weiter;
aber das macht Deine Bewohner so selbstständig
und gibt ihnen das eigene sichere Urteil.
Schwer und hart ist der Boden, der Dich umgibt;
aber fleißige Leute hat er geschaffen, die unermüdlich
und mit unverdrossener Stetigkeit ihn bearbeiten
und ihm doch das Brot, das sie brauchen, abringen.
Der Kranz der Obstbäume,
der so lieblich die Dörfer des Unterlandes schmückt,
fehlt Dir, aber stolz ragt über Dir der hohe Lupfen
und bringt in Deine kleinen alltäglichen Dinge
den Klang von altem Geschehen, von großer Geschichte.
Über Dir ist der große weite Himmel,
der Deine Bewohner nicht ärmlich und kleinlich bleiben lässt.
Sie tragen ein Aufgeschlossen sein für göttliche Dinge in sich
und erheben ihre Blicke von der Erde zu den ewigen Welten des Himmels.
Tuningen, Du kleines Dörflein in der Baar,
eine köstliche Heimat bist Du denen, die Dich kennen und lieben!
Allen Lesern dieses Buches wünsche ich viel Interesse und einen großen Gewinn.
Es grüßt Sie heimatlich verbunden Emil Klaiber
Einleitung
Tuningen, das Dorf im geographischen Mittelpunkt der Baar
Bild 001. Eine historische Landkarte, Ausgabe vor 1900.
Tuningen bekam keine Bahnlinie und blieb deshalb lange Zeit ein stattliches Bauerndorf. Noch heute liegt dieses Dorf in der Mitte der Ringzugstrecke, aber es ist heute kein altes Bauerndorf mehr. Auf fast allen Gebieten der Technik ist Tuningen eines der auf höchstem Stand ausgestatteten Dörfer im ganzen Land. Die Ursache hierfür findet sich zuerst in den katastrophalen Ereignissen in der Geschichte, aber auch in den vorausschauenden Entscheidungen der verantwortlichen Gremien. Die hoch automatisierten landwirtschaftlichen Betriebe außerhalb des Dorfes gleichen den modernen Gewerbebetrieben am Ortsrand. Durch den Autobahnanschluss wurde Tuningen zu einem kleinen Industriestandort. Trotzdem finden Erholungssuchende in den großen Wäldern vielfältige Möglichkeiten zum Wandern, zur Erholung und zum Ausgleichsport.
Kapitel 01. Frühgeschichte
Lange Zeit vor der Gründung von Tuningen hielten sich in unserer Gegend schon Menschen auf. Bereits die Kelten bauten für ihre ausgedehnten Handelsreisen Wege, von denen manche später von den Römern benutzt und teilweise auch ausgebaut wurden. Der Oberamtsbeschreibung des Oberamtes Tuttlingen 1) von 1879 ist bezüglich Straßen in der Frühgeschichte von Tuningen Folgendes zu entnehmen:
„Von Spuren aus der Vorzeit nennen wir: eine von Schwenningen herkommende römische Straße, „Heerstraße“, sie führt auf der Markung über den „Hattensteig“, durch den Ort und weiterhin durch den „Heerwald“, an der „Heidelburg“ vorbei, dann durch das „Brentenwäldle“ an den Lupfen; eine weitere römische Straße kommt als „Rottweiler Weg“, „Heerstraße“, an der Weigheimer Kapelle herab, zieht ebenfalls durch den Ort und setzt sich auf der „Schelmengasse“ gegen Baldingen im Badischen fort. An ihr lag bei der badischen Grenze auf der Flur „Weil“ ein römischer Wohnplatz, von dem früher schon Überreste aufgefunden wurden.“
Es war nicht die Militärstraße, die der römische Kaiser Vespasian (69-79) von Offenburg durch das Kinzigtal, zu dem, in der gleichen Zeit geründeten, Stützpunkt „Arae Flaviae“ in Rottweil 2) und weiter nach Tuttlingen bauen ließ. Dieser römische Fernweg verlief von Mainz, über Straßburg, Offenburg, Rottweil, Tuttlingen bis nach Augsburg. Es war auch nicht die Süd-Nord-Fernstraße Neckar-Alb-Aare, die von der römischen Badeanlage in Hüfingen, eines der ältesten römischen Militärbäder nördlich der Alpen, zum römischen Kastell „Arae Flaviae“ in Rottweil führte und doch kreuzten sich zwei von den Römern benutzte alte Straßen im Bereich von Tuningen. Verschiedene Funde und Flurnamen beweisen, dass hier schon zu Zeiten der Frühgeschichte Menschen waren.
Rottweil ist die älteste Stadt Baden-Württembergs und wurde erstmals im Jahr 73 n. Chr. als römischer Militärstützpunkt mit dem Namen „Arae Flaviae“, das hieß die Altäre des römischen Herrschergeschlechts Flavier, erwähnt. Die Römer zogen sich nach dem Durchbruch des Limes, um das Jahr 260 n. Chr., vermutlich aus innenpolitischen Gründen im 3. bis 5. Jahrhundert zurück. Nach neuester Erkenntnis wurden sie nicht vertrieben. Die Alemannen ließen sich erst als die Römer weg waren, bei der Landeinnahme im ursprünglich römischen Rottweil nieder. In einer Lebensbeschreibung von 771 über den hl. Gallus wurde Rottweil als „rotuvilla“ bezeichnet.
Zeugnisse aus vorgeschichtlicher Zeit
Funde aus der Frühzeit
Funde auf Tuninger Gemarkung, auf dem Häufenberg, deuten bis in die Mittelsteinzeit zurück, d.h. bis zwischen 4.500 und 10.000 Jahre vor Christi Geburt. Auf dem östlichen Höhenrücken des Lupfens weisen Funde nach, dass dort schon in vorkeltischer Zeit, etwa 1.000 vor Christi Geburt, eine Höhensiedlung bestand.
Im Jahr 1854 wurden im Gewann „Hinter Eichen" zwei römische Goldmünzen gefunden, eine Münze des römischen Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.) und eine Münze des römischen Kaisers Nero (54-68 n. Chr.). An einer nicht genau benannten Stelle soll ein Denar des Kaisers Vespasian (69-79 n. Chr.) gefunden worden sein.
Auf „heiligen Wegen", das ist die ebene Fläche links der Straße zur Unteren Mühle, soll 1778 ein Grab, das mit einem großen Stein abgedeckt war und das unter anderem eine Hellebarde enthielt, gefunden worden sein. Hellebarden waren Stangenwaffen, Hieb- und Stichwaffen des Fußvolkes, in den Kämpfen zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert.
Bauliche Zeugnisse
Außer den Funden von Werkzeugen, Waffen und Münzen geben auch die Bauwerke der Kelten und Römer Zeugnis davon, dass es bereits vor der Zeitrechnung nach Christus Menschen in Tuningen und Umgebung gab.
Die Hügelgräber
Hügelgräber, auch Grabhügel genannt, findet man nahezu weltweit. Sie wurden in allen Zeitepochen als Grabstätten für Stammesführer errichtet. Der größte Grabhügel in unserer Gegend ist der Magdalenenberg in Villingen, der etwa im 7. Jahrhundert v. Chr. angelegt wurde.
In Tuningen konnten an drei verschiedenen Plätzen entlang der von Süden nach Norden verlaufenen Heerstraße 30 unterschiedlich große Keltengrabhügel gefunden werden. Sie sollen aus der Hallstattzeit, also aus dem 8. bis 4. Jahrhundert v. Chr. stammen. Elf dieser Grabhügel liegen wenige Meter östlich der Hegestraße in Tuningen. Sie sind teilweise noch gut sichtbar. An zwei weiteren Plätzen, nördlich von Tuningen sind nochmals 19, welche jedoch nicht mehr sichtbar sind.
Die Hügelgräber beweisen, dass hier schon lange vor den Römern und schon 1.000 oder 1.500 Jahre vor der Besiedelung der Baar durch die Alemannen, Menschen waren. Die Grabhügel liegen entlang einer alten Heerstraße. Das drängt zur Frage, die wohl unbeantwortet bleiben wird, was die Todesursache gewesen sein könnte. Nachdem die Tuninger Grabhügel bisher nicht erforscht sind, existieren auch keine weiteren Informationen dazu.
Modell eines Hügelgrabes
Ein großes Modell eines Keltengrabhügels wurde zur 1200-Jahrfeier im Jahr 1997 im Gewann „Döbel“ geschaffen. Es steht an der Schelmengasse (Hegestraße), bei der Abzweigung zur Unterführung unter der Autobahn hindurch, direkt neben dem Autobahnparkplatz. Dort führt auch der Geschichtliche Wanderpfad vorbei.
Bild 002. Modell eines Hügelgrabes.
Die Viereckschanze, auch Schänzle genannt
Ein anderes bauliches Zeugnis der vorgeschichtlichen Zeit finden wir in Tuningen im Haldenwald, unweit des Parkplatzes am früheren Trimmplatz. Die keltische Viereckschanze wird auf die Latènezeit im zweiten bis im ersten Jahrhundert v. Chr. datiert. Viereckschanzen findet man hauptsächlich in Süddeutschland, in der Schweiz und in Österreich. Sie haben rechteckige, meist quadratische oder leicht trapezförmige Gestalt und einen umlaufenden Wall und Graben. Manche waren bewohnt oder dienten kultischen Zwecken.
Der römische Gutshof
Ein ausgegrabenes Nebengebäude eines Gutshofes auf der Tuninger Gemarkung „auf Weil", an der Grenze zu Sunthausen, wies auf einen römischen Herrenhof hin. Er lag an der Schelmengasse, der alten Heerstraße und er war das einzige vorgeschichtliche Bauwerk, das uns nach der Ausgrabung keine sichtbaren Spuren mehr hinterließ. Die römischen Gutshöfe waren steingebaute Herrenhöfe. „Weil“ kommt vom lateinischen Wort Villa.
Kapitel 02. Siedlungsgeschichte
Die Baar 3)
Baar ist ein althochdeutscher Begriff. „Para“ oder „bara“ ist die Bezeichnung für eine Landschaft im frühmittelalterlichen Alemannien. Ursprünglich gab es zwei Baaren, die Bertholdsbaar (Westbaar) und die Ostbaar im Bereich des Bussen und um Marchtal. Die Ostbaar lag also nicht im Bereich von Sunthausen, Ober- und Unterbaldingen, Biesingen, Heidenhofen, sondern bei Marchtal.
Die Westbaar zerfiel vor 770 n. Chr. in mehrere Teile. Ein Teil davon war die Grafschaft Adelhardsbaar, die heute Baar heißt. Der Name Baar entstammt also der ehemaligen Landgrafschaft Baar. Die Adelhardsbaar wurde von folgenden Grafen verwaltet:
763-775 Graf Adalhard
786-817 Graf Hrodhar
818-825 Graf Tiso
831-851 Graf Ato
851-857 Graf Uto
Die Alemannen oder Alamannen
Bei den Alemannen, auch Alamannen genannt, handelte es sich um eine frühmittelalterliche germanische Bevölkerungsgruppe aus dem Elb-/Saalegebiet. Sie sprachen westgermanische Dialekte. Die älteste überlieferte Sprachform des Alemannischen ist Teil der althochdeutschen Sprache zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert n. Chr. Die Alemannen besiedelten die Landschaft, die heute Baar heißt, in den Jahren 300 bis 500 n. Chr.
Bevor die Alemannen die fruchtbare Baar einnahmen, war diese kaum besiedelt. Die Siedler bauten zuerst Höfe, von denen aus sie gemeinsam das Land bewirtschafteten. Zwischen der Ansiedlung der Alemannen und der Bildung von Dörfern lagen Jahrhunderte. Die Nachkommen der ersten Siedler bauten in dieser Zeit weitere Häuser um die Höfe herum, wodurch aus den ursprünglichen Höfen die späteren Teile des Dorfes wurden. Die alemannischen Häuser hatten den Wohnbereich und den landwirtschaftlichen Teil unter einem Dach, sowie es noch bis einige Zeit nach dem zweiten Weltkrieg der Fall war. Sie hatten, im Gegensatz zu den Steinhäusern der Römer, unten dicke Steinmauern als Fundament und wurden im oberen Bereich aus Holzriegeln und durch Steine mit Lehm ausgemauert.
Die Bekehrung der Alemannen und die Gründung von Klöstern
Im 6. und im 7. Jahrhundert kamen irische Mönche, die unter dem Einfluss der fränkischen Herrschaft, welche nach dem Sieg des Frankenkönigs Chlodwig in der Schlacht von Zülpich (496 n. Chr.) entstand, die heidnischen Alemannen zum Christentum missionierten. Im Jahr 610 n. Chr. kam der irische Mönch St. Gallus nach Alemannien. Er baute im Jahr 612 in der Einöde eine Klause, auf die das im Jahr 719 von Abt Otmar gegründete Kloster St. Gallen zurückgeht. Es war das zweitälteste Kloster auf dem Gebiet der Alemannen, nach dem Kloster Säckingen. 724 n. Chr. folgte die Gründung des Klosters Reichenau, 1083 n. Chr. die Gründung des Klosters St. Georgen. Zwischen 550 und 750 n. Chr. erfolgte die Bekehrung der Alemannen zum Christentum. Ab 750 wurden die Alemannen der Baar endgültig unter fränkische Herrschaft gestellt, wodurch das Christentum immer mehr Einfluss bekam.
Die zuvor heidnischen Alemannen hatten keine Kirchen, sie brauchten nur einen Friedhof. Den legten sie in Tuningen im Vogelösch, unweit der späteren Mühlengasse, an. Nach ihrer Christianisierung bauten sie im 8. Jahrhundert die ersten Kirchen auf Kirchhöfen, also mit Friedhöfen, in deren Mitte eine Kirche oder Kapelle stand. Den alten Alemannenfriedhof im Tuninger Vogelösch brauchten sie danach nicht mehr, er wurde aufgegeben. Ab diesem Zeitpunkt war die Kirche der Mittelpunkt aller Höfe dieser Siedlung. Die Kirchen waren lange die einzigen Steinhäuser der Alemannen.
Die Kapelle der fränkischen Mission4)
Im damals noch gemeinsamen Dorf Baldingen musste das Kloster St. Gallen im Jahr 854 eine Kapelle, die vermutlich im heutigen Oberbaldingen stand, nebst zugehörendem Land, an das Bistum Konstanz zur Freistellung von gefordertem Zins abtreten. Die Kapelle war auf St. Martin geweiht, der zu jener Zeit der Hausheilige des fränkischen Königshauses war. Diese Kapelle soll die Urpfarrei der fränkischen Mission im Bereich zwischen Trossingen und Baldingen, also auch im heutigen Tuningen, gewesen sein.
Verbindungen zum Kloster St. Gallen und die erste Erwähnung des Ortsnamens
Das Kloster St Gallen wurde mit Stiftungen aus den Dörfern der Baar bedacht. Diese sind in Schenkungsurkunden protokolliert und ermöglichten dadurch die Feststellung der Erstnennung der Dörfer. Es ist aber anzunehmen, dass alle „ingen-Orte“ möglicherweise Jahre vor den erfolgten Stiftungen gegründet wurden, also älter sind, als die Erstnennungen der Klöster angeben. Im 8. und im 9. Jahrhundert stifteten auch die Dorfbewohner von Tuningen mehrfach Güter an das Kloster St Gallen. Im 9. Jahrhundert erhielt dieses Kloster auch von König Ludwig dem Frommen erhebliche Stiftungen aus dem Reichsgut in der Adelhardsbaar, der Grafschaft des Grafen Hrodhar.
Als Reichsgut bezeichnete man die Güter, die an das Amt des Königs oder des Kaisers und nicht an dessen Person gebunden waren. Ab etwa 1050 bis 1100 wurde in Tuningen nur noch an die Klöster St. Georgen, St. Peter, Amtenhausen und Rottenmünster gestiftet.
Kapitel 03. Die Gründung von Tuningen und das alte Dorfbild
Bild 003. Das alte Tuningen.
Tuningen gehört zu den ältesten Dörfern der Baar. Die Gründung erfolgte vermutlich wenig später als die Entstehung des Klosters St. Gallen (719 n. Chr.). Der Gründer von Tuningen soll Teino gewesen sein. Der Personenname „Teino" ist aber nicht urkundlich überliefert. In einer Mitteilung des Staatsarchivs Sigmaringen 10) aus dem Jahr 1988 wird darauf hingewiesen, dass der Namensgeber, im Gegensatz zur früheren Annahme, nicht der Anführer einer Sippe war. Vermutlich handelte es sich einfach um eine starke Persönlichkeit. Es besteht kein schriftliches Dokument, das einen Teino beweist. Personennamen wurden erst nach 700 n. Chr. urkundlich überliefert. Somit wird klar, dass wenn es den nur mündlich überlieferten Teino tatsächlich gab, dann kann er nur vor 700 n. Chr. gelebt haben und eine Persönlichkeit der Sippe gewesen sein. Teino steht deshalb ziemlich sicher nicht im Zusammenhang mit der Gründung des heutigen Dorfes.
Die Erstnennung der Orte der Baar
Die erste Erwähnung des Ortsnamens Tuningen erfolgte in der Schenkungsurkunde vom 30. Juli 797 des alemannischen Adeligen Thrutbert (Trudbert) aus Dainingas. Er schenkte seinen Besitz in Weigheim und in Trossingen dem Kloster St. Gallen. Die Stiftungsurkunde wird im Stiftsarchiv des Klosters St. Gallen aufbewahrt. Am 1. September 818 folgte die zweite Erwähnung des Ortsnamens durch die Schenkung eines „Kunfred" (Cunfred, Cundfred). Er schenkte seine Besitzungen in Tainingas, alles was er im Orte zu Erbe besaß, für sein und seines Vaters Seelenheil an das Kloster St. Gallen.
Nach der Erstnennung wäre Tuningen älter als Villingen, welches erstmals im Jahr 817 erwähnt wurde und das durch die Zähringer im 13. Jahrhundert die Stadtrechte erhielt. Nach der Erstnennung wäre Geisingen mit dem Jahr 764 die älteste der Baar-Städte im Umkreis rund um Tuningen, danach käme Spaichingen (791), dann Trossingen und Tuttlingen (797, gleich wie Tuningen), Schwenningen und Villingen (817). Das alte Städtchen Möhringen, das seine Ursprünge bereits in keltischer Zeit hatte, aber erst 882 genannt wurde, das als einziges der genannten Dörfer zu der Abtei Reichenau gehörte, 1307 die Stadtrechte bekam, heute aber bei Tuttlingen eingemeindet ist und schlussendlich Donaueschingen mit der Erstnennung im Jahr 889.
Die Endsilben in den Ortsnamen geben Auskunft über die Zeit der Entstehung 2)
Die ältesten Dörfer der Alemannen tragen im Ortsnamen die Endsilbe „ingen“. Die Wortendung „ingen“ wurde in aller Regel mit dem Personennamen eines Anführers verbunden. Daraus entstanden die Ortsnamen:
Im 5. und im 6. Jahrhundert entstanden die „ingen-Orte“,
im 6. Jahrhundert die „heim-Orte“ und die „dorf-Orte“ und
im 7. Jahrhundert die „stetten-Orte“, die „hausen-Orte“ sowie die „hofen-Orte“.
Es gab keine Schreibregeln
Vor der Reformation gab es in Deutschland keine einheitliche Sprache. Selbst lange danach bestanden keine behördlichen Schreibregeln. Jeder, der schreiben konnte, durfte schreiben, wie er es für richtig hielt und das galt bis über das 18. Jahrhundert hinaus. Die Wörter, nicht nur die der Orts- und Personennamen, wurden in den verschiedenen Zeitabschnitten, auch von unterschiedlichen Personen, oft verschieden und auch nach dem gesprochenen Dialekt geschrieben. Deshalb hatte Tuningen bis zum Jahr 1750 etwa 30 verschiedene Ortsnamen. Die Zuordnung von Personennamen zu den Endsilben in den Ortsnamen ist deshalb nicht immer einfach erklärbar.
Das Schreiben war im Mittelalter den kirchlichen Würdeträgern, den Klöstern, dem Kaiser, den Königen und Fürsten vorbehalten. Die Klöster waren wichtige Institutionen für Kultur und Bildung, aber auch politische und wirtschaftliche Zentren. In der Zeit der Gründung von Tuningen konnte die Bevölkerung weder lesen noch schreiben.
Der Ortsname Tuningen
Das heutige Tuningen hatte bis etwa 1700/1750 keinen offiziellen Namen. Der dem Dorf angehängte Ortsname änderte sich bis 1750 etwa 30 mal.
Hier einige Beispiele: 797: Dainingas,
817: Teiningas,
870: Teininga,
1363: Tayningen
um 1700: Thoningen,
ab etwa 1750 bis 1899: Thuningen
und seit 1900: Tuningen
Die neun Urhöfe, aus denen sich später Ortsteile bildeten
In Tuningen waren es ursprünglich neun Höfe, die als Häusergruppen zu Ortsteilen wurden und die mit der Kirche in der Mitte allmählich zu einem Dorf zusammenwuchsen. Das Dorf soll aus den Höfen Kalkhof (Kalchhof), Schlupfhof (Schlüpfhof), Zu Hohen Mauern, Barrhohenhof (Barrhowhof), Burghof, Niederhof, Sonnenhof, Mittelhof und Butschhof entstanden sein. 11) Es kann angenommen werden, dass die neun Höfe nicht zur gleichen Zeit gebaut wurden. Heute lässt sich nicht mehr in jedem Fall feststellen, wo diese Höfe und die Häuser standen. Möglicherweise gingen im Laufe der Zeit auch einzelne Höfe ab.
Man kann aber davon ausgehen, dass die Urhöfe in der Nähe eines Wasserlaufes oder einer ergiebigen Quelle angesiedelt waren. Dort war der Weg jeweils zu einem kleinen Platz ausgeweitet. Ein kleiner Platz und ein fließendes Gewässer waren typisch für einen Hofplatz.
Eindeutig klar ist die Lage des Mittelhofes. Die Häusergruppe stand westlich des Baches, der bis heute keinen anderen Namen hat und der anliegenden Straße den Namen „Am Bach“, heute „Bachstraße“, gab. Der Mittelhof lag also im Bereich des heutigen kommunalen Kindergartens.
Bild 004.Häusergruppe am Mittelhof, mit dem Verlauf des Baches.
Ein Hof, vermutlich war es der Kalkhof, stand in der Nähe des Sieblegrabens im späteren Unterdorf. Auch hier waren die Häuser bis zum Dorfbrand 1860 auf einem kleinen Dorfplatz angeordnet und es gab fließendes Wasser, ideal für einen Hof in der Gründerzeit.
Bild 005. Möglicherweise stand der Kalkhof am Sieblegraben.
Der Butschhof kann nur dort gestanden haben, wo heute die Trossinger Straße einmündet. Die Trossinger Straße war damals noch außerhalb des Dorfes. Auch die Butschhofstraße endete sogar noch nach 1860 an dieser Stelle. Die Kaiserstraße und das Oberhägle, die heutige Espanstraße, gab es noch nicht.
Bild 006. Vermuteter Standort des Butschhofes.
Den Burghof könnte man im Hege in der Nähe des Sieblegrabens vermuten. Dort geben auch die Flurnamen „Hinter der Burg“ und „Hinter der Zehntscheuer“ Hinweise auf die Burg, den Wohnplatz der Tuninger Maier, die als die Ortsadeligen den Namen „von Thuningen“ trugen.
Bild 007. Der Burghof stand sicher in der Nähe der Burg am Sieblegraben im Hege.
Auch zwischen der Staig (Staigstraße), der Mühlengasse (Sunthauser Straße) und der Brühlstraße (Dengen) stehen die Häuser quer zur Straße heute noch weit auseinander. Dort befinden sich die ältesten Häuser von Tuningen und es gab zwei fließende Gewässer. Mit großer Wahrscheinlichkeit stand dort mindestens einer, vielleicht sogar zwei, der neun Gründerhöfe.
Bild 008. zeigt einen möglichen Standort eines Hofes zwischen der Staigstraße und der Dengenstraße
Weitere Hofstandorte sind heute nicht mehr nachvollziehbar, es ist aber denkbar, dass einige von ihnen bei mehreren schweren Bränden und Kriegen inzwischen abgingen.
Die Ortsteile und ihre Verbindungswege
Die Kirche mit dem Kirchhof war von Anfang an der Mittelpunkt des Dorfes.
Die Ortsteile des alten Dorfes waren
die der Hofnamen Mittelhof, Kalkhof, Butschhof und möglicherweise das Höfle, welches ebenfalls auf einen Hofplatz hindeutet, die Ortsteile Platz, Oberdorf, Unterdorf, Dengen (auch Tengen), Hege, Hasenloch, Winkel, Sieble, Bach, Ober Hägle, Brühl und die Staig.
Die Wege der Ortsteile führten alle zur Kirche und zum Kirchhof. Sie wurden Gaße genannt:
Amtshausgaße, Vogtsjockengäßle, Gaißengäßle (später Sparrengaße), das Rote Gäßle, die Hintergaße, die Kirchgaße (Kilgagaß), das Burggäßle, später auch die Mühlengaße, das ist heute die Sunthauser Straße und die Schmalzgasse, heute die Martin-Luther-Straße.
Das heißt, dass es bis ins 20. Jahrhundert keine Verbindungswege gab, die als Straße bezeichnet wurden.
Die Bedeutung der Namen der Ortswege
Die alten Namen hatten ihre Bedeutung, auch wenn sie uns oft nicht bekannt oder bewusst sind. Eine Gasse ist ein kleiner schmaler Weg und eine Staig (Steig) ein steiler Weg. Die Bedeutung von „Dengen“ (auch Tengen) konnte ich selbst in der Stadt Tengen im Hegau nicht ergründen. Der Name „Hege“ bedeutete einen eingezäunten Ort, eingezäunt vielleicht durch eine Hecke. Das „Ober Hägle“ lag vielleicht am oder oberhalb der oberen Hecke. Heute ist das irrtümlicherweise die Espanstraße. Der alte Flurname „Espan“ lag im heutigen Bereich Kaiserstraße-Uhlandstraße-Goethestraße und dem nördlichen Teil der abgewinkelten Johannesstraße. „Espan“ bedeutete „freies, nicht eingezäuntes, der Gemeinde gehörendes Weideland“, „Brühl“ bedeutete feuchte Wiesen, die sich als Viehweide eigneten und „Breite“ bedeutete große Feldstücke, die meistens in Ortsnähe lagen und im Besitz der reichsten Leute waren. Der Vogtsjocken, nach dem die heutige südliche Friedhofstraße bezeichnet wurde, war Jakob, der Sohn des Vogtes Hans Ötter, welcher nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) aus der Schweiz zuwanderte. Der Vogtsjocken war der Schwiegervater des in Hausen ob Verena geborenen späteren Tuninger Pfarrers Johann Christian Maurer (1690-1719).
Das alte Dorfbild
Es ist nicht bekannt, wie sich das Dorfbild vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) darstellte, welche Häuser die Überfälle der plündernden Villinger überstanden. Es sind nur Hof-, Flur- und wenige Personennamen überliefert. Sie ermöglichen geringe Rückschlüsse auf das Dorfbild jener Zeit. Wir wissen aber, dass nach diesem fürchterlichen Krieg die Tuninger Bevölkerung fast nicht mehr vorhanden war. Durch den starken Zuzug danach, entstand eine vollkommen neue Einwohnerschaft. Die neuen Bewohner kamen vielfach aus den nördlichen und grenznahen Landesteilen der Schweiz, aber auch aus dem Schwarzwald und vermutlich auch aus Vorarlberg. Es steht heute kein Haus in Tuningen, das vor dem Dreißigjährigen Krieg gebaut wurde.
Der einzige Bericht über die Brandkatastrophe vom 21. April 1750 ist nur im Totenregister eines Kirchenbuches 12) enthalten, weil bei diesem Brand ein Kind ums Leben kam. Aus diesem Bericht gehen die Namen von Bewohnern der abgebrannten Häuser hervor. Es ist also nicht feststellbar, welche Häuser dem Brand von 1750 zum Opfer fielen. Möglicherweise sind sie 110 Jahre später erneut oder auch schon früher abgebrannt. Der erste Ortsplan ist aus der Zeit vor dem Dorfbrand von 1860 (siehe die Berichte über beide Dorfbrände in Kapitel 17, Katastrophen, Epidemien, Notzeiten).
Die Straßen des Dorfes vor 1860
Aus dem Ortsplan von 1860 sind die damals vorhandenen Straßen, die in ihrer Bauweise nicht den heutigen Waldwegen entsprechen sowie die teilweise enge Bebauung durch Häuser ersichtlich. Fast alle Wege führten von den ursprünglichen Höfen sternförmig zum „Platz“, der den Mittelpunkt bildete und wo von Anfang an die Kirche mit dem Kirchhof stand. In dem damaligen Ortsplan ist die Lage des 1836 beschlossenen und 1843 neu angelegten Friedhofes eingezeichnet. Demnach wurde der Ortsplan nach 1836 und vor 1860 angefertigt.
Die Hochemminger Straße, die Trossinger Straße und der Brühl waren 1860 noch nicht bebaut. Fast überall im Dorf standen die Häuser sehr eng zusammen, was sich noch in diesen Tagen auf der östlichen Straßenseite in Dengen zeigt. Der Weg in Dengen (Tengen) war von Anfang an Durchfahrtsstraße von Schwenningen nach Tuttlingen. Trotzdem soll er bis 1840 nahe an der östlichen Häuserreihe vorbei verlaufen sein. Die Dunglegen (Misthaufen) und die Holzplätze lagen für beide Häuserreihen auf der westlichen Straßenseite.
Der im Ortsplan mit „Mittelhofen“ bezeichnete Weg, die heutige Bachstraße, führte zum Mittelhof. Der Mittelhof war über die sehr steile Sparrengasse, der heutigen Bergstraße, ebenfalls direkt mit dem „Platz“ verbunden. Zwischen Mittelhof und dem neuen Friedhof war der Weg nur ganz gering bebaut und vermutlich, bevor es dort den Friedhof gab, eine Sackgasse. Dies änderte sich, als 1843 der neue Friedhof angelegt wurde. Ab dann war das „Vogtsjockengäßchen“, die heutige Friedhofstraße, mit dem hinteren Teil der Bachstraße verbunden.
Bild 009. Die frühere Straße „Am Bach“.
In der Bachstraße verlief der Wasserlauf vom heutigen kommunalen Kindergarten nahe an dem kleinen Haus vorbei, das auf der derzeitigen kleinen Grünanlage stand. Die Häuser des Mittelhofs standen wie auf einer Insel. Bis zur Bergstraße verlief der Bach rechts der Bachstraße, danach bis zur Staig links der Straße. Die wenigen Häuser auf der östlichen Seite waren ab der Bergstraße jeweils durch Brücken mit der Bachstraße verbunden. Das änderte sich erst, als etwa um 1955 der Bach in den unterirdischen Kanal verlegt wurde, zuvor trennte der Bach die Häuserreihen.
Der „Winkel“ war ein rechter Winkel und als Sackgasse nur vom Unterdorf, der heutigen Hauptstraße, zugänglich. Heute ist statt des Winkels die Johannesstraße ein Winkel, die es jedoch damals noch nicht gab. Das „Hege“, die heutige Hegestraße, zeigt heute noch an manchen Stellen die enge Bebauung. Das „Ober Hägle“, das ist die heutige Espanstraße, führte nur in die Feldflur, ebenso das Hege. Das „Hasenloch“ und das „Rote Gässchen“ waren Sackgassen. Das heute noch amtlich eingetragene „Burggässle“ ist auf dem Ortsplan von 1860 nicht eingetragen. Die Martin-Luther-Straße (Schmalzgasse) bestand 1860 noch nicht.
Die starken Steigungen in Mühlhausen, am Hattensteig und in Tuningen an der Staig waren für den damaligen Verkehr sehr schwer zu bewältigen. Die Staig (Steig) war die einzige befahrbare Verbindung durch Tuningen auf der Strecke zwischen Schwenningen und Tuttlingen. Sie war aber bis ins 19. Jahrhundert ein steiler und schwer befahrbarer nicht gewalzter Schotterweg.
Die Staig wurde 1852 baulich erweitert und anders angelegt, jedoch noch nicht gewalzt. Selbstfahrende Straßenwalzen kamen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Das steile „Gaißengässle“ (heute Bergstraße) war für den Durchgangsverkehr nicht geeignet. Es wurde erst im Jahr 1914 eingeschottert und gewalzt, wobei die Dampfwalze nur bergab fahren konnte. Für die bergauf fahrende Walze war der Weg zu steil.
Bild 010. Die frühere Straße „An der Staig“
Die Häuser
Die ältesten Häuser von Tuningen stehen heute im Bereich zwischen Gasthof Kreuz, Brühlstraße und untere Dengenstraße, auch im Hasenloch. Sie wurden jedoch meistens umgebaut und modernisiert, sodass ihr frühes Baujahr um 1650 in der Regel nicht mehr erkennbar ist. Wie die Häuser bei der Dorfgründung aussahen, wissen wir nicht. Der frühere Bürgermeister Christian Jost (1952-1956) bezeichnete die in Tuningen vorherrschende Hausform als „alemannisches Einheitshaus“. An der Mühlengasse, der heutigen Sunthauser Straße, stand vor 1700 nur ein Haus südlich des Sieblegrabens. Vier weitere wurden um 1840 dort gebaut. Das ehemalige Vogthaus auf dem Butschhof wurde schon um 1660 gebaut. Weitere Häuser mit dem Baujahr um 1700 stehen noch in Dengen, an der Staig und im Hege. Die im November 1841 im Winkel abgebrannten sieben Häuser wurden 1842 wieder aufgebaut. Im Hege baute Schultheiß Kammerer im Jahr 1843 ein neues Haus.
Diese Gebäude wurden jedoch etwa 1.000 Jahre nach der Siedlung der Alemannen gebaut und von Bewohnern, die vielfach erst nach dem Dreißigjährigen Krieg zugezogen waren. Richtig ist, dass über Jahrhunderte zwei Hausformen gebaut wurden, bei denen fast immer der Hausflur die Gebäude in zwei Teile gliederte. Auf der einen Seite war der Wohnbereich, auf der anderen der Stall und die Scheune. Bei den meisten Gebäuden verlief der Stall durchgehend von vorne bis an die Rückfront des Hauses. Ziegenbauern, die manchmal nur den Almend zur Bewirtschaftung hatten, standen oft nur kurze und kleine Scheunen zur Verfügung. Der kleine Ziegenstall befand sich in diesem Fall hinter der Scheuer. Fast an jedem Haus war eine Scheuer mit Stall angebaut und vor dem Haus lag eine Dunglege. Ausnahmen bildeten das Pfarrhaus, die 1730/1740 gebaute Ölburg und vielleicht auch der Ochsen. In diesen Ausnahmefällen befand sich der landwirtschaftliche Teil des Hauses nicht mit dem Wohnteil unter einem Dach.
Oft waren die kleinen Häuser, die man heute teilweise noch an der Dengenstraße, an der Staigstraße und an der Hegestraße findet, ganz zusammengebaut. Zu jedem Gehöft gehörte ein Vorhof, auf dem die Wagen abgestellt wurden und auf dem in der Regel aus Platzgründen die Dunglege vor der Wohnstube lag. Nicht jedes Gebäude verfügte über eine ausreichend große Hofreite (die Hofreite ist der um das Haus liegende Platz), in der Regel war aber ein Hinterhof, bzw. ein Garten hinter dem Haus vorhanden. Wenn das Haus auf einem ebenen Grundstück gebaut wurde, kam das ebenerdige Haus zur Ausführung, es sei denn, es stand an einem Bach. Beim ebenerdigen Haus waren Eingang und Wohnräume auf dem Höheniveau des Hofraumes.
Bild 011. Zwei der ältesten Häuser.
©Landesmedienzentrum Baden-Württemberg / Hans Schwenkel.
Die hier gezeigten Häuser mit ebenerdigem Zugang wurden sicher nicht in der Gründerzeit gebaut, aber sie gehörten, bzw. gehören heute noch zu den ältesten Häusern von Tuningen, wobei das links angebaute in seiner Grundausführung das heute älteste von Tuningen sein soll. Aber sicher hat die obere Etage später eine Erweiterung erfahren. Dieses Bild zeigt zwei aneinandergebaute ebenerdige Häuser. Sie standen auf der westlichen Seite der Dengenstraße.
Es bestehen heute noch alte Häuser, die mit ihrer Rückseite an den Hang gebaut sind, zum Beispiel auf der östlichen Seite der unteren Dengenstraße oder, wie auf diesem Bild, im oberen Bereich der nordseitigen Staigstraße. Bei diesen Gebäuden befinden sich die Wohnräume meistens eine Etage höher. Sie haben einen annähernd ebenerdigen Ausgang von der zweiten Etage aus nach hinten. Je nach Bedarf wurde bei dieser Bauform an der Vorderseite in der unteren Etage neben der Haustüre nur ein Kellerraum oder eine Werkstatt oder ein Zimmer eingebaut. Die Raumhöhe war sehr niedrig.
Ab dem 18. Jahrhundert verwendete man Schindeln statt Stroh für die Dächer und oft wurden die Giebel im oberen Bereich mit Schindeln verkleidet. Die enge Bebauung und die Schindeln boten dem Feuer reiche Nahrung. Erst ab Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Schindeln auf den Dächern durch Ziegel ersetzt.
Bild 012. Häusergruppe an der Staigstraße.
Eine Sonderform bestand bis etwa 1950/1955 in einem Haus an der Hegestraße. Das Doppelhaus hatte eine gemeinsame Scheuer, aber zu jeder Haushälfte gehörte ein Stall.
Bild 013. Ehemaliges Doppelhaus an der Hegestraße.
Eine andere Sonderform bestand in der Bunzelhütte, die auf dem Butschhof stand und drei Wohnungen mit unterschiedlichen Eigentümern aufwies. Das gab es sonst und in der damaligen Zeit in Tuningen nie. Zum Gemeinschaftseigentum gehörten die Scheuer, der Stall und das Plumpsklo. Das alte Haus wurde 1969 abgebrochen und durch ein neues Mehrfamilienhaus ersetzt.
Bild 014. Die Bunzelhütte.
Kapitel 04. Die Verwalter des klösterlichen Vermögens und ihre Burg
Durch die Stiftungen erhielt das Kloster St. Gallen in Tuningen und Umgebung ab dem 8. Jahrhundert Land, das vor Ort bewirtschaftet werden musste. Das Kloster, besaß bis ins 13., möglicherweise bis anfangs des 14. Jahrhunderts das Zehntrecht in Tuningen. Die Verwaltung der klösterlichen Güter wurde einem der neun Besitzer der Gründerhöfe von Tuningen übertragen. Dieser wurde Maier genannt und seine Nachkommen kamen zu Reichtum und Ansehen. Sie stiegen in den Ortsadel auf, für den es standesgemäß war, dass er in einer Burg wohnte.
Am 21. Juni 1297 reichte der St. Galler Propst Heinrich von Lupfen beim Konstanzer Offizial Klage gegen Konrad von Grünburg ein, weil er dem Kloster in verschiedenen Orten auf der Baar die Zehenten entfremdet habe 6). Die damalige Grünburg stand oben am Eingang in die Gauchachschlucht, auf Unadinger Gemarkung. Über den Prozessverlauf ist nur bekannt, dass außer in Mundelfingen, auch in Tuningen, Weigheim und Pfohren Unregelmäßigkeiten beklagt wurden. Der Gerichtstermin fand am 21. Oktober 1297 statt. Die Zeugenbefragung zog sich bis in den November 1298. Seither soll Tuningen in den Unterlagen von St Gallen nicht mehr zu finden sein. Über den Ausgang des Prozesses ist nichts bekannt. Es ist anzunehmen, dass er mit einem Vergleich endete (siehe auch im Kapitel 04, Abschnitt „Die heute bekannten Mitglieder des Ortsadels“ in diesem Buch).
Da das Zehntrecht etwa im 13. Jahrhundert an die Herren von Lupfen ging, benötigte das Kloster St. Gallen in Tuningen vermutlich keine Verwalter mehr. Das mag der wahre Grund für den Wegzug der Tuninger Maier im 14. Jahrhundert gewesen sein. In diesem Zusammenhang verweise ich auch darauf, dass nach etwa 1100 die Stiftungen von Tuningen an andere Klöster gingen (siehe Kapitel 02, Abschnitt „Verbindungen zum Kloster St. Gallen und die erste Erwähnung des Ortsnamens“ in diesem Buch).
Der Ortsadel von Tuningen1)
Es ist nicht bekannt, wann sich der Ortsadel in Tuningen bildete. Der Name „Willehart von Thuningen“ findet sich schon im 12. Jahrhundert, später auch mehrfach der Name „der Jäger von Thuningen“. Die letzten Ortsadeligen „von Thuningen“ wurden erst kurz vor ihrem Wegzug anfangs des 14. Jahrhunderts im Zusammenhang mit bestimmten Tätigkeiten oder Ereignissen erwähnt. Konrad und Berthold von Thuningen waren sicher nicht die ersten Ortsadeligen. Sie wurden etwa um 1270-1290, vermutlich in der Tuninger Burg, geboren. Ihre direkten Vorfahren wohnten wahrscheinlich auch schon in der Burg.
Die Tuninger Ortsadeligen zogen nach Villingen. Sie trugen dort den Namen „von Thuningen zu Villingen“. Ahnenfolgen lassen sich aus den vorliegenden Daten nicht zuverlässig ermitteln. Nachdem es sich jedoch um eine einzige Familie handelte, kann ein annähernd sicherer Zusammenhang angenommen werden. Wir finden auch den Beinamen zum Rufnamen „der Thuninger von Villingen“ und im 15. Jahrhundert den Namen Wilhelm Thuninger. So änderte sich in Villingen die Namensschreibung der ehemaligen Ortsadeligen von Tuningen. Der Beiname Thuninger wurde aber in Villingen nicht zum Familiennamen. Die Tuninger Maier waren teilweise auch in Villingen als Verwalter tätig. Konrad von Thuningen war zum Beispiel von 1380-1387 in Villingen Bürgermeister. Die Nachkommen der Tuninger Maier bekamen deshalb in Villingen, nach ihrer früheren Tätigkeit, den Familiennamen Maier.
Die heute bekannten Mitglieder des Ortsadels
„Konrad von Thuningen“, war im Jahr 1310 in St. Blasien Zeuge in einem Vergleich und „Berthold von Thuningen“ war am 2. Februar 1324 Zeuge in einem Verzicht an das Kloster St. Blasien. Möglicherweise standen diese Verhandlungen im Zusammenhang mit dem vorstehend erwähnten Gerichtsverfahren. „Konrad von Thuningen“ war außerdem am 11. November 1331 Bürge für Heinrich von Offenburg.
Der hier mit den Jahreszahlen 1310 und 1331 genannte „Konrad von Thuningen“ war sicher nicht derselbe, wie der, der von 1380 bis 1387 Schultheiß von Villingen war. Jener beurkundete 1385 eine Ratsurkunde mit dem Tuninger Siegel. Der Schultheiß war vermutlich ein Sohn des „Heinrich von Thuningen“, der bereits Bürger in Villingen war, als er im Dezember 1360 von Graf Haug von Fürstenberg Güter in der Langenschiltach zu Lehen bekam. Noch im Januar 1412 trug ein „Hans von Thuningen zu Villingen“ den Namen „von Thuningen“, aber er wohnte „zu Villingen“. Er war mit Anna, der Tochter des Villinger Bürgers Konrad Enger, verheiratet, welcher auch zeitweise im Besitz des Tuninger Zehnten war. „Hans von Thuningen“ zog sich im November 1417 auf das Leibgeding zurück und starb im Februar 1427. Sein Bruder Mathias starb im Jahr 1428. Der Name „von Thuningen“ findet sich noch 1483 bei „Wilhelm von Thuningen“, dem Sohn des „Mathias von Thuningen“. Die Besitzer der Tuninger Burg wohnten inzwischen alle in Villingen. Diese und viele andere Aufzeichnungen über die Familie derer „von Thuningen“, können der Beschreibung des ehemaligen Oberamtes Tuttlingen von 1879 entnommen werden. Sie zeigen, dass diese Herrschaften, die zuvor die Tuninger Burg bewohnten, sich bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Villingen niederließen.
Bild 015. Der Tuninger Ortsadel.
Die Tuninger Burg
Burgen waren Wohnstätten, die mit Schutzfunktionen ausgestattet waren. Wenn es keine steilen Felsen gab, die die Burgen schützen, so waren es oft Wassergräben. Eine Burg musste nicht auf einem Berg stehen. Oft standen sie auch in den Niederungen. Eine Höhenburg war in Tuningen nicht möglich.
Es ist nicht bekannt, wann die Tuninger Burg gebaut wurde. Vermutlich war es im 12. oder im 13. Jahrhundert. Auch ist nicht bekannt, wo die Burg genau stand. Der heutige Flurname „Hinter der Burg" und das „Burggäßchen", das vom früheren Unterdorf entlang dem Sieblegraben in Richtung Hege führte, geben jedoch einen groben Hinweis auf den Standort der Burg. Es ist anzunehmen, dass sie in der Nähe der Flur „Hinter der Burg“ und gewiss auch in der Nähe des Burghofes, unweit der Zehntscheuer im „Höfle“, auf die der Flurname „Hinter der Zehntscheuer“ hinweist, stand. Ihr Standort war somit zwischen der Hege- und der Kalkhofstraße. Sie stand nicht, wie teilweise behauptet wurde, auf einem der in der Nähe befindlichen Grabhügel aus vorgeschichtlicher Zeit, auch nicht in der Nähe des Kirchplatzes, zehn Meter über dem Sieblegraben. Solchen Veröffentlichungen fehlt jegliche Beweiskraft.
Nachdem Graf Ludwig I. von Württemberg 1444 die ehemaligen Herrschaften Lupfen und Karpfen gekauft hatte (siehe Kapitel 05 in diesem Buch), zerfiel die Tuninger Burg. Es blieb kein Stein auf dem anderen. Heute, fast 600 Jahre nach dem letzten Besitzerwechsel, ist nichts mehr von der Tuninger Burg zu sehen. Ihre ehemalige Existenz ist aber eindeutig belegt.
Kapitel 05. Die Herrschaft der Herren von Lupfen
Tuningen gehörte seit mindestens Ende des 13. Jahrhunderts zur Herrschaft der Herren von Lupfen, danach vorübergehend zur Herrschaft von Blumberg und bis 1444 zur Herrschaft von Friedingen bei Radolfzell. Seit 9. Juli 1444 ist Tuningen württembergisch.
Die Burg Lupfen, ist erstmals im Jahr 1065 nachweisbar und war eine der größten Burgen in Württemberg. Die ersten bekannten Herren von Lupfen waren hochangesehene Äbte, Priester und Domherren, deren Namen schon um das Jahr 1000 zu finden ist 5).
Heinrich von Lupfen, wurde um 1200/1220 geboren. Er war verheiratet mit einer Frau von Küssenberg. Sein Schwager, der letzte Graf von Küssenberg, hinterließ ihm, nach dem Vergleich vom 19. März 1251 mit dem Bischof von Konstanz, die Burg Stühlingen. Dadurch war er der erste Landgraf von Stühlingen aus dem Hause Lupfen. Nach dem Tode des Heinrich von Lupfen, Herr von Stühlingen, der wohl vor 1258 erfolgte, teilte sich die Familie in zwei Linien. Der Sohn Berthold von Lupfen, um 1240 geboren, erhielt die Burg bei Talheim und die Herrschaft Lupfen, der Sohn Eberhard, geboren 1256, bewohnte mit seiner Frau Adelheid von Zimmern das mütterliche Erbe derer von Küssenberg, in der Landschaft Stühlingen. Er nannte sich Landgraf zu Stühlingen. Die Stühlinger Linie brachte viele bedeutende Männer hervor und gelangte zu hohem Glanze, bis 1582 mit dem Grafen Heinrich VI. der Mannesstamm erlosch. Drei weitere Söhne von Heinrich von Lupfen und seiner Frau von Küssenberg waren Ulrich, Domherr von Straßburg, Hugo, Domherr in Straßburg und Stadtpfarrer in Rottweil und Heinrich, Pfarrer in Oberndorf, Mönch und Probst in St. Gallen. Es war dieser Heinrich, der am 21. Juni 1297 als Propst von St. Gallen beim Konstanzer Offizial Klage gegen Konrad von Grünburg einreichte (siehe Kapitel 04 in diesem Buch).
Der vorstehend genannte Eberhard I., Landgraf von Stühlingen (1256-1302) und seine Söhne Eberhard II. und Hugo (Haug) verkauften im Jahr 1299 die Güter in Tuningen, zusammen mit denen in „Schierstein“ (vermutlich in Schura) an seinen Neffen Heinrich von Lupfen, Sohn seines Bruders Berthold von Lupfen (Talheimer Linie). Eine Steuerliste um 1280 vom Hause Lupfen enthielt bereits 21 Steuerzahler aus Tuningen. Diese Angaben belegen, dass Tuningen mindestens seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zur Herrschaft der Herren von Lupfen gehörte.
Um diese Zeit gehörte auch die Herrschaft Karpfen dem Landgraf Eberhard I. von Stühlingen, welche nach 1250 durch Erbe den Herren von Lupfen zufiel. Etwa 1295 hatte er sogar seinen Sitz auf Karpfen. Danach folgten die Herren von Blumberg und ab etwa 1413 besaßen die Herren von Emershofen Teile der Burg und Herrschaft Hohenkarpfen.
Dem Stammvater Berthold (Talheimer Linie) folgte der vorstehend genannte Sohn Heinrich von Lupfen (siehe Stammbaum), danach dessen Sohn Konrad I., danach dessen Sohn Georg und schließlich seine Söhne Bruno (oder Brun Eberhard) und Konrad II. Bruno war mit der Baroness Margaretha von Geroldseck-Sulz (Burg Albeck) verheiratet. Aus ihrer Ehe überlebten keine Söhne. Die beiden Söhne von Konrad II., Hans und Diepold, wurden von einer „nicht ebenbürdigen Gemahlin“ geboren und fielen deshalb in der Herrschaftsnachfolge aus.
Die Burg Lupfen wurde erstmals im Jahr 1377 durch die Rottweiler zerstört, danach teilweise wieder aufgebaut. Weil sich Bruno von Lupfen mit Kaiser Sigismund verfeindete, eroberten und zerstörten die mit dem Kaiser befreundeten Rottweiler im Jahr 1416 die Burg erneut und endgültig. Die Herren von Lupfen waren nicht mehr in der Lage ihre Burg erneut aufzubauen. Sie kauften deshalb 1435, am Montag nach Palmtag (Palmsonntag), von Anna, der Witwe des Konrad von Tannheim und Villinger Bürgerin, die unbewohnte Tuninger Burg, finanziert von Leo dem Juden von Villingen 20). Diese Anna war wahrscheinlich eine Schwester von „Hans und Mathias von Thuningen“.
Nach der Beschreibung des Oberamtes Tuttlingen von 1879 verkaufte Bruno von Lupfen bereits im Jahr 1432 das Dorf Tuningen an Heinrich von Blumberg, vergleiche jedoch die nachstehend erklärten vertraglichen Vereinbarungen vom November 1442. Heinrich von Blumberg nannte sich „Herr von Tainingen (Tuningen) und Dießenhofen“ und war verheiratet mit Ursula Truchsess von Dießenhofen.
Im Jahr 1437 verkaufte Bruno von Lupfen seine Stammburg und das Dorf Talheim, sowie die heute verschwundenen Dörfer Ötishofen, Asp und Reifenberg, die auf der heutigen Gemarkung Talheim lagen, an die Herren von Friedingen bei Radolfzell. Die Herrschaft Hohenkarpfen, die die Herren von Lupfen seit dem 13. oder 14. Jahrhundert besaßen, verkaufte Bruno an seine dortigen Mitbesitzer, die Herren von Emershofen.
Bruno von Lupfen starb am 21. September 1439. Er und sein Bruder Konrad II. von Lupfen waren die letzten Besitzer der Herrschaft Lupfen. Brunos Frau Margareta von Geroldseck-Sulz starb am 26. Mai 1440. Diebold von Lupfen, Sohn von Konrad II. und seiner „nicht ebenbürdigen Gemahlin“, war der letzte männliche Namensträger der Talheimer Linie der Herren von Lupfen. Er starb am 1. September 1462.
Die Vermögensverhältnisse des verstorbenen Bruno von Lupfen und seiner Frau Margareta wurden im November 1442 in Vertretung durch Heinrich, Georg, Konrad und Hans von Geroldseck-Sulz (Brüder der verstorbenen Margareta) einerseits und Heinrich von Blumberg, Stefan von Emershofen und Rudolf von Friedingen andererseits vertraglich geregelt, wonach die Dörfer Trossingen, Tuningen und Biesingen an die Herren von Friedingen, bei Radolfzell, gingen.
Zwei Jahre später kaufte Graf Ludwig I. von Württemberg die Herrschaften Lupfen und Karpfen für 7.152 rheinische Gulden. Dazu gehörten der Berg Lupfen, Talheim, Trossingen, Biesingen, Tuningen mit der Burg darin, Rietheim, das Schloss und der Berg Karpfen
Der letzte Namensträger derer von Lupfen (Stühlinger Linie)
Heinrich VI. von Lupfen starb im Dezember 1582. Mit ihm erlosch auch die Stühlinger Linie der Herren von Lupfen.
Bild 016. Stammbaum derer von Lupfen zu Lupfen. 5)
Bild 017. Stammbaum derer von Lupfen, Landgrafen zu Stühlingen. 5)
Anmerkungen zu den Stammbäumen derer von Lupfen. 5)
(Siehe vorstehende Doppelseite)
Die Schreibweise „Probst“ wurde bis ins 18. Jahrhundert neben „Propst“ verwendet. In den Stammbäumen wurde, gemäß der Vorlage, die alte Schreibweise verwendet. Es wäre zwar müßig, aber sicher auch interessant, die Geschichte der in den Stammbäumen aufgeführten Personen zu erforschen.
Auf Heinrich von Lupfen, der zuletzt Propst im Kloster St. Gallen war und der beim Konstanzer Offizial Klage gegen Konrad von Grünburg eingereicht hatte, wurde schon an anderer Stelle hingewiesen. 6) Er war einer der fünf Söhne von Heinrich von Lupfen und seiner Frau von Küssenberg.
Geschichtlich interessant ist der Hinweis auf den Fürstbischof Johann I. (Hans) von Lupfen, der beim Konstanzer Konzil (1414-1418) als Vorsteher des Hofgerichtes die Verurteilung von Hieronymus von Prag, dem Mitstreiter von Jan Hus, der wie dieser auf dem Scheiterhaufen sein Leben ließ, leitete.
Ein weiterer interessanter Hinweis: Der Schwiegervater von Elisabeth von Lupfen, der Tochter des Fürstbischofs Hans von Lupfen, war Graf Heinrich IV. von Fürstenberg, der im Jahr 1372 seiner zweiten Gemahlin, Sophie von Zollern, einen Teil von Sunthausen schenkte. Dieser Teil von Sunthausen wurde bei der Reformation evangelisch und gehörte bis 1871 zur Tuninger Kirchengemeinde.
Kapitel 06. Über die Zehnt- und Patronatsrechte von Tuningen und über die Tuninger Besonderheiten
Das Zehntrecht oder Zehentrecht
Kaiser Karl der Große (768-814) führte das Zehntrecht ein. Der Begriff Zehnt oder Zehent bestand ursprünglich in einer etwa zehnprozentigen Steuer, die die zehntpflichtigen Bauern, in Form von Geld oder Naturalien, an eine geistliche oder an eine weltliche Institution, abzuliefern hatten. Im Mittelalter wurde der Zehnt als Kirchenzehnt in Naturalien auf den Grundbesitz erhoben. Die Abgabe und die Lagerung der Naturalien erfolgten in der Zehntscheuer.
Das Zehntrecht gliederte sich in unterschiedliche Teilrechte, die mit verschiedenen Steuersätzen, auch über zehn % hinaus, belastet werden konnten. Es gab den großen und den kleinen Zehnten, unterteilt in den großen und den kleinen Heuzehnten (Heu- und Öhmdzehnten), den großen und den kleinen Fruchtzehnten (Kornzehnten, den Zehnten auf Halm- und Schotenfrüchte, Kartoffeln, Futterpflanzen, Hanf, Flachs) und den Novalzehnten (Neubruchzehnten für neu umgebrochene Äcker).
Das Patronatsrecht (Kirchensatz) und die damit verbundenen Verpflichtungen
Papst Alexander III. führte das Kirchenpatronat, auch Kirchensatz genannt, ein. Der Kirchensatz war ein bestimmter Teil (Satz) des großen und kleinen Zehnten. Das Patronat bestand aus der Gesamtheit von Teilrechten und -pflichten, die einer natürlichen oder juristischen Person zustanden. Es war nicht an eine Person gebunden und konnte deshalb vererbt, verkauft, verpfändet oder getauscht werden. Der Kirchensatz wurde oft zusammen mit dem Zehntrecht gegen Bezahlung verliehen.
Das wichtigste Teilrecht des Kirchensatzes war das Präsentationsrecht, d.h. das Recht einen Pfarrer auf eine zu besetzende Stelle vorzuschlagen. Zu den Pflichten des Patronats gehörten die Finanzierung der Pfarrei, also der Besoldung des Pfarrers, einschließlich der mit dieser Stelle verbundenen Kosten, zum Beispiel auch die Kosten am Pfarrhaus und dessen Nebengebäuden, auch die der Pfarrscheuer sowie ein Teil, in der Regel die Hälfte, der Baulast an der Kirche.
Verpflichtungen der Ortsgemeinde
In jedem württembergischen Dorf stand nur ein Kirchengebäude, welches in der Regel dem Dorf gehörte. Demgemäß war in Tuningen der Gemeinderat der (bürgerlichen) Gemeinde, für das Kirchengebäude, die Orgel, den Turm, die Glocken, die Turmuhr und den Kirchhof, samt Kirchhofmauer, zuständig. Finanziell trugen die Dorfgemeinde und der Patronatsträger je die Hälfte der Baulast an der Kirche und ihren Einrichtungen.
Die Rechte im Besitz des Klosters St. Gallen und der Herren von Lupfen.
Bis ins 13. Jahrhundert hatte das Kloster St. Gallen das Zehntrecht und den Kirchensatz von Tuningen. Vom 13. bis ins 15. Jahrhundert besaßen die Grafen von Lupfen die Rechte. Wie bereits erwähnt, teilte sich die Familie der Herren von Lupfen vor 1258 in die zwei Linien, derer von Lupfen, zu Lupfen, und derer von Lupfen, Landgrafen zu Stühlingen. Es ist nicht bekannt, ob sich die beiden Linien der Herren von Lupfen die Zehntrechte teilten. Anscheinend waren die Rechte aber längere Zeit im Besitz der Landgrafen zu Stühlingen. In der Folgezeit wurden die Zehntrechte oft gehandelt und verliehen.
Für Tuningen begann eine katastrophale Abhängigkeit
Als am 9. Juli 1444 Graf Ludwig I. von Württemberg die Herrschaften Lupfen und Karpfen kaufte, war Tuningen mit dabei. Dies geht aus dem Kaufbrief, der in der Heimatchronik Tuningen auf den Seiten 40 und 41 abgedruckt wurde, hervor. Dort steht wörtlich „Beide Herrschaften, Karpfen und Lupfen mit allen Rechten und Gerechtigkeiten wurden erkauft um Sieben Tausend Ein Hundert Fünfzig und Zwey Gulden“.
Der langjährige Talheimer Pfarrer Hochstetter (1908-1948) schrieb in seinem Büchlein „Talheim in der Baar“ über Lasten und Zehnten „Nicht bloß die Leibeigenen, sondern auch alle anderen Bewohner der von der Herrschaft Lupfen an die Grafschaft Württemberg übergegangenen Ortschaften schuldeten, was sie zuvor der früheren Herrschaft Lupfen schuldig gewesen waren, fortan dem neuen Herrn.“ Doch das war im Fall Tuningen nicht so. Wie konnte es sein, dass die Zehntrechte von Tuningen mit dem Patronat (Kirchensatz) etwa 40 Jahre nach dem Kauf durch den Grafen von Württemberg in die Hände von Villinger Bürger kamen?
Wahrscheinlich hatte zu diesem Zeitpunkt der Landgraf zu Stühlingen die Zehntrechte von Tuningen größtenteils noch selbst im Besitz. Doch dann wurden diese Rechte endgültig von der Grundherrschaft getrennt und unabhängig und eigenständig gehandelt. Württemberg kaufte die Herrschaft von den Herren von Friedingen, die Zehntrechte von Tuningen blieben vermutlich beim Landgrafen von Stühlingen, der sie hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an Villinger Bürger verkaufte.
Der Zehnte und das Patronat (Kirchensatz) kamen in private Hände.11)
In der Tuninger Pfarrbeschreibung von 1828 berichtete Pfarrer Laichinger über mehrere Käufe von Teilrechten bei Zehnte und Kirchensatz durch verschiedene Privatpersonen. Demnach wurde zum Beispiel im Jahr 1486 der große Kirchensatz in zwei Teilen, sowie der große und der kleine Zehent und auch Teile des Barrhohof-Zehenten (Bauhof ist falsch), an Privatpersonen veräußert. Danach entstand ein reger Handel mit den Rechten, auch zwischen den Privatpersonen.
Dieser Vorgang und besonders die damit verbundenen Folgen dürften einmalig in der Geschichte des Zehnt- und Patronatsrechtes gewesen sein. Darüber wird in weiteren Abschnitten dieses Buches im Detail berichtet, so zum Beispiel über die Schikanen im Zusammenhang mit der Reformation und über die Villinger Überfälle während des Dreißigjährigen Krieges. Die einstmals engen Beziehungen zwischen Villingen und Tuningen haben dadurch sehr gelitten.
Die Elendjahrszeitpflege Villingen kaufte die Tuninger Zehntrechte auf
Die Elendjahrszeitpflege (Seelenjahrszeitpflege) war vergleichbar mit einer Bank im Mittelalter, teilweise auch mit einer sozialen Einrichtung. Sie wurde im Jahr 1354 n. Chr. gegründet und stand unter der Verwaltung des Magistrats der Stadt Villingen (siehe Kapitel 17, Abschnitt „Die Pest“).
Die Elendjahrszeitpflege kaufte am 7. Februar 1549 11), also in der Interimszeit der Reformation, von den Erben des Altbürgermeisters Hans Hermann den Kirchensatz sowie den großen und den kleinen Korn- und Heuzehnten von Tuningen. Die Rechte wurden hauptsächlich an das Haus Fürstenberg und an die Landgrafen von Stühlingen verliehen. Die bei der Reformation streng katholisch gebliebenen Villinger besaßen danach fast 300 Jahre lang das Tuninger Zehntrecht und das Patronat der Tuninger evangelischen Kirche. Das Recht der Nomination und der Präsentation des jeweiligen Pfarrers von Tuningen kam schon zur Zeit der Reformation dem Stadtrat der großherzoglich badischen Stadt Villingen als Verwalter des Elendjahrszeithauses zu. Ab 1549 hatte dann der württembergische Regent lediglich das Recht, die Ernennung der Pfarrer durch die Elendjahrszeitpflege Villingen zu bestätigen oder abzulehnen. Die Elendjahrszeitpflege in Villingen war bis 15. Juli 1841 Inhaber des Kirchensatzes von Tuningen. Der Villinger Magistrat war Eigentümer des Tuninger Pfarreinkommens, weshalb er bis 1850 den Zehnten von Tuningen bekam.
Während dieser Zeit erfüllte jedoch die Elendjahrszeitpflege ihre Patronatsverpflichtungen bezüglich der Unterhaltsleistungen gegenüber dem jeweiligen Pfarrer nicht, was zuerst aus einer Aufzeichnung um das Jahr 1659 von Pfarrer Johann Ulrich Danböck hervorgeht. Er schrieb, dass die Villinger Patronatsherren dem jeweiligen evangelischen Pfarrer von Tuningen zu Philippi (26. Mai), Jakobi (25. Juli), Martini (11. November) und am Thomastag (21. Dezember) je eine Mahlzeit schulde. Solches ist auch aus der bitteren Klage von Pfarrer Laichinger in der Tuninger Pfarrbeschreibung von 1828 zu lesen 11).