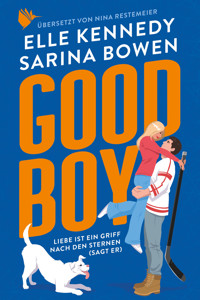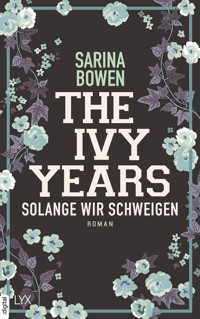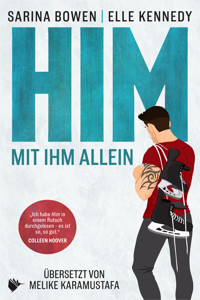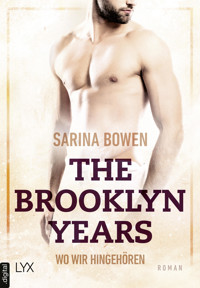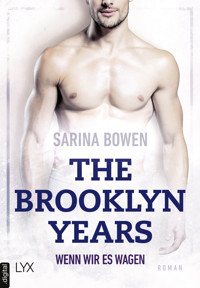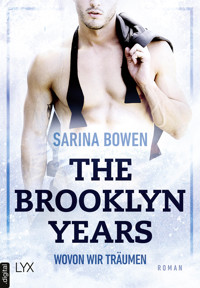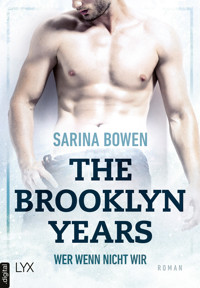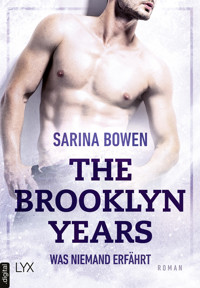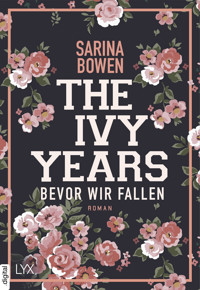
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ivy-Years-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Liebe kann dich heilen ... aber auch zerstören.
Wegen eines schweren Sportunfalls muss Corey Callahan das College im Rollstuhl beginnen. In ihrem Wohnheim trifft sie Adam Hartley, einen charismatischen Eishockeyspieler, der sich das Bein gebrochen hat und wegen seiner Krücken im benachbarten barrierefreien Zimmer untergebracht wurde. Ein Glücksfall, denn Adam behandelt sie als Einziger ganz normal. Corey entwickelt schnell Gefühle für Adam, die über enge Freundschaft weit hinausgehen - aber Adam hat eine wunderhübsche Freundin und gegen die hat Corey in ihrem Rollstuhl doch sowieso keine Chance ...
"Ich liebe Sarina Bowens Geschichten. Ich werde alles von ihr lesen!" Colleen Hoover, Spiegel-Bestseller-Autorin
Band 1 der Ivy-Years-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchZitat1234567891011121314151617181920212223Die AutorinDie Romane von Sarina Bowen bei LYXImpressumSARINA BOWEN
Ivy Years
Bevor wir fallen
Roman
Ins Deutsche übertragen vonRalf Schmitz
Zu diesem Buch
Bei einem Sportunfall verletzt Corey Callahan sich so schwer, dass sie vorübergehend auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Um ihren überfürsorglichen Eltern zu entkommen, entschließt sie sich, den Platz am renommierten Harkness College trotzdem anzunehmen. Gleich am ersten Tag begegnet sie dem sexy Eishockeyspieler Adam Hartley, der sich in den Ferien ein Bein gebrochen hat und nun auch im barrierefreien Wohnheim untergebracht wurde. Da ihr Zimmernachbar mit Krücken und Gipsbein vor ähnlichen Herausforderungen steht wie Corey, verbringen die beiden viel Zeit miteinander, und schnell merkt sie, dass es an Adam mehr zu entdecken gibt als nur sein gutes Aussehen und sein freches Sportlerimage. Er hilft ihr, die Folgen ihres Unfalls zu verarbeiten, und behandelt sie als Einziger völlig normal. Corey entwickelt Gefühle für Adam, die über enge Freundschaft weit hinausgehen, und in ihr regen sich Hoffnungen, die sie seit ihrem Unfall für begraben hielt. Aber Adam hat eine hübsche Freundin, die er für ein Mädchen im Rollstuhl sicher nie verlassen würde, und Corey weiß, dass sie nach ihrem Unfall nicht auch noch die Kraft hat, mit einem gebrochenen Herzen zu leben!
Die Hoffnung ist das Federding,das in der Seel’ sich birgtund Weisen ohne Worte singtund niemals müde wird.
EMILY DICKINSON
1
Wasserspeier und ein Barbecue
Corey
»Sieht doch vielversprechend aus«, sagte meine Mutter, als sie die mit Efeu überwucherte Fassade des Studentenwohnheims betrachtete. Ich hörte die großen Erwartungen, die in ihrem Tonfall mitschwangen. »Probier mal deinen Kartenschlüssel aus.«
Überall auf dem Campus hörte man die Ahs und Ohs der Eltern der Erstsemesterstudenten am Harkness College. Den Reiseführern konnte man entnehmen, dass drei der letzten sechs Präsidenten mindestens einen Abschluss an diesem dreihundert Jahre alten College gemacht hatten; und dass zweimal täglich Studenten der Carillon Guide die einhundertvierundvierzig Stufen des Beaumont-Towers hinaufstiegen, um den Campus mit einem Ständchen zu beglücken, das von den Glocken herrührte, von denen jede mindestens eine Tonne wog.
Allerdings interessierte sich meine Mutter leider weder aus historischen noch aus architektonischen Gründen für das Wohnheim. Es war die Rampe für Rollstuhlfahrer, die es ihr angetan hatte.
Ich rollte vorwärts und hielt meine glänzende neue Harkness-ID vor den Kartenleser. Dann drückte ich die blaue Taste mit dem Rollstuhl darauf und hielt die Luft an, bis die schön gewölbte Tür langsam aufschwang. Nach allem, was ich im vergangenen Jahr durchgemacht hatte, konnte ich kaum glauben, dass dies hier tatsächlich geschah. Ich war drin.
Nachdem ich die Rampe hoch und in das schmale Gebäude gerollt war, zählte ich zwei Schlafräume – einen links, einen rechts des Ganges – mit breiten Türen, die von den barrierefreien Zimmern dahinter kündeten. Vor mir sah ich eine Treppe mit einem hübschen Geländer aus Eiche. Wie die meisten Wohnheime am Harkness College hatte auch dieses keinen Aufzug. Einem der oberen Räume würde ich mit meinem Rollstuhl also gewiss keinen Besuch abstatten.
»Der Boden ist absolut ebenerdig«, stellte meine Mutter beifällig fest. »Als man uns mitgeteilt hat, dass das Gebäude acht Jahre alt ist, hatte ich da meine Zweifel.«
Und das war noch vorsichtig ausgedrückt.
Der Umstand, dass meine Eltern mich förmlich angefleht hatten, nicht hierherzukommen, war nur das Tüpfelchen auf dem i der bitteren Ironie, die mich verfolgte. Während andere Eltern in solchen Momenten praktisch Konfetti über ihren Nachwuchs regnen ließen, hatten meine pro Kopf zwei Herzattacken erlitten, weil ihre Kleine sich für ein College entschieden hatte, das mehr als tausend Kilometer von zu Hause entfernt lag, was bedeutete, dass sie nicht alle halbe Stunde nach ihr sehen konnten.
Gott sei Dank.
Nach dem Unfall hatten sie mich auf Knien angefleht, noch ein Jahr zu warten. Aber wer hatte schon Lust, ein Jahr herumzuhängen und keinen anderen Zeitvertreib zu haben als zusätzliche Stunden Physiotherapie. Als ich auf den sprichwörtlichen Tisch schlug, um endlich mit dem College beginnen zu können, änderten meine Eltern ihre Taktik und versuchten, mich dazu zu überreden, lieber in Wisconsin zu bleiben und dort eine Uni zu besuchen. Anschließend musste ich mir jede Menge besorgter Vorträge zu den Themen »Warum ausgerechnet Connecticut?« und »Du musst niemandem etwas beweisen!« anhören.
Doch ich wollte es so. Ich wollte die Chance, dieselbe Eliteuniversität zu besuchen wie mein Bruder. Ich wollte die Unabhängigkeit, ich wollte einen Tapetenwechsel, und vor allem wollte ich mir den Geschmack des vergangenen Jahres aus dem Mund spülen.
In diesem Moment öffnete sich die Tür links von mir und ein hübsches Mädchen mit dunklen Locken streckte den Kopf heraus.
»Corey!«, rief sie mit einem Strahlen im Gesicht. »Ich bin Dana!«
Als ich die Nachricht, mit wem ich zusammenwohnen würde, aus unserem Briefkasten in Wisconsin gefischt hatte, hatte ich nicht recht gewusst, was ich von Dana halten sollte. Doch in den vergangenen Monaten hatten wir einige E-Mails hin- und hergeschrieben, und ich hatte sie ein wenig besser kennengelernt.
Sie stammte aus Kalifornien, hatte aber eine Highschool in Tokio besucht, weil ihr Vater dort seit Jahren geschäftlich zu tun hatte. Über meine körperlichen Macken wusste sie Bescheid. Ich hatte ihr erklärt, dass ich in meinem rechten Fuß und meinem ganzen linken Bein kein Gefühl mehr hatte. Und ich hatte sie vorgewarnt, dass ich die meiste Zeit im Rollstuhl saß. Auch wenn ich mit unförmigen Beinschienen und auf Unterarmstützen manchmal eine armselige Imitation des aufrechten Gangs hinlegte. Außerdem hatte ich mich bei ihr dafür entschuldigt, dass man ihr mit mir eine äußerst seltsame Mitbewohnerin zugewiesen hatte und dass sie für den Rest des Erstsemesters mit »der Behinderten« in einem anderen Wohnheim als die anderen Studenten leben musste.
Nachdem Dana mir sofort geantwortet hatte, dass mache ihr nichts aus, begann mir eine kleine Hoffnungsfee auf meiner Schulter aufmunternd ins Ohr zu flüstern. Das kleine gefiederte Ding schwirrte wochenlang um mich herum und hauchte seine Ermutigungen. Als ich Dana nun zum ersten Mal in Fleisch und Blut vor mir stehen sah, schlug die Hoffnungsfee auf meiner Schulter begeistert ein Rad.
Ich breitete die Arme aus und schloss den Rollstuhl in meine Geste mit ein. »Wie hast du mich erkannt?«
Ihre Augen funkelten, bevor sie genau richtig reagierte: »Facebook, du Dussel!« Dann riss sie die Tür auf, und ich rollte hinein.
»Unser Zimmer ist sagenhaft!«, rief Dana schon zum dritten Mal. »Wir haben mindestens doppelt so viel Platz wie alle anderen. Das ist super für Partys.«
Gut, dass ich mit Dana eine Mitbewohnerin hatte, für die das Bierglas immer halb voll war.
Unser Zimmer war wirklich schön. Direkt hinter der Tür lag etwas, das Harkness-Studenten einen »Gemeinschaftsraum« nannten, was für den Rest der Welt aber einfach ein Wohnzimmer war. Daran grenzten zwei Schlafzimmer, die beide groß genug waren, um darin mit einem Rollstuhl manövrieren zu können. Was die Möbel anbetraf, so verfügte jede von uns über einen Schreibtisch und – überraschenderweise – ein Doppelbett.
»Ich habe Laken für ein schmales Bett mitgebracht«, sagte ich irritiert.
»Ich auch«, lachte Dana. »Vielleicht haben barrierefreie Zimmer immer Doppelbetten. Egal, dann müssen wir eben shoppen gehen – wie schrecklich!« Ihre Augen blitzten.
In dem Moment kam, unter der Last einer meiner Koffer schnaufend, meine Mutter ins Zimmer. »Shoppen? Wozu?«
»Bettwäsche«, antwortete ich. »Wir haben Doppelbetten.«
Sie klatschte in die Hände. »Dann bringen wir euch Mädels zu Target, bevor wir zurückfahren.«
Ich wäre meine Eltern lieber gerne schnell wieder losgeworden, doch Dana stimmte begeistert zu.
»Aber ich schau mich erst noch mal um. Vielleicht brauchst du ja noch mehr Sachen«, sagte meine Mutter und marschierte in unser Badezimmer.
Das Bad war geräumig und hatte eine barrierefreie Dusche.
»Perfekt«, rief sie. »Lass uns schon mal ein paar Sachen von dir einräumen und sehen, wo du deine Katheter trocknen kannst.«
»Mutter!«, zischte ich. Ich hatte wirklich keine Lust, gleich als erstes meine abgefahrenen Rituale vor meiner Mitbewohnerin zu erörtern.
»Wenn wir zu Target fahren«, ließ sich Dana aus dem Gemeinschaftsraum vernehmen, »sollten wir uns auch nach Teppichen umsehen. Hier drin hallt es.«
Meine Mutter kam aus dem Bad gelaufen, um mich noch tiefer zu demütigen. »Oh, solange Corey noch laufen übt, ist ihr ein Teppich bloß im Weg. Sie könnte stolpern. Aber sagt doch mal, wo Frank euren Fernseher aufhängen soll«, fügte sie hinzu, während sie sich im Kreis drehte.
Ich nahm die Gelegenheit wahr, das Thema zu wechseln. »Mein Vater hat einen Flachbildfernseher und einen Kabelvertrag für uns besorgt«, erklärte ich Dana. »Das heißt, falls du nichts dagegen hast, es steht ja nicht jeder auf Fernsehen.«
Dana wog nachdenklich den Kopf hin und her. »Ich bin auch nicht so der Fernsehjunkie …« Ihre Augen blitzen. »Aber vielleicht versammeln sich ja gewisse, äh, Leute in unserem Zimmer, um hier Sport zu gucken.«
Meine Mutter lachte. »Was für Leute?«
»Habt ihr unseren Nachbarn noch nicht gesehen? Er ist im dritten Studienjahr.« Meine neue Mitbewohnerin blickte vielsagend Richtung Gang.
»Gegenüber?«, fragte ich. »In dem zweiten barrierefreien Schlafraum?« Nicht gerade der erste Ort, an dem ich nach einem heißen Typen suchen würde.
Sie nickte. »Wart’s ab. Du wirst schon sehen.«
Unsere Einkaufstour dauerte viel länger, als ich gehofft hatte. Meine Mutter bestand mit dem Hinweis, dass die speziellen Betten unsere Schuld seien, darauf, für Danas neue Laken zu bezahlen.
Sie entschied sich für eine Daunendecke mit einer riesigen toten Blume in der Mitte. Ich nahm Punkte.
»Sehr fröhlich«, kommentierte Mom anerkennend.
Meine Mutter hatte immer schon auf fröhlich gestanden. Aber nach den Monaten, die wir hinter uns hatten, klammerte sie sich an den Begriff wie an einen Rettungsring.
»Und jetzt die passenden Kopfkissen, meine Damen. Und …«, sie bog in den nächsten Gang ein, »für jede ein Extrakissen. Sonst sehen die Betten nicht richtig aus.«
»Sie muss das nicht tun«, flüsterte Dana mir zu.
»Lass sie«, gab ich zurück und bedeutete ihr, sich zu mir herunterzubeugen, damit ich etwas Vertrauliches hinzufügen konnte. »Kuck mal nach Teppichen. Wenn du was Gutes entdeckst, kommen wir ein andermal noch mal her.«
Sie sah mich stirnrunzelnd an. »Aber ich dachte …«
Ich verdrehte die Augen. »Sie hat eine Meise.«
Dana verschwand mit einem Zwinkern zwischen den Teppichen.
Als wir zurückkamen, stand mein Vater mitten in unserem leeren Zimmer und zappte durch die Kanäle auf dem inzwischen an der Wand befestigten Fernseher.
»Voller Erfolg!«, rief er.
»Danke, Dad.«
Sein Lächeln verriet seine Müdigkeit. »Keine Ursache.«
Während meine Mutter mir im vergangenen Jahr vor allem auf den Geist gegangen war, gestaltete sich das Verhältnis zu meinem Vater noch beträchtlich schwieriger. Früher hatten wir den lieben langen Tag nur über Eishockey geredet. Unsere gemeinsame Leidenschaft und das, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Doch nach dem Unfall hatte sich ein unbehagliches Schweigen zwischen uns breitgemacht. Dass ich nicht mehr eislaufen konnte, machte ihn fix und fertig. Er war seitdem um mindestens zehn Jahre gealtert. Ich hoffte sehr, er würde, sobald ich aus dem Haus war, wieder zu seinem alten Ich zurückfinden.
Es war höchste Zeit meine Eltern hinauszukomplimentieren. »Leute, auf der Wiese gibt es ein Barbecue für die Erstsemester. Dana und ich wollen dahin. Sofort.«
Meine Mutter rang die Hände. »Warte. Ich hab deine Nachttischlampe noch nicht installiert.«
Sie flitzte ins Schlafzimmer, während ich mir einen wütenden Kommentar verkniff. Echt jetzt? Ich besaß seit meinem siebten Lebensjahr keine Nachttischlampe mehr. Und als mein Bruder vor vier Jahren am Harkness angefangen hatte, hatte es auch keine derartigen Handreichungen gegeben. Damien hatte nicht mehr als ein Flugticket und ein gut gemeintes Klopfen auf die Schulter bekommen.
»Sie kann nicht anders«, sagte mein Vater, der meine Miene richtig deutete. Dann hob er seinen Werkzeugkasten vom Boden auf und wandte sich der Tür zu.
»Alles wird gut«, sagte ich, während ich ihm hinterherrollte.
»Ich weiß, Corey.« Er legte mir eine Hand auf den Kopf, nahm sie aber gleich wieder weg.
»Dad? Ich hoffe, du hast eine tolle Spielzeit.«
Sein Blick war schwermütig. »Danke, Schatz.«
Unter anderen Umständen hätte er mir bestimmt dasselbe gewünscht. Er hätte meine Schulterpolster gecheckt, und wir hätten uns im Zimmer nach einem Platz für meine Hockeytasche umgesehen. Und später hätte er einen Flug gebucht, um herzukommen und mich spielen zu sehen. Doch nun würde nichts dergleichen passieren. Stattdessen standen beziehungsweise saßen wir uns schweigend im Flur gegenüber.
Doch schon im nächsten Moment wurde mein Tagtraum jäh vom Anblick eines Typen beendet, der gerade an der Wand neben seiner Zimmertür ein Whiteboard aufhängte. Zuerst fiel mein Blick auf einen äußerst straffen Rücken und muskulöse Oberarme. Er versuchte, einen Nagel in die Wand zu bekommen, ohne dass dabei seine Krücken auf den Boden polterten.
»Verdammt«, fluchte er leise, als trotzdem eine umfiel.
Als er sich zu uns umdrehte, war es, als würde sich nach einem Regentag doch noch die Sonne blicken lassen. Sein Gesicht war so schön wie das eines Filmstars, mit strahlenden braunen Augen und dichten Wimpern. Sein dickes braunes Haar war ein bisschen zerzaust, als wäre er gerade mit den Fingern hindurchgefahren. Außerdem war er groß, und er sah stark aus, ohne dabei gleich wie ein Muskelprotz zu wirken. Nicht gerade der Körper eines Linebackers, aber definitiv athletisch. Definitiv.
Wow!
»Hey«, grüßte er und offenbarte dabei ein Grübchen.
Hallo auch, Süßer, antwortete mein Hirn unwillkürlich. Mein Mund blieb jedoch leider stumm. Einen Pulsschlag später ging mir auf, dass ich die ganze Zeit wie ein Reh ins Scheinwerferlicht auf seinen schönen Mund starrte.
»Hey«, brachte ich unter allergrößter Anstrengung quiekend hervor.
Mein Vater bückte sich, um die Krücke aufzuheben, die diesem hübschen Geschöpf entglitten war. »Das nenne ich mal einen Gipsverband, mein Sohn.«
Ich sah genauer hin und spürte, dass ich rot wurde. Seinen Gips zu betrachten, bedeutete, ihn praktisch von oben bis unten zu mustern. Am Ende meiner gründlichen Prüfung blieb ich mit dem Blick an einem äußerst muskulösen Bein hängen. Das Gegenstück steckte in einem weißen Gips.
»Ja, wunderschön, oder?« Seine Stimme war auf eine so männliche Weise rau, dass ich eine Gänsehaut bekam. »An zwei Stellen gebrochen.« Damit streckte er meinem Vater die Hand hin. »Adam Hartley.«
»Autsch, Adam Hartley«, sagte Dad und schüttelte ihm die Hand. »Frank Callahan.«
Adam Hartley blickte an seinem Bein hinunter. »Tja, Mr Callahan, da sollten Sie erst den anderen Burschen sehen.«
Die Miene meines Vaters erstarrte.
Doch dann verzog mein Nachbar seinen Mund erneut zu einem extrabreiten Grinsen. »Keine Sorge, Sir, Ihre Tochter muss nicht Tür an Tür mit einem Schläger wohnen. In Wahrheit bin ich gestürzt.«
Das Gesicht, das mein Vater darauf machte, war so unbezahlbar, dass ich zu sabbern aufhörte und stattdessen lachen musste.
Als mein hinreißender neuer Nachbar mir die Hand reichte, musste ich ein Stück vorrollen, um sie zu ergreifen.
»Netter Schachzug«, kommentierte ich seine Schlagfertigkeit. »Ich bin Corey Callahan.«
»Freut mich«, sagte er, als er mit seiner Riesenhand zupackte.
Als seine hellbraunen Augen aufleuchteten, bemerkte ich, dass jede Iris von einem dunkleren Ring eingefasst war. Ich fühlte mich mit einem Mal befangen, als er sich über mich beugte, um mir die Hand zu schütteln. Und war es hier drinnen nicht plötzlich viel zu warm?
Im nächsten Moment wurde der Bann von einer schrillen weiblichen Stimme gebrochen, die aus seinem Zimmer drang.
»Haaartleeey! Du musst das Foto aufhängen, damit du mich nicht vergisst, solange ich in Frankreich bin! Ich kann mich bloß nicht entscheiden, wo es am besten aussieht.«
Hartley verdrehte ein kleines bisschen die Augen. »Mach noch drei Abzüge, Schatz«, rief er. »Dann hast du eines für jede Wand.«
Mein Vater reichte Hartley grinsend seine Krücke.
»Liebling?«, ließ sich die Stimme aufs Neue vernehmen. »Hast du meine Mascara gesehen?«
»Die brauchst du doch gar nicht, Schönste«, antwortete er, während er sich beide Krücken unter die Arme klemmte.
»Hartley! Hilf mir suchen!«
»Tja, das klappt nie«, sagte er augenzwinkernd. Dann wies er mit einem Nicken auf seine offene Zimmertür. »Hat mich sehr gefreut, aber jetzt muss ich dringend die große Make-up-Krise lösen.«
Er verschwand im selben Moment, in dem meine Mutter mit angespannter Miene aus meinem Zimmer trat. »Bist du dir sicher, dass wir nichts mehr für dich tun können?«, fragte sie mit von Furcht erfülltem Blick.
Sei nett, redete ich mir gut zu. Jetzt ist endlich Schluss mit dem Welpenschutz.
»Danke für eure Hilfe. Aber ich glaube, ich habe alles.«
Der Ausdruck in den Augen meiner Mutter wurde noch trauriger. »Pass gut auf dich auf, Kleines«, sagte sie mit kratziger Stimme. Dann beugte sie sich vor und schloss mich in die Arme, wobei sie meinen Kopf fast an ihrer Brust zerquetschte.
»Mache ich, Mom«, gab ich mit gedämpfter Stimme zurück.
Sie schien tief durchzuatmen und sich zusammenzureißen. »Ruf an, wenn du uns brauchst«, sagte sie noch, bevor sie Richtung Ausgang ging.
»Aber wir geraten auch nicht gleich in Panik, wenn du mal ein paar Tage nicht anrufst«, ergänzte mein Vater, und bevor die Tür hinter ihm zufiel, legte er kurz salutierend eine Hand an die Stirn.
Dann waren sie fort.
Ich stieß einen Seufzer purer Erleichterung aus.
Eine halbe Stunde später brachen Dana und ich zum Barbecue auf. Sie ging auf der Straße, während ich auf dem Gehweg neben ihr herrollte.
Die Studenten am Harkness College verteilten sich auf zwölf Häuser. Ganz wie auf Hogwarts, nur viel größer und ohne die verschiedenen Hüte. Dana und ich gehörten zum Beaumont House, wo wir ab dem zweiten Studienjahr wohnen würden. Die Erstsemester waren alle zusammen in den Gebäuden rings um den riesigen Freshman Court untergebracht. Alle Erstsemester außer uns. Aber wenigstens lag unser Wohnheim gleich auf der anderen Straßenseite. Mein Bruder hatte mir gesagt, dass McHerrin House allen möglichen Zwecken diente. So wurden dort unter anderem Studenten untergebracht, deren Wohnheim gerade renoviert wurde, oder solche aus dem Ausland, die nur ein Semester lang blieben. Und offenbar Behinderte wie ich.
Dana und ich folgten dem Duft von Grillhähnchen durch eine Reihe von Marmortorbögen. Dahinter lag der Freshman Court, wo die Gebäude einander an Eleganz und Alter zu übertrumpfen schienen. Jedes von ihnen protzte mit steilen, steinernen Stufen, die zu geschnitzten Holztüren hinaufführten. Obwohl ich jetzt selbst hier studierte, bestaunte ich die Schmuckfassaden wie ein Tourist. Da war ich also – am Harkness College mit all seinen steinernen Wasserspeiern und seiner dreihundertjährigen Geschichte. Und es war ebenso fantastisch wie barrierefrei.
»Ich wollte dir noch sagen, wie leid es mir tut, dass wir nicht mit den anderen am Fresh Court wohnen«, sagte ich im Jargon der Erstsemester, den ich meinem Bruder abgelauscht hatte. »Es ist irgendwie nicht fair, dass du mit mir im McHerrin festsitzt.«
»Hör auf, dich zu entschuldigen, Corey«, entgegnete Dana mit Nachdruck. »Wir werden jede Menge Leute kennenlernen. Und unser Zimmer ist doch großartig. Also alles kein Thema.«
Wir näherten uns der Mitte der Rasenfläche, wo ein Zelt aufgeschlagen war. Die warme Brise trug Gitarrenakkorde herüber, und der Geruch von Holzkohle stieg uns in die Nase.
Ich hätte mir niemals träumen lassen, ausgerechnet in einem Rollstuhl im College aufzuschlagen. Manche Menschen behaupteten, das Leben nach einem so einschneidenden Erlebnis mehr schätzen gelernt zu haben. Dass sie seitdem nichts mehr für selbstverständlich gehalten hätten. Manchmal hätte ich solchen Menschen am liebsten eine reingehauen. Heute aber verstand ich sie. Die Septembersonne schien warm, und meine Mitbewohnerin erwies sich als genauso nett wie in ihren E-Mails. Und ich war am Leben. Es wurde Zeit, dass ich diesem Umstand allmählich mehr abgewann.
2
Guck mal, Mom, keine Stufen!
Corey
Am nächsten Morgen begannen die Vorlesungen. Also rollte ich, bewaffnet mit einer Sonderausgabe der Harkness Accessible Campus Map – des Übersichtsplans, der mich über den barrierefreien Campus führen sollte –, durch den Sonnenschein auf das mathematische Institut zu. Wie angekündigt verfügte das Gebäude an seiner Westseite über eine zweckmäßige Rollstuhlrampe und extrabreite Türen. Analysis 105 war also wenigstens barrierefrei, wenn schon nicht besonders aufregend.
Danach ging es auf Anregung meines Vaters zum Wirtschaftswissenschaftskurs.
»Ich hätte immer gern mehr über Geld gewusst«, hatte er in einem seltenen Moment der Reue gestanden. »Ich habe deinen Bruder gebeten, es mit Wirtschaft zu versuchen, und ihm hat es gefallen. Ich fände es gut, wenn du es auch mal ausprobieren würdest.«
Nachdem ich die Trumpfkarte »Großer Bruder« zuvor für meine eigenen selbstsüchtigen Zwecke ausgespielt hatte, war das natürlich eine äußerst wirksame Verhandlungstaktik.
Mein Totschlagargument in den nervigen Diskussionen darüber, welches College ich von diesem Jahr an besuchen würde, hatte gelautet: »Damien ist aufs Harkness gegangen, und ich will da auch hin.« Worauf weder mein Vater noch meine Mutter den Mumm gehabt hatten, ihrer behinderten Tochter in die Augen zu blicken und zu widersprechen. Sie waren eingeknickt, und ich hatte mich, um meinen Vater zufriedenzustellen, für ein Semester Mikroökonomie eingeschrieben. Was immer das sein mochte. Das Ende vom Lied war, das meine Montag-, Mittwoch- und Freitagvormittage – zuerst Analysis und danach Wirtschaft – schrecklich langweilig sein würden.
Der Hörsaal, in dem die Wirtschaftsvorlesung stattfand, war groß und alt mit endlosen Reihen dicht beieinanderstehender antiker Eichenstühle. Da es keine offensichtlichen Rollstuhlstellplätze gab, positionierte ich mich neben ein paar alten, nicht zueinanderpassenden Stühlen an der Rückwand.
Eine Minute darauf ließ sich jemand schwer auf den Platz neben mir fallen.
Ein Blick nach rechts offenbarte einen gebräunten, muskulösen Unterarm, der mit einem Paar hölzerner Unterarmstützen hantierte. Allem Anschein nach war soeben mein heißer Nachbar aufgeschlagen, und sofort erwachte meine kleine gefiederte Fee Hoffnung und flüsterte mir ins Ohr: Wirtschaft wird immer interessanter.
Hartley kickte stöhnend seinen Rucksack über den Holzboden vor sich und wuchtete dann die Ferse seines gebrochenen Beins darauf. Schließlich lehnte er den Kopf an die Wandtäfelung hinter uns und sagte: »Erschieß mich, Callahan. Wieso hab ich mich bloß für eine Vorlesung eingeschrieben, die so weit weg von McHerrin stattfindet?«
»Du hättest mit dem Behindertenfahrdienst herkommen können«, schlug ich vor.
Er wandte sich mir zu und richtete seine schokobraunen Augen wie zwei Scheinwerfer auf mich. »Wie bitte?«
In diesem Moment vergaß ich fast, was ich gesagt hatte. Ach ja, der Behindertenfahrdienst.
»Es gibt einen Fahrdienst.« Ich gab ihm meinen Übersichtsplan. »Du musst nur früh genug die Nummer hier anrufen, dann wirst du vor der Vorlesung abgeholt.«
»Wer hätte das gedacht?« Hartley betrachte stirnrunzelnd die Karte. »Und du machst das so?«
»Im Ernst? Ich würde mir lieber ein leuchtend rotes L auf die Stirn kleben, als den Fahrdienst zu nutzen.«
Ich deutete mit zwei Fingern das universell gültige Zeichen für »Loser« an, worauf Hartley vor Lachen losprustete. Als dabei sein Grübchen zum Vorschein kam, hätte ich am liebsten die Hand ausgestreckt und den Daumen hineingelegt.
Ein mageres Mädchen mit glatten dunklen Haaren und einer Riesenbrille glitt auf den Stuhl auf Hartleys anderer Seite.
»Entschuldige«, wandte er sich an sie. »Die Plätze hier sind für Krüppel reserviert.«
Sie sah mit Riesenaugen zu ihm auf und sprang dann wie ein furchtsames Kaninchen vom Stuhl.
Ich sah ihr nach, wie sie durch den Mittelgang zu einem anderen Platz huschte. »Also, ich hab kapiert, dass du einen Witz gemacht hast«, sagte ich.
»Echt?« Hartley schenkte mir ein weiteres warmherziges und gleichzeitig so teuflisches Grinsen, dass ich unmöglich den Blick abwenden konnte. Als der Professor an das Mikrofon über dem Pult klopfte, zog er einen Notizblock hervor und legt ihn sich auf den Schoß.
Professor Rumpel schien ungefähr hundertneun zu sein, plus/minus ein Jahrzehnt. »Es stimmt«, begann er, »was man über die Ökonomie sagt. Die Antwort auf so ziemlich jede Prüfungsfrage lautet: Angebot und Nachfrage.« Darauf prustete der alte Mann einen Schwall Luft ins Mikro.
Hartley beugte sich zu mir und flüsterte: »Das sollte wohl ein Scherz sein.«
Die körperliche Nähe brachte meine Wangen zum Glühen. »Wir haben echt ein Problem«, zischte ich zurück.
Aber eigentlich meinte ich damit nur mich selbst.
Am Ende der Vorlesung klingelte Hartleys Handy, also winkte ich ihm nur freundlich zu und rollte alleine aus dem Vorlesungssaal.
Nachdem ich meinen treuen Behindertenplan konsultiert hatte, machte ich mich auf den Weg zum größten Speisesaal auf dem Campus – der Harkness-Mensa, die in den Neunzehnhundertdreißigern erbaut worden war, um sämtlichen Studenten auf einmal Platz zu bieten. Langsam rollte ich in den riesigen, überfüllten Saal. Vor mir erstreckten sich über hundert Holztische. Nachdem ich am Eingang meinen Ausweis durchgezogen hatte, beobachtete ich, um herauszufinden, wohin ich mich als Nächstes wenden musste, das allgemeine Gewusel.
Die Studenten strömten an mir vorbei auf die gegenüberliegende Wand zu. Also fädelte ich mich mit dem Rollstuhl zwischen den Tischen hindurch und hielt auf die offenkundige Warteschlange zu. Ich ließ mich weitertreiben, während ich eine Anschlagtafel zu entziffern versuchte, und rollte dabei versehentlich in das weibliche Ende der Schlange.
Das Mädchen fuhr herum und schaute wütend, bis ihr Blick mich fand und sie erkannte, wer sie da angestoßen hatte. »Oh, entschuldige, tut mir leid«, sagte sie schnell.
Ich spürte, wie ich rot wurde. »Nein, mir tut es leid.«
Wieso entschuldigte sie sich bei mir? Schließlich war ich die Dumpfbacke, die sie angefahren hatte. Dabei wusste ich inzwischen nur allzu gut, dass es nur eine der vielen seltsamen Wahrheiten war, die mit einem Mal dazugehörten, wenn man in einem Rollstuhl unterwegs war. In neun von zehn Fällen entschuldigten sich die Leute, die ich anrempelte oder sogar über den Haufen fuhr, bei mir. Was echt keinen Sinn ergab und mich eigentlich sogar mächtig ankotzte.
Mir fiel auf, dass alle anderen vor mir bereits ein Tablett und Besteck in der Hand hielten, also manövrierte ich wieder aus der Schlange, fand Tabletts und Geschirr und stellte mich aufs Neue an.
Im Rollstuhl befand ich mich auf Augenhöhe mit den Hinterteilen vor mir. So hatte die Welt schon mal für mich ausgesehen – als ich sieben Jahre alt gewesen war.
Hartley
Ich schwöre bei Gott, der Typ, der mein Sandwich zubereitete, hätte sich nicht langsamer bewegen können, wenn er an den Handgelenken gefesselt gewesen wäre. Ich stand derweil mit schmerzhaft pochendem Knöchel und zappelndem gesunden Bein vor ihm. Dass ich das Frühstück ausgelassen hatte, machte es nicht besser. Als er mir endlich den Teller reichte, hatte ich das Gefühl, jeden Moment in Ohnmacht zu fallen.
»Danke.«
Ich nahm den Teller mit der rechten Hand entgegen und rammte mir anschließend die Krücke unter die rechte Achsel. So versuchte ich vorwärtszukommen, ohne mit der Hand nach der Krücke greifen zu müssen. Doch ich verlor das Gleichgewicht, wankte gefährlich und musste mich gegen die Essensausgabe lehnen, um aufrecht stehen zu bleiben. Die Krücke fiel klappernd zu Boden.
Gescheitert. Mein einziger Trost war, dass das Sandwich nicht auch noch über Bord gegangen war.
»Hey Krüppel!«, hörte ich eine Stimme hinter mir.
Ich drehte mich um, brauchte aber eine Minute, bis ich Corey ausgemacht hatte, weil ich zuerst nach jemandem auf meiner Höhe Ausschau gehalten hatte. Doch nach einem kurzen peinlichen Moment senkte ich den Blick und entdeckte sie.
»Callahan«, rief ich. »Hast du mein geschicktes Manöver gerade mitgekriegt?«
Sie nahm mir lächelnd den Teller ab und stellte ihn auf ihr Tablett. »Du solltest dich nicht unglücklich machen wegen einem …«, sie blickte auf meinen Teller, »Truthahnsandwich. Warte einen Moment, dann nehme ich es für dich mit.«
»Danke.«
Ich seufzte, hoppelte aus dem Weg und wartete geduldig, bis derselbe unmotivierte Sandwich-Typ ihr Mittagessen zusammengestellt hatte.
Stunden später (vielleicht übertreibe ich aber auch ein bisschen) enthielt unser Gemeinschaftstablett Sandwiches, Chips, Cookies, mein Glas Milch und ihre Cola Light.
»Ich glaube, ich hab da drüben einen freien Tisch gesehen. Unter der nächsten Postleitzahl«, brummte ich und stelzte los.
Corey rollte mit unserer Beute zum Tisch, wo ich einen der schweren Holzstühle zurückzog, um einen Stellplatz für sie zu schaffen. Dann ließ ich mich auf einen Stuhl fallen.
»Jesus, Maria und die ganze heilige Familie.« Ich bettete meine Stirn auf die Handballen. »Das hat ja nur siebenmal so lange gedauert wie normal.«
Corey gab mir meinen Teller. »Deine Verletzung ist noch ziemlich frisch, oder?«, fragte sie, als sie ihr Sandwich nahm.
»Merkt man mir das so deutlich an? Es ist erst vor einer Woche beim Hockey passiert. Während des Vorbereitungstrainings.«
»Hockey?« Ein seltsamer Ausdruck huschte über ihr Gesicht.
»So in der Art. Es ist nicht beim Spielen selbst passiert, was wenigstens noch irgendwie Sinn ergeben hätte. Ich hab mir das Bein gebrochen, als ich von einer Kletterwand gestürzt bin.«
Ihr klappte die Kinnlade runter. »Sind die Seile gerissen?«
Nicht wirklich.
»Eigentlich gab es gar keine Seile. Und eigentlich war es zwei Uhr nachts.« Ich wand mich. Es machte wirklich überhaupt keinen Spaß, einem hübschen Mädchen zu beichten, was für ein Idiot man gewesen war. »Und noch eigentlicher war ich ziemlich betrunken.«
»Autsch, dann kannst du nicht mal behaupten, dass du auf dem Spielfeld zu hart rangenommen worden bist?«
Ich sah sie mit einer hochgezogenen Augenbraue an. »Stehst du auf Hockey, Callahan?«
»Kann man so sagen.« Sie fuchtelte mit einem Kartoffelchip herum. »Mein Vater trainiert ein Highschool-Hockeyteam. Und mein Bruder Damien war letztes Jahr hier am College Senior Wing.«
»Kein Scheiß? Du bist Callahans kleine Schwester?«
Ihre blauen Augen funkelten, als sie lächelte. Sie hatte ein Mörderlächeln und so rosige Wangen, als hätte sie gerade einen Fünftausendmeterlauf absolviert. »So ist es.«
»Na bitte, ich wusste doch, du bist cool.« Ich trank einen großen Schluck Milch.
»Also«, sie griff wieder nach ihrem Sandwich, »wenn der Bruch erst eine Woche alt ist, musst du ganz schöne Schmerzen haben.«
Ich zuckte kauend mit den Schultern. »Mit den Schmerzen komme ich klar, wenn ich nur nicht so verdammt tollpatschig wäre. Ich brauche eine halbe Stunde, um mich anzuziehen. Und zu duschen ist ein echtes Trauerspiel.«
»Aber nur vorübergehend.«
Als mir das Ausmaß meiner Blödheit bewusst wurde, hörte ich schlagartig auf zu kauen. »Shit, Callahan, da heul ich dir was vor, weil ich zwölf Wochen ein Gipsbein tragen muss …« Ich legte mein Sandwich beiseite. »Ich bin echt ein Arsch.«
Sie wurde rot. »Nein, so habe ich das nicht gemeint. Wirklich nicht. Wie soll ich mich denn beklagen, wenn du nicht auch ein bisschen jammern darfst?«
»Wieso?« Meiner Meinung nach hatte ich soeben bewiesen, dass sie so viel jammern durfte, wie sie wollte. Vor allem gegenüber so einem Arsch wie mir.
Corey spielte mit ihrer Serviette. »Na ja, meine Eltern haben mich nach meinem Unfall in eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Rückenmarksverletzungen geschickt. Der Grund dafür, dass ich in diesem Ding sitze …« Sie gestikulierte mit den Händen vor ihrem Bauch herum. »Egal, da waren lauter Leute, die noch viel weniger Körperteile bewegen konnten als ich. Viele konnten ihre Arme nicht mehr spüren. Die waren nicht mal in der Lage, alleine zu essen oder sich im Bett herumzudrehen. Diese Leute könnten weder aus einem brennenden Gebäude fliehen, noch jemandem eine E-Mail schicken oder mal irgendwen in den Arm nehmen.«
Ich stützte den Kopf auf eine Hand. »Tja, das baut einen echt auf.«
»Wem sagst du das? Die Leute dort haben mir eine Heidenangst eingejagt, deswegen bin ich nie wieder hingegangen. Also, wenn ich heulen darf – und glaub mir, ich heule viel –, kannst du dich ebenso gut darüber beklagen, dass du wie ein Flamingo herumhüpfen musst.« Damit nahm sie ihr Sandwich wieder auf.
»Und …« Ich hatte keinen Schimmer, ob die Frage nicht vielleicht viel zu persönlich war. »Und wann war das?«
»Wann war was?« Sie wich meinem Blick aus.
»Der Unfall.«
»Am fünfzehnten Januar.«
»Moment mal … dieses Jahr im Januar? Vor acht Monaten?« Die Andeutung eines Nickens. »Und … da hast du dir letzte Woche gedacht, scheiß drauf, es ist September, Zeit, ans andere Ende des Landes zu ziehen und mein Leben zu leben?«
Corey kippte hastig ihre Cola hinunter, wahrscheinlich, um meiner Neugier zu entgehen. »Na ja, mehr oder weniger. Aber mal im Ernst, wie lange muss man denn trauern, wenn man nur noch ein Bein benutzen kann?« Sie sah mich mit einer hochgezogenen Braue unverwandt an.
Fuck. Dieses Mädchen hatte mich gerade wahrscheinlich für den Rest meines Lebens von meinem Jammer geheilt. »Du bist echt hart drauf, Corey Callahan.«
Sie zuckte leicht mit den Schultern. »Das College hat mir ein Jahr Aufschub angeboten, aber ich habe abgelehnt. Du hast meine Eltern ja gesehen. Ich wollte nicht länger zu Hause herumsitzen und zuschauen, wie sie verzweifelt die Hände ringen.«
Als mein Handy klingelte, musste ich Corey das allgemein gültige Zeichen für »Moment mal« geben und Stacias Anruf entgegennehmen.
»Hey heißer Feger«, sagte ich. »Ich sitze an einem Tisch an der Rückwand. Ich liebe dich auch.« Ich verstaute das Handy. »Okay … wo waren wir? Dann hat dich also ein wenig liebevolle Fürsorge in eine andere Zeitzone katapultiert?«
»Wir drei sind in den letzten Monaten halb verrückt geworden. So war es für alle am besten.«
Darüber hatte ich bisher nicht nachgedacht – hätte ich aber tun sollen. Man erleidet einen Unfall nie nur für sich allein.
»Kann ich mir vorstellen. Meine Mom hat mich letzte Woche auch völlig bekloppt gemacht. Aber vermutlich hatte ich es nicht besser verdient.«
»Deine Mom war sauer, weil du dir das Bein gebrochen hast?«
»Und wie. Ich hab mich ja nicht verletzt, während ich einen Haufen Kleinkinder aus einem brennenden Haus gerettet habe. Meine Mutter musste ein paar Tage Urlaub nehmen, um sich um mich kümmern zu können, und das Geld für die Mordsrechnung für die Notaufnahme muss sie auch noch berappen.«
»Dein Trainer war bestimmt genauso wenig begeistert«, stellte Corey fest.
»Du sagst es. Die Ansage, dass ich alle anderen im Stich gelassen habe, musste ich mir schon ein paarmal reinziehen«, sagte ich und hielt gleichzeitig nach Stacia Ausschau.
Ein paar Minuten und ein halbes Sandwich später erschien ein umwerfendes Mädchen unter dem Eingangstorbogen. Ich konnte die Augen nicht von ihr lassen, während sie dastand und den Blick über die Tische schweifen ließ.
Stacia hatte alles. Sie war groß und hatte trotzdem Kurven, dazu ihr langes, fließendes blondes Haar und die hoheitsvolle Haltung einer Prinzessin. Ihre großen haselnussbraunen Augen leuchteten auf, als sie mich entdeckte. Dann setzte sie ihre langen Beine in Bewegung und kam auf mich zu. Als sie neben mir stand, beugte sie sich herunter, um mir einen hingebungsvollen Kuss auf den Mund zu geben.
Obwohl wir seit fast einem Jahr miteinander ausgingen, traf es mich noch immer wie ein Schock, wenn sie das tat.
»Stacia«, sagte ich, nachdem sie meine Lippen freigegeben hatte, »das ist meine neue Nachbarin, Corey Callahan. Sie und ihre Mitbewohnerin Dana haben auch ein Zimmer in Beaumont House.«
»Freut mich, dich kennenzulernen«, sagte Stacia schnell und würdigte Corey dabei kaum eines Blickes. »Bist du so weit, Hartley?«
Ich lachte. »Baby, du hast ja keine Ahnung, wie hart wir uns diese Mahlzeit erkämpfen mussten. Also gib mir ein paar Minuten, damit ich in Ruhe aufessen kann.« Ich rückte ihr einen Stuhl zurecht.
Stacia setzte sich zwar, gab sich aber keine Mühe, ihren Ärger hinunterzuschlucken. Sie hackte auf ihr Handy ein, während ich mir mit Milch und Cookies Zeit ließ.
Corey war verstummt, aber die Stille währte nicht lange. Stacia war noch nie darum verlegen gewesen, jedes Schweigen mit einem ihrer Luxusprobleme zu füllen.
»Meine Friseurin schreibt, dass sie mich morgen nicht dazwischenschieben kann. So ein Mist«, beschwerte sich meine Freundin.
»Ich bin ziemlich sicher, dass es in Paris auch Friseursalons gibt«, sagte ich. Nicht dass sie irgendwas darauf gegeben hätte.
Stacia war das wählerischste Mädchen der Welt. Auch das Mensaessen genügte ihren Ansprüchen nicht, weswegen sie fast immer außerhalb des Campus aß. Ihr Haarwaschmittel kam mit der Post, weil keine der fünfzig Sorten im Drugstore die richtige war. Und neuen Leuten gegenüber war sie auch nicht gerade warmherzig eingestellt. Mich jedoch betrachtete sie mit demselben Blick, mit dem sie eine Einkauftüte von Prada ins Auge fasste. Das schicke Mädchen aus Greenwich, Connecticut wollte genau diesen Typ. Den mit der Bruins-Cap und dem Gold’s Gym T-Shirt. Wenn ich behaupten würde, mich deshalb nicht dreißig Zentimeter größer zu fühlen, wäre ich ein Lügner.
Corey trank ihre Cola aus und machte sich daran, unser Zeug auf ihr Tablett zurückzupacken.
»Hey Stacia.« Ich legte ihr eine Hand auf den Unterarm, um sie auf mich aufmerksam zu machen. »Tust du uns einen Gefallen und bringst das Geschirr weg?«
Überrascht sah sie von ihrem Handy auf. Dann ließ sie den Blick von dem Tablett durch die Mensa wandern, als wollte sie die für die Aufgabe erforderliche Anstrengung berechnen. Sie zögerte eine ganze Weile, und ich sah, dass Corey bereits kurz davor war, in die Bresche zu springen, als Stacia sich doch noch erhob, das Tablett packte und davonstapfte.
Ich schüttelte den Kopf und schenkte meiner neuen Nachbarin ein verlegenes Grinsen. »Bei ihr zu Hause macht so was das Personal.«
Coreys Miene verriet mir, dass sie keine Ahnung hatte, ob das ein Scherz sein sollte oder nicht. Ehrlich gesagt war es keiner.
Stacia mochte ein harter Brocken sein, aber immerhin war sie mein harter Brocken.
3
Der Möbel-Dschinn
Corey
»Und, wie war dein erster Tag?«, fragte Dana, als ich am Nachmittag heimkam. Sie thronte auf dem Fensterbrett und lackierte ihre Fingernägel.
»Gut. Ich hab alle drei Vorlesungen auf Anhieb gefunden. Und bei dir?«
»Alles super. Mein Kunstgeschichteprof gefällt mir echt gut.«
»Sieht er scharf aus?« Ich wackelte anzüglich mit den Augenbrauen.
»Wenn du auf Mittsiebziger stehst, dann ja.«
»Hat jemand was anderes behauptet?« Ich grinste.
Da mir kein Möbelstück im Weg stand – Danas Schreibtisch stand an der einen Wand, ihren Koffer hatte sie danebengeschoben –, kippte ich meinen Rollstuhl auf die Hinterräder.
»Wow! Ist das nicht gefährlich?«
»Nö.« Ich machte es gleich noch mal, stieß mich ab und drehte mich auf den Hinterrädern im Kreis. »Mir wird davon nur ein bisschen schwindlig.«
»Gibt es nicht vielleicht so was wie Rollstuhlbasketball?«, erkundigte sich Dana und pustete auf ihre Nägel.
»Wahrscheinlich«, antwortete ich ausweichend.
In Anbetracht meiner sportlichen Vergangenheit hatte mir mindestens ein Dutzend Leute dieselbe Frage gestellt. Vor meinem Unfall hatten mich Körbe allerdings null interessiert. Und irgend so ein angepasster Scheiß kam für mich erst recht nicht infrage. Wieso dachten die Leute automatisch, ich könnte Spaß daran haben? Warum mussten alle Behinderten auf Basketball abfahren?
Dana schraubte den Nagellack zu. »Also … ich gehe heute Abend zu der Session. Hast du Lust?«
»Was für eine Session?«
»Ein Konzert, bei dem sich die ganzen A-cappella-Gruppen der Uni präsentieren. Willst du mitmachen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab in der Achten mit dem Singen aufgehört, weil sich der Chorunterricht mit dem Hockeykurs überschnitten hat.«
»So super gut musst du gar nicht sein. Es gibt zehn Gruppen, und die Geselligkeit ist dabei genauso wichtig wie die Musik.«
»Na gut, dann gehen wir zusammen hin«, beschloss ich. »Probieren kann man es ja mal.«
»Spitze. Es geht nach dem Abendessen los. Ich schaue mal nach, wo die Aula ist.« Sie sprang auf und kramte einen Campusplan aus ihrer Tasche.
»Netter Fernseher, Ladys«, ließ sich von der offenen Tür eine sexy Stimme vernehmen.
Ich blickte auf und sah Hartley im Türrahmen stehen. »Danke«, sagte ich, während mein Herz einen Zahn zulegte.
»Aber was ihr wirklich braucht, ist genau hier ein Sofa.« Er deutete auf die leere Wand neben der Tür. »Auf dem Fresh Court kann man Gebrauchte kaufen.«
»Haben wir gesehen«, sagte Dana. »Wir wissen bloß nicht, wie wir an einen Möbel-Dschinn kommen, der es uns hierherträgt.«
Hartley kratzte sich an seinem umwerfend markanten Kinn. »Ich schätze, zwei Behinderte und ein Mädchen kriegen das nicht auf die Reihe. Aber ich lass mir beim Abendessen was einfallen.« Er blickte auf seine Uhr. »Was genau jetzt losgeht. Seid ihr dabei?«
»Klar«, antwortete Dana. »Ich war noch gar nicht im Beaumont-Speisesaal.«
»Na, dann los«, rief Hartley und kehrte seine Krücken dem Ausgang zu.
Dana und ich folgten ihm aus McHerrin auf die Straße hinaus.
Beaumont House verfügte, passend zu seiner ganzen sonstigen gotischen Pracht, über massive Eisentore. Als Dana ihren Ausweis vor das Lesegerät hielt, öffnete sich das Schloss mit einem Klicken. Sie schob das Tor auf, damit zuerst Hartley hindurchgehen und anschließend ich hinterherrollen konnte.
Mit Hartley auf Krücken und mir, die ich sehr vorsichtig fuhr, kam unsere körperlich eingeschränkte Parade nur langsam voran. Der Plattenweg war ziemlich bucklig, und ich wollte nicht in einer der Ritzen stecken bleiben und mich auf die Nase legen. Es war so schon ätzend genug, das »Mädchen im Rollstuhl« zu sein. Da musste ich nicht auch noch zum »Mädchen, das aus seinem Rollstuhl katapultiert wurde« werden.
Wir durchquerten einen kleinen gepflasterten Innenhof, der in einen größeren mündete, der Teil jeder offiziellen Harkness-Führung war. Mein Bruder Damien hatte immer gejammert, dass er dort auf dem Weg zum Unterricht ständig Touristen mit Fotoapparaten ausweichen musste. Aber falls das der Preis dafür war, in einem historischen Schloss aus Granit und Marmor zu leben und zu studieren, hatte ich nichts dagegen.
Als wir auf der anderen Hofseite angekommen waren, blieb Hartley plötzlich stehen. »Mist«, sagte er und sah an dem Gebäude hoch. »Der Speisesaal liegt im ersten Stock. Ich hab nicht an die Stufen gedacht.«
»Der Beaumont-Speisesaal steht auch nicht im barrierefreien Übersichtsplan«, stellte ich fest. »Ich suche mir lieber einen anderen Ort fürs Essen.«
Die Mensa war abends geschlossen, aber ich hatte mir vorsorglich gemerkt, in welchen Häusern es ebenerdige Speisesäle gab.
Hartley beugte sich über seine Krücken und schüttelte den Kopf. »Ich klettere da bestimmt auch nicht hoch. Aber … irgendwie muss das Essen da doch auch raufkommen … Ich wette, die tragen nicht alles einzeln die Treppe hoch.« Er schaute wieder stirnrunzelnd an dem Gebäude hoch. »Ich kann nicht glauben, dass ich zwei Jahre lang hier essen war, ohne mich das jemals gefragt zu haben.« Damit wandte er sich einem weiteren Tor zu, das auf die Straße hinausführte. »Dana, wir treffen uns drinnen. Es muss irgendwo einen Lieferanteneingang geben. Hier entlang, Callahan!«
Ich folgte Hartley mit rosigen Wangen auf die Pine Alley, die sowohl hinter Beaumont als auch hinter Turner House entlangführte.
»Das wird’s sein«, sagte Hartley mit einem Grinsen. Er humpelte zu einer grauen Eisentür mit einer Gegensprechanlage daneben und drückte auf den Knopf.
»Ja?«, ließ sich eine Stimme vernehmen.
Er sah mich an und zeigte dabei sein Grübchen. »Lieferung!«
Kurz darauf glitt die graue Tür auf und offenbarte einen spärlich erhellten Aufzug mit niedriger Decke.
»Nobel«, schnaubte Hartley. »Na dann, auf geht’s.«
Er machte einen Schritt vor und wäre dabei fast über die leicht erhöhte Kante gestolpert. Dann stieg er mit eingezogenem Kopf ein und hielt mir die Tür auf, damit ich rückwärts in die Kabine rollen konnte.
Die Tür schloss sich mit einem Knirschen, das mir Angst machte. Würde dies einer dieser speziellen Augenblicke werden, von denen man sich hinterher fragte, wie man nur mit diesem gut aussehenden Typen in einen wackligen, nicht wirklich vertrauenerweckenden Aufzug hatte einsteigen können?
Doch Hartley lachte nur vergnügt, als der Lift um uns herum in seinen Grundfesten erschüttert zu werden schien. »Ich hoffe, du hast gute Lungen. Falls wir um Hilfe schreien müssen.«
Der Fahrstuhl bewegte sich so langsam, dass ich mich erst entspannte, als die Tür endlich mit einem Schnaufen wieder aufging.
Wir traten in eine hell erleuchtete Küche. Ein Typ mit einer Kochmütze starrte uns stirnrunzelnd an, während sich eine Handvoll schwer beschäftigter Leute in weißen Küchenschürzen zu uns umdrehte und glotzte.
»Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie haben unsere Reservierung verschlampt«, scherzte Hartley, während er sich umsah. »Da lang, Callahan.«
Ich folgte ihm über den gefliesten Boden, um eine verglaste Essensausgabe herum und in das Gewimmel der dort mit ihren Tabletts anstehenden Studenten.
»Da seid ihr ja!«, rief Dana und machte uns Platz in der Schlange. »Wie seid ihr hier raufgekommen?«
»Mit dem Lastenaufzug«, antwortete Hartley. »Wie von Zauberhand. Könntest du uns noch ein Tablett besorgen?«
»Klar, nehmt das hier.« Dann flitzte sie los und kam mit einem weiteren Tablett und Besteck für uns drei wieder.
Die Schlange kroch nur langsam weiter. Als wir an der Reihe waren, sah Hartley mich besorgt an. »Kannst du genug sehen?«
Nein, wie üblich natürlich nicht.
»Was sieht denn gut aus?«
»Das Jumbosandwich mit Fleischbällchen. Der Fisch ist mir ein bisschen unheimlich.«
»Da fällt die Wahl nicht schwer.«
»Zweimal das Jumbosandwich, bitte.«
»Kann ich euch irgendwie tragen helfen?«, wollte Dana wissen.
»Danke, aber Corey und ich haben ein System.«