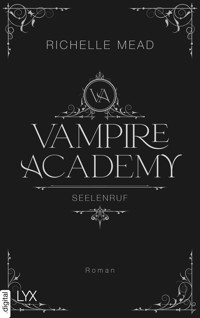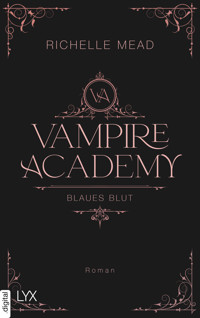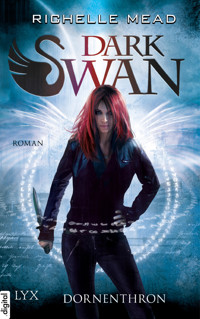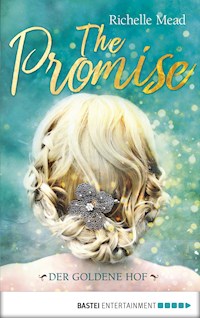
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ich hatte nie vorgehabt, das Leben einer anderen zu stehlen. Wirklich. Schließlich war ich jung, gesund und klug. Sicher, mein Titel hätte noch ein bisschen glanzvoller sein können, wenn das Vermögen meiner Familie nicht dahingeschmolzen wäre, aber das ließ sich leicht in Ordnung bringen. Ich musste mich lediglich gut verheiraten. Und da fingen meine Probleme an.
Elizabeth steht nach dem Tod ihrer adligen Eltern vor dem finanziellen Ruin. Entsprechend sind die Anwärter, die bereit sind, sie zu heiraten, entweder uninteressant, unattraktiv oder beides. Doch als eine der Bediensteten Besuch von dem jungen und gut aussehenden Cedric bekommt, der sie für den "Goldenen Hof" anwerben will, wittert sie ihre Chance. Dort werden nämlich hübsche, aber gewöhnliche Mädchen zu echten Damen ausgebildet, die im aufstrebenden Nachbarland Adoria an den Mann gebracht werden. Kurzerhand nimmt Elizabeth den Platz der Bediensteten ein und gelangt so in die Ausbildung am Goldenen Hof. Doch schnell wird klar, dass sie nicht erst nach Adoria reisen muss, um ihren Traummann zu finden. Denn zwischen ihr und Cedric knistert es gewaltig ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Ich hatte nie vorgehabt, das Leben einer anderen zu stehlen. Wirklich. Schließlich war ich jung, gesund und klug. Sicher, mein Titel hätte noch ein bisschen glanzvoller sein können, wenn das Vermögen meiner Familie nicht dahingeschmolzen wäre, aber das ließ sich leicht in Ordnung bringen. Ich musste mich lediglich gut verheiraten. Und da fingen meine Probleme an. Elizabeth steht nach dem Tod ihrer adligen Eltern vor dem finanziellen Ruin. Entsprechend sind die Anwärter, die bereit sind, sie zu heiraten, entweder uninteressant, unattraktiv oder beides. Doch als eine der Bediensteten Besuch von dem jungen und gut aussehenden Cedric bekommt, der sie für den »Goldenen Hof« anwerben will, wittert sie ihre Chance. Dort werden nämlich hübsche, aber gewöhnliche Mädchen zu echten Damen ausgebildet, die im aufstrebenden Nachbarland Adoria an den Mann gebracht werden. Kurzerhand nimmt Elizabeth den Platz der Bediensteten ein und gelangt so in die Ausbildung am Goldenen Hof. Doch schnell wird klar, dass sie nicht erst nach Adoria reisen muss, um ihren Traummann zu finden. Denn zwischen ihr und Cedric knistert es gewaltig ...
Über den Autor
Richelle Mead wurde in Michigan geboren. Sie studierte Kunst, Religion und Englisch. Mit ihrer Jugendbuchserie Vampire Academy gelang ihr auf Anhieb der Sprung auf die internationalen Bestsellerlisten. Bloodlines führt die Geschichte der Vampire Academy fort.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon Susann Friedrich
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Glittering Court« bei Razorbill, einem Imprint von Penguin Random House, New York.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Richelle Mead
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Stephanie Frey/Trevillion Images und © Nikki Zalewski/Shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-4928-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Jay,sieht aus, als hätte ich den Code entschlüsselt.
Kapitel 1
Ich hatte nie vorgehabt, das Leben einer anderen zu stehlen. Wirklich, auf den ersten Blick hätte man nicht geglaubt, dass mit meinem alten Leben etwas nicht stimmte. Ich war jung und gesund. Ich hielt mich für klug. Ich gehörte einer der nobelsten Familien in Osfrid an, einer Familie, die von den Gründern des Landes abstammte. Sicher, mein Titel hätte noch ein bisschen glanzvoller sein können, wenn das Vermögen meiner Familie nicht dahingeschmolzen wäre, aber das ließ sich leicht in Ordnung bringen. Ich musste mich lediglich gut verheiraten.
Und da fingen meine Probleme an.
Die meisten Aristokraten bewunderten eine Nachfahrin von Rupert, dem Ersten Grafen von Rothford, dem großen Helden Osfrids. Vor Jahrhunderten hatte er dazu beigetragen, den Ureinwohnern dieses Land zu entreißen und damit die große Nation geschaffen, derer wir uns heute erfreuten. Aber nur wenige Adlige bewunderten meine fehlenden Mittel, vor allem in diesen Zeiten. Andere Familien hatten selbst mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, und ein hübsches Gesicht mit einem hochrangigen Titel bot nicht mehr den gleichen Anreiz, den es früher vielleicht geboten hätte.
Ich brauchte ein Wunder, und zwar schnell.
»Liebes, ein Wunder ist geschehen.«
Den Kopf voller düsterer Gedanken hatte ich im Ballsaal auf die samtene Prägetapete gestarrt. Jetzt blinzelte ich und wandte mich wieder dem lärmenden Fest und meiner näher kommenden Großmutter zu. Obwohl ihr Gesicht voller Falten und ihr Haar schneeweiß war, machten die Leute ständig Bemerkungen darüber, was für eine attraktive Frau Lady Alice Witmore war. Ich war derselben Meinung, obwohl ich den Eindruck hatte, dass sie in den Jahren, seit meine Eltern gestorben waren, stärker gealtert war. Doch jetzt gerade leuchtete ihr Gesicht, wie ich es seit Langem nicht mehr gesehen hatte.
»Und wie, Großmama?«
»Es gibt einen Bewerber. Einen Bewerber. Er ist alles, was wir uns erhofft haben. Jung. Ein beträchtliches Vermögen. Und seine Familie ist so glanzvoll wie unsere.«
Letzteres überraschte mich. Mit dem Stammbaum des hochverehrten Rupert ließ sich fast nichts vergleichen. »Bist du sicher?«
»Aber gewiss. Er ist dein … Cousin.«
Es kam nicht oft vor, dass es mir die Sprache verschlug. Einen Moment lang fiel mir nur mein Cousin Peter ein. Etwa doppelt so alt wie ich – und verheiratet. Nach der Erbfolgeregelung würde der Rothford-Titel an ihn übergehen, falls ich kinderlos starb. Wann immer er in der Stadt war, kam er vorbei und erkundigte sich nach meinem Befinden.
»Welcher?«, fragte ich schließlich und entspannte mich ein wenig. Der Begriff »Cousin« wurde manchmal recht großzügig verwendet, und wenn man die Stammbäume weit genug zurückverfolgte, war der halbe osfridische Adel mit der anderen Hälfte verwandt. Großmutter konnte sich auf jede Menge Männer beziehen.
»Lionel Belshire, Baron von Ashby.«
Ich schüttelte den Kopf. Er war mir unbekannt.
Großmutter hakte sich bei mir unter und zog mich auf die gegenüberliegende Seite des Ballsaals, wobei sie sich an einigen der einflussreichsten Personen der Stadt vorbeischlängelte. Sie waren in Samt und Seide gehüllt und hatten sich mit Perlen und Edelsteinen geschmückt. Überall an der Decke hingen Kristalllüster – als ob unser Gastgeber die Sterne übertreffen wollte. So lebte die Aristokratie von Osfro.
»Seine Großmutter und ich waren früher Hofdamen bei der Herzogin von Samford. Leider ist er nur ein Baron.« Großmama beugte ihren Kopf zu mir, damit sie leiser sprechen konnte. Das perlenbesetzte Cape, das sie trug, war tadellos, aber seit mindestens zwei Jahren unmodern. Sie gab unser Geld aus, um mich einzukleiden. »Aber er ist trotzdem von sehr guter Herkunft. Er stammt von einem von Ruperts unbedeutenderen Söhnen ab, obwohl es da ein Gerücht gab, dass Rupert vielleicht nicht sein leiblicher Vater gewesen sei. Doch seine Mutter war eine Adelige, wir sind also von beiden Seiten abgesichert.«
Ich war noch dabei, die Neuigkeiten zu verdauen, als wir vor einem bodentiefen Fenster stehen blieben, das einen Ausblick auf Harlington Park bot. Ein junger Mann und eine Frau in Großmutters Alter standen dort und unterhielten sich in leisem Ton. Sobald sie uns bemerkten, blickten beide mit gespanntem Interesse auf.
Großmama ließ meine Hand los. »Meine Enkeltochter Elizabeth, die Gräfin von Rothford. Liebes, das sind Baron Belshire und seine Großmutter, Lady Dorothy.«
Lionel beugte sich vor und küsste mir die Hand, während seine Großmutter einen Knicks machte. Doch ihre Ehrerbietung war nur vorgetäuscht. Mit scharfem Blick musterte sie jedes Detail an mir. Wenn der Anstand es erlaubt hätte, hätte sie wahrscheinlich auch meine Zähne begutachtet.
Ich wandte mich Lionel zu, der sich gerade wieder aufrichtete. Er war derjenige, den ich taxieren musste. »Gräfin, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Es ist eine Schande, dass wir uns nicht schon früher begegnet sind, da wir zur selben Familie gehören und beide Abkömmlinge von Graf Rupert sind.«
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Großmama skeptisch eine Braue hochzog.
Ich schenkte ihm ein sittsames Lächeln, nicht unterwürfig genug, um meinen höheren Rang herabzumindern, aber ausreichend, um ihn glauben zu lassen, dass sein Charme bei mir nicht ohne Wirkung geblieben war. Natürlich musste er diesen Charme zunächst noch unter Beweis stellen. Auf den ersten Blick war er vielleicht alles, was überhaupt für ihn sprechen könnte. Lionels Gesicht war lang und spitz, seine Haut fahl. Wenn man bedachte, wie die Menschenmenge den Saal aufgeheizt hatte, hätte ich zumindest rote Wangen erwartet. Seine hängenden, schmalen Schultern vermittelten den Eindruck, dass er sich in sich selbst verkriechen wollte. Doch nichts davon spielte eine Rolle. Allein die Absicherung durch diese Ehe zählte. Eine Liebesheirat hatte ich ohnehin nie erwartet.
»Dass wir uns begegnen, war definitiv überfällig«, stimmte ich ihm zu. »Wirklich, zu Ehren unseres Stammvaters sollten wir regelmäßig Rupert-Treffen abhalten: Alle zusammentrommeln und dann im Grünen ein Picknick veranstalten. Wir könnten es mit Drei-Bein-Rennen versuchen, wie es die Leute auf dem Land machen. Das schaffe ich bestimmt auch mit meinen Röcken.«
Lionel sah mich ungerührt an und kratzte sich am Handgelenk. »Graf Ruperts Nachfahren sind über ganz Osfrid verteilt. Ich bezweifle, dass eine solche Zusammenkunft durchführbar wäre. Und es ist nicht nur für den Adel ungebührlich, solche Drei-Bein-Rennen abzuhalten; ich gestatte es auch den Pächtern auf meinem Besitz nicht. Der große Gott Uros hat uns zwei Beine geschenkt, nicht drei. Etwas anderes vorzugaukeln, ist abscheulich.« Er schwieg einen Moment. »Auch Sackhüpfen schätze ich nicht.«
»Selbstverständlich haben Sie recht«, sagte ich und lächelte krampfhaft weiter. Neben mir räusperte sich Großmama. »Der Baron baut mit großem Erfolg Gerste an«, sagte sie mit erzwungener Munterkeit. »Sehr wahrscheinlich ist er der erfolgreichste Produzent von Gerste im ganzen Land.«
Lionel kratzte sich am linken Ohr. »Meine Pächter haben mehr als achtzig Prozent der Felder in Gerstenfelder umgewandelt. Kürzlich haben wir ein neues Anwesen erworben, und auch auf dessen Feldern fahren wir nun eine reiche Ernte ein. Gerste, so weit das Auge reicht. Morgen um Morgen. Meine Bediensteten in den beiden Gutshäusern lasse ich zu jedem Frühstück Gerste essen. Um die Moral zu stärken.«
»Das ist … eine Menge Gerste«, erwiderte ich. Seine Bediensteten begannen mir leidzutun. »Nun, ich hoffe, Sie gestatten ihnen, ab und zu mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Mit Hafer. Oder Roggen, wenn Ihnen nach etwas Exotischerem der Sinn steht.«
Sein früherer verdutzter Ausdruck kehrte zurück, während er sich am rechten Ohr kratzte. »Warum sollte ich das tun? Gerste ist unsere Lebensgrundlage, es schadet ihnen nicht, daran erinnert zu werden. Für mich gilt das Gleiche – tatsächlich gehe ich sogar noch weiter, denn ich sorge dafür, dass in all meinen Mahlzeiten Gerste enthalten ist. Als positives Beispiel.«
»Sie sind ein Mann des Volkes«, sagte ich und musterte das Fenster hinter ihm. Könnte ich vielleicht dort hinausspringen?
Es entstand ein peinliches Schweigen, das Lady Dorothy zu füllen suchte. »Wo wir gerade von Anwesen sprechen, habe ich es richtig verstanden, dass Sie gerade Ihr letztes verkauft haben?« Da war sie, die Erinnerung an unsere finanzielle Lage. Rasch versuchte Großmama, unsere Ehre zu verteidigen.
»Wir haben es nicht genutzt.« Sie reckte das Kinn in die Luft. »Ich bin nicht so töricht, Geld für ein leer stehendes Haus und Dienstboten zu verschwenden, die ohne Aufsicht nur bequem werden. Unser Haus in der Stadt ist viel komfortabler, und wir sind am Puls der Gesellschaft. Allein diesen Winter waren wir dreimal bei Hofe eingeladen.«
»Ja, im Winter«, sagte Lady Dorothy herablassend. »Aber die Sommer in der Stadt sind zweifellos öde. Vor allem wenn so viele Adelige auf ihren Anwesen auf dem Land weilen. Wenn Sie Lionel heiraten, Lady Elizabeth, werden Sie in seinem Haus in Northshire leben – wo auch ich wohne –, und es wird Ihnen an nichts mangeln. Sie können so viele Gesellschaften planen, wie Sie mögen. Natürlich nur unter meiner Aufsicht. Das ist doch eine wundervolle Aussicht für Sie. Ich meine, ich möchte Sie nicht kränken, Gräfin, Lady Alice. Sie halten sich so gut, dass niemand Ihre wahre Lage erraten würde. Aber ich bin mir sicher, es wird eine Erleichterung sein, unter besseren Umständen zu leben.«
»Bessere Umstände für mich. Einen besseren Titel für ihn«, murmelte ich.
Während wir uns unterhielten, kratzte sich Lionel zuerst an der Stirn und dann in der Armbeuge. Er kratzte sich eine ganze Weile dort, und ich versuchte nicht hinzusehen. Was war mit ihm los? Warum juckte es ihn so sehr? Und warum am ganzen Körper? Ich konnte nirgendwo ein Ekzem entdecken. Und schlimmer: Je länger ich ihn beobachtete, desto stärker war plötzlich der Drang, mich selbst zu kratzen. Ich musste die Hände ineinander verschränken, um mich zu bremsen.
Die quälende Konversation ging noch für einige Minuten so weiter, und unsere Großmütter schmiedeten Pläne für eine Eheschließung, von der ich gerade erst erfahren hatte. Lionel fuhr fort, sich zu kratzen. Als wir uns endlich von ihnen losgerissen hatten, wartete ich ganze dreißig Sekunden, bevor ich Großmama meine Meinung kundtat.
»Nein«, sagte ich.
»Pst!« Sie lächelte diversen Gästen zu, die wir kannten, während wir Richtung Ausgang gingen, und wies dann einen der Bediensteten unseres Gastgebers an, unsere Kutsche vorfahren zu lassen. Ich verkniff mir meine Worte, bis wir allein waren.
»Nein«, wiederholte ich und ließ mich in den Plüschsitz sinken. »Auf gar keinen Fall.«
»Sei nicht so dramatisch.«
»Das bin ich nicht! Ich bin nur bei Verstand. Ich kann nicht fassen, dass du diesen Bewerber akzeptiert hast, ohne dich zuvor mit mir zu beraten.«
»Nun, es war zweifellos schwer, sich zwischen ihm und deinen zahlreichen anderen Bewerbern zu entscheiden.« Sie begegnete meinem zornigen Funkeln mit gleichmütigem Blick. »Ja, meine Liebe, du bist nicht die Einzige hier, die schnippisch sein kann. Allerdings bist du die Einzige, die uns vor dem letztendlichen Ruin bewahren kann.«
»Wer ist hier dramatisch? Du könntest mit Lady Branson ins Haus ihrer Tochter ziehen. Du würdest dort ein sehr gutes Leben führen.«
»Und was geschieht mit dir, während ich ein sehr gutes Leben führe?«
»Keine Ahnung. Ich finde einen anderen.« Ich dachte an die Vielzahl von Gästen, denen ich an diesem Abend auf dem Fest begegnet war. »Was ist mit diesem Kaufmann, der auch da war? Donald Crosby? Wie ich hörte, hat er ein ziemlich großes Vermögen angehäuft.«
»Pfui.« Großmama rieb sich die Schläfen. »Bitte sprich nicht über diese Neureichen. Du weißt, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme.«
Ich schnaubte. »Was stimmt nicht mit ihm? Sein Geschäft blüht. Und er hat über all meine Witze gelacht – was man von Lionel nicht gerade sagen kann.«
»Du weißt, was an Mister Crosby nicht stimmt. Man hätte ihn nie zu dem Fest einladen dürfen. Ich weiß nicht, was sich Lord Gilman dabei gedacht hat.« Sie verstummte, während ein besonders großes Schlagloch im Kopfsteinpflaster unsere Kutsche zum Schlingern brachte. »Was glaubst du, was dein bedeutender Urahn Rupert davon halten würde, wenn du seinen Stammbaum mit solch gewöhnlichem Blut vermischen würdest?«
Ich stöhnte. In letzter Zeit schien es, als könnten wir keine Unterhaltung führen, ohne dass dabei Ruperts Name fiel. »Ich glaube, jemand, der seinem Herrscher über den Kanal folgt, um ein Imperium aus dem Boden zu stampfen, würde ziemlich viel Wert darauf legen, dass man seine Selbstachtung behält. Und sich nicht an einen langweiligen Cousin und dessen tyrannische Großmutter verkauft. Hast du mitgezählt, wie oft sie ›unter meiner Aufsicht‹ gesagt hat, als wir über die Zukunft gesprochen haben? Ich habe es getan. Fünfmal. Siebenmal weniger, als sich Lionel irgendwo gekratzt hat.«
»Glaubst du, du bist die Erste, die eine arrangierte Ehe eingehen muss?«, sagte Großmutter mit erschöpftem Gesichtsausdruck. »Glaubst, du bist die Erste, der das zuwider ist? Erzählungen und Lieder sind voll von Geschichten über beklagenswerte Jungfern, gefangen in solchen Situationen, die dann in eine glanzvolle Zukunft entfliehen. Aber das sind Märchen. Die Wahrheit ist, dass die meisten in deiner Lage … es einfach erdulden. Dir bleibt kein anderer Ausweg. Du kannst nirgendwo hin. Das ist der Preis, den du für die Welt zahlst, in der du lebst. Für deinen Rang.«
»Meine Eltern hätten mich nie gezwungen, so etwas zu erdulden«, murrte ich.
Großmamas Blick verhärtete sich. »Deine Eltern und ihre leichtsinnigen Investitionen sind der Grund, warum wir uns in dieser Lage befinden. Wir haben kein Geld mehr. Der Verkauf von Bentley hat es uns ermöglicht, weiter so zu leben wie bisher. Aber das wird sich ändern. Und es wird dir nicht gefallen, wenn es passiert.« Als ich weiter störrisch vor mich hin stierte, fügte sie hinzu: »Dein Leben lang werden Menschen Entscheidungen für dich treffen. Gewöhn dich daran.«
Unser Haus lag in einem anderen – aber gleichfalls vornehmen – Bezirk der Stadt als das Haus von Lord Gilman. Bei unserer Ankunft eilten Dienstboten herbei, um sich unserer anzunehmen. Sie halfen uns aus der Kutsche, nahmen uns Umhänge und Schals ab. Ich hatte eine eigene Schar von Zofen, die mich zu meinen Gemächern begleiteten und mir das Ballkleid auszogen. Ich sah zu, wie sie das rote Samtüberkleid mit den Trompetenärmeln und Goldstickereien glattstrichen. Sie hängten es zu den zahllosen anderen dekadenten Gewändern, und nachdem sie verschwunden waren, ertappte ich mich dabei, dass ich den Schrank anstarrte. Ein Großteil vom schwindenden Reichtum unserer Familie wurde für Kleider ausgegeben, die es mir ermöglichen sollten, mein Leben zum Besseren zu ändern.
Zweifellos war mein Leben gerade dabei, sich zu verändern, aber zum Besseren? Da war ich skeptisch.
Und darum tat ich so, als wäre das alles gar nicht real. So war ich auch mit dem Tod meiner Eltern umgegangen. Ich hatte mich geweigert zu glauben, dass sie gestorben waren – sogar angesichts des konkreten Beweises in Form ihrer Gräber. Es war unmöglich, dass jemand, den ich so sehr liebte, jemand, der einen so großen Platz in meinem Herzen einnahm, nicht länger existieren sollte. Also versuchte ich mir einzureden, sie würden eines Tages wieder durch meine Tür treten. Und als mir das nicht gelang, dachte ich einfach gar nicht mehr daran.
Genauso verfuhr ich auch mit Lionel. Ich verbannte ihn aus meinen Gedanken und führte mein Leben weiter, als wäre bei dem Fest gar nichts passiert.
Als eines Tages ein Brief von Lady Dorothy eintraf, musste ich seine Existenz schließlich doch wieder zur Kenntnis nehmen. Sie wollte ein Datum für die Hochzeit festlegen, was ja zu erwarten war. Nicht zu erwarten war allerdings ihre Anweisung, wir sollten die Hälfte unserer Bediensteten entlassen und die Mehrzahl unserer Besitztümer veräußern. Sie werden sie nicht brauchen, wenn Sie nach Northshire ziehen, schrieb sie. Unter meiner Aufsicht werden Ihnen die nötigen Dienstboten zugeteilt, und Sie werden mit allem Notwendigen versorgt.
»Ach du lieber Uros«, sagte ich, als ich den Brief gelesen hatte.
»Missbrauche nicht den Namen des Herrn«, fuhr mich Großmama an. Trotz ihrer scharfen Worte spürte ich ihre Anspannung. Unter der Fuchtel einer anderen zu stehen, würde auch für sie nicht leicht sein. »Ach ja. Lionel hat dir ein Geschenk geschickt.«
Das »Geschenk« war ein Behälter mit Lionels eigener Gerstenflocken-Mischung, die er jeden Morgen zum Frühstück aß. Dazu eine kurze Nachricht, dass mir dieses Geschenk einen Vorgeschmack auf das geben würde, was mich erwartete. Ich hätte gern geglaubt, dass das Wortspiel Absicht war, aber ich bezweifelte es ernstlich.
Großmutter begann darüber zu brüten, wie sie die Dienerschaft halbieren sollte, und ich ging aus dem Zimmer. Und dann einfach weiter. Ich ging aus dem Haus und durch den Vorgarten. Ich trat durch das Tor, das unser Grundstück von der geschäftigen, breiten Straße abschirmte, und erntete einen verblüfften Blick von dem Lakaien, der dort seinen Dienst versah.
»Mylady? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«
Ich winkte ihn zurück an seinen Platz, als er sich erheben wollte. »Nein«, sagte ich. Er blickte sich um und wusste nicht, was er tun sollte. Nie zuvor hatte er erlebt, dass ich allein das Haus verließ. Niemand hatte es je erlebt. Es geschah einfach nicht.
Seine Verwirrung hielt ihn auf seinem Platz, und alsbald wurde ich vom Fußgängerstrom auf der Straße verschluckt. Das hier war natürlich nicht die Oberschicht. Es waren Dienstboten, Kaufleute, Laufburschen … all die Menschen, deren Arbeit das Überleben der Reichen in der Stadt sicherte. Ich passte mich ihrem Trott an und wusste nicht recht, wohin ich gehen sollte.
Ein verrückter Teil von mir kam auf den Gedanken, dass ich mich an Donald Crosby wenden sollte. Während unserer kurzen Unterhaltung hatte er den Eindruck gemacht, als könnte er mich ganz gut leiden. Oder vielleicht könnte ich mich auch irgendwohin einschiffen. Auf den Kontinent reisen und dort irgendeinen belsianischen Adligen bezirzen. Vielleicht könnte ich mich auch einfach nur in der Menge verlieren, nur ein weiteres anonymes Gesicht sein, das im Gewühl der Stadt verschwand.
»Kann ich Ihnen helfen, Mylady? Sind Sie von Ihren Dienern getrennt worden?«
Offensichtlich war ich doch nicht ganz so anonym.
Ich war am Rand eines der vielen Geschäftsviertel der Stadt gelandet. Der Sprecher war ein älterer Mann, der Pakete auf dem Rücken trug, die viel zu schwer für seine schmale Gestalt wirkten.
»Woher wissen Sie, dass ich eine Lady bin?«, brach es aus mir heraus.
Er grinste und entblößte dabei ein paar Zahnlücken. »Sind nicht gerade viele allein unterwegs, die wie Sie angezogen sind.«
Ich schaute mich um und stellte fest, dass er recht hatte. Mein violettes Jacquardkleid war für meine Verhältnisse eher leger, aber es ließ mich in dem Meer graubrauner Kleidung hervorstechen. Es gab noch ein paar andere aus der Oberschicht, die hier einkauften, aber sie waren von pflichtbewussten Dienstboten umgeben, die bereit waren, sie vor jeglichen widerwärtigen Subjekten zu beschützen.
»Alles bestens«, sagte ich und drängte mich an ihm vorbei. Aber ich kam nicht sehr weit, bis mich ein anderer aufhielt: ein rotgesichtiger Junge, der seinen Lebensunterhalt offensichtlich mit dem Überbringen von Botschaften bestritt.
»Soll ich Sie nach Hause begleiten, Mylady?«, fragte er. »Drei Kupfermünzen und ich bring Sie hier raus.«
»Nein, ich …« Ich sprach nicht weiter, als mir etwas dämmerte. »Ich habe kein Geld. Jedenfalls nicht bei mir.« Er wandte sich zum Gehen, und ich rief: »Warte. Hier.« Ich zog mein Perlenarmband ab und hielt es ihm hin. »Kannst du mich zur Kirche des Glorreichen Vaiel bringen?«
Beim Anblick der Perlen bekam er große Augen, trotzdem zögerte er. »Das ist zu viel, Mylady. Die Kirche ist gleich da drüben in der Cunningham Street.«
Ich drückte ihm das Armband in die Hand. »Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Bring mich hin.«
Wie sich zeigte, lag die Kirche wirklich nur drei Straßen weit entfernt. Ich kannte alle zentralen Stadtviertel von Osfro, wusste aber nicht viel darüber, wie man von einem zum anderen gelangte. Es hatte nie die Notwendigkeit bestanden, es zu wissen.
Heute wurden keine Gottesdienste abgehalten, aber die Haupttüren standen ein Stück weit auf und hießen alle Rat suchenden Seelen willkommen. Ich ging an der eleganten Kirche vorbei zum Friedhof, durchquerte den Teil für das gewöhnliche Volk, den Teil für Bessergestellte und kam schließlich zu den Gräbern der Aristokraten. Sie waren von einem schmiedeeisernen Zaun umgeben und mehr mit Monumenten und Mausoleen bestückt als mit gewöhnlichen Grabsteinen.
Vielleicht kannte ich mich nicht gut auf Osfros Straßen aus, aber ich wusste ganz genau, wo sich auf diesem Friedhof das Mausoleum meiner Familie befand. Mein Führer wartete in der Nähe des Eisenzauns, während ich hinüber zu dem hübschen Steingebäude ging, auf dem WITMORE stand. Es war nicht das größte auf diesem Friedhof, aber ich fand, es war eines der schönsten. Mein Vater hatte die schönen Künste geliebt, und wir hatten für die Außenwände erlesen gearbeitete Statuen der sechs glorreichen Engel in Auftrag gegeben.
Ohne vorherige Rücksprache mit einem Verantwortlichen der Kirche konnte ich das Mausoleum nicht betreten, deshalb ließ ich mich einfach auf den Stufen nieder. Mit den Fingern fuhr ich über die Namen, die auf der Steintafel eingraviert waren: LORD ROGER WITMORE, SECHZEHNTER GRAF VON ROTHFORD, UND LADY AMELIA ROTHFORD. Über ihnen stand der Name meines Großvaters: LORD AUGUSTUS WITMORE, FÜNFZEHNTER GRAF VON ROTHFORD. Der Name meiner Großmutter würde sich eines Tages zu seinem gesellen, und dann wäre das Mausoleum voll. »Du wirst dir deinen eigenen Platz suchen müssen«, hatte Großmutter bei Vaters Beerdigung zu mir gesagt.
Meine Mutter war zuerst gestorben, sie hatte sich mit einer der vielen Krankheiten infiziert, die in den ärmeren Stadtvierteln grassierten. Meine Eltern hatten großes Interesse an der Förderung wohltätiger Einrichtungen für die weniger Begünstigten gehabt, und das hatte sie das Leben gekostet. In einem Sommer erkrankte meine Mutter, im nächsten mein Vater. Ihre wohltätigen Unternehmen gingen zugrunde. Manche sagten, meine Eltern seien Heilige gewesen. Die meisten hielten sie für Narren.
Ich betrachtete die große Steintür mit der Statue des glorreichen Engels Ariniel, Uros’ Wächterin. Sie war prachtvoll gearbeitet, aber ich fand schon immer, dass Ariniel der am wenigsten interessante Engel war. Sie tat nichts weiter als anderen das Tor zu öffnen und sie bei ihrem Übergang ins Jenseits zu unterstützen. Gab es einen Ort, an dem sie lieber gewesen wäre? Etwas, das sie lieber getan hätte? War sie zufrieden mit einer Existenz, die es anderen ermöglichte, ihre Ziele zu erreichen, während sie immer nur an Ort und Stelle verharrte? Großmama hatte gesagt, mein Leben lang würden andere die Entscheidungen für mich treffen. Galt das nicht nur für Menschen, sondern auch für Engel? In der Heiligen Schrift waren solche Fragen nie gestellt worden. Sehr wahrscheinlich war das Blasphemie.
»Mylady!«
Ich wandte den Blick von Ariniels gleichmütigem Gesicht ab und sah ein Gewusel von Farben am Tor. Drei meiner Zofen eilten auf mich zu. Weit hinter ihnen, in der Nähe des Kircheneingangs, wartete unsere Kutsche. Sofort war ich von meinen Zofen umringt.
»Oh, Mylady, was haben Sie sich bloß dabei gedacht?«, rief Vanessa. »Hat sich dieser Junge etwa unangemessen verhalten?«
»Sie müssen doch frieren!« Ada warf einen schweren Umhang über meine Schultern.
»Bitte lassen Sie mich den Dreck von Ihrem Saum bürsten«, sagte Thea.
»Nein, schon gut«, sagte ich zu ihr. »Alles in Ordnung. Wie habt ihr mich gefunden?«
Sie begannen alle durcheinanderzureden, aber im Grunde lief es darauf hinaus, dass sie mein Verschwinden bemerkt, den Lakaien am Tor unseres Stadthauses und dann so ziemlich jeden Menschen befragt hatten, an dem ich bei meinem Ausflug vorbeigekommen war. Offensichtlich hatte ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
»Ihre Großmutter weiß noch nichts«, sagte Vanessa und drängte mich zu gehen. Sie war die Schlauste der drei. »Lassen Sie uns rasch zurückfahren.«
Bevor ich mich abwandte, schaute ich noch einmal auf den Engel und auf die Namen meiner Eltern. »Schlimme Dinge werden immer geschehen«, hatte mein Vater in seinem letzten Jahr zu mir gesagt. »Es gibt keine Möglichkeit, sie zu verhindern. Bestimmen können wir nur, wie wir ihnen begegnen. Lassen wir zu, dass sie uns zerstören, uns entmutigen? Oder treten wir ihnen entschlossen entgegen und ertragen den Schmerz? Überlisten wir sie vielleicht sogar?« Ich fragte ihn, wie man es anstellen sollte, eine schlimme Sache zu überlisten. »Wenn der Zeitpunkt kommt, wirst du es wissen. Und wenn er da ist, musst du rasch handeln.«
Meine Zofen hörten gar nicht mehr auf zu lamentieren, selbst auf der Kutschfahrt nach Hause. »Mylady, wenn Sie das Mausoleum besuchen wollten, hätten Sie uns einfach beauftragen sollen, einen offiziellen Besuch zusammen mit einem Priester zu arrangieren«, sagte Thea.
»Ich habe nicht nachgedacht«, murmelte ich. Ganz bestimmt würde ich ihnen nicht erzählen, dass der Brief von Lady Dorothy mir fast einen Nervenzusammenbruch beschert hatte. »Ich brauchte frische Luft und habe beschlossen, einfach alleine einen Spaziergang dorthin zu unternehmen.«
Sie starrten mich ungläubig an. »Das dürfen Sie nicht«, sagte Ada. »Alleine dürfen Sie das nicht. Sie … Sie dürfen überhaupt nichts alleine tun.«
»Und warum nicht?«, fuhr ich sie an und verspürte nur ein geringes Schuldgefühl, als sie zusammenzuckte. »Ich gehöre dem Hochadel des Königreichs an. Mein Familienname gebietet überall Respekt. Warum sollte ich also nicht frei sein, überall hinzugehen? Und zu tun, was immer mir gefällt?«
Darauf sagte zunächst keine von ihnen etwas, und es überraschte mich nicht, dass es schließlich Vanessa war, die mir antwortete: »Weil Sie die Gräfin von Rothford sind. Jemand mit einem solchen Namen kann sich nicht frei unter den Namenlosen bewegen. Und wenn es darum geht, wer Sie sind, Mylady … nun, das ist etwas, das wir nie frei wählen können.«
Kapitel 2
Erst jetzt wurde mir klar, dass ich bei der »schlimmen Sache« mit Lionel den ersten Weg eingeschlagen hatte: Ich ließ mich davon zerstören. Und deshalb beschloss ich auf der Stelle, den nobleren, entschlosseneren Weg zu wählen und den Schmerz zu ertragen.
In den folgenden Wochen hatte ich stets ein Lächeln auf den Lippen, machte meine Scherze und tat so, als ob unser Haushalt nicht gerade auseinandergerissen würde. Während die Dienerschaft ihre Arbeit tat und sich um ihre Zukunft sorgte, widmete ich mich gefasst den Aufgaben, die für eine junge Adelige angemessen waren: Bilder malen und mein Hochzeitskleid entwerfen. Wenn Besucher kamen, um uns zu beglückwünschen, saß ich bei ihnen und täuschte Begeisterung vor. Mehr als einmal hörte ich, wie die Heirat als »gute Partie« bezeichnet wurde. Es erinnerte mich daran, wie ich im Alter von sechs Jahren mit meiner Mutter den Hochzeitszug von Prinzessin Margaret verfolgt hatte.
Die Prinzessin hatte winkend und steif lächelnd in einer Kutsche gesessen, während sie die Hand eines lorandischen Herzogs gehalten hatte, dem sie in der Woche zuvor zum ersten Mal begegnet war.
»Sie sieht ein bisschen grün aus«, hatte ich gesagt.
»Unsinn. Und wenn du Glück hast«, hatte meine Mutter gesagt, »wirst du auch so eine gute Partie machen.«
Hätte meine Mutter dieser Hochzeit zugestimmt, wenn sie noch am Leben wäre? Oder hätte sich alles ganz anders entwickelt? Vermutlich. Eine Menge Dinge hätten sich ganz anders entwickelt, wenn meine Eltern noch immer leben würden.
»Mylady?«
Ich blickte von der Leinwand hoch, auf die ich ein Feld aus violetten und rosafarbenen Mohnblumen gemalt hatte, eine Kopie von einem der großen Meister aus der Nationalgalerie. Ein Page stand vor mir. Dem Klang seiner Stimme nach zu urteilen, war es wohl nicht das erste Mal, dass er mich angesprochen hatte.
»Ja?«, fragte ich, und mein Ton war ein bisschen unfreundlicher als beabsichtigt. Ich hatte an diesem Morgen mit Großmama über die Entlassung meiner Lieblingsköchin gestritten, und das machte mir noch immer zu schaffen.
Er verbeugte sich, erleichtert, endlich Beachtung zu finden. »Ein Gentleman ist hier, und er hat, äh, Ada zum Weinen gebracht.«
Ich blinzelte und fragte mich, ob ich mich verhört hatte. »Entschuldigung, wie bitte?«
Thea und Vanessa saßen neben mir und nähten. Sie blickten gleichermaßen verblüfft von ihrer Arbeit auf.
Verlegen trat der Page von einem Bein aufs andere. »Ich verstehe es selbst auch nicht so ganz, Mylady. Das Treffen wurde von Lady Branson arrangiert. Ich vermute, sie wollte eigentlich dabei sein, wurde aber aufgehalten. Ich habe die beiden in den Salon im Westflügel geführt, und als ich zurückkam, um nach ihnen zu sehen, war Ada ziemlich hysterisch. Ich nahm an, Sie würden das gern erfahren wollen.«
»Ja, ganz gewiss.«
Und ich hatte gedacht, dies würde ein langweiliger Tag.
Meine Zofen wollten ebenfalls aufstehen, als ich mich erhob, aber ich nötigte sie, sitzen zu bleiben.
»Haben Sie eine Ahnung, weswegen dieser sogenannte Gentleman hier ist?«, fragte ich den Pagen, während ich ihm ins Haus folgte.
»Ich nehme an, es geht um eine andere Stellung.«
Ich verspürte ein leises Schuldgefühl. Wir hatten mit der Entlassung der Dienstboten begonnen, und Ada war eine der Zofen, die nicht länger zu meinem Gefolge gehören würden. Ich hatte nur eine von ihnen behalten dürfen. Lady Dorothy hatte mir versichert, die unter ihrer Aufsicht ausgewählten Ersatzzofen wären mustergültig, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie mich hauptsächlich ausspionieren sollten.
Auf dem Weg zum Salon grübelte ich, was dieses unerwartete morgendliche Drama ausgelöst haben könnte. Lady Branson war die Erste Kammerzofe meiner Großmutter. Wenn sie eine Stellung für Ada gefunden hatte, war es eigentlich gar nicht anders denkbar, als dass es etwas Respektables und mitnichten ein Anlass für einen Zusammenbruch war.
»Es waren keine Tränen der Freude?«, fragte ich den Pagen, um ganz sicherzugehen.
»Nein, Mylady.«
Wir betraten den Salon, und tatsächlich, da saß die arme Ada auf einem Sofa, hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und schluchzte. Ein Mann, der mir den Rücken zuwandte, beugte sich über sie und versuchte unbeholfen sie zu trösten, indem er ihr die Schulter tätschelte. Mein Herz verhärtete sich sofort, und ich fragte mich, was für ein Unhold dieses Drama zu verantworten hatte.
»Lady Witmore, Gräfin von Rothford«, verkündete der Page.
Ada und ihr Gast schraken beide zusammen. Noch immer schluchzend hob Ada das Gesicht und schaffte es, für einen kleinen Knicks aufzustehen. Der Mann richtete sich ebenfalls auf und wandte sich mir zu. Bei seinem Anblick erlosch das Bild eines alten, unredlichen Schurken, das vor meinem inneren Auge entstanden war, sofort.
Vielleicht war er ein Schurke, aber wer war ich, das zu beurteilen? Der Rest von ihm … Mir gingen die Augen über bei seinem Anblick. Tief kastanienbraune Haare, die am Hinterkopf zu einem kurzen, modischen Zopf zusammengefasst waren, gaben den Blick frei auf ein Gesicht mit klaren Konturen und hohen Wangenknochen. Seine Augen waren von intensivem Blau-Grau und bildeten einen schönen Kontrast zu seiner an der Luft gebräunten Haut. Das war unter Aristokraten nicht üblich, aber ich hätte ohnehin bereits von Weitem erkannt, dass er keiner von uns war.
»Ihre Ladyschaft«, sagte er und machte eine tadellose Verbeugung. »Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen.«
Ich bedeutete dem Pagen, sich zurückzuziehen, und setzte mich als Zeichen, dass die beiden anderen es mir nachtun durften.
»Ich bin mir nicht sicher, ob umgekehrt das Gleiche gilt, da Sie meine Zofe dermaßen in Hysterie versetzt haben.«
Über sein hübsches Gesicht huschte ein verärgerter Ausdruck. »Äh, das war nicht meine Absicht. Ich bin genauso überrascht wie Sie. Ich hatte den Eindruck, dass Lady Branson bereits alles mit ihr geklärt hätte.«
»Das hat sie!«, rief Ada aus, und ich sah, wie ihr erneut Tränen in die Augen stiegen. »Aber jetzt wo es so weit ist … bin ich … Ich weiß einfach nicht, ob ich es tun will!«
Der junge Mann sah sie mit einem überaus selbstbewussten und gründlich einstudierten Lächeln an. Bestimmt setzte er es regelmäßig ein, um seinen Willen zu bekommen. »Nun, eine gewisse Nervosität ist verständlich. Aber wenn Sie erst einmal gesehen haben, was für ein Leben die anderen Mädchen am Goldenen Hof führen …«
»Einen Moment«, unterbrach ich ihn. »Was in aller Welt ist der Goldene Hof?« Es klang ein wenig nach Bordell, aber es schien unwahrscheinlich, dass Lady Branson so etwas eingefädelt haben sollte.
»Ich erkläre es Ihnen mit Vergnügen, Mylady. Vorausgesetzt, die Einzelheiten langweilen Sie nicht.«
Ich musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Glauben Sie mir, nichts an dieser Situation erscheint mir langweilig.«
Jetzt schenkte er mir das galante Lächeln – zweifellos in der Hoffnung, es würde mich für ihn einnehmen, wie es andere für ihn einnahm. Und das tat es irgendwie auch. »Der Goldene Hof ist eine interessante Perspektive für junge Frauen wie Ada. Eine Perspektive, die ihr Leben verändern und …«
»Ich muss Sie noch einmal unterbrechen«, sagte ich. »Wie ist Ihr Name?«
Er erhob sich und verbeugte sich wieder. »Cedric Thorn, zu Ihren Diensten.« Kein Titel, aber auch das überraschte mich nicht. Je länger ich ihn betrachtete, desto mehr faszinierte er mich. Er trug einen braunen Frack aus leichtem Wollstoff, der am Knie leicht ausgestellt und damit länger war, als es dem derzeitigen Modetrend entsprach. Die braune Brokatweste darunter reflektierte das Licht. Es war ein seriöser, dezenter Auftritt, vielleicht die Kleidung eines aufstrebenden Kaufmannes, aber eine leuchtende Bernsteinnadel an seinem Hut, den er in der Hand hielt, verriet mir, dass er doch ein gewisses modisches Gespür besaß.
»Mylady?«, fragte er.
Ich wurde mir meines Starrens bewusst und machte eine großzügige Geste mit der Hand. »Bitte fahren Sie fort mit Ihrer Schilderung, was es mit diesem Glänzenden Hof auf sich hat.«
»Goldener Hof, Mylady. Und wie ich schon sagte, es ist eine interessante Perspektive für junge Frauen, um in der Gesellschaft aufzusteigen. Und Ada hier ist genau die Art Mädchen – aufgeweckt und vielversprechend –, nach denen wir suchen.«
Ich zog eine Augenbraue hoch. Ada war mit großem Abstand meine geistloseste Zofe. Aber sie war hübsch, was, wie ich festgestellt hatte, bei den meisten Männern als Synonym für »aufgeweckt und vielversprechend« galt.
Er setzte zu einem anscheinend gut einstudierten Vortrag an. »Der Goldene Hof ist ein hoch angesehenes Unternehmen hüben und drüben des Ozeans. Mein Vater und mein Onkel haben es vor zehn Jahren gegründet, nachdem ihnen klar wurde, wie wenig Frauen es in Adoria gibt.«
Adoria? Darum ging es hier? Fast hätte ich mich neugierig vorgebeugt, doch dann wurde ich mir meiner selbst wieder bewusst. Dennoch fiel es mir schwer, nicht fasziniert zu sein. Adoria. Das Land auf der anderen Seite der Sunset Sea. Adoria. Schon allein der Klang verhieß Abenteuer und Aufregung. Es war eine neue Welt – eine Welt weit entfernt von jener, in der ich meinen von Juckreiz geplagten Cousin heiraten sollte. Aber auch eine Welt ohne Galerien, Theater und eine verschwenderisch gekleidete Aristokratie.
»Es gibt dort viele Icorifrauen«, bemerkte ich, weil ich mich genötigt fühlte, etwas zu sagen.
Cedrics Lächeln wurde noch breiter, was seinen Zügen mehr Herzlichkeit verlieh. Waren seine Wimpern etwa länger als meine? Das kam mir wirklich unfair vor.
»Das stimmt, aber unsere Siedler sind nicht an primitiven Icorifrauen in Kilt und Tartan interessiert. Nun ja«, räumte er dann ein, »die meisten unserer Siedler sind nicht an primitiven Frauen interessiert. Ich nehme an, es gibt immer einen, auf den das einen Reiz ausübt.«
Beinahe hätte ich gefragt, was auf ihn einen Reiz ausübte, aber dann fiel mir wieder ein, dass ich eine Dame von hohem Rang war.
»Die Mehrheit unserer Siedler hingegen wünscht sich sanfte, kultivierte Frauen aus Osfrid – vor allem die Männer, die drüben ein Vermögen gemacht haben. Viele schiffen sich Richtung Adoria ein mit nicht viel mehr als ein paar Kleidern im Gepäck. Nun sind sie als Geschäftsleute und Plantagenbesitzer erfolgreich. Sie sind die Stützen ihrer Gemeinden geworden, Männer von hohem Ansehen.« Er machte eine ausladende Geste wie ein Schauspieler auf der Bühne. »Sie suchen passende Frauen, um mit ihnen Familien zu gründen. Auch seine Majestät will es so. Er hat die Gründung von weiteren Kolonien angeordnet und die Expansion der bestehenden, aber das ist schwierig, wenn es dreimal so viele osfridische Männer wie Frauen gibt. Und wenn Frauen nach Adoria kommen, dann sind es gewöhnlich normale Mädchen aus der Arbeiterschicht, die bereits verheiratet sind. Doch das ist nicht die Art Frauen, nach denen der neuen Aristokratie der Sinn steht.«
»Der neuen Aristokratie?«, fragte ich. Ich stand kurz davor, mich von seinem Vortrag völlig vereinnahmen zu lassen. Es war eine gänzlich neue Erfahrung für mich, dass jemand seine Überredungskünste bei mir einsetzte, anstatt dass ich es selbst tat.
»Die neue Aristokratie. So nennen wir sie – diese gewöhnlichen Männer, die in der neuen Welt zu außergewöhnlicher Größe aufgestiegen sind.«
»Das ist sehr einprägsam. Haben Sie sich das ausgedacht?«
Er wirkte überrascht von dieser Frage. »Nein, Mylady. Das war mein Vater. Was Öffentlichkeitsarbeit und Überredungskunst anbelangt, ist er ein wahrer Meister. Er übertrifft mich bei Weitem.«
»Das kann ich kaum glauben. Bitte – fahren Sie fort mit Ihrer neuen Aristokratie.«
Cedric betrachtete mich einen Moment lang. Da lag etwas in seinem Blick. Ein Kalkül oder vielleicht auch eine Neubewertung. »Nun denn: die neue Aristokratie. Diese Leute brauchen weder Titel noch Geburtsrecht, um Macht und Ansehen für sich zu beanspruchen. Sie haben sich beides durch harte Arbeit verdient und bilden eine eigene Gattung von Aristokratie, die nun passende ›noble‹ Ehefrauen sucht. Doch da Frauen Ihres Standes nicht gerade Schlange stehen, um sich nach Adoria einzuschiffen, hat der Goldene Hof es sich zur Aufgabe gemacht, junge Frauen anzuwerben, die Interesse an einer Veränderung haben. Wir suchen bezaubernde Mädchen wie unsere Ada hier, Mädchen gewöhnlicher Herkunft, Mädchen ohne Familie – oder vielleicht mit einer zu großen Familie – und formen sie dann zu wahrer Größe.«
Als er die Bemerkung über Schlange stehende Aristokratinnen machte, lächelte er kurz, als wäre es ein Scherz zwischen uns beiden. Es gab mir einen Stich. Was wusste er schon davon, dass ich just in diesem Augenblick bei der Aussicht, ein Leben lang an einen mürrischen Cousin und eine herrische Schwiegergroßmutter gefesselt zu sein, die aristokratische Welt aufgegeben und liebend gern zu den Kolonien aufgebrochen wäre – primitive Bedingungen hin oder her. Nicht dass ich es jemals bis zu den Docks geschafft hätte, ohne dass Dutzende Menschen versucht hätten, mich zurück auf meinen angestammten Platz in der Gesellschaft zu scheuchen.
Ada schniefte und rief mir so ihre Anwesenheit wieder in Erinnerung. Ich kannte sie seit Jahren und hatte kaum je einen größeren Gedanken an sie verschwendet. Nun beneidete ich sie zum allerersten Mal. Denn ihr stand eine Welt offen – eine neue Welt voller Möglichkeiten und Abenteuer.
»Aha. Dann werden Sie Ada also mit nach Adoria nehmen«, sagte ich. Es fiel mir schwer, meinen lockeren Ton beizubehalten und meinen Neid nicht offen zu zeigen.
»Nicht sofort«, erwiderte Cedric. »Zunächst sorgen wir dafür, dass sie gemäß den hohen Standards des Goldenen Hofs ausgebildet wird. Zweifellos hat sie in Ihren Diensten eine gewisse Erziehung erfahren, die sich aber nicht mit der Ihren vergleichen lässt. Mit anderen Mädchen ihres Alters wird sie ein Jahr in einem der Gutshäuser meines Onkels verbringen und in den verschiedensten Fächern unterrichtet werden, um das auszugleichen. Sie wird …«
»Moment«, unterbrach ich ihn. Meine Großmutter wäre entsetzt über die gegen jegliche Etikette verstoßende Sprunghaftigkeit, mit der ich diese Unterhaltung führte, aber die ganze Situation war zu eigenartig, um mich mit Formalitäten aufzuhalten. »Sie behaupten, sie wird eine Ausbildung genießen, die sich mit meiner vergleichen lässt? Innerhalb eines Jahres?«
»Ganz so vollkommen wird sie natürlich nicht sein, nein. Aber Ada kann nach dieser Zeit als Teil der Oberschicht durchgehen – vielleicht sogar der Aristokratie.«
So, wie ich Ada kannte, war ich da skeptisch, dennoch wollte ich mehr erfahren. »Fahren Sie fort.«
»Wir beginnen, indem wir ihre grundlegenden Kenntnisse im Lesen und Rechnen auffrischen, dann weiten wir die Ausbildung auf feingeistigere Dinge aus. Wie man einen Haushalt führt und mit der Dienerschaft umgeht. Musikunterricht. Wie man Gesellschaften gibt. Worüber man bei Geselligkeiten spricht. Die schönen Künste, Geschichte, Philosophie. Fremdsprachen, wenn dafür noch genug Zeit bleibt.«
»Das ist sehr umfangreich«, sagte ich und warf Ada einen neugierigen Blick zu.
»Deshalb dauert es ja auch ein Jahr«, erklärte Cedric. »Wie gesagt, Ada wird in einem der Gutshäuser meines Onkels leben, all diese Dinge lernen und dann zusammen mit ihrer Gruppe und den Mädchen aus den anderen Häusern nach Adoria reisen. Falls sie sich dafür entscheidet.«
Bei diesem Satz kam endlich Leben in Ada. Ihr Kopf fuhr hoch. »Ich muss nicht dorthin?«
»Äh, nein«, entgegnete Cedric ein wenig überrascht angesichts dieser Frage. Er zog eine Papierrolle aus seinem Frack – mit einem gewissen Schwung, wenn ich mich nicht täuschte. »Nach Abflauf des Jahres sieht Ihr Vertrag vor, dass Sie entweder nach Adoria reisen können, wo eine Ehe für Sie arrangiert wird. Oder Sie verlassen den Goldenen Hof, und wir finden eine passende Arbeit für Sie, damit Sie uns Ihre Ausbildung vergüten können.«
Ada sah jetzt um vieles fröhlicher aus. Wahrscheinlich dachte sie, dass die erwähnte passende Arbeit eine Position miteinschloss, die mit ihrer jetzigen vergleichbar war.
»Ich vermute, Mister Thorn meint damit ein Arbeitshaus oder eine Fabrik«, sagte ich.
Ada machte ein langes Gesicht. »Oh. Aber ich wäre immer noch hier. In Osfrid.«
»Ja«, bestätigte Cedric. »Wenn Sie bleiben möchten. Aber ganz ehrlich? Wer zieht schon lange, arbeitsreiche Tage der Möglichkeit vor, die Gunst eines reichen, vernarrten Ehemannes zu genießen, der Sie in Seide und Juwelen kleiden würde?«
»Aber ich darf ihn mir nicht aussuchen, oder?«, warf Ada ein.
»Das stimmt nicht ganz. Wenn Sie in Adoria sind, ist für Sie und die anderen Mädchen eine Zeitspanne von drei Monaten vorgesehen, in der Sie den heiratswürdigen Männern vorgestellt werden, die Interesse an unseren ›Juwelen‹ gezeigt haben – so nennt mein Onkel die Mädchen des Goldenen Hofs.« Er schenkte Ada sein umwerfendstes Lächeln, um sie zu beruhigen. »Es wird Ihnen dort sehr gefallen. Die Männer in den Kolonien geraten meist ganz außer sich, wenn wir mit den neuen Mädchen eintreffen. Es ist eine Saison voller Festivitäten und anderer gesellschaftlicher Ereignisse, und für all das werden Sie komplett neu eingekleidet. Die adorianische Mode ist etwas anders als unsere. Wenn dann mehr als ein Mann ein Angebot für Sie macht, dürfen Sie zwischen ihnen wählen.«
Wieder platzte ich fast vor Neid, aber Ada wirkte nach wie vor unsicher. Zweifellos hatte sie aus Adoria Berichte über Gefahren und Gräueltaten gehört. Und der Fairness halber musste man sagen, dass einige von ihnen der Wahrheit entsprechen. Als Siedler aus Osfrid und anderen Ländern nach Adoria gekommen waren, hatte es zwischen ihnen und den Icori-Clans, die dort lebten, ein furchtbares Blutvergießen gegeben. Die Mehrzahl der Icori war vertrieben worden, aber man hörte noch immer Geschichten von anderen Tragödien: Krankheiten, Stürme und gefährliche Raubtiere, um nur ein paar zu nennen.
Aber was bedeutete das schon im Vergleich zu Reichtum und Größe, die Adoria versprach? Gab es nicht überall Gefahren? Um sie zur Vernunft zu bringen, hätte ich Ada am liebsten geschüttelt und ihr gesagt, sie solle diese Chance ergreifen und nicht zurückschauen. Ohne Zweifel gab es kein größeres Abenteuer als dieses. Aber sie hatte nie einen Hang zum Abenteuer gehabt, nie die Verheißung gesehen, die im Ausprobieren von etwas Neuem, Unbekannten lag. Das war einer der Gründe, warum ich Ada nicht ausgewählt hatte, um mit mir in Lionels Haus überzusiedeln.
Nach langem Nachdenken wandte Ada sich an mich. »Was meinen Sie, was ich tun soll, Mylady?«
Die Frage traf mich unvorbereitet, und plötzlich konnte ich nur noch an die Worte meiner Großmutter denken: Dein Leben lang werden andere Menschen die Entscheidungen für dich treffen. Gewöhn dich daran.
Ich spürte, wie meine harte Haltung ins Wanken geriet. »Sie müssen Ihre eigenen Entscheidungen treffen – vor allem, da Sie auf sich gestellt sein werden, sobald Sie aus meinen Diensten scheiden.« Ich sah zu Cedric, und zum allerersten Mal spiegelte sich ein gewisses Unbehagen in seinen markanten Zügen. Er befürchtete, dass Ada kneifen wollte. Musste der Goldene Hof eine bestimmte Quote erfüllen? War er verpflichtet, mit einem Mädchen zurückzukommen?
»So wie Mister Thorn es schildert, klingt das alles wundervoll«, sagte sie. »Aber ich fühle mich wie irgendein Schmuckstück, das gekauft und wieder verkauft wird.«
»So fühlen sich Frauen immer«, bemerkte ich.
Schließlich willigte Ada trotzdem in Cedrics Angebot ein, denn so, wie sie es sah, konnte sie sonst nirgendwohin. Über ihre Schulter hinweg las ich den Vertrag, der im Großen und Ganzen eine etwas förmlichere Erklärung dessen war, was Cedric uns erzählt hatte. Als sie unterschrieb, musste ich zweimal hinschauen.
»Das ist Ihr voller Name?«, fragte ich. »Adelaide? Warum benutzen Sie ihn nicht?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Zu viele Buchstaben. Ich habe Jahre gebraucht, um ihn richtig buchstabieren zu lernen.«
Cedric schien alle Mühe zu haben, ein unbewegtes Gesicht zu machen. Ich fragte mich, ob ihm allmählich Zweifel an seiner Wahl kamen und ob Ada wirklich zu einer geeigneten Gefährtin für seine »neue Aristokratie« ausgebildet werden konnte.
Mit dem Vertrag in der Hand erhob er sich und verbeugte sich vor mir. Zu Ada gewandt sagte er: »Ich muss heute Nachmittag noch einige Verträge überbringen, und auch an der Universität habe ich noch einiges zu erledigen. Sie können den Rest des Tages dazu nutzen, Ihre Sachen zu packen, und heute Abend wird unsere Kutsche Sie abholen und zu dem Gutshaus bringen. Mein Vater und ich werden uns auf dem Weg dorthin zu Ihnen gesellen.«
»Wo liegt dieses Gutshaus?«, fragte ich.
»Ich weiß nicht genau, welchem Haus sie zugeteilt wird«, gestand Cedric ein. »Bis heute Abend habe ich es aber in Erfahrung gebracht. Mein Onkel unterhält vier Häuser für den Goldenen Hof, und in jedem leben zehn Mädchen. Eines befindet sich in Medfordshire. Zwei in Donley und eines in Fairhope.«
Dann waren es echte Landgüter, fiel mir auf, als ich jeden der Orte auf einer imaginären Landkarte lokalisierte. Und sie waren allesamt mindestens eine halbe Tagesreise von unserem Haus in Osfro entfernt.
Er gab Ada noch ein paar letzte Instruktionen, dann schickte er sich an zu gehen. Ich bot an, ihn hinauszubegleiten, was eher unüblich war, und führte ihn in den Garten, in dem ich mich zuvor aufgehalten hatte. »Die Universität. Dann sind Sie also Student, Mister Thorn?«
»Ja. Sie scheinen darüber nicht überrascht zu sein.«
»Es liegt an Ihrem Auftreten. Und an Ihrem Frack. Nur ein Student kleidet sich nach seinen eigenen modischen Regeln.«
Er lachte. »Das habe ich aber nicht. Das entspricht tatsächlich der Mode in Adoria. Ich muss doch glaubwürdig wirken, wenn ich die Mädchen begleite.«
»Sie reisen mit ihnen dorthin?« Das machte das Ganze irgendwie noch qualvoller. »Sind Sie zuvor schon mal dort gewesen?«
»Seit Jahren nicht mehr, aber …«
Er blieb stehen, als wir um eine Ecke bogen und ein weiteres Schniefen hörten. Doris, die alte Köchin, schlurfte Richtung Küche und unterdrückte dabei ein Weinen.
»Fassen Sie das nicht falsch auf …«, setzte Cedric an, »aber in Ihrem Haus gibt es eine Menge Tränen.«
Ich warf ihm einen schiefen Blick zu. »Es ist vieles im Umbruch. Doris wird uns auch nicht begleiten. Sie ist auf einem Auge blind, und mein Cousin möchte sie nicht in seine Dienste nehmen.«
Cedric wandte sich mir zu, um mich anzusehen, doch ich mied seinen Blick, denn er sollte nicht merken, wie sehr mich diese Entscheidung schmerzte. Mit diesem Handicap würde Doris es schwer haben, eine neue Stellung zu finden. Eine weitere Auseinandersetzung, die Großmama gewonnen hatte. Ich verlor an Boden.
»Kocht sie gut?«, fragte Cedric.
»Sehr gut.«
»Entschuldigen Sie bitte!«, rief er ihr hinterher.
Überrascht wandte Doris sich um. »M’lord?« Keiner von uns beiden machte sich die Mühe, ihren Irrtum zu korrigieren.
»Stimmt es, dass Ihre Dienste gerade frei sind? Ich verstehe natürlich, wenn Ihnen bereits ein anderer eine Stellung angeboten hat.«
Sie blinzelte und sah ihn mit ihrem gesunden Auge forschend an. »Nein, M’Lord.«
»In einer der Universitätsküchen gibt es eine freie Stelle. Vier Silbermünzen im Monat, dazu freie Kost und Logis. Falls Sie interessiert sind, gehört die Stelle Ihnen. Aber vielleicht schreckt Sie ja der Gedanke, für so viele Menschen zu kochen …«
»M’Lord« unterbrach sie ihn und richtete sich zu ihrer vollen, wenn auch geringen Größe auf. »Ich habe siebengängige Menüs für hundert adlige Gäste verantwortet. Ich kann mit prahlerischen Jungs umgehen.«
Cedrics Gesichtsausdruck blieb würdevoll. »Das freut mich zu hören. Gehen Sie morgen zum Universitätsbüro im Nordflügel und nennen Sie dort Ihren Namen. Dann werden Sie weitere Informationen erhalten.«
Der alten Doris klappte die Kinnlade herunter. Auf der Suche nach Bestätigung blickte sie mich an. Ich nickte ermutigend.
»Ja, ja, M’Lord! Ich gehe gleich hin, nachdem ich das Frühstück vorbereitet habe. Danke … Haben Sie vielen Dank.«
»Nun, das ist ja ein glücklicher Zufall«, sagte ich zu ihm, als wir wieder alleine waren. Ich würde es ganz bestimmt nicht laut aussprechen, aber ich fand es unglaublich nett von ihm, Doris ein solches Angebot zu unterbreiten, ganz zu schweigen davon, dass er überhaupt Notiz von ihr genommen hatte. Die meisten taten das nicht. »Ein glücklicher Zufall, dass es eine offene Stelle gab.«
»Eigentlich gibt es keine«, antwortete er. »Aber ich gehe nachher im Büro vorbei und rede mit ihnen. Und wenn ich das getan habe, wird es eine freie Stelle geben.«
»Mister Thorn, irgendetwas sagt mir, dass Sie sogar einem Priester die Erlösung aufschwatzen könnten.«
Er lächelte über den alten Spruch. »Wie kommen Sie darauf, dass ich das nicht schon längst getan habe?«
Wir gingen durch den Garten und näherten uns seinem Ende, als er wieder stehen blieb. Ungläubigkeit zeichnete sich auf seinem Gesicht ab, und ich wandte mich dem zu, was seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Mein Mohnblumenbild.
»Das sind … Peter Cosingfords Mohnblumen. Ich habe das Bild in der Nationalgalerie gesehen. Es sei denn …?« Er verstummte voller Verwirrung, als er die Leinwand und die Pigmentfarben daneben entdeckte.
»Das ist eine Kopie. Mein Versuch einer Kopie. Ich habe noch andere. Es ist etwas, das ich zu meinem Vergnügen mache.«
»Sie machen zu Ihrem Vergnügen Kopien großer Meisterwerke … Mylady?«, fügte er dann nachträglich an.
»Nein, Mister Thorn. Das ist das, was Sie tun.«
Das Lächeln auf seinem Gesicht war aufrichtig und gefiel mir besser als sein Schauspiellächeln. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sie niemals kopieren könnte.«
Wir erreichten das Tor, und diesmal blieb ich stehen angesichts seiner Worte. Es war weniger ihr Inhalt als die Art, wie er sie gesagt hatte. Der Ton. Die Herzlichkeit. Ich suchte nach einer geistreichen Erwiderung, aber mein normalerweise schneller Verstand war wie eingefroren.
»Und wenn Sie es nicht als Kränkung auffassen, dass ich offen zu Ihnen spreche …«, setzte Cedric rasch hinzu.
»Ich wäre enttäuscht, wenn Sie es nicht täten.«
»Es ist nur … Ich bin ein wenig enttäuscht, dass ich wahrscheinlich nie mehr die Gelegenheit haben werde, Sie wiederzusehen.« In dem Bewusstsein allzu großer Offenherzigkeit verbeugte er sich rasch. »Leben Sie wohl und viel Glück für Sie, Mylady.«
Einer der Bediensteten öffnete ihm das Tor, und ich sah zu, wie er hinaus auf die Straße trat. Die Art, wie der samtene Frack seinen Körper umschmeichelte, gefiel mir ungemein.
»Aber Sie werden mich wiedersehen«, murmelte ich. »Warten Sie nur ab.«
Kapitel 3
Der Plan hatte sich in meinem Hinterkopf eingenistet, seit Ada unter Tränen den Vertrag unterschrieben hatte. Das war die Gelegenheit, die sich anbahnenden »schlimmen Dinge« mit einer List abzuwenden. Und ich musste rasch handeln – wie mein Vater es mir geraten hatte. Je mehr Einzelheiten ich über das ganze Unternehmen erfuhr, desto größer wurde meine Aufregung, und ich konnte mich gerade noch beherrschen, nicht alles laut herauszuschreien.
Ich riss mich zusammen und ging äußerlich gelassen, aber schnellen Schrittes aus dem Garten zurück zum Salon, wo Ada noch immer verdrossen auf dem Sofa saß. Ich wich zwei Dienern aus, die die Chaiselongue meiner Großmutter wegschleppten, und war froh, dass Cedric das nicht gesehen hatte. Es hatte den Anschein, als würden wir geplündert.
»Tja, sicher sind Sie voller Vorfreude«, sagte ich fröhlich zu Ada. »Mit so einer interessanten Perspektive vor Augen.«
Sie stützte ihr Kinn auf die Hände. »Wenn Sie es sagen, Mylady.«
Ich setzte mich neben sie und täuschte Verwunderung vor. »Das ist doch eine große Sache für Sie.«
»Ich weiß, ich weiß.« Sie seufzte. »Es ist bloß … Es ist bloß …« Ihre Selbstbeherrschung fiel in sich zusammen, und wieder rannen Tränen über ihre Wangen. Ich reichte ihr ein seidenes Taschentuch. »Ich will nicht in ein fremdes Land reisen! Ich will nicht quer über den Ozean segeln! Ich will nicht heiraten!«
»Dann gehen Sie eben nicht«, sagte ich. »Machen Sie etwas anderes, wenn Großmama und ich umziehen. Suchen Sie sich eine andere Stellung.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe den Vertrag unterschrieben. Und was soll ich denn tun? Ich bin nicht wie Sie, Mylady. Ich kann nicht einfach so fortgehen. Ich habe nicht die nötigen Mittel, und im Moment gibt es auch bei den anderen Adelsfamilien keine freien Stellen – zumindest nicht in dieser Position. Ich habe mich umgehört.«
Fortgehen? Glaubte sie wirklich, dass ich das könnte? Ada sah meine Abstammung und meinen Wohlstand als Macht an, aber in Wahrheit hatte jeder gewöhnliche Bürger mehr Freiheiten als ich. Was der Grund war, warum ich vielleicht eine Bürgerliche werden musste.
»Sie sind die Gräfin von Rothford. Jemand mit einem solchen Namen kann sich nicht frei unter den Namenlosen bewegen.«
»Was würden Sie denn tun? Wenn Sie die nötigen Mittel hätten?«
»Wenn ich hier nicht mehr arbeiten würde?« Ada schwieg kurz und putzte sich die Nase. »Ich würde zu meiner Familie nach Hadaworth gehen. Dort leben Cousins von mir. Sie haben einen hübschen Milchbauernhof.«
»Hadaworth liegt ganz weit oben im Norden«, erinnerte ich sie. »Das ist auch keine ganz einfache Reise.«
»Aber man muss keinen Ozean überqueren!«, rief sie aus. »Und es gehört noch immer zu Osfrid. Wilde gibt es dort auch keine.«
»Sie würden also lieber auf einem Milchbauernhof arbeiten als einen adorianischen Abenteurer zu heiraten?« Zugegeben, das spielte mir noch besser in die Hände, als ich gedacht hatte. Aber es war so kurios, dass ich sie einfach fragen musste: »Wie kam es überhaupt dazu, dass man Sie für diesen Goldenen Hof empfohlen hat?«
»Lady Bransons Sohn John studiert zusammen mit ihm an der Universität – mit Master Cedric. Lord John hat gehört, wie er davon gesprochen hat, dass er auf der Suche nach hübschen Mädchen wäre – wegen einer Aufgabe, die sein Vater ihm gestellt hat. Und da Lord John wusste, dass Sie einen Teil der Dienerschaft entlassen, hat er seine Mutter gefragt, ob es Mädchen gäbe, die nicht wüssten, wo sie hinsollten. Als mich Lady Branson dann angesprochen hat … Nun, was konnte ich denn da tun?«
Ich ergriff ihre Hand, was zwischen uns ungewohnt vertraulich war. »Sie gehen nach Hadaworth. Das ist, was Sie tun werden.«
Ada schnappte nach Luft, und ich führte sie hoch in mein Schlafzimmer, wo weitere Zofen meine Kleider durchsahen. Ich wies ihnen andere Aufgaben zu und holte dann ein Paar Topasohrringe aus meinem Schmuckkästchen.
»Hier«, sagte ich und gab sie Ada. »Verkaufen Sie sie. Das ist mehr als genug, um sich einer respektablen Reisegruppe nach Hadaworth anschließen zu können.«
Ich hatte damit gerechnet, dass sie einen viel größeren Lebenstraum hegte – einen, den ich mir vielleicht nicht hätte leisten können. Das hier war ein Schnäppchen.
Ada machte große Augen. »Mylady … Ich … Nein. Ich kann sie nicht annehmen.«
»Sie können«, beharrte ich, und mein eigenes Herz schlug schneller. »Ich, äh, kann den Gedanken an Ihr Unglück nicht ertragen. Ich möchte, dass Sie bei Ihrer Familie sind und dort Ihr Glück finden. Das haben Sie verdient.« Das war zwar nicht vollkommen gelogen, aber meine wahren Motive waren nicht annähernd so edel.
Sie umklammerte die Ohrringe, und ein Hoffnungsschimmer zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab. »Ich … Nein. Das geht nicht. Der Vertrag! Er ist bindend. Sie werden mich suchen und …«
»Ich werde mich darum kümmern, keine Sorge. Ich hole Sie da raus. Solche Dinge sind ein Leichtes für mich, wissen Sie. Doch damit das alles auch wirklich klappt, müssen Sie, äh, jetzt gleich gehen. Sofort. Es ist kurz nach Mittag. Die meisten Handelsreisenden haben ihre Geschäfte jetzt erledigt und werden bald in Richtung Norden aufbrechen. Außerdem müssen Sie leugnen, je etwas vom Goldenen Hof gehört zu haben. Erzählen Sie nie jemandem, dass man an Sie herangetreten ist.«
Adas Augen wurden noch größer. »Das werde ich nicht, Mylady. Ich werde nie auch nur ein Wort sagen. Und ich reise jetzt sofort ab – sobald ich gepackt habe.«
»Nein, tun Sie das nicht. Ich meine, nehmen Sie nicht so viel mit. Packen Sie nur das Nötigste ein. Es sollte nicht so aussehen, als verließen Sie das Haus für immer. Tun Sie so, als müssten Sie nur eine Besorgung machen.« Niemand sollte bemerken, dass Ada für immer fortging, sonst würde man sie möglicherweise aufhalten und ihr Fragen stellen.
Sie nickte angesichts meiner weisen Worte. »Sie haben recht, Mylady. Natürlich haben Sie recht. Außerdem kann ich mir mit dem Geld für die Ohrringe in Hadaworth neue Kleider kaufen.«
Getreu meines Ratschlags suchte sie nur ein paar Habseligkeiten zusammen: Kleidung zum Wechseln, das Medaillon ihrer Familie und einen Stapel Deanzan-Karten. Als ich über Letzteres die Augenbrauen hochzog, wurde sie rot.
»Die sind nur zum Zeitvertreib, Mylady. Wir legen die Karten zum Spaß. Das haben die Leute immer schon getan.«
»Bis die Alanzaner sie zum Herzstück ihrer Religion gemacht haben«, wandte ich ein. »Heutzutage verbrennen die Priester diese Karten. Passen Sie auf, dass Sie nicht als Ketzerin verhaftet werden.«
Sie schluckte. »Ich bete keine Dämonen an! Oder Bäume!«
Alles andere ließ Ada zurück. Das ganze Haus war so damit beschäftigt, sich auf den Umzug vorzubereiten, dass keiner einen weiteren Gedanken an uns verschwendete, als wir umherschlichen und die letzten Dinge erledigten. Ich brachte ihre übrigen Besitztümer – es waren nicht mehr viele, nur ein paar Kleidungsstücke – in mein Zimmer, verbarg sie und geleitete Ada dann heimlich hinaus. Ihre kurze, höchst unangemessene Umarmung ließ mich zusammenzucken. Tränen glänzten in ihren Augen.
»Danke, Mylady. Danke. Sie haben mich vor einem furchtbaren Schicksal bewahrt.«
Und Sie haben vielleicht dasselbe für mich getan, dachte ich.
Meinen Anweisungen folgend trat Ada ganz beiläufig durchs Tor auf die Straße – als wäre sie nur kurz unterwegs zum Markt. Wahrscheinlich bemerkte der diensthabende Lakai ihren Weggang noch nicht einmal. Sie war unsichtbar, etwas, das ich nicht einmal im Ansatz nachvollziehen konnte. Noch nicht. Sobald sie weg war, kehrte ich zu meinem Bild im Garten zurück und ließ es für alle Welt so aussehen, als versuchte ich wie üblich, die Zeit totzuschlagen, während der Rest des Haushalts arbeitete. Wann immer ich es ins Gespräch mit einem der anderen Dienstboten einflechten konnte, erwähnte ich, dass Ada gegangen wäre, um eine neue Stellung anzutreten und wie wundervoll es sei, dass man etwas für sie gefunden hätte. Alle wussten von dem Besucher, der nach ihr gefragt hatte, aber keiner kannte die Einzelheiten dieser Unterhaltung. Viele Dienstboten hatten bereits die Stellung gewechselt, daher war Adas Abschied nichts Neues.