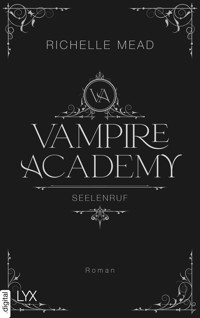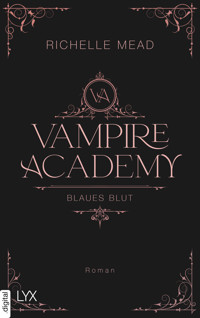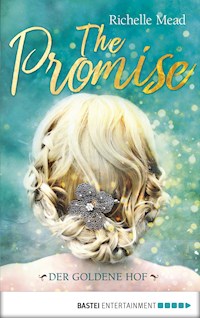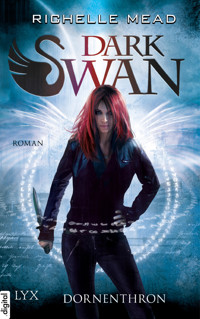11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Bloodlines-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sydney kämpft mit den Folgen der verhängnisvollen Entscheidung, die ihr Leben als Alchemistin völlig auf den Kopf gestellt hat. Dabei muss sie äußerst vorsichtig sein, damit ihr Geheimnis nicht ans Tageslicht kommt. Denn seit der Ankunft ihrer Schwester Zoe ist die Gefahr, entdeckt zu werden, größer denn je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Kapitel 1 - Adrian
Kapitel 2 - Sydney
Kapitel 3 - Adrian
Kapitel 4 - Sydney
Kapitel 5 - Adrian
Kapitel 6 - Sydney
Kapitel 7 - Adrian
Kapitel 8 - Sydney
Kapitel 9 - Adrian
Kapitel 10 - Sydney
Kapitel 11 - Adrian
Kapitel 12 - Sydney
Kapitel 13 - Adrian
Kapitel 14 - Sydney
Kapitel 15 - Adrian
Kapitel 16 - Sydney
Kapitel 17 - Adrian
Kapitel 18 - Sydney
Kapitel 19 - Adrian
Kapitel 20 - Sydney
Kapitel 21 - Adrian
Kapitel 22 - Sydney
Kapitel 23 - Adrian
Kapitel 24 - Sydney
Die Autorin
Die Romane von Richelle Mead bei LYX
Impressum
Titel
RICHELLE MEAD
BLOODLINES
FEURIGES HERZ
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Michaela Link
Zu diesem Buch
Als Alchemistin sollte es Sydneys Aufgabe sein, die Menschen vor den Vampiren zu beschützen und deren Existenz geheim zu halten. Die Alchemisten verachten alle Vampire, ganz gleich, ob es sich um die blutrünstigen Strigoi oder die friedlichen Moroi handelt. Doch nachdem Sydney den attraktiven Vampir Adrian kennenlernte, begriff sie, dass alles, was sie über die Moroi zu wissen glaubte, eine Lüge war. Nach langem Ringen hat sich Sydney nun endlich für ihre verbotene Liebe zu Adrian entschieden. Ausgerechnet jetzt taucht ihre jüngere Schwester Zoe auf, die noch fest an die Ideologie ihrer Leute glaubt. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt – steht Sydney doch kurz davor, den magischen Zwang zu brechen, den die Alchemisten auf Abtrünnige ihrer Zunft ausüben können. Zudem glaubt Adrian, mithilfe seiner Magie und Sydneys alchemistischen Fähigkeiten einen Weg gefunden zu haben, die Moroi vor der Verwandlung in Strigoi zu schützen. Doch um dies zu erreichen, hat sich der junge Vampir auf gefährliche Weise magisch verausgabt und droht, in den Wahnsinn zu gleiten. Sydney muss alles daran setzen, ihr Geheimnis vor Zoe zu hüten und ihren Geliebten davor zu bewahren, langsam den Verstand zu verlieren.
KAPITEL 1
ADRIAN
Ich will nicht lügen. Als ich hereinkam und meine Freundin dabei überraschte, wie sie in einem Buch mit Babynamen blätterte, blieb mir fast das Herz stehen.
»Ich bin ja kein Experte«, sagte ich, nachdem ich mich gefangen hatte, und wählte meine Worte mit Bedacht. »Das heißt – eigentlich schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gewisse Dinge gibt, die wir noch tun müssten, bevor du dieses Buch brauchst.«
Sydney Sage, die erwähnte Freundin und das Licht meines Lebens, schaute nicht einmal auf, obwohl der Anflug eines Lächelns ihre Lippen umspielte. »Es ist für die Initiation«, sagte sie dann sachlich, als spreche sie über ihre Maniküre oder irgendwelche Einkäufe, und nicht über den Beitritt zu einem Hexenzirkel. »Ich muss einen ›magischen‹ Namen haben, den sie während ihrer Versammlungen benutzen können.«
»Alles klar. Magischer Name, Initiation. Also ein ganz normaler Tag heute?« Das musste ich gerade sagen, da ich ein Vampir bin – mit der fantastischen, aber auch komplizierten Fähigkeit, Leute zu heilen und mit Zwang zu belegen.
Diesmal bekam ich ein volles Lächeln, und sie hob sogar den Blick. Nachmittägliches Sonnenlicht sickerte durch mein Schlafzimmerfenster, fing sich in ihren Augen und brachte die bernsteinfarbenen Einsprengsel darin zum Vorschein. Ihre Augen weiteten sich voller Überraschung, als sie die drei Kartons sah, die ich hereinbrachte. »Was ist das?«
»Eine Musikrevolution«, erklärte ich und stellte den Stapel ehrfürchtig auf den Boden. Ich öffnete den obersten Karton und brachte einen Plattenspieler zum Vorschein. »Ich hatte ein Schild gesehen, auf dem stand, dass ein Typ sie auf dem Campus verkauft.« Ich öffnete einen weiteren Karton, der voller Schallplatten war, und hob Rumours von Fleetwood Mac heraus. »Jetzt kann ich Musik in ihrer reinsten Form hören.«
Sie wirkte nicht gerade beeindruckt, was ich überraschend fand, zumal für jemanden, der meinen 1967er Mustang – den sie den Ivashkinator getauft hatte – als eine Art Heiligen Schrein betrachtete. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts Reineres gibt als Digitalmusik. Das war Geldverschwendung, Adrian. Ich kann sämtliche Songs in diesen Kartons auf meinem Telefon speichern.«
»Kannst du die anderen sechs Kartons, die noch im Auto sind, auch auf deinem Telefon speichern?«
Sie blinzelte erstaunt, dann wurde sie misstrauisch. »Adrian, wie viel hast du dafür bezahlt?«
Ich winkte ab. »He, ich kann immer noch die Raten für den Wagen abstottern. So gerade eben jedenfalls.« Ich brauchte wenigstens keine Miete mehr zu überweisen, da die Wohnung im Voraus bezahlt war, aber ich hatte eine Menge anderer Rechnungen. »Außerdem habe ich für solche Sachen ein größeres Budget, seit mich ein gewisser Jemanddazu gebracht hat, mit dem Rauchen aufzuhören und mich bei der Happy Hour zurückzuhalten.«
»Eher beim Happy Day«, sagte sie spitz. »Ich achte nur auf deine Gesundheit.«
Ich setzte mich neben sie aufs Bett. »Genauso, wie ich auf dich und deine Koffeinsucht achte.« Es war ein Deal, den wir gemacht hatten; wir hatten unsere eigene Art von Selbsthilfegruppe gegründet. Ich hatte mit dem Rauchen aufgehört und beschränkte mich jetzt auf einen Drink pro Tag. Sie hatte ihr zwanghaftes Diäthalten durch eine gesunde Kalorienzahl ersetzt und trank nur noch eine Tasse Kaffee am Tag. Erstaunlicherweise fiel ihr das schwerer als mir der Verzicht auf den Alkohol. In den ersten Tagen dachte ich, ich müsse sie in eine Koffein-Entzugsklinik einliefern.
»Es war keine Sucht«, brummte sie, immer noch verbittert. »Eher ein … bewusster Lebensstil.«
Ich lachte, zog sie zu einem Kuss an mich heran, und einfach so verschwand der Rest der Welt. Es gab keine Namensbücher mehr, keine Schallplatten, überhaupt keine Gewohnheiten. Es gab nur noch sie und das Gefühl ihrer Lippen, die es auf wunderbare Weise schafften, gleichzeitig weich und wild zu sein. Der Rest der Welt hielt Sydney für steif und kalt. Nur ich kannte die Wahrheit über die Leidenschaft und den Hunger, die in ihr steckten – gut, ich und Jill, das Mädchen, das in meinen Geist schauen konnte, weil wir durch ein psychisches Band verbunden waren.
Als ich Sydney wieder aufs Bett legte, dachte ich wie immer flüchtig, dass eigentlich tabu war, was wir taten. Menschen und Moroi-Vampire hatten aufgehört, sich miteinander zu vermischen, seit sich meine Rasse im Mittelalter vor der Welt versteckt hatte. Wir hatten es aus Sicherheitsgründen getan und beschlossen, es sei das Beste, wenn die Menschen nichts von unserer Existenz wussten. Jetzt betrachteten meine Leute und ihre (diejenigen, die von den Moroi wussten) Beziehungen wie diese als falsch, und in manchen Kreisen galten sie sogar als dunkel und widernatürlich. Aber mir war das egal. Mir war überhaupt alles egal, bis auf sie und die Art, auf die es mich wild machte, sie zu berühren, so wie ihre Ruhe und ihre ständige Präsenz die Stürme beruhigten, die in mir tobten.
Das hieß jedoch nicht, dass wir es an die große Glocke hängten. Tatsächlich war unsere Beziehung ein streng gehütetes Geheimnis, das allerlei Heimlichtuerei und immer eine sorgfältige Planung erforderte. Selbst jetzt noch tickte die Uhr. In der Woche sah das bei uns so aus: Die nachsichtige Lehrerin ihres Spezialkurses ließ sie früher gehen. Dann kam sie zu mir herübergeflitzt, und wir hatten eine kostbare Stunde miteinander, entweder um rumzumachen oder zu reden. Meistens knutschten wir, und zwar ziemlich wild – wegen des Drucks, unter dem wir standen. Danach war sie gerade rechtzeitig wieder in ihrer Privatschule, wenn ihre Schwester Zoe aus dem Unterricht kam. Zoe hasste Vampire und hing wie eine Klette an ihr.
Irgendwie hatte Sydney eine innere Uhr, die ihr sagte, wann die Zeit um war. Ich glaube, es war Teil ihrer angeborenen Fähigkeit, hundert Dinge gleichzeitig im Auge zu behalten. Bei mir war das anders. In diesen Momenten konzentrierten sich meine Gedanken normalerweise darauf, ihr die Bluse auszuziehen und … ob ich diesmal an ihrem BH vorbeikommen würde. Bis jetzt hatte ich noch kein Glück gehabt.
Sie setzte sich auf, die Wangen gerötet und das goldene Haar zerzaust. Sie war so schön, dass es mir in der Seele wehtat. In diesen Momenten wünschte ich mir immer verzweifelt, dass ich sie malen und den Ausdruck in ihren Augen unsterblich machen könnte. Da lag eine Weichheit in ihnen, die ich sonst selten sah, eine völlige und absolute Verletzlichkeit bei einer Frau, die in ihrem Leben sonst so zurückhaltend und eher analytisch war. Aber obwohl ich durchaus ein ordentlicher Maler war, überstieg es meine Fähigkeiten, sie auf die Leinwand zu bannen.
Sie hob ihre braune Bluse auf, knöpfte sie zu und verbarg das Leuchten der türkisfarbenen Spitze unter der konservativen Kleidung, die sie wie eine Rüstung trug. Im letzten Monat hatte sie sich ein paar neue BHs angeschafft, und obwohl es mich immer traurig machte, sie wieder unter der Bluse verschwinden zu sehen, war ich doch froh zu wissen, dass sie da waren, diese geheimen Farbtupfer in ihrem Leben.
Als sie vor den Spiegel trat, der auf meiner Kommode stand, beschwor ich etwas Geistmagie in mir herauf, um einen Blick auf ihre Aura zu werfen, also auf die Energie, die alle Lebewesen umgibt. Die Magie sorgte für ein kurzes Glücksgefühl in mir, und dann sah ich das Leuchten um sie herum. Es war das typische Gelb einer Gelehrten, ausgewogen von dem reicheren Purpur der Leidenschaft und Spiritualität. Ein Wimpernschlag, und mit dem tödlichen Rausch von Geist verging ihre Aura wieder.
Sie strich sich die Haare glatt und blickte dann nach unten. »Was ist das?«
»Hm?« Ich trat hinter sie und legte die Arme um sie. Dann sah ich, was sie aufgehoben hatte, und versteifte mich: Manschettenknöpfe, die mit glitzernden Rubinen und Diamanten besetzt waren. Und schlagartig wichen das Glück und die Wärme, die ich gerade verspürt hatte, einer kalten, aber vertrauten Dunkelheit. »Die hat mir Tante Tatiana vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt.«
Sydney hielt einen Manschettenknopf hoch und musterte ihn mit Kennerblick. Sie grinste. »Die sind ein Vermögen wert. Aus Platin. Verkauf die Manschettenknöpfe, und du hast ausgesorgt. Dann kannst du dir alle Platten kaufen, die du haben willst.«
»Ich würde eher in einem Pappkarton übernachten, als diese Manschettenknöpfe zu verkaufen.«
Sie bemerkte die Veränderung in mir und drehte sich mit besorgter Miene um. »He, ich hab doch nur Spaß gemacht.« Dann berührte sie sanft mein Gesicht. »Ist schon gut. Alles ist gut.«
Aber es war nicht gut. Die Welt war ganz plötzlich ein grausamer, hoffnungsloser, leerer Ort geworden, und zwar wegen des Verlustes meiner Tante, der Königin der Moroi und der einzigen Verwandten, die mich nicht verurteilt hatte. Mir steckte ein Kloß im Hals, und die Wände schienen sich enger um mich herum zu schließen, als ich daran dachte, wie sie erstochen worden war und dass die Bilder dieser blutigen Tat herumgezeigt worden waren, um ihren Mörder zu finden. Dabei spielte es auch keine Rolle, dass die Mörderin hinter Gittern saß und auf ihre Hinrichtung wartete. Tante Tatiana würde das nicht zurückbringen. Sie war tot, und damit war sie an einem Ort, an den ich ihr nicht folgen konnte – zumindest jetzt noch nicht. Und ich blieb hier, allein und unbedeutend und haltlos …
»Adrian.«
Sydneys Stimme klang ruhig, aber fest, und langsam riss ich mich aus der Verzweiflung, die so schnell und heftig gekommen war, und aus der Dunkelheit, die sich im Laufe der Jahre mit zunehmender Geistbenutzung verstärkt hatte. Das war der Preis für diese Art von Macht, und meine plötzlichen Stimmungswechsel waren in letzter Zeit immer häufiger geworden. Ich konzentrierte mich auf Sydneys Augen, und schon kehrte das Licht in die Welt zurück. Ich trauerte zwar immer noch um meine Tante, aber Sydney war hier, meine Hoffnung und mein Anker. Ich war nicht allein. Jemand verstand mich. Ich schluckte, nickte und schenkte ihr ein schwaches Lächeln, während ich dem dunklen Griff von Geist entkam. Für den Moment.
»Ich bin okay.« Als sich ein Ausdruck von Zweifel auf ihrem Gesicht abzeichnete, drückte ich ihr einen Kuss auf die Stirn.
»Ehrlich. Du musst los, Sage. Sonst wird Zoe misstrauisch, und du kommst zu spät zu deiner Hexenversammlung.«
Sie sah mich noch einen Augenblick lang sorgenvoll an und entspannte sich dann ein wenig. »Na gut. Aber wenn du irgendwas brauchst …«
»Ich weiß, ich weiß. Dann ruf ich dich auf dem Liebestelefon an.«
Das zauberte ihr Lächeln zurück. Wir hatten vor Kurzem geheime Prepaid-Handys gekauft, die die Alchemisten, die Organisation, für die sie arbeitete, nicht orten konnten. Nicht dass sie regelmäßig ihr Haupttelefon überwachten – aber sie könnten es schon, wenn sie vermuteten, dass etwas Verdächtiges vorging. Auf jeden Fall wollten wir keine Spur von SMS und Anrufen hinterlassen.
»Und ich werde heute Abend vorbeikommen«, fügte ich hinzu.
Schon verhärteten sich ihre Züge wieder. »Adrian, nein. Es ist zu riskant.«
Ein weiterer Vorteil von Geist war die Fähigkeit, Leute in ihren Träumen zu besuchen. Es war eine praktische Art, sich zu verständigen, da wir in der wachen Welt nicht viel Zeit miteinander hatten – und weil wir in der wachen Welt unsere knappe Zeit neuerdings kaum aufs Reden verwendeten. Aber wie bei jeder Benutzung von Geist bestand ein ständiges Risiko, das meinen Verstand betraf. Ihr machte es große Sorgen, ich aber betrachtete es lediglich als ein kleines Opfer, um mit ihr zusammen zu sein.
»Keine Diskussion«, warnte ich. »Ich möchte wissen, wie die Dinge laufen. Und ich weiß, dass du bestimmt auch wissen willst, wie es bei mir läuft.«
»Adrian …«
»Nur ganz kurz«, versprach ich.
Widerstrebend stimmte sie zu – ohne dabei auch nur ansatzweise glücklich zu wirken –, und ich brachte sie zur Tür. Als wir durchs Wohnzimmer gingen, blieb sie vor einem kleinen Aquarium stehen, das am Fenster aufgestellt war. Lächelnd kniete sie sich hin und klopfte gegen das Glas. Ein Drache war darin.
Nein, ernsthaft. Die genaue Bezeichnung lautete Callistana, aber wir benutzten sie nur selten. Wir nannten ihn Hoppel. Sydney hatte ihn aus einem dämonischen Reich als eine Art Gehilfen heraufbeschworen. Meistens schien er uns dabei unterstützen zu wollen, das ganze Junkfood in meiner Wohnung zu vernichten. Wir beide waren an ihn gebunden, und um dafür zu sorgen, dass er gesund blieb, mussten wir uns abwechselnd um ihn kümmern. Seit Zoe eingezogen war, war meine Wohnung jedoch zu seinem Hauptwohnsitz geworden. Sydney hob den Deckel des Aquariums und ließ das kleine, golden geschuppte Geschöpf in ihre Hand huschen. Er schaute bewundernd zu ihr auf, und ich konnte ihm deswegen keinen Vorwurf machen.
»Er war jetzt eine Weile draußen«, bemerkte sie. »Kannst du eine Pause vertragen?« Hoppel konnte entweder in dieser Lebensform existieren oder als kleine Statue, was unbequeme Fragen zu vermeiden half, falls ihn jemand sah. Doch nur Sidney war in der Lage, ihn zu verwandeln.
»Ja. Er versucht ständig, meine Farben zu fressen. Und ich möchte nicht, dass er sieht, wie ich dich zum Abschied küsse.«
Sie kitzelte ihn leicht am Kinn und sprach die Worte, die ihn in eine Statue verwandelten. So war das Leben wirklich einfacher, aber andererseits verlangte seine Gesundheit, dass er ab und zu herauskam. Und außerdem warmir der kleine Kerl inzwischen ans Herz gewachsen.
»Ich werde ihn für eine Weile nehmen«, sagte sie und ließ ihn in ihre Handtasche gleiten. Selbst wenn er reglos war, profitierte er immer noch von ihrer Nähe.
Seinen Knopfaugen entronnen, gab ich ihr einen langen Abschiedskuss und ließ ihn nur widerstrebend zu Ende gehen. Dann nahm ich ihr Gesicht in die Hände.
»Fluchtplan Nummer siebzehn«, sagte ich zu ihr. »Abhauen und in Fresno einen Saftstand aufmachen.«
»Warum Fresno?«
»Klingt nach einem Ort, an dem die Leute viel Saft trinken.«
Sie grinste und küsste mich wieder. Die »Fluchtpläne« waren ein Dauerscherz zwischen uns, immer weit hergeholt und ohne besondere Reihenfolge nummeriert. Meistens improvisierte ich sie. Trotzdem waren sie – traurigerweise – durchdachter als unsere echten Pläne. Uns beiden war schmerzhaft bewusst, dass wir vor allem im Jetzt lebten, mit einer Zukunft, die alles andere als klar war.
Auch die Beendigung dieses zweiten Kusses fiel schwer, aber sie schaffte es schließlich, und ich sah ihr nach, als sie davonging. Ohne sie wirkte meine Wohnung dunkler.
Ich holte die restlichen Kartons aus dem Wagen und sah die Schätze durch, die sie enthielten. Die meisten Platten stammten aus den Sechzigern und Siebzigern, ein paar auch aus den Achtzigern. Sie waren völlig ungeordnet, und ich beließ es dabei. Sobald Sydney über die Geldverschwendung hinwegkam, würde sie sich nicht beherrschen können und alle Platten nach Künstlern oder dem Genre oder nach der Farbe der Cover ordnen. Für den Moment aber stellte ich den Plattenspieler in meinem Wohnzimmer auf und zog irgendein Album heraus: Machine Head von Deep Purple.
Ich hatte bis zum Abendessen noch ein paar Stunden Zeit, hockte mich vor eine Staffelei und starrte die leere Leinwand an, während ich überlegte, wie ich meine aktuelle Aufgabe in Ölmalerei für Fortgeschrittene angehen sollte: ein Selbstbildnis. Es brauchte kein genaues Porträt zu werden. Es konnte ruhig abstrakt sein. Es durfte alles sein, solange es nur mich darstellte. Und ich war mit meiner Weisheit am Ende. Ich hätte jeden anderen malen können, den ich kannte. Auch wenn ich den Ausdruck von Verzückung, den Sydney in meinen Armen bekam, nicht genau festhalten konnte, so war ich doch imstande, ihre Aura oder die Farbe ihrer Augen zu malen. Ich hätte das wehmütige, zerbrechliche Gesicht meiner Freundin Jill Mastrano Dragomir malen können, einer jungen Prinzessin der Moroi. Ich hätte flammende Rosen zu Ehren meiner Exfreundin malen können, die mir das Herz zerrissen und es dabei noch geschafft hatte, dass ich sie bewunderte.
Aber mich selbst? Ich wusste nicht, wie ich mich darstellen sollte. Vielleicht war es eine Malblockade. Vielleicht kannte ich mich selbst einfach nicht. Während ich auf die Leinwand starrte und meine Frustration zunahm, musste ich gegen den Drang ankämpfen, zu meinem vernachlässigten Schnapsschrank zu gehen und mir einen Drink einzuschenken. Alkohol erzeugte nicht zwangsläufig die beste Kunst, aber für gewöhnlich inspirierte er etwas. Ich konnte den Wodka praktisch schon schmecken. Ich könnte ihn mit Orangensaft mischen und so tun, als lebte ich gesund. Es juckte mich in den Fingern, und meine Füße trugen mich beinahe in die Küche – aber ich widerstand. Ich sah die Ernsthaftigkeit von Sydneys Blick vor meinem inneren Auge, und ich konzentrierte mich wieder auf die Leinwand. Ich würde es auch nüchtern schaffen. Ich hatte ihr versprochen, dass ich nur einen Drink am Tag nehmen würde, und daran würde ich mich halten. Und zurzeit brauchte ich diesen einen Drink am Ende des Tages, wenn ich mich fürs Bett fertig machte. Ich schlief nicht gut. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gut geschlafen, daher nutzte ich jede Hilfe, die ich bekommen konnte.
Meine nüchterne Entschlossenheit führte jedoch nicht zu Inspiration, und als es fünf Uhr wurde, war die Leinwand immer noch leer. Ich stand auf, streckte meine Glieder und spürte, wie die frühere Dunkelheit wiederkehrte. Sie war eher zornig als traurig, gemischt mit der Frustration darüber, kein Bild zustande zu bekommen. Meine Kunstlehrer behaupteten, ich hätte Talent, doch in Momenten wie diesem fühlte ich mich wie der Versager, als den die meisten Leute mich bezeichneten. Es war, als sei ich für ein Leben des Scheiterns bestimmt. Und es war besonders deprimierend, wenn ich an Sydney dachte, die einfach alles über alles wusste und in jedem Beruf eine glänzende Karriere machen könnte. Wenn ich das Mensch-Vampir-Problem einmal beiseiteließ, musste ich mich fragen, was ich ihr eigentlich zu bieten hatte. Die Hälfte der Dinge, die sie interessierten, konnte ich nicht einmal aussprechen, geschweige denn, darüber vernünftig reden. Wenn es uns jemals gelingen sollte, zusammen ein normales Leben zu führen, würde sie arbeiten gehen müssen, während ich zu Hause blieb und putzte. Und das konnte ich auch nicht besonders gut. Wenn sie allerdings abends nichts erwartete als ihren Schatz mit einer tollen Frisur, dann würde ich das wahrscheinlich halbwegs hinbekommen können.
Ich wusste, dass die Ängste, die mich auffraßen, von Geist verstärkt wurden. Sie waren zwar nicht alle real, aber sie waren schwer abzuschütteln. Ich ließ die Kunst Kunst sein und ging nach draußen, in der Hoffnung, in der bevorstehenden Nacht Ablenkung zu finden. Die Sonne ging unter, und der Winterabend in Palm Springs erforderte kaum eine leichte Jacke. Es war die Lieblingszeit der Moroi, wenn es zwar noch immer hell war, aber nicht mehr so, dass man sich dabei unwohl fühlte. Mit ein bisschen Sonnenlicht kamen wir klar, anders als die Strigoi – die untoten Vampire, die für ihre Blutmahlzeiten töteten. Sonnenlicht brachte sie um, was für uns eher von Vorteil war. Im Kampf gegen sie brauchten wir jede Hilfe, die wir bekommen konnten.
Ich fuhr nach Vista Azul hinaus, dem Vorort, der nur zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt war. Hier lag die Amberwood Prep, das private Internat, das von Sydney und dem Rest unseres bunten Haufens besucht wurde. Normalerweise fungierte Sydney als Chauffeur der Gruppe, aber heute Abend war mir diese zweifelhafte Ehre zugefallen, da sie ein heimliches Treffen mit ihrem Zirkel hatte. Als ich vorfuhr, wartete die Bande bereits vollzählig am Straßenrand draußen vor dem Mädchenwohnheim. Ich beugte mich über den Beifahrersitz und öffnete die Tür. »Alles einsteigen, bitte«, sagte ich.
Sie stiegen in den Wagen. Es waren jetzt fünf, plus meine Wenigkeit, sodass wir mit Sydney eine glückliche Sieben ergeben hätten. Als wir nach Palm Springs gekommen waren, waren wir nur zu viert gewesen. Jill, der Grund, warum wir alle hier waren, ließ sich neben mich gleiten und grinste mich breit an.
Sydney war die wichtigste beruhigende Kraft in meinem Leben, und Jill kam an zweiter Stelle. Sie war erst fünfzehn, also sieben Jahre jünger als ich, aber schon jetzt verströmte sie eine gewisse Anmut und Weisheit. Sydney mochte die Liebe meines Lebens sein, aber Jill verstand mich, wie es sonst niemand vermochte. Durch das psychische Band ging das auch gar nicht anders. Dieses Band war geschmiedet worden, als ich Geist benutzt hatte, um ihr im vergangenen Jahr das Leben zu retten – und wenn ich retten sage, dann meine ich es auch so. Jill war eigentlich schon tot gewesen, zwar noch keine Minute, aber trotzdem tot. Ich hatte die Macht des Geistes benutzt, um eine Wunderheilung zu bewirken und sie zurückzuholen, bevor die nächste Welt Anspruch auf sie erheben konnte. Dieses Wunder hatte uns auf eine Art miteinander verbunden, die es ihr erlaubte, meine Gedanken und Gefühle wahrzunehmen. Es funktionierte aber nur in dieser Richtung; ich selbst hatte zu ihrem Fühlen und Denken keinen Zugang.
Leute, die auf diese Weise zurückgeholt wurden, nannte man »schattengeküsst«, und das allein hätte schon gereicht, um jedes Mädchen fertigzumachen. Außerdem hatte Jill das Pech, eines der beiden letzten Mitglieder der aussterbenden königlichen Familie der Dragomirs zu sein. Dies hatte sie erst vor Kurzem erfahren, und damit ihre Halbschwester Lissa – die Königin der Moroi und eine gute Freundin von mir – ihren Thron behalten konnte, musste Jill am Leben sein. Also waren die Gegner von Lissas liberaler Herrschaft auf Jills Tod aus. Es gab nämlich ein altes Gesetz bei den Moroi, nach dem ein Monarch wenigstens einen weiteren lebenden Verwandten haben müsste. Und so war irgendjemand auf die fragwürdige Idee gekommen, Jill mitten in einer Menschenstadt in der Wüste zu verstecken. Denn ernsthaft, welcher Vampir würde hier leben wollen? Diese Frage habe ich mir oft gestellt.
Jills drei Leibwächter kletterten auf die Rückbank. Sie waren allesamt Dhampire, eine Rasse, die aus einer Mischung von Vampiren und Menschen hervorgegangen war, zu einer Zeit, da beide sich noch in freier Liebe verbunden haben. Dhampire sind schneller und stärker als die Moroi – also ideale Krieger im Kampf gegen Strigoi und königliche Attentäter. Eddie Castile war faktisch der Anführer der Gruppe, ein verlässlicher Fels, der von Anfang an bei Jill gewesen war. Angeline Dawes, dieser rothaarige Hitzkopf, war nicht ganz so zuverlässig. Und mit »nicht ganz« meine ich »überhaupt nicht«. Sie gab sich jedoch ziemlich kampflustig. Der jüngste Neuzugang zu der Gruppe war Neil Raymond, geradezu ein Synonym für groß, anständig und langweilig. Aus Gründen, die mir schleierhaft waren, schienen Jill und Angeline zu denken, dass sein ernstes Auftreten ein Zeichen für eine Art edlen Charakter sei. Die Tatsache, dass er in England zur Schule gegangen war und einen leichten britischen Akzent erworben hatte, schien ihre Östrogene besonders in Wallung zu bringen.
Das letzte Mitglied der Gruppe stand draußen vor dem Wagen und weigerte sich einzusteigen. Zoe Sage, Sydneys Schwester.
Sie beugte sich vor und sah mich mit braunen Augen an, die fast genauso wirkten wie die von Sydney, aber mit weniger goldenen Einsprengseln. »Da ist kein Platz mehr«, erklärte sie. »Dein Auto hat nicht genug Sitze.«
»Stimmt nicht«, entgegnete ich. Wie aufs Stichwort rutschte Jill näher an mich heran. »Dieser Sitz ist für drei Personen. Der letzte Besitzer hat sogar noch einen Sicherheitsgurt einbauen lassen.« Obwohl das für moderne Zeiten gewiss sicherer war, hatte Sydney beinahe einen Herzinfarkt bekommen, weil man den Originalzustand des Mustangs verändert hatte. »Außerdem sind wir doch alle eine Familie, oder?« Damit wir leichteren Zugang zueinander behielten, hatten wir der Amberwood weisgemacht, wir seien alle Geschwister oder Vettern und Cousinen. Bei Neil hatten es die Alchemisten jedoch schließlich aufgegeben, ihn zu einem Verwandten zu machen, da es allmählich ziemlich lächerlich wurde.
Zoe sah die leere Stelle für einen kurzen Moment an. Obwohl die Sitzbank wirklich lang war, würde sie Jill doch recht nahekommen. Zoe war seit einem Monat an der Amberwood, offenbarte aber noch immer all die Komplexe und Vorurteile, die ihre Leute gegenüber Vampiren und Dhampiren hegten. Ich kannte sie gut, weil Sydney früher genauso gedacht hatte. Es war ironisch, zumal die Mission der Alchemisten darin bestand, dafür zu sorgen, dass die Welt der Vampire und des Übernatürlichen vor ihren Mitmenschen verborgen blieb, weil sie Angst hatten, dass sie damit nicht umgehen konnten. Die Alchemisten wurden von dem Glauben getrieben, meine Art wäre ein verdorbener Teil der Natur, den man am besten ignorierte und von Menschen fernhielt, damit wir sie nicht mit unserem Übel besudelten. Sie halfen uns nur widerwillig und machten sich lediglich in einer Situation wie der von Jill nützlich, wenn hinter den Kulissen Arrangements mit Menschenbehörden und Schulvertretern getroffen werden mussten. Alchemisten waren hervorragend darin, Dinge zu ermöglichen. Das war Sydneys ursprünglicher Auftrag gewesen: den Weg für Jill und ihr Exil zu ebnen. Denn die Alchemisten wollten keinen Bürgerkrieg unter den Moroi. Zoe hatte man erst vor Kurzem als Lehrling hergeschickt, und es war unglaublich nervig, unsere Beziehung vor ihr zu verbergen.
»Du brauchst nicht mitzukommen, wenn du Angst hast«, sagte ich. Es gab wahrscheinlich nichts, was sie mehr motiviert hätte. Sie hatte den Ehrgeiz, eine super Alchemistin zu werden, vor allem um ihren Vater zu beeindrucken, der, wie ich nach vielen Geschichten folgern musste, ein Riesenarschloch war.
Zoe holte tief Luft und wappnete sich. Ohne ein weiteres Wort stieg sie neben Jill in den Wagen, schlug die Tür zu und blieb so dicht neben ihr sitzen wie möglich. »Sydney hätte den SUV dalassen sollen«, murmelte sie etwas später.
»Wo steckt Sage überhaupt? Ähm, Sage senior«, korrigierte ich mich, als ich aus der Einfahrt der Schule fuhr. »Nicht dass ich etwas dagegen hätte, euch herumzufahren. Du hättest mir eine kleine schwarze Mütze mitbringen sollen, Küken.« Ich stieß Jill an, die zurückstieß. »Du könntest so was mal in deinem Nähclub zaubern.«
»Sie ist zu einem Projekt für Ms Terwilliger unterwegs«, stellte Zoe missbilligend fest. »Ständig tut sie irgendwas für sie. Ich verstehe nicht, warum Recherche in Geschichte so viel Zeit verschlingt.«
Zoe ahnte nicht, dass es bei besagtem Projekt darum ging, dass Sydney in den Zirkel ihrer Lehrerin eingeführt wurde. Menschliche Magie war für mich immer noch etwas Seltsames und Geheimnisvolles – und den Alchemisten ein richtiges Gräuel –, aber Sydney war anscheinend ein Naturtalent. Das war auch keine Überraschung, da sie in allem ein Naturtalent war. Sie hatte ihre Ängste vor dieser Magie überwunden, ebenso wie sie ihre Angst vor mir überwunden hatte. Und jetzt war sie vollauf damit beschäftigt, das Handwerk von ihrer zwar verrückten, aber liebenswerten Mentorin Jackie Terwilliger zu erlernen. Zu behaupten, den Alchemisten würde das nicht gefallen, wäre eine Untertreibung. Es war schwer zu sagen, was sie mehr ankotzen mochte: das Erlernen geheimer Künste oder eine Beziehung mit einem Vampir. Es wäre beinahe komisch, wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass ich mir Sorgen machte, die Hardcorefanatiker unter den Alchemisten könnten Sydney etwas Schreckliches antun, wenn sie jemals erwischt werden sollte. Das war auch der Grund dafür, warum durch Zoes ständige Gegenwart in letzter Zeit alles so gefährlich geworden war.
»Einfach weil Sydney so ist«, erklärte Eddie von hinten. Im Rückspiegel konnte ich ein unbefangenes Lächeln auf seinem Gesicht erkennen, obwohl er die Welt beständig mit scharfen Augen nach Gefahren absuchte. Er und Neil waren von den Wächtern ausgebildet worden, das war die Dhampir-Organisation von harten Kerlen und Mädels, die die Moroi beschützten. »Wenn sie für eine Aufgabe hundert Prozent gibt, dann ist das für ihre Verhältnisse schon nachlässig.«
Zoe schüttelte den Kopf, nicht annähernd so erheitert wie der Rest von uns. »Es ist doch bloß ein blöder Kurs. Sie muss nur bestehen.«
Nein, dachte ich. Sie muss lernen. Sydney saugte Wissen nicht auf, weil sie Alchemistin war. Sie tat es aus Leidenschaft. Und am allerliebsten hätte sie sich in den akademischen Forschungen am College verloren, wo sie alles lernen konnte, was sie wollte. Stattdessen war sie in ihren Familienjob hineingeboren worden und musste springen, wenn die Alchemisten sie zu neuen Aufträgen schickten. Sie hatte bereits ihren Highschool-Abschluss, nahm dieses zweite Abschlussjahr aber genau so ernst wie ein erstes und war wild darauf zu lernen, was sie konnte.
Eines Tages, wenn all dies vorüber und Jill in Sicherheit ist, werden wir von allem weglaufen. Ich wusste nicht, wohin, und ich wusste auch nicht, wie, aber um die Logistik würde sich Sydney kümmern. Sie würde dem Zugriff der Alchemisten entfliehen und zu Dr. Sydney Sage werden, während ich … irgendwas tat.
Ich spürte eine kleine Hand auf dem Arm und warf einen kurzen Blick zur Seite. Jill sah mich mitfühlend an, ihre jadefarbenen Augen glänzten. Sie wusste, was ich dachte, kannte die Fantasien, die ich oft spann. Ich schenkte ihr ein mattes Lächeln.
Wir fuhren durch die Stadt und dann an den Rand von Palm Springs zu Clarence Donahue, dem einzigen Moroi, der so dumm gewesen war, in dieser Wüste zu leben, bis im letzten Herbst meine Freunde und ich aufgetaucht waren. Der alte Clarence war zwar ein Spinner, aber ein netter Spinner, der eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Moroi und Dhampiren willkommen geheißen und uns erlaubt hatte, seine Blutspenderin/Haushälterin zu benutzen. Moroi brauchen zwar im Gegensatz zu Strigoi nicht für Blut zu töten, aber wir müssen es mindestens zwei Mal in der Woche trinken. Zum Glück gab es auf der Welt viele Menschen, die ihr Blut gerne zur Verfügung stellten und zum Tausch dafür ein Leben auf dem Endorphin-High erhielten, das ein Vampirbiss auslöste.
Wir fanden Clarence im Wohnzimmer, wo er in seinem großen Ledersessel saß und mit einer Lupe in einem alten Buch las. Bei unserem Eintritt schaute er erschrocken auf. »Ihr kommt an einem Donnerstag! Was für eine schöne Überraschung.«
»Es ist Freitag, Mr Donahue«, sagte Jill sanft und beugte sich vor, um ihn auf die Wange zu küssen.
Er musterte sie voller Zuneigung. »Tatsächlich? Seid ihr nicht erst gestern hier gewesen? Na ja, spielt keine Rolle. Dorothy wird euch sicher gern entgegenkommen.«
Dorothy, seine betagte Haushälterin, sah tatsächlich äußerst entgegenkommend aus. Als Jill und ich in Palm Springs angekommen waren, hatte sie das große Los gezogen. Ältere Moroi tranken nicht so viel Blut wie junge, und obwohl Clarence immer noch für einen gelegentlichen Rausch sorgen konnte, lieferten ihr die regelmäßigen Besuche von Jill und mir ein beinahe ständiges High. Was außer Jill jedoch niemand wusste, war dies: Während die Gruppe Jill nur zwei oder drei Mal in der Woche herbrachte, kam ich jeden Tag, um von Dorothy zu trinken. Wahrscheinlich war dies auch der Grund, warum sich Clarence im Wochentag geirrt hatte. Ich hatte nie irgendwelche wilden Momente der Blutgier, wenn ich mit Sydney intim war, noch würde ich wohl jemals welche haben. Aber trotz ihrer Entwicklung in Hinsicht auf Vampire wusste ich, dass sie immer noch empfindlich auf das Bluttrinken reagierte – und ich würde es auf gar keinen Fall riskieren, dass mir in der Hitze der Leidenschaft ein Biss in den Sinn kam. Andere Moroi taten solche Dinge miteinander und auch mit Dhampiren, aber mit ihr würde ich es nicht machen. Ich hungerte nach dem Rest ihres Körpers, jedoch nicht nach ihrem Blut.
Jill eilte auf Dorothy zu. »Darf ich jetzt?« Die ältere Frau nickte eifrig, und die beiden verließen den Raum, um ungestört zu sein. Ein Blick des Abscheus glitt über Zoes Gesicht, aber sie sagte nichts. Ihr Gesichtsausdruck und die Art, wie sie weit entfernt von allen anderen saß, hatte eine solche Ähnlichkeit mit Sydney, wie sie früher war, dass ich beinahe lächelte.
Angeline hüpfte praktisch auf dem Sofa auf und ab. »Was gibt es zum Abendessen?« Sie hatte einen ungewöhnlichen südlichen Akzent, weil sie in einer ländlichen Berggemeinschaft von Moroi, Dhampiren und Menschen aufgewachsen war – der einzigen, die ich kannte, in der diese drei Rassen frei miteinander lebten und untereinander heirateten. Und dafür wurde diese Gemeinschaft praktisch von allen, die ihr nicht angehörten, mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination betrachtet oder schlicht verachtet. So verlockend diese Offenheit auch sein mochte, mir war es in meinen Fantasien mit Sydney noch nie in den Sinn gekommen, bei ihnen zu leben. Ich hasste Camping.
Niemand antwortete. Angeline sah von einem Gesicht zum anderen. »Nun? Warum gibt es hier nichts zu essen?« Dhampire tranken kein Blut und konnten die ganz normalen Sachen essen, die Menschen aßen. Auch Moroi brauchten diese Art von Nahrung, allerdings nicht annähernd in den gleichen Mengen. Es kostete viel Energie, den aktiven Dhampir-Stoffwechsel aufrechtzuerhalten.
Diese regelmäßigen Zusammenkünfte waren zu einer Art Familienessen geworden, nicht nur wegen des Blutes, sondern auch wegen richtiger Mahlzeiten. Es war eine schöne Art, so zu tun, als führten wir ein normales Leben. »Es gibt immer etwas zu essen«, stellte sie fest – für den Fall, dass wir es noch nicht gemerkt hatten. »Mir hat das indianische Essen neulich gut geschmeckt. Dieses Masala oder wie das Zeug hieß. Aber ich weiß nicht, vielleicht sollten wir dort lieber nicht wieder hingehen, bis sie sich in ›Spezialitäten amerikanischer Ureinwohner‹ umbenennen. So ist es nicht sehr höflich.«
»Normalerweise kümmert sich Sydney um das Essen«, meinte Eddie. Er ignorierte Angelines bekannte und liebenswerte Neigung, vom Thema abzukommen.
»Nicht normalerweise«, korrigierte ich ihn. »Immer.«
Angeline richtete den Blick auf Zoe. »Warum hast du uns nicht gesagt, dass wir unterwegs etwas einkaufen sollen?«
»Weil das nicht mein Job ist!« Zoe hob den Kopf. »Wir sind hier, damit Jills Tarnung nicht auffliegt und sie nicht entdeckt wird. Es ist aber nicht mein Job, euch zu füttern.«
»In welchem Sinne?«, fragte ich. Ich wusste zwar ganz genau, dass es gemein war, so etwas zu ihr zu sagen, aber ich konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen. Zoe brauchte einen Moment, um die Doppeldeutigkeit zu verstehen. Sie wurde erst blass, dann rot.
»Weder noch! Ich bin doch nicht eure Concierge. Und Sydney auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum sie das immer für euch erledigt. Sie sollte sich nur um Dinge kümmern, die für euer Überleben wichtig sind. Pizza bestellen gehört nicht dazu.«
Ich täuschte ein Gähnen vor und lehnte mich auf dem Sofa zurück. »Vielleicht denkt sie, dass ihr zwei nicht mehr lange so appetitlich aussehen würdet, wenn wir nicht gut gefüttert werden.«
Zoe war zu entsetzt, um zu reagieren, und Eddie warf mir einen vernichtenden Blick zu. »Das reicht jetzt. So schwer ist es nicht, Pizza zu bestellen. Ich übernehme das.«
Jill kam zurück, als er den Anruf gerade beendete, ein erheitertes Lächeln im Gesicht. Anscheinend hatte sie den Wortwechsel mitbekommen. Das Band war nicht die ganze Zeit über aktiv, aber heute schien es stark zu sein. Nachdem das Pizzaproblem gelöst war, schafften wir es tatsächlich, in eine überraschende Kameradschaft zu verfallen – na ja, alle bis auf Zoe, die nur zuschaute und abwartete. Angeline und Eddie waren überraschend freundlich zueinander, trotz einer katastrophalen Reihe von Dates in jüngster Zeit. Sie war darüber hinweg und tat jetzt so, als sei sie von Neil besessen. Wenn Eddie immer noch litt, so ließ er sich nichts anmerken, aber das war typisch für ihn. Sydney sagte, er sei heimlich in Jill verliebt, was er ebenfalls gut verbarg.
Ich wäre damit einverstanden gewesen, aber Jill tat genau wie Angeline so, als sei sie in Neil verliebt. Beide Mädchen spielten uns etwas vor, aber niemand – nicht einmal Sydney – glaubte mir.
»Ist unsere Bestellung okay für dich?«, fragte ihn Angeline. »Du hast nicht gesagt, was du haben möchtest.«
Neil schüttelte mit stoischer Miene das Gesicht. Er trug sein dunkles Haar raspelkurz und effizient geschnitten. Es war die Art von Sachlichkeit, die den Alchemisten gefallen hätte. »Ich kann keine Zeit damit verschwenden, mich über Belanglosigkeiten wie Peperoni und Pilze zu streiten. Hättet ihr meine Schule in Devonshire besucht, würdet ihr das verstehen. In der zehnten Klasse haben sie uns für einen meiner Kurse im Moor abgesetzt. Wir sollten lernten, uns allein durchzuschlagen. Lebt mal drei Tage nur von Zweigen und Heidekraut, dann streitet ihr nicht mehr übers Essen.«
Angeline und Jill gurrten, als sei dies das Härteste und Männlichste, was sie je gehört hatten. Eddie trug einen Gesichtsausdruck zur Schau, der meine eigenen Gefühle widerspiegelte; er fragte sich, ob dieser Kerl tatsächlich so ernst war, wie er zu sein schien, oder ob er einfach nur ein genialer Sprücheklopfer war, der Frauen zum Dahinschmelzen brachte.
Zoes Handy klingelte. Sie schaute auf das Display und sprang erschrocken auf. »Es ist Dad.« Ohne einen Blick zurück ging sie ran und huschte aus dem Raum.
Ich war kein Freund von Vorahnungen, aber jetzt überlief mich doch ein Frösteln. Der Sage-Dad war nicht die Art von warmem und freundlichem Mann, der einfach so während der Geschäftszeiten anrufen würde, um Hallo zu sagen, wenn er doch wusste, dass Zoe ihr Alchemistending durchzog. Wenn mit ihr etwas war, dann war auch etwas mit Sydney. Und das machte mir Angst.
Ich achtete kaum auf den Rest des Gesprächs, während ich die Sekunden bis zu Zoes Rückkehr zählte. Als sie endlich wieder erschien, sagte mir ihr kreidebleiches Gesicht, dass ich recht gehabt hatte. Etwas Schlimmes war passiert.
»Was ist los?«, fragte ich scharf. »Irgendwas mit Sydney?« Zu spät wurde mir klar, dass ich keine besondere Sorge um Sydney hätte zeigen sollen. Nicht einmal unsere Freunde wussten von uns. Glücklicherweise richtete sich alle Aufmerksamkeit auf Zoe.
Sie schüttelte langsam den Kopf, die Augen groß und ungläubig. »Ich … ich weiß nicht. Es sind meine Eltern. Sie lassen sich scheiden.«
KAPITEL 2
SYDNEY
Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass eine geheime Initiation in einen Hexenzirkel mit einer Teegesellschaft beginnen würde.
»Würden Sie mir bitte die Löffelbiskuits anreichen, meine Liebe?«
Schnell nahm ich den Porzellanteller vom Beistelltisch und gab ihn Maude, einer der älteren Hexen in der Gruppe – außerdem war sie die Gastgeberin, die uns heute Abend ihr Haus zur Verfügung gestellt hatte. Wir saßen im Kreis auf Klappstühlen in ihrem makellosen Wohnzimmer, und meine Geschichtslehrerin, Ms Terwilliger, knabberte neben mir an einem Gurkensandwich. Ich war viel zu nervös, um etwas zu sagen, und trank einfach meinen Tee, während die anderen über eher leichte Themen plauderten. Maude servierte Kräutertee, daher brauchte ich mir keine Sorgen darüber zu machen, meinen Koffein-Deal mit Adrian zu brechen. Nicht dass es mir etwas ausgemacht hätte, eine Entschuldigung zu haben, wenn sie Kaffee serviert hätte.
Es waren sieben von uns zusammengekommen, und obwohl sie beliebig viele würdige Kandidatinnen in ihrer Gruppe willkommen geheißen hätten, schienen sie sich alle besonders darüber zu freuen, eine Primzahl zu haben. Es war eine Glückszahl, darauf beharrte Maude. Gelegentlich streckte Hoppel den Kopf hervor und huschte dann unter die Möbel. Da Hexen sich wegen eines Callistana nicht störten, hatte ich ihn heute Abend rausgelassen.
Jemand brachte die Pros und Kontras von Initiationen im Winter oder im Sommer zur Sprache, und ich ertappte mich dabei, dass meine Gedanken abschweiften. Ich fragte mich, wie es wohl drüben bei Clarence lief. Seit September war ich dafür verantwortlich gewesen, Jill zu ihrer Nahrungsaufnahme zu bringen, und jetzt weckte es in mir ein seltsames (und etwas wehmütiges) Gefühl, hier zu sein, während alle anderen zusammen sein konnten und Spaß hatten. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich überhaupt keine Vorkehrungen fürs Abendessen getroffen hatte. Adrian war nur der Fahrer gewesen, daher hatte ich nicht daran gedacht, etwas zu sagen. Ob Zoe das Kommando übernommen hatte? Wahrscheinlich nicht. Ich verdrängte die mütterlichen Instinkte in mir, die sich für den Hunger der anderen verantwortlich fühlten. Bestimmt war jemand von ihnen in der Lage, etwas Essbares zu besorgen.
Der Gedanke an Adrian brachte die goldenen Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit an diesem Nachmittag zurück. Selbst noch nach Stunden konnte ich die Stellen spüren, wo er mich geküsst hatte. Ich holte tief Luft, um mich zusammenzureißen, und war besorgt, meine zukünftigen Schwestern könnten merken, dass Magie das Letzte war, worüber ich mir im Moment Gedanken machte. In diesen Tagen schien ich an nicht viel anderes mehr denken zu können als daran, mich mit Adrian halb nackt zu machen. Nachdem ich ein Leben lang stolz darauf gewesen war, mich stoisch an das Prinzip der Herrschaft des Geistes über die Materie zu halten, war ich jetzt irgendwie erstaunt darüber, dass ein solcher Verstandesmensch wie ich sich so schnell an körperliche Aktivität gewöhnen konnte. Manchmal versuchte ich, es rational als eine natürliche, animalische Reaktion zu erklären. Aber ernsthaft, ich musste mich einfach der Wahrheit stellen: Mein Freund war wahnsinnig sexy, Vampir hin oder her, und ich konnte die Hände nicht von ihm lassen.
Dann merkte ich, dass mir jemand eine Frage gestellt hatte. Widerstrebend blinzelte ich den Gedanken an Adrian weg, wie er mir die Bluse aufknöpfte, und wandte mich der Sprecherin zu. Ich brauchte einen Moment, um mich an ihren Namen zu erinnern. Trina. Sie war Mitte Zwanzig, die Jüngste hier, abgesehen von mir selbst.
»Wie bitte?«, fragte ich.
Sie lächelte. »Ich sagte, Sie machen etwas mit Vampiren, nicht?«
Oh, ich machte eine Menge Sachen mit einem ganz bestimmten Vampir, aber das war natürlich nicht das, was sie meinte.
»Mehr oder weniger«, sagte ich ausweichend.
Ms Terwilliger kicherte. »Die Alchemisten sind sehr darauf bedacht, ihre Geheimnisse zu hüten.«
Zwei weitere Hexen nickten. Andere wirkten einfach neugierig. Die magische Welt der Hexen überschnitt sich nicht mit der Welt der Vampire. Die meisten Hexen und Vampire wussten noch nicht einmal etwas über die Existenz der anderen. Für einige hier war es eine Überraschung gewesen, von Moroi und Strigoi zu erfahren – was bedeutete, dass die Alchemisten ihre Arbeit taten. Nach dem, was ich gehört hatte, waren diese Hexen genug mystischen und übernatürlichen Dingen begegnet, um zu akzeptieren, dass bluttrinkende, magische Kreaturen auf Erden wandelten und dass es Gruppen wie die Alchemisten gab, die dieses Wissen unter Verschluss hielten.
Hexen akzeptierten das Paranormale ohne Weiteres. Die Alchemisten waren weniger offen. Die Gruppe, die mich großgezogen hatte, dachte, dass Menschen um der Unantastbarkeit ihrer Seelen willen frei von Magie bleiben müssten. Ich hatte das früher auch geglaubt und gedacht, dass Wesen wie Vampire kein Recht darauf hätten, mit uns befreundet zu sein. Damals war ich auch noch davon ausgegangen, dass die Alchemisten mir die Wahrheit sagten. Jetzt wusste ich, dass es in der Organisation Leute gab, die sowohl Menschen als auch Moroi belogen und bereit wären zu jedem Mittel zu greifen, um ihre eigenen selbstsüchtigen Interessen zu schützen, ganz gleich, wem sie damit schadeten. Als sich meine Augen der Wahrheit geöffnet hatten, konnte ich den Alchemisten nicht länger blind gehorchen, obwohl ich eigentlich immer noch für sie arbeitete. Das sollte allerdings nicht heißen, dass ich offen gegen sie rebellierte (wie mein Freund Marcus), da einige ihrer ursprünglichen Ziele immer noch etwas für sich hatten.
Im Grunde lief alles darauf hinaus, dass ich jetzt für mich selbst arbeitete.
»Wissen Sie, mit wem Sie da mal sprechen sollten – falls sie überhaupt bereit ist, mit Ihnen zu sprechen? Mit Inez. Sie hatte alle möglichen Begegnungen mit diesen Kreaturen – nicht mit den lebenden. Mit den untoten.« Das war wieder Maude. Sie hatte die goldene Lilie auf meiner Wange, die mich als Alchemistin auswies (für diejenigen, die wussten, worauf sie achten mussten), sofort erkannt. Die Lilie bestand aus Vampirblut und anderen Zutaten, die uns einen Teil der Heilkraft und Robustheit der Vampire verliehen, und belegte uns zudem mit einem Zauber, der uns hinderte, mit den nicht Eingeweihten übernatürliche Angelegenheiten zu besprechen. Jedenfalls hatte meine Tätowierung früher diese Wirkung gehabt.
»Wer ist Inez?«, fragte ich.
Das entlockte den anderen ein Kichern. »Wahrscheinlich die Größte unseres Ordens – zumindest in dieser Hälfte des Landes«, erklärte Maude.
»In dieser Hälfte der Welt«, beharrte Ms Terwilliger. »Sie ist fast neunzig und hat Dinge gesehen und getan, die die Vorstellungskraft der meisten von uns weit übersteigen.«
»Warum ist sie nicht hier?«, erkundigte ich mich.
»Sie gehört keinem formellen Zirkel an«, erläuterte eine andere Hexe, die Alison hieß. »Das hat sie sicher früher einmal getan, aber sie praktiziert nun schon allein seit … seit ich von ihr weiß. Sie ist jetzt nicht mehr so beweglich und bleibt meistens einfach für sich. Lebt in einem alten Haus außerhalb von Escondido und setzt kaum einen Fuß vor die Tür.«
Da musste ich unwillkürlich an Clarence denken. »Ich glaube, ich kenne einen Mann, mit dem sie sich gut verstehen würde.«
»Sie hat zu ihrer Zeit gegen eine Reihe von Strigoi gekämpft«, erinnerte Maude sich laut. »Wahrscheinlich hat sie einige Zauber, die Sie nützlich finden werden. Und die Geschichten, die sie erzählen kann. Sie war eine großartige Kriegerin. Ich weiß noch, wie sie erzählt hat, dass einer versucht hatte, ihr Blut zu trinken.« Maude schauderte. »Aber anscheinend konnte er es nicht, und sie hat es geschafft, ihn zu erledigen.«
Ich hatte gerade die Teetasse angehoben und erstarrte mitten in der Bewegung. »Was meinen Sie damit, dass er es nicht konnte?«
Maude zuckte die Achseln. »An die Einzelheiten erinnere ich mich nicht. Vielleicht hatte sie eine Art von Schutzzauber.«
Das ließ mich an ein eigenes Erlebnis denken. Im vergangenen Jahr war ich von einer Strigoi gefangen worden, die versucht hatte, auch mein Blut zu trinken. Sie hatte es jedoch nicht tun können, weil ich angeblich »schlecht schmeckte«. Der Grund dafür war immer noch ein Rätsel, dessen Lösung Alchemisten und Moroi wegen anderer drängenderer Probleme zurückgestellt hatten. Aber mich selbst hatte es einfach nicht losgelassen. Ich fragte mich oft, was ich wohl an mir haben mochte, das ihr so zuwider gewesen war.
Ms Terwilliger, die mich kannte, musterte mich und erriet meine Gedanken. »Wenn Sie gern mit ihr reden würden, könnte ich ein Treffen für Sie arrangieren.« Ihre Lippen zuckten und verzogen sich zu einem Lächeln. »Obwohl ich Ihnen nicht garantieren kann, dass Sie etwas Nützliches aus ihr herausbekommen werden. Sie ist sehr … eigen mit dem, was sie preisgibt.«
Maude lachte spöttisch. »Das ist zwar nicht das Wort, an das ich denke, aber deins ist höflicher.« Sie warf einen Blick auf eine kunstvolle Standuhr und stellte ihre Tasse ab. »Nun denn. Wollen wir anfangen?«
Ich vergaß Inez und sogar Adrian, als mich Angst überkam. In weniger als einem Jahr hatte ich mich meilenweit von der Alchemistendoktrin entfernt, die mein Leben früher einmal beherrscht hatte. Es machte mir nichts mehr aus, Vampiren nahe zu sein, aber hin und wieder verspürte ich noch ein warnendes Gefühl vor der Geheimwissenschaft. Ich musste mich wappnen und mir ins Gedächtnis rufen, dass die Vermeidung von Magie ein Weg war, den ich längst hinter mir gelassen hatte, und dass sie nur in dem Fall böse war, wenn man sie für das Böse benutzte. Die Stellae, wie sich diese Gruppe nannte, hatten geschworen, mit ihren Kräften niemandem zu schaden – es sei denn, um sich selbst oder andere zu verteidigen.
Wir vollzogen das Ritual in Maudes Garten, einem weitläufigen Grundstück voller Palmen und Winterblumen. Draußen herrschten etwa zehn Grad, im Vergleich zum Spätjanuar in anderen Teilen des Landes war das zwar mild, aber eben trotzdem Jackenwetter in Palm Springs – oder vielmehr Umhangwetter. Ms Terwilliger hatte mir erklärt, dass es keine Rolle spiele, was ich heute Abend tragen würde, dass man mir geben würde, was ich brauchte. Und das, was ich brauchte, entpuppte sich als ein Umhang, der aus sechs verschiedenfarbigen Samtstücken zusammengesetzt war. Ich kam mir wie ein Krämer in einem Märchen vor, als ich ihn mir über die Schultern warf.
»Das ist unser Geschenk an Sie«, erklärte Ms Terwilliger. »Jede von uns hat ein Stück beigetragen und selbst genäht. Sie werden den Umhang bei jeder formellen Zeremonie tragen.« Die anderen streiften ähnliche Umhänge über, die aus unterschiedlich vielen Flicken bestanden, je nachdem, wie viele Zirkelmitglieder während ihrer jeweiligen Initiationen zugegen gewesen waren.
Der Himmel war klar und mit Sternen übersät, und der Vollmond leuchtete vor der tiefen Schwärze wie eine glänzende Perle. Es war die geeignetste Zeit, um gute Magie zu wirken.
Dann bemerkte ich, dass die Bäume im Garten in einem Kreis angeordnet waren. Die Hexen bildeten darin einen weiteren Kreis vor einem Steinaltar, der mit Weihrauch und Kerzen geschmückt worden war. Maude stellte sich neben den Altar und bedeutete mir, mich vor ihr hinzuknien. Ein leichter Wind kam auf, und obwohl ich bei geheimen Ritualen an überwucherte, neblige Laubwälder dachte, schienen die hohen Palmen und die frische Luft genau das Richtige zu sein.
Ich hatte eine Weile gebraucht, um mich zum Beitritt zu dem Zirkel durchzuringen, und Ms Terwilliger hatte mir hundert Mal versichern müssen, dass ich nicht irgendeinem vorzeitlichen Gott die Treue schwören würde. »Sie verschwören sich der Magie«, hatte sie erklärt. »Dem Streben nach Wissen und seiner Verwendung zum Wohl der Welt. Es ist im Grunde ein Gelehrtengelübde. Scheint mir etwas zu sein, mit dem Sie gut leben könnten.«
Das war es tatsächlich. Und so kniete ich vor Maude, während sie das Ritual vollzog. Sie weihte mich den Elementen und umkreiste mich zuerst mit einer Kerze – dies galt dem Feuer. Dann sprenkelte sie mir Wasser auf die Stirn. Zerbröselte Veilchenblätter sprachen für die Erde, und ein Kranz aus Weihrauchschwaden beschwor die Luft. Manche Traditionen benutzten für dieses Element eine Klinge, aber ich war irgendwie froh, dass es bei ihrer nicht so war.
Wie in der Vampirmagie waren die Elemente das Herz der menschlichen Magie. Aber ebenso wie die Moroi billigten sie nicht die Verwendung von Geist. Die Moroi hatten diese Magie erst vor Kurzem wiederentdeckt, und nur eine Handvoll von ihnen wendete sie an. Als ich Ms Terwilliger danach gefragt hatte, hatte sie keine gute Antwort gehabt. Ihre beste Erklärung war gewesen, dass sich die menschliche Magie aus der materiellen Welt speise, die von den körperlichen Elementen gebildet wurde. Geist, an das Wesen des Lebens geknüpft, brannte in uns allen und war daher immer schon vorhanden. Zumindest hatte sie das vermutet. Geist war für menschliche und vampirische Magiebenutzer gleichermaßen ein Rätsel, seine Wirkungen gefürchtet und unbekannt – was der Grund dafür war, warum ich nachts so oft wach lag und mir über Adrians Unfähigkeit Sorgen machte, sich von Geist fernzuhalten.
Als Maude mit den Elementen fertig war, forderte sie mich auf: »Legen Sie Ihre Gelübde ab.«
Die Gelübde waren auf Italienisch abgefasst, da dieser spezielle Zirkel seine Ursprünge in der mittelalterlichen römischen Welt hatte. Das meiste von dem, was ich schwor, stimmte mit dem überein, was Ms Terwilliger gesagt hatte. Es war ein Versprechen, Magie klug zu benutzen und meine Zirkelschwestern zu unterstützen. Ich hatte es bereits vor einer Weile auswendig gelernt und sagte es nun fehlerlos auf. Dabei spürte ich, wie mich eine Energie durchbrannte, ein angenehmes Summen von Magie, das zugleich von dem Leben herrührte, das uns umgab. Das Gefühl war süß und berauschend, und ich fragte mich, ob dies das gleiche Gefühl sein mochte, das man verspürte, wenn Geist angewandt wurde. Als ich zum Ende kam, sah ich auf, und die Welt schien heller und klarer zu sein, von viel mehr Wundern und Schönheit erfüllt, als gewöhnliche Menschen es wahrnehmen konnten. In diesem Moment glaubte ich mehr denn je, dass Magie nichts Böses war, es sei denn, man führte es selbst herbei.
»Wie lautet dein Name unter uns?«, fragte Maude.
»Iolanthe«, antwortete ich prompt. Auf Griechisch bedeutete es »Veilchen« und war mir eingefallen, nachdem Adrian so oft von dem Violett gesprochen hatte, mit dem meine Aura durchsetzt sei.
Sie streckte mir die Hände hin und half mir auf. »Willkommen, Iolanthe.« Dann zog sie mich zu meiner Überraschung in eine herzliche Umarmung. Die Übrigen, die den Kreis nun, da das Ritual vorüber war, aufbrachen, umarmten mich ebenfalls, und Ms Terwilliger war die Letzte. Sie hielt mich länger fest als die anderen, und mehr als alles andere, was ich an diesem Abend gesehen hatte, erstaunten mich die Tränen in ihren Augen.
»Sie werden große Dinge tun«, eröffnete sie mir in heftigem Ton. »Ich bin so stolz auf Sie, stolzer, als ich es auf eine Tochter sein könnte.«
»Obwohl ich Ihr Haus niedergebrannt habe?«, fragte ich.
Der für sie so typische erheiterte Gesichtsausdruck kehrte zurück. »Vielleicht gerade deshalb.«
Ich lachte, und die ernste Stimmung verwandelte sich in eine Feierstimmung. Wir kehrten ins Wohnzimmer zurück, wo Maude Tee gegen Würzwein eintauschte, jetzt, da die Magie gewirkt war. Ich trank zwar keinen Wein, aber meine Nervosität war längst verschwunden. Ich fühlte mich glücklich und leicht … und – das war noch wichtiger – während ich dasaß und ihren Geschichten lauschte, kam es mir so vor, als gehörte ich hierher – mehr, als ich jemals zu den Alchemisten gehört hatte.
Als Ms Terwilliger und ich uns schließlich zum Aufbruch bereit machten, summte mein Handy in der Handtasche. Es war meine Mom. »Tut mir leid«, sagte ich zu den anderen. »Ich muss rangehen.«
Ms Terwilliger, die mehr Wein getrunken hatte als alle anderen, winkte mich mit einer Handbewegung aus dem Raum und schenkte sich ein weiteres Glas ein. Ich fuhr sie, daher konnte sie jetzt allein nirgendwohin gehen. Ich nahm ab, während ich mich in die Küche zurückzog. Dass meine Mom anrief, hatte mich nicht besonders überrascht. Wir blieben in Verbindung, und sie wusste, dass sie mich meistens abends für einen Schwatz erwischen konnte. Doch als sie jetzt sprach, lag eine Dringlichkeit in ihrer Stimme, die mir sagte, dass dies kein normaler Anruf war.
»Sydney? Hast du mit Zoe gesprochen?«
In mir gingen sämtliche Alarmglocken los. »Seit heute Nachmittag nicht mehr. Stimmt was nicht?«
Meine Mom holte tief Luft. »Sydney … dein Vater und ich, wir werden uns trennen. Wir lassen uns scheiden.«
Für einen Moment drehte sich alles vor mir, und ich lehnte mich haltsuchend an die Küchentheke. Ich schluckte. »Ich verstehe.«
»Es tut mir ehrlich leid«, fuhr sie fort. »Ich weiß, wie schwer das für dich sein wird.«
Ich dachte darüber nach. »Nein … eigentlich nicht. Ich meine, ich schätze … na ja, ich kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin.«
Sie hatte mir einmal erzählt, dass mein Dad in seiner Jugend umgänglicher gewesen sei. Ich konnte mir das zwar kaum vorstellen, aber sie musste ihn ja aus irgendeinem Grund geheiratet haben. Im Laufe der Jahre war mein Dad dann kalt und unnachgiebig geworden und hatte sich mit einer Hingabe in die Sache der Alchemisten gestürzt, die Vorrang vor allen anderen Dingen in seinem Leben hatte, einschließlich seiner Töchter. Er war streng und unbeirrbar geworden, und mir war schon vor langer Zeit klar geworden, dass ich in seinen Augen eher ein Werkzeug für das größere Wohl als eine Tochter war.
Meine Mom hingegen war warm und witzig, jederzeit bereit, Zuneigung zu zeigen und uns zuzuhören, wenn wir sie brauchten. Sie lächelte gern und oft … obwohl mir schien, als habe sie es in letzter Zeit nicht mehr so oft getan.
»Ich weiß, dass es für dich und Carly emotional schwierig werden wird«, sprach sie weiter. »Aber andererseits wird es euer tägliches Leben kaum beeinflussen.«
Ich grübelte über ihre Wortwahl nach. Ich und Carly. »Aber Zoe …«
»Zoe ist minderjährig, und selbst wenn sie jetzt gerade fort ist, um eure Alchemistenarbeit zu tun, steht sie rechtlich doch immer noch unter der Obhut ihrer Eltern. Oder jedenfalls eines Elternteils. Dein Vater hat vor, das alleinige Sorgerecht zu beantragen, um sie dort lassen zu können, wo sie jetzt ist.« Nun folgte eine lange Pause. »Ich habe vor, gegen ihn zu kämpfen. Und wenn ich gewinne, werde ich sie zurückholen, damit sie bei mir lebt, und dann werde ich dafür sorgen, dass sie ein normales Leben führen kann.«
Ich war benommen und konnte mir die Art von Schlacht, die sie andeutete, nicht vorstellen. »Muss es denn alles oder nichts sein? Könnt ihr euch nicht auf ein geteiltes Sorgerecht einigen?«
»In dem Fall könnte ich ihm das Sorgerecht auch ganz überlassen. Er wird die Kontrolle an sich reißen, und ich darf nicht zulassen, dass er sie bekommt – dass er sie geistig kontrolliert. Du bist erwachsen. Du kannst deine Entscheidungen selbst treffen, und auch wenn du deinen Weg gefunden hast, packst du die Dinge anders an als sie. Du bist du, aber sie ist eher wie …«
Sie beendete den Satz nicht, aber ich wusste es bereits. Sie ist eher wie er.
»Wenn ich das Sorgerecht bekommen und sie nach Hause holen kann, dann werde ich sie auf eine Regelschule schicken und ihr damit vielleicht wieder eine Art normales Teenagerdasein ermöglichen können. Falls es noch nicht zu spät ist. Du hasst mich wahrscheinlich dafür, dass ich sie von deiner Sache abziehe.«
»Nein«, warf ich schnell ein. »Ich denke … ich denke, das ist wirklich eine gute Idee.« Falls es noch nicht zu spät ist.
Ich konnte hören, dass ihre Stimme ein wenig brach, und fragte mich, ob sie gegen Tränen ankämpfte. »Wir werden vor Gericht gehen müssen. Die Alchemisten werden wir nicht erwähnen, nicht einmal ich, aber es wird viel über Eignung und Charakteranalyse gesprochen werden. Zoe wird aussagen müssen … und du und Carly auch.«
In diesem Moment wusste ich, warum sie gesagt hatte, dass dies schwierig werden würde. »Ihr möchtet, dass wir uns für einen von euch entscheiden.«
»Ich möchte, dass ihr die Wahrheit sagt«, erwiderte sie mit fester Stimme. »Was dein Vater will, weiß ich nicht.«
Aber ich wusste es. Er würde wollen, dass ich meine Mom verunglimpfe, dass ich sage, sie sei ungeeignet, nur eine Hausfrau, die nebenbei Autos repariere und keinem Vergleich mit einem ernsthaften Akademiker wie ihm standhalte, der Zoe eine breite Ausbildung und kulturelle Erfahrungen bieten würde. Er würde wollen, dass ich es zum Wohle der Alchemisten täte. Er würde es wollen, einfach darum, weil er immer seinen Willen bekam.
»Ich liebe und unterstütze das, was du für richtig hältst.« Die Tapferkeit in der Stimme meiner Mom brach mir das Herz. Sie würde sich mit mehr als familiären Komplikationen auseinandersetzen müssen. Die Alchemisten hatten weitreichende Beziehungen, möglicherweise sogar bis hinein in die Rechtsprechung. »Ich wollte nur, dass du vorbereitet bist. Ich bin mir sicher, dass dein Vater auch mit dir sprechen wollen wird.«
»Ja«, sagte ich finster. »Das wird er bestimmt. Aber was ist mit dir? Bist du okay?« Ich ließ Zoe beiseite und musste zugeben, wie sehr diese ganze Sache das Leben meiner Mom verändern würde. Auch wenn ihre Ehe qualvoll geworden sein mochte, waren sie doch seit fast fünfundzwanzig Jahren zusammen. So etwas aufzugeben war eine große Umstellung, ganz gleich unter welchen Umständen.
Ich konnte spüren, dass sie lächelte. »Mir geht es gut. Ich wohne bei einer Freundin. Und ich habe Cicero mitgenommen.«
Der Gedanke daran, dass sie unsere Katze entführt hatte, brachte mich zum Lachen, trotz des ernsten Gespräches. »Wenigstens hast du Gesellschaft.«
Sie lachte auch, aber das Lachen hatte etwas Zerbrechliches. »Und das Auto meiner Freundin muss repariert werden, also sind wir alle glücklich.«
»Nun, das freut mich, aber wenn es irgendetwas gibt, das du brauchst, egal was, Geld oder …«
»Mach dir um mich keine Sorgen. Kümmere dich nur um dich selbst – und um Zoe. Das ist im Moment das Wichtigste.« Sie zögerte. »Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen … geht es ihr denn gut?«
Das hing vermutlich davon ab, wie man »gut« definierte. Zoe fand es toll, dass sie das Alchemistenhandwerk vor Ort erlernte, obwohl sie noch so jung war, aber sie verhielt sich meinen Freunden gegenüber kalt und arrogant – genau wie alle anderen in unserer Organisation. Außerdem hing sie wie ein ständiger, bedrohlicher Schatten über meinem Liebesleben.
»Es geht ihr prima«, versicherte ich meiner Mom.
»Gut«, sagte sie, und ihre Erleichterung war fast mit Händen zu greifen. »Ich bin froh, dass du bei ihr bist. Ich weiß nicht, wie sie das aufnehmen wird.«
»Ich bin mir sicher, sie wird deinen Standpunkt verstehen.«