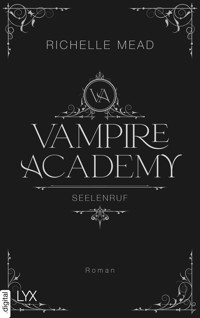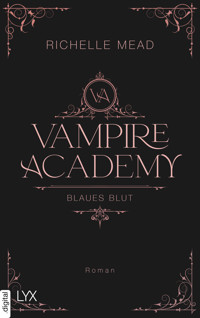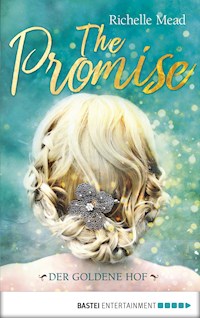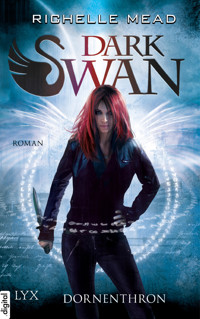11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Bloodlines-Reihe
- Sprache: Deutsch
Für Sydney Sage ist ihr schlimmster Albtraum Realität geworden. Durch den Verrat ihrer Schwester Zoe ist sie nun die Gefangene der Alchemisten. Denn Sydney hat das größte Tabu der Alchemisten gebrochen: Sie hat sich auf eine Liebesbeziehung mit einem Vampir eingelassen und mit Rebellen gemeinsame Sache gemacht. Ist ihre Magie stark genug, um sie vor der Gehirnwäsche durch ihre eigenen Leute zu schützen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Die Autorin
Die Romane von Richelle Mead bei LYX
Impressum
RICHELLE MEAD
BLOODLINES
SILBERSCHATTEN
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Michaela Link
Zu diesem Buch
Nach dem schweren Verrat durch ihre Schwester Zoe ist für Sydney nichts mehr, wie es war. Ihr schlimmster Albtraum ist bittere Realität geworden: Sydney ist in der Gewalt der Alchemisten und täglichen Demütigungen ausgesetzt mit dem Ziel, ihre Beziehung zu den Moroi und insbesondere ihre Liebe zu Adrian zu zerstören. Adrian versucht ebenfalls, gegen alle Widerstände weiter an seiner Liebe zu Sydney festzuhalten, auch wenn die ganze Welt sich gegen sie verschworen zu haben scheint. Doch der Kampf wirkt aussichtslos. Aus Verzweiflung darüber, dass er seiner geliebten Sydney nicht helfen kann, sucht er erneut Trost im Alkohol. Und dann tritt auch noch eine neue Frau in sein Leben … Können Sydney und Adrian ihre schwerste Krise überstehen und wieder einen Weg zueinander finden?
Für die #VAFamilie
KAPITEL 1
SYDNEY
Ich erwachte im Dunkeln.
Das war allerdings nichts Neues, da ich seit … ich wusste nicht, seit wie vielen Tagen ich schon im Dunkeln aufgewacht war. Es konnten Wochen oder sogar Monate gewesen sein. Ich hatte in dieser kleinen, kalten Zelle – mit nur einem rauen Steinboden als Bett – jedes Zeitgefühl verloren. Es war unmöglich, die Tage zu zählen, weil meine Wärter mich entweder mit einer Droge wach hielten oder mich schlafen ließen, ganz wie es ihnen gefiel. Einige Zeit lang war ich mir sicher gewesen, dass sie mir etwas ins Essen oder ins Wasser taten, daher war ich in einen Hungerstreik getreten. Das Einzige, was mir das gebracht hatte, war eine Zwangsernährung – was ich nie, nie wieder erleben möchte. Und der Droge entkam ich dadurch auch nicht. Schließlich war mir klar geworden, dass sie sie durch das Lüftungssystem in die Zelle strömen ließen, und anders als beim Essen konnte ich ja schließlich nicht in einen Atemstreik treten.
Für eine Weile hatte ich dann die abstruse Idee gehabt, meinen Menstruationszyklus als Zeitmesser zu nehmen, so wie sich Frauen in primitiven Gesellschaften am Mond orientiert hatten. Meine Wärter, Verfechter von Sauberkeit und Effizienz, hatten für diesen Fall sogar weibliche Hygieneprodukte bereitgestellt. Doch auch dieser Plan scheiterte. Da ich durch meine Gefangennahme die Pille plötzlich nicht mehr nehmen konnte, hatten sich meine Hormone neu eingestellt und meinen Körper in unregelmäßige Zyklen gestürzt, die es unmöglich machten, irgendetwas zu messen, vor allem in Kombination mit meinem verrückten Schlafrhythmus. So konnte ich mir allerdings sicher sein, dass ich nicht schwanger war – eine gewaltige Erleichterung. Hätte ich auch noch Angst um Adrians Kind haben müssen, hätten die Alchemisten eine schier unbegrenzte Macht über mich gehabt. Aber in diesem Körper gab es nur mich allein, und ich konnte alles aushalten, Hunger, Kälte, egal was. Ich weigerte mich, mich von ihnen brechen zu lassen.
»Haben Sie über Ihre Sünden nachgedacht, Sydney?«
Die metallische Frauenstimme hallte durch die winzige Zelle und schien aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen. Ich richtete mich in eine sitzende Position auf und zog mir das grobe Hemd über die Knie. Das war reine Gewohnheit. Das ärmellose Kleidungsstück war so papierdünn, dass es nicht die geringste Wärme bot. Es vermittelte lediglich ein Anstandsgefühl. Sie hatten es mir irgendwann während meiner Gefangenschaft gegeben und behauptet, es sei ein Zeichen guten Willens. In Wirklichkeit denke ich aber, dass die Alchemisten einfach nicht ertragen konnten, mich nackt zu lassen, vor allem als sie sahen, dass es mir nicht so zusetzte, wie sie gehofft hatten.
»Ich habe geschlafen«, antwortete ich und unterdrückte ein Gähnen. »Keine Zeit zum Nachdenken.« Von den Drogen in der Luft schien ich ständig müde zu sein, aber sie bliesen offenbar auch irgendeine Art von Aufputschmittel herein, das dafür sorgte, dass ich wach blieb, wenn sie es wollten, egal wie erschöpft ich sein mochte. Das Ergebnis war: Ich fühlte mich nie vollkommen ausgeruht – was natürlich ihre Absicht war. Psychologische Kriegsführung funktionierte am besten, wenn der Geist müde war.
»Haben Sie geträumt?«, fragte die Stimme. »Haben Sie von Erlösung geträumt? Haben Sie davon geträumt, wie es wäre, wieder das Licht zu sehen?«
»Sie wissen, dass ich das nicht getan habe.« Heute war ich ungewöhnlich redselig. Sie stellten mir diese Fragen ständig, und manchmal blieb ich einfach stumm. »Aber wenn Sie mal eine Weile damit aufhören würden, mir dieses Beruhigungsmittel zu verabreichen, würde ich vielleicht ein bisschen richtigen Schlaf bekommen und Träume haben, über die wir uns unterhalten können.«
Wichtiger noch, richtigen Schlaf ohne diese Drogen zu bekommen bedeutete, dass Adrian mich in meinen Träumen aufspüren und mir helfen konnte, einen Weg aus diesem Höllenloch zu finden.
Adrian.
Allein sein Name hatte mich viele lange, dunkle Stunden durchstehen lassen. Gedanken an ihn, an unsere Vergangenheit und unsere Zukunft, halfen mir, meine Gegenwart zu überleben. Ich verlor mich oft in Tagträumen und dachte an die Handvoll Monate zurück, die wir zusammen gehabt hatten. War es wirklich so kurz gewesen? In meinen neunzehn Jahren erschien mir nichts so lebendig oder bedeutungsvoll wie die Zeit, die ich gemeinsam mit ihm verbracht hatte. Meine Tage waren ausgefüllt mit Gedanken an ihn. Im Geiste ging ich jede kostbare Erinnerung durch, die schönen und die herzzerreißenden, und wenn ich sie alle durchhatte, fantasierte ich über die Zukunft. Ich durchlebte all die möglichen Szenarien, die wir uns für uns selbst ausgemalt hatten, all diese dummen »Fluchtpläne«.
Adrian.
Er war der Grund, warum ich in diesem Gefängnis überleben konnte.
Und er war auch der Grund, warum ich überhaupt hier war.
»Sie brauchen Ihr Unterbewusstsein nicht, um sich zu sagen, was Ihr Bewusstsein bereits weiß«, erklärte mir die Stimme. »Sie sind verdorben und unrein. Ihre Seele ist in Dunkelheit gehüllt, und Sie haben sich gegen Ihre eigene Art versündigt.«
Ich seufzte über diese alten Phrasen und veränderte meine Position, versuchte, es mir bequemer zu machen, obwohl das ein aussichtsloser Kampf war. Meine Muskeln waren schon seit einer Ewigkeit steif geworden. An Bequemlichkeit war unter diesen Bedingungen nicht zu denken.
»Es muss Sie doch traurig machen«, fuhr die Stimme fort, »zu wissen, dass Sie Ihrem Vater das Herz gebrochen haben.«
Das war jetzt eine neue Herangehensweise, die mich derart überrumpelte, dass ich ohne nachzudenken erwiderte: »Mein Vater hat kein Herz.«
»Oh doch, Sydney. Oh doch.« Wenn ich mich nicht täuschte, klang die Stimme ein wenig erfreut darüber, mich aus der Reserve gelockt zu haben. »Er bedauert Ihren Absturz zutiefst. Vor allem, nachdem Sie uns und unserem Kampf gegen das Böse so vielversprechend erschienen waren.«
Ich rutschte ein Stück, sodass ich mich gegen die grob behauene Wand lehnen konnte. »Na ja, er hat noch eine andere Tochter, die jetzt deutlich vielversprechender ist als ich, also wird er bestimmt darüber hinwegkommen.«
»Sie haben auch ihr das Herz gebrochen. Beide sind betrübter, als Sie ahnen. Wäre es nicht schön, sich mit ihnen zu versöhnen?«
»Bieten Sie mir diese Möglichkeit an?«, fragte ich vorsichtig.
»Wir haben Ihnen diese Möglichkeit von Anfang an geboten, Sydney. Sie brauchen es nur zu sagen, und wir werden Ihren Weg zur Erlösung mit Freuden vorbereiten.«
»Wollen Sie damit sagen, dies sei kein Teil davon gewesen?«
»Dies war Teil der Bemühung, Ihnen zu helfen, Ihre Seele zu reinigen.«
»Klar«, sagte ich. »Sie helfen mir mit Hunger und Demütigung.«
»Möchten Sie Ihre Familie sehen oder nicht? Wäre es nicht schön, sich mit ihnen zusammenzusetzen und gemeinsam zu sprechen?«
Ich gab keine Antwort und versuchte stattdessen zu enträtseln, was hier für ein Spiel gespielt wurde. Die Stimme hatte mir im Laufe meiner Gefangenschaft viele Dinge angeboten, die meisten davon betrafen das leibliche Wohl – Wärme, ein weiches Bett, richtige Kleidung. Man hatte mir auch andere Belohnungen genannt, wie die Kette mit dem Kreuz, die Adrian für mich gemacht hatte, und Essen, das nahrhafter und appetitlicher war als der Haferschleim, mit dem sie mich gegenwärtig am Leben erhielten. Sie hatten sogar versucht, mich mit dem Schleim in Versuchung zu führen, indem sie Kaffeeduft in die Zelle einströmen ließen. Irgendjemand – wahrscheinlich diese Familie, der so viel an mir lag – musste ihnen einen Tipp gegeben haben, was meine Vorlieben betraf.
Aber dies … die Möglichkeit, mit Menschen zu reden, das war etwas ganz Neues. Zugegeben, Zoe und mein Dad standen nicht gerade ganz oben auf der Liste der Leute, die ich jetzt gern sehen würde, aber mich interessierte auch der größere Rahmen, der zu dem Angebot der Alchemisten gehörte: ein Leben außerhalb dieser Zelle.
»Was müsste ich tun?«, fragte ich.
»Das haben Sie die ganze Zeit über gewusst«, antwortete die Stimme. »Ihre Schuld eingestehen. Beichten Sie Ihre Sünden und geben Sie ein Zeichen, dass Sie bereit sind, sich reinzuwaschen.«
Ich hätte beinahe gesagt: Ich habe nichts zu beichten. Das hatte ich ihnen schon hundert Mal gesagt. Vielleicht sogar tausend Mal. Aber ich war immer noch fasziniert. Eine Begegnung mit anderen Menschen bedeutete, dass sie dieses Gift in der Luft ausschalten mussten … nicht wahr? Und wenn ich dem entkommen könnte, könnte ich träumen …
»Ich sage einfach diese Worte, und dann darf ich meine Familie sehen?«
Die Stimme klang herablassend. »Natürlich nicht gleich. Sie müssen es sich erst verdienen. Aber Sie wären in der Lage, zum nächsten Stadium Ihrer Heilung überzugehen.«
»Umerziehung«, sagte ich.
»So, wie Sie es ausdrücken, klingt es wie etwas Schlechtes«, erwiderte die Stimme. »Wir tun das alles nur, um Ihnen zu helfen.«
»Nein danke«, stellte ich fest. »Ich gewöhne mich gerade an diese Zelle. Es wäre furchtbar schade, sie zu verlassen.«
Einmal das, und dann wusste ich, dass mit der Umerziehung erst die wahre Folter begann. Sicher, sie würde körperlich vielleicht nicht so belastend sein wie dies hier, aber da würden sie sich erst richtig auf die Gedankenkontrolle konzentrieren. Diese harten Bedingungen waren Absicht, damit ich mich schwach und hilflos fühlte und beeinflussbar wäre, wenn sie versuchten, mich in der Umerziehung einer Gehirnwäsche auszusetzen. Damit ich ihnen dankbar dafür wäre.
Und doch wurde ich den Gedanken nicht mehr los, dass ich vielleicht wieder normal schlafen und träumen könnte, wenn ich die Zelle verließe. Wenn ich diesen Kontakt zu Adrian herstellen könnte, würde sich vielleicht alles verändern. Zumindest würde ich wissen, dass es ihm gut geht … falls ich die Umerziehung selbst überlebte. Ich könnte Vermutungen über die Art der psychologischen Manipulation anstellen, die sie bei mir versuchen würden, aber ich wusste es nicht mit Bestimmtheit. Würde ich das aushalten? Könnte ich bei Verstand bleiben, oder könnten sie mich so manipulieren, dass ich all meinen Prinzipien untreu würde und mich gegen die Menschen wendete, die ich liebte? Das war das Risiko, das ich beim Verlassen dieser Zelle eingehen würde. Außerdem wusste ich, dass den Alchemisten genügend Drogen und Tricks zur Verfügung standen, damit ihre Befehle »hängen blieben«, sozusagen, und obwohl ich wahrscheinlich dank regelmäßiger Magiebenutzung in der Zeit vor meiner Gefangennahme gegen sie geschützt war, nagte die Furcht an mir, ich könnte trotzdem anfällig sein. Der einzige sichere Schutz vor ihrem Zwang, den ich kannte, war ein Trank, den ich einmal gebraut und bei einem Freund erfolgreich eingesetzt hatte – aber nicht bei mir selbst.
Weitere Grübeleien wurden auf Eis gelegt, als ich spürte, wie mich die Müdigkeit befiel. Anscheinend war dieses Gespräch jetzt vorbei. Ich war inzwischen so klug, nicht dagegen anzukämpfen, und streckte mich auf dem Boden aus, ließ mich in einen dicken, traumlosen Schlaf sinken, einen Schlaf, der jeden Gedanken an Freiheit begrub. Aber bevor mir die Droge das Bewusstsein raubte, sagte ich im Geist noch seinen Namen, um stark zu bleiben.
Adrian …
Ich wachte später wieder auf, zu einer unbestimmten Zeit, und stellte fest, dass man mir etwas zu essen in die Zelle gebracht hatte. Es war der übliche Brei, irgendeine Art von heißem Fertigzeug, das wahrscheinlich mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert worden war, damit ich gesund blieb, sofern man da von Gesundheit sprechen konnte. Es als »heißes Zeug« zu bezeichnen, wäre jedoch etwas hoch gegriffen. »Lauwarm« war treffender. Sie mussten es so unappetitlich wie möglich machen. Geschmacklos oder nicht, ich aß automatisch, denn ich wusste, dass ich meine Kräfte brauchen würde, wenn ich hier herauskam.
Falls ich hier herauskomme.
Der verräterische Gedanke befiel mich, bevor ich ihn aufhalten konnte. Es war eine alte Furcht, die an mir genagt hatte, die erschreckende Möglichkeit, dass sie mich für immer hierbehalten könnten und ich nie wieder einen der Menschen sehen würde, die ich liebte – nicht Adrian, nicht Eddie, nicht Jill, keinen von ihnen. Ich würde nie wieder Magie praktizieren. Ich würde auch niemals wieder ein Buch lesen. Dieser letzte Gedanke traf mich heute besonders hart, denn so sehr mir meine Tagträume von Adrian auch durch diese dunklen Stunden halfen, ich hätte morden können, um etwas so Banales wie einen Schundroman zum Lesen zu bekommen. Schon mit einer Zeitschrift oder einer Broschüre wäre ich zufrieden gewesen. Alles, nur nicht diese Dunkelheit und diese Stimme.
Sei stark, sagte ich mir. Sei stark für dich selbst. Und sei stark für Adrian. Täte er für dich nicht das Gleiche?
Ja, das würde er. Wo immer er war, ob er sich noch in Palm Springs oder woanders befand, ich wusste, dass Adrian mich niemals aufgeben würde, und ich musste mich entsprechend verhalten. Ich musste bereit sein für den Tag, an dem wir wieder zusammenkommen würden. An dem wir wieder vereint wären.
Centrum permanebit. Die lateinischen Worte gingen mir durch den Kopf und gaben mir Kraft. Übersetzt bedeuteten sie: »Die Mitte hält«. Sie waren von einem Gedicht abgeleitet, das Adrian und ich gelesen hatten. Wir sind jetzt die Mitte, dachte ich. Und er und ich werden halten, was auch geschieht.
Ich beendete mein dürftiges Mahl und tastete mich im Dunkeln zu dem kleinen Becken hinüber. Es war in der Ecke der Zelle neben einer Toilette angebracht, und ich versuchte mich dort flüchtig zu waschen. Ein richtiges Bad oder eine Dusche kamen nicht infrage (obwohl sie auch das zuvor als Köder benutzt hatten), und ich musste mich täglich (oder was ich für täglich hielt) mit einem rauen Waschlappen und kaltem Wasser säubern, das nach Rost roch. Es war demütigend zu wissen, dass sie mich mit ihren Nachtsichtkameras beobachteten, aber es schien mir immer noch würdevoller, als schmutzig zu bleiben. Diese Befriedigung würde ich ihnen nicht geben. Ich wollte menschlich bleiben, auch wenn genau dies der Vorwurf war, zu dem sie mich befragten.
Als ich sauber genug war, rollte ich mich wieder an der Wand zusammen. Meine Haut war noch nass, und ich zitterte in der kalten Luft so stark, dass mir die Zähne klapperten. Würde mir je wieder warm werden?
»Wir haben mit Ihrem Vater und Ihrer Schwester gesprochen, Sydney«, sagte die Stimme. »Sie waren sehr traurig zu hören, dass Sie sie nicht sehen möchten. Zoe hat geweint.«
Ich wand mich innerlich und bereute, dass ich beim letzten Mal mitgespielt hatte. Die Stimme dachte jetzt natürlich, dass diese Familientaktik ein gutes Druckmittel sei. Wie konnten sie annehmen, dass ich Kontakt zu den Menschen haben wollte, die mich hier eingesperrt hatten? Die einzigen Familienmitglieder, die ich vielleicht hätte sehen wollen – meine Mom und meine ältere Schwester – standen wahrscheinlich gar nicht auf der Besucherliste, vor allem wenn mein Dad bei der Scheidung seinen Willen bekommen hatte. Wie das ausgegangen war, hätte ich tatsächlich gern gewusst, aber das würde ich niemals zugeben.
»Bedauern Sie den Schmerz nicht, den Sie ihnen zugefügt haben?«, fragte die Stimme.
»Ich finde eher, Zoe und Dad sollten den Schmerz bedauern, den sie mir zugefügt haben«, blaffte ich zurück.
»Sie wollten Ihnen keinen Schmerz zufügen.« Die Stimme versuchte, besänftigend zu klingen, aber ich wollte vor allem denjenigen schlagen, der dahinter steckte – und ich war normalerweise kein Mensch, der zur Gewalt neigte. »Sie haben es nur getan, um Ihnen zu helfen. Mehr wollen auch wir gar nicht. Sie würden sich sehr darüber freuen, wenn sie mit Ihnen sprechen und sich rechtfertigen könnten.«
»Davon bin ich überzeugt«, murmelte ich. »Falls Sie überhaupt mit ihnen geredet haben.« Ich hasste mich dafür, dass ich mich mit meinen Wärtern unterhielt. Seit einer ganzen Zeit hatte ich schon nicht mehr mit ihnen gesprochen. Sie mussten es genießen.
»Zoe hat uns gefragt, ob es okay sei, dass sie Ihnen einen Vanilla Latte mit fettarmer Milch mitbringt, wenn sie Sie besucht. Wir haben das bejaht. Wir sind sehr für einen höflichen Besuch, dafür dass Sie sich gemeinsam hinsetzen und miteinander sprechen, damit Ihre Familie und vor allem Ihre Seele heilen kann.«
Mein Herz schlug schnell, aber das hatte nichts mit der Verlockung des Kaffees zu tun. Die Stimme bestätigte einmal mehr, was bereits angedeutet worden war. Ein richtiger Besuch, bei dem man sich hinsetzt und Kaffee trinkt … das musste aber außerhalb dieser Zelle stattfinden. Wenn diese Fantasie auch nur ansatzweise zutraf, dann würden sie meinen Dad und Zoe niemals hierherbringen – nicht dass es mein Ziel wäre, sie zu sehen. Mein Ziel war es, hier rauszukommen. Ich behauptete immer noch, dass ich ewig hierbleiben könne, dass ich aushalten könne, was immer sie mir antaten. Und ich konnte es sicher. Aber was erreichte ich damit? Ich bewies nur meine Zähigkeit und meinen Trotz, worauf ich zwar stolz war, was mich Adrian aber nicht näher brachte. Um zu Adrian zu kommen, um über ihn auch zu meinen anderen Freunden zu kommen … musste ich träumen. Um zu träumen, musste ich die Betäubung durch die ständig verabreichten Drogen abschütteln.
Und nicht nur das. Wenn ich mich nicht mehr in einer kleinen, dunklen Zelle befand, würde ich vielleicht wieder Magie wirken können. Ich würde eventuell sogar einen Hinweis darauf erhalten, wo sie mich hingebracht hatten. Und dann würde ich mich vielleicht befreien können.
Aber zuerst musste ich aus dieser Zelle herauskommen. Ich hatte gedacht, es sei tapfer hierzubleiben, aber plötzlich fragte ich mich, ob die wahre Mutprobe nicht vielmehr darin bestünde herauszukommen.
»Würde Ihnen das gefallen, Sydney?« Wenn ich mich nicht irrte, schwang in der Stimme ein aufgeregter Unterton mit – sie klang beinahe eifrig. Das stand im Gegensatz zu dem hochmütigen und herrischen Ton, an den ich mich gewöhnt hatte. Sie hatten noch nie so viel Interesse bei mir entfacht. »Würden Sie gern die ersten Schritte zur Reinigung Ihrer Seele unternehmen – und Ihre Familie sehen?«
Wie lange hatte ich schon in dieser Zelle geschmachtet und immer wieder das Bewusstsein verloren? Wenn ich mich am Leib und an den Armen abtastete, merkte ich, dass ich stark abgenommen hatte, und ein solcher Gewichtsverlust dauerte Wochen. Wochen, Monate … ich hatte keine Ahnung. Und während ich hier war, drehte sich die Welt ohne mich weiter – eine Welt voller Leute, die mich brauchten.
»Sydney?«
Um nicht zu eifrig zu klingen, versuchte ich, sie hinzuhalten. »Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Dass Sie mir erlauben, meine Familie zu sehen, falls ich … diese Reise antrete?«
»Bosheit und Täuschung sind nicht unsere Art«, entgegnete die Stimme. »Wir schätzen das Licht und die Aufrichtigkeit.«
Lügner, Lügner, dachte ich. Sie hatten mich jahrelang belogen und mir eingeredet, gute Menschen seien Ungeheuer, und versucht mir vorzuschreiben, wie ich mein Leben zu leben hatte. Aber es spielte keine Rolle. Was meine Familie betraf, konnten sie ihr Wort halten oder nicht.
»Werde ich … ein richtiges Bett bekommen?« Es gelang mir, meine Stimme ein wenig erstickt klingen zu lassen. Die Alchemisten hatten eine hervorragende Schauspielerin aus mir gemacht, und jetzt würden sie die praktische Umsetzung ihrer Ausbildung erleben.
»Ja, Sydney. Ein richtiges Bett, richtige Kleider, richtiges Essen. Und Leute zum Reden – Leute, die Ihnen helfen werden, wenn Sie ihnen nur zuhören wollen.«
Der letzte Teil besiegelte den Deal. Wenn ich regelmäßig mit anderen zusammen war, konnten sie die Luft nicht weiter mit Drogen versetzen. Jetzt gerade fühlte ich mich besonders wach und erregt. Sie bliesen dieses Aufputschmittel herein, von dem ich ungeduldig wurde und überstürzt handeln wollte. Bei einem müden und erschöpften Geist war das ein guter Trick, und er funktionierte – nur nicht so, wie sie es erwartet hatten.
Aus alter Gewohnheit legte ich eine Hand auf mein Schlüsselbein und berührte ein Kreuz, das nicht mehr da war. Lass nicht zu, dass sie mich verändern, betete ich stumm. Lass mich bei Verstand bleiben. Lass mich aushalten, was immer kommt.
»Sydney?«
»Was muss ich tun?«, fragte ich.
»Sie wissen, was Sie tun müssen«, antwortete die Stimme. »Sie wissen, was Sie sagen müssen.«
Ich legte mir die Hände aufs Herz, und meine nächsten inneren Worte waren kein Gebet, sondern eine stumme Botschaft an Adrian: Warte auf mich. Sei stark, und ich werde auch stark sein. Ich werde mich aus allem herauskämpfen, was sie mir in den Weg stellen. Ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nie verlassen, ganz gleich, welche Lügen ich ihnen erzählen muss. Unsere Mitte wird halten.
»Sie wissen, was Sie sagen müssen«, wiederholte die Stimme. Sie geiferte förmlich.
Ich räusperte mich. »Ich habe mich gegen meine Art versündigt und zugelassen, dass meine Seele verdorben wurde. Ich bin bereit, von der Dunkelheit reingewaschen zu werden.«
»Und was sind Ihre Sünden?«, verlangte die Stimme zu erfahren. »Beichten Sie, was Sie getan haben.«
Das war zwar schwerer, aber es gelang mir trotzdem, es auszusprechen. Wenn es mich näher an Adrian und die Freiheit heranbrachte, konnte ich alles sagen.
Also holte ich tief Luft und sagte: »Ich habe mich in einen Vampir verliebt.«
Und einfach so wurde ich von Licht geblendet.
KAPITEL 2
ADRIAN
Versteh das nicht falsch, aber du siehst scheiße aus.«
Ich hob den Kopf vom Tisch und öffnete blinzelnd ein Auge. Selbst mit Sonnenbrille – im Haus – war das Licht fast immer noch zu viel für das Hämmern in meinem Kopf. »Ach ja?«, fragte ich. »Was kann man daran falsch verstehen?«
Rowena Clark bedachte mich mit einem gebieterischen Blick, der von Sydney hätte stammen können. Mein Herz machte einen Satz. »Sieh es konstruktiv.« Rowena rümpfte die Nase. »Du hast doch einen Kater, oder? Denn das impliziert schließlich, dass du irgendwann nüchtern gewesen bist. Und nach der ganzen Gin-Fabrik zu schließen, die ich riechen kann, bin ich mir da nicht so sicher.«
»Ich bin nüchtern. Fast.« Ich wagte es, die Sonnenbrille abzunehmen, um sie besser anschauen zu können. »Dein Haar ist blau.«
»Petrol«, korrigierte sie mich und berührte es verlegen. »Und du hast es schon vor zwei Tagen gesehen.«
»Wirklich?« Vor zwei Tagen hieße bei unserem letzten Kurs in Mischtechnik hier am Carlton College. Ich konnte mich kaum an etwas erinnern, das vor zwei Stunden geschehen war. »Hm. Wahrscheinlich war ich da nicht so nüchtern. Aber es sieht schön aus«, fügte ich hinzu, in der Hoffnung, dass sie mich dafür ein wenig mit ihrer Missbilligung verschonen würde. Sie tat es nicht.
In Wahrheit war ich in letzter Zeit etwa die Hälfte der Tage am College nüchtern. Doch wenn man bedachte, dass ich es überhaupt in den Kurs geschafft hatte, fand ich, dass ich durchaus ein wenig Lob verdient hatte. Als Sydney gegangen war – nein, entführt worden war –, hatte ich nicht hierherkommen wollen. Ich wollte nicht irgendwo hingehen oder irgendetwas tun, das nicht dem Ziel diente, sie zu finden. Ich hatte mich tagelang im Bett verschanzt, hatte gewartet und mit Geist die Welt der Träume nach ihr durchgesucht. Nur dass ich keine Verbindung hatte herstellen können. Egal zu welcher Tageszeit ich es versuchte, sie schien nie zu schlafen. Es ergab einfach keinen Sinn. Niemand konnte so lange wach bleiben. Es war schwer, Kontakt zu Betrunkenen herzustellen, da Alkohol die Wirkung von Geist schwächte und den Verstand blockierte, aber irgendwie bezweifelte ich, dass sie und ihre Alchemisten-Wärter ständig Cocktailpartys feierten.
Ich hätte vielleicht an mir und meinen Fähigkeiten gezweifelt, vor allem nachdem ich für eine Weile Medikamente eingenommen hatte, um Geist auszuschalten. Aber irgendwann war meine Magie mit voller Gewalt zurückgekommen, und ich hatte keine Probleme, andere in ihren Träumen zu erreichen. Ich mag in vieler Hinsicht lebensuntüchtig sein, aber ich war zweifellos noch immer der begabteste traumwandelnde Geistbenutzer, den ich kannte. Das Problem war allerdings, dass ich nur wenige andere Geistbenutzer kannte. Von daher hörte ich auch nicht viele Meinungen darüber, warum ich Sydney nicht erreichte. Alle Moroi-Vampire benutzen irgendeine Art von Elementarmagie. Die meisten spezialisieren sich auf eines der vier physikalischen Elemente: Erde, Luft, Wasser oder Feuer. Nur eine Handvoll von uns benutzt Geist, und anders als für die anderen Elemente gibt es dafür keine gut dokumentierte Geschichte. Zwar gab es zahlreiche Theorien, aber niemand wusste mit Bestimmtheit, warum ich Sydney nicht erreichte.
Der Assistent meiner Professorin warf mir einen Packen getackerter Blätter zu. Den gleichen Packen bekam auch Rowena hingeworfen. Das riss mich aus meinen Gedanken. »Was ist das?«
»Ähm, deine Abschlussprüfung«, antwortete Rowena und verdrehte die Augen. »Lass mich raten. An die erinnerst du dich auch nicht? Oder daran, dass ich angeboten hatte, mit dir zu lernen?«
»Muss an einem meiner schlechten Tage gewesen sein«, murmelte ich und blätterte mit einem unguten Gefühl in den Seiten.
Rowenas tadelnder Ausdruck verwandelte sich in einen des Mitgefühls, aber was immer sie sonst noch gesagt haben mochte, ging in den Befehlen unserer Professorin unter, ruhig zu sein und uns an die Arbeit zu machen. Ich starrte auf das Examen und fragte mich, ob ich mich da durchmogeln konnte. Dass ich mich aus dem Bett und zurück ins College geschleppt hatte, lag zum Teil daran, dass ich wusste, wie viel Sydney meine Ausbildung bedeutete. Sie war immer neidisch auf die Möglichkeit gewesen, die ich hatte, eine Möglichkeit, die ihr kontrollsüchtiges Arschloch von einem Dad ihr verweigert hatte. Als ich begriffen hatte, dass ich sie nicht sofort finden konnte – und glaubt mir, neben den magischen hatte ich es mit jeder Menge weltlicher Methoden versucht –, hatte ich für mich beschlossen weiterzumachen und das zu tun, was sie gewollt hätte: Ich wollte dieses Semester im College beenden.
Zugegeben, ich war nicht der eifrigste Schüler gewesen. Da die meisten meiner Seminare Grundkurse in Kunst waren, vergaben meine Dozenten im Allgemeinen Leistungspunkte, solange man überhaupt irgendetwas abgab. Das war ein großes Glück für mich, denn »irgendetwas« war vermutlich die netteste Beschreibung für einige der Machwerke, die ich in letzter Zeit geschaffen hatte. Ich hatte immer gerade so bestanden, aber dieses Examen jetzt würde vielleicht mein Untergang sein. Bei diesen Fragen hieß es alles oder nichts, richtig oder falsch. Ich konnte nicht einfach halbherzig eine Zeichnung oder ein Gemälde hinschludern und auf Punkte für diese Mühe zählen.
Als ich anfing, nach bestem Vermögen Fragen über Umrisszeichnungen und dekonstruierte Landschaften zu beantworten, spürte ich, wie mich eine dunkle Depression herunterzog. Und es lag nicht nur daran, dass ich in dem Kurs wahrscheinlich durchfallen würde. Ich würde auch Sydney und ihre hohen Erwartungen an mich enttäuschen. Aber ernsthaft, was war schon ein Kurs, wenn ich sie vorher so oft auf andere Weise enttäuscht hatte? Wären unsere Rollen vertauscht gewesen, hätte sie mich wahrscheinlich längst gefunden. Sie war klüger und einfallsreicher. Sie hätte etwas Außergewöhnliches tun können. Und ich kam nicht mal mit dem Gewöhnlichen klar.
Eine Stunde später gab ich die Klausur ab und hoffte, dass ich nicht gerade ein komplettes Semester verschwendet hatte. Rowena war früh fertig geworden und wartete draußen vor dem Seminarraum auf mich. »Möchtest du was essen?«, fragte sie. »Du bist eingeladen.«
»Nein danke. Ich muss mich mit meiner Cousine treffen.«
Rowena beäugte mich argwöhnisch. »Du fährst doch nicht etwa selbst, oder?«
»Ich bin jetzt nüchtern, herzlichen Dank«, antwortete ich. »Aber wenn du dich dann besser fühlst, nein, ich nehme lieber den Bus.«
»Dann war es das wohl, oder? Letzter Unterrichtstag.«
Vermutlich hatte sie recht, stellte ich bestürzt fest. Ich hatte zwar noch zwei andere Kurse, aber dieser war mein einziger Kurs mit ihr. »Wir werden uns bestimmt wiedersehen«, sagte ich tapfer.
»Das hoffe ich«, antwortete sie mit sorgenvollem Blick. »Du hast meine Nummer. Oder zumindest hattest du sie mal. Ich werde diesen Sommer hier sein. Ruf mich und Cassie an, falls du was unternehmen möchtest … oder wenn du über irgendetwas reden willst … ich weiß, dass du in letzter Zeit mit einigen heftigen Problemen zu kämpfen hattest …«
»Ich habe schon schlimmere gehabt«, log ich. Sie hatte keine Ahnung, und als normaler Mensch konnte sie es auch nicht wissen. Ich wusste, dass sie dachte, Sydney habe mit mir Schluss gemacht, und Rowenas Mitleid brachte mich um. Ich konnte sie jedoch kaum korrigieren. »Und ich melde mich auf jeden Fall, also bleib lieber neben deinem Telefon sitzen. Man sieht sich, Ro.«
Halbherzig winkte sie mir zu, als ich zur nächsten Bushaltestelle auf den Campus ging. Sie war nicht weit entfernt, aber als ich sie erreichte, schwitzte ich. Es war Mai in Palm Springs, und unser kurzer Frühling wurde von dem heißen und drückenden Herannahen des Sommers überrollt. Ich setzte die Sonnenbrille wieder auf, während ich wartete, und versuchte, das Hipster-Pärchen zu ignorieren, das rauchend neben mir stand. Zigaretten waren ein Laster, zu dem ich nicht zurückgekehrt war, seit Sydney fort war, aber manchmal fiel es schwer. Sehr schwer.
Um mich abzulenken, öffnete ich meine Tasche und spähte hinein, betrachtete eine kleine, goldene Drachenfigur. Ich legte ihm die Hand auf den Rücken und spürte seine winzigen Schuppen. Kein Künstler hätte ein so perfektes Kunstwerk erschaffen können – und zwar, weil das gar keine Skulptur war. Es war ein echter Drache – na ja, ein Callistana, um genau zu sein, eine Art wohlwollender Dämon –, den Sydney beschworen hatte. Er hatte eine Bindung zu ihr und zu mir aufgebaut, aber nur sie besaß die Fähigkeit, ihn jeweils in seine lebendige oder starre Form zu verwandeln. Zu Hoppels Pech war er in diesem Zustand gefangen gewesen, als man sie entführt hatte, was bedeutete, dass er darin festsaß. Laut Jackie Terwilliger, Sydneys magischer Mentorin, war Hoppel im Grunde genommen immer noch lebendig, fristete aber ein ziemlich unglückliches Dasein ohne Nahrung und Aktivität. Ich nahm ihn überall mit hin und wusste nicht, ob ihm der Kontakt mit mir etwas bedeutete. Was er wirklich brauchte, war Sydney, und ich konnte ihm deshalb keinen Vorwurf machen. Schließlich brauchte ich sie auch.
Ich hatte Rowena die Wahrheit gesagt: Ich war jetzt nüchtern. Und das war Absicht. Die lange Busfahrt, die vor mir lag, gab mir die perfekte Gelegenheit, nach Sydney zu suchen. Obwohl ich nicht mehr so krampfhaft wie früher versuchte, sie in Träumen zu erreichen, war es mir trotzdem wichtig, einige Male pro Tag nüchtern zu werden und sie zu suchen. Sobald der Bus fuhr und ich auf meinem Platz saß, beschwor ich die Geistmagie in mir und genoss kurz das herrliche Gefühl, das es mir bescherte. Es war jedoch ein zweischneidiges Glück, das von dem Wissen gedämpft wurde, dass Geist mich langsam in den Wahnsinn trieb.
Wahnsinn ist ein so hässliches Wort, sagte eine Stimme in meinem Kopf. Betrachte es als einen neuen Blick auf die Realität.
Ich zuckte zusammen. Die Stimme in meinem Kopf war nicht mein Gewissen oder etwas in der Art. Es war meine tote Tante Tatiana, ehemalige Königin der Moroi. Oder, also gut, es war Geist, der dazu führte, dass ich ihre Stimme halluzinierte. Ich hatte sie früher immer gehört, wenn meine Stimmung ganz besonders tief im Keller gewesen war. Jetzt, seit Sydney fort war, war diese Phantomtante zu einer wiederkehrenden Gefährtin geworden. Die positive Seite – wenn man es überhaupt so betrachten konnte – war, dass einige der manisch-depressiven Nebenwirkungen von Geist seltener geworden waren. Es schien so, als hätte der Wahnsinn von Geist die Gestalt gewechselt. War es besser, Gedankengespräche mit einer verstorbenen Verwandten zu führen, als dramatischen Stimmungswechseln unterworfen zu sein? Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher.
Geh weg, sagte ich zu ihr. Du bist nicht echt. Außerdem wird es Zeit, nach Sydney zu suchen.
Sobald ich die Verbindung mit der Magie hergestellt hatte, streckte ich meine Sinne aus und hielt Ausschau nach Sydney – demjenigen Menschen, den ich besser kannte als irgendjemanden sonst auf dieser Welt. Jemanden im Schlaf zu finden, von dem ich nur wenig wusste, wäre einfach gewesen. Sie zu finden – falls sie schlief –, wäre mühelos möglich gewesen. Aber ich stellte keinen Kontakt her und ließ die Magie schließlich los. Entweder schlief sie nicht, oder sie war immer noch von mir abgeschirmt. Einmal mehr besiegt, fand ich eine Wodkaflasche in meiner Tasche und beschäftigte mich mit ihr, während ich nach Vista Azul fuhr.
Ich war angenehm beduselt, abgeschnitten von meiner Magie, aber nicht von meinem Herzschmerz, als ich die Amberwood Preparatory School erreichte. Der Unterricht für den Nachmittag war gerade beendet, und Schüler in modischen Uniformen betraten und verließen die Gebäude, um zu lernen oder rumzumachen oder was immer Highschool-Kids gegen Ende des Semesters so taten. Ich ging zum Mädchenwohnheim und wartete dann draußen auf Jill Mastrano Dragomir.
Während Rowena nur erraten hatte, was mich bedrückte, kannte Jill meine Probleme ganz genau. Das lag daran, dass die fünfzehnjährige Jill den »Vorteil« hatte, in meinen Kopf hineinsehen zu können. Letztes Jahr war sie von Attentätern angegriffen worden, die ihre Schwester entthronen wollten, die zufällig Königin der Moroi und außerdem eine sehr gute Freundin von mir war. Eigentlich hatten diese Attentäter Erfolg gehabt, aber ich hatte Jill durch weitere ungewöhnliche Fähigkeiten von Geist zurück ins Leben geholt. Diese Heilung hatte einen großen Tribut von mir gefordert und außerdem ein psychisches Band geschmiedet, das Jill von da an meine Gedanken und Gefühle kennen ließ. Ich wusste, dass mein jüngster Anfall von Depression und Komasaufen hart für sie gewesen war – obwohl das Trinken an manchen Tagen zumindest das Band betäubte. Wäre Sydney da gewesen, hätte sie mit mir geschimpft, dass ich selbstsüchtig sei und nicht an Jills Gefühle denke. Aber Sydney war nicht da. Die Last der Verantwortung ruhte allein auf mir, und ich war offenbar nicht stark genug, um sie zu schultern.
Drei Campus-Shuttle-Busse kamen und fuhren ab, und Jill saß in keinem davon. Es war der Tag der Woche, an dem wir uns für gewöhnlich trafen, und ich hatte mir Mühe gegeben, mich daran zu halten, auch wenn ich mich sonst an nichts anderes halten konnte. Ich nahm mein Telefon heraus und schickte ihr eine SMS: Hey, ich bin hier. Alles okay?
Es kam keine Antwort, und schon beschlich mich ein ungutes Gefühl. Nach dem Mordversuch hatte man Jill hierhergeschickt, damit sie sich in Palm Springs unter Menschen versteckte, denn eine Wüste war kein Ort, an dem sich irgendeiner von unserer Art oder der der Strigoi – böser, untoter Vampire – aufhalten wollte. Die Alchemisten – eine Geheimgesellschaft von Menschen, die versessen darauf war, Menschen und Vampire voneinander fernzuhalten – hatten Sydney als Kontaktperson hergeschickt, um dafür zu sorgen, dass alles glatt lief. Die Alchemisten hatten sicherstellen wollen, dass die Moroi nicht in einen Bürgerkrieg gerieten, und Sydney hatte ihre Sache gut gemacht, Jill durch alle möglichen Aufs und Abs zu helfen. In den Augen ihrer Auftraggeber hatte Sydney jedoch versagt, indem sie eine Liebesbeziehung mit einem Vampir angefangen hatte. Das verstieß irgendwie gegen die Vorgehensweise der Alchemisten, Menschen und Vampire zu trennen. Und die Alchemisten hatten brutal und effizient darauf reagiert.
Selbst nachdem Sydney verschwunden und ihr starrgesichtiger Ersatz, Maura, auf der Bildfläche erschienen war, war es für Jill relativ ruhig geblieben. Es hatte keine Anzeichen von Gefahr von irgendeiner Seite gegeben, und wir hatten sogar Hinweise darauf, dass sie in die Moroi-Gesellschaft würde zurückkehren können, sobald ihr Schuljahr im nächsten Monat zu Ende ging. Diese Art von Verschwinden war untypisch, und als ich keine SMS-Antwort von ihr bekam, schickte ich eine an Eddie Castile.
Während Jill und ich Moroi waren, war er ein Dhampir – eine Mischlingsrasse aus menschlichem und vampirischem Blut. Seine Art wurde dazu ausgebildet, als unsere Verteidiger zu dienen, und er war einer der Besten. Leider hatten seine beeindruckenden Kampfkünste nicht ausgereicht, als Sydney ihn überlistet hatte, sich von ihr zu trennen, da die Alchemisten hinter ihr her gewesen waren. Sie hatte sich selbst geopfert, um ihn zu retten, und er kam nicht darüber hinweg. Diese Demütigung hatte die aufkeimende Liebe zwischen ihm und Jill getötet, weil er nicht länger das Gefühl hatte, einer Moroi-Prinzessin würdig zu sein. Er diente ihr jedoch immer noch pflichtgemäß als Leibwächter, und ich wusste, dass er als Erster wissen würde, wenn ihr irgendetwas zugestoßen war.
Aber Eddie beantwortete meine SMS auch nicht, ebenso wenig die beiden anderen Dhampire, die als ihre verdeckten Beschützer dienten. Das war merkwürdig, aber ich versuchte, mich dahingehend zu beruhigen, dass Funkstille von ihnen allen wahrscheinlich bedeutete, dass sie zusammen abgelenkt worden waren und es ihnen gut ging. Jill würde sicher bald kommen.
Die Sonne machte mir wieder zu schaffen, daher ging ich um das Gebäude herum zu einer anderen Bank, die etwas abseits stand und von Palmen beschattet wurde. Ich machte es mir darauf bequem und schlief bald ein, was wohl daran lag, dass ich letzte Nacht lange in einer Bar gewesen war und meine Wodkaflasche geleert hatte. Ein Stimmengemurmel weckte mich später, und ich sah, dass die Sonne am Himmel über mir ein gutes Stück weitergewandert war. Ebenfalls über mir schwebten die Gesichter von Jill und Eddie, zusammen mit unseren Freunden Angeline, Trey und Neil.
»Hey«, krächzte ich und schaffte es, mich aufrecht hinzusetzen. »Wo wart ihr denn?«
»Wo warst du?«, fragte Eddie spitz.
Jills grüne Augen wurden weich, als sie mich ansah. »Ist schon gut. Er war die ganze Zeit über hier. Er hat es vergessen. Verständlich, da … na, er macht eben eine schwere Zeit durch.«
»Was habe ich vergessen?«, fragte ich und schaute unbehaglich von einem Gesicht zum anderen.
»Ist egal«, antwortete Jill ausweichend.
»Was habe ich vergessen?«, rief ich.
Angeline Dawes, eine von Jills Dhampir-Beschützerinnen, erwies sich wie üblich als die Stimme der Unverblümtheit. »Jills Ausstellung zum Semesterende.«
Ich starrte sie verständnislos an, und dann fiel mir alles wieder ein. Eine von Jills außerschulischen Aktivitäten war ein Nähclub. Sie hatte als Model angefangen, aber als sich das für ihre Position als zu öffentlich und zu gefährlich erwiesen hatte, hatte sie sich in letzter Zeit hinter den Kulissen als Designerin versucht – und festgestellt, dass sie ziemlich gut darin war. Sie hatte während des ganzen letzten Monats über eine große Show und Ausstellung geredet, die ihr Club als Semesterendprojekt plante, und es war gut gewesen, sie überhaupt mal wieder so aufgeregt zu sehen – über etwas. Ich wusste, dass sie ebenfalls wegen Sydney litt, und mit meiner übertragenen Depression und ihrer verpfuschten Beziehung mit Eddie hatte sie unter einer Wolke gelebt, die fast so dunkel war wie meine eigene. Diese Show und die Möglichkeit, ihre Arbeit zu zeigen, waren ein Lichtblick für sie gewesen – klein im großen Plan der Dinge, aber monumental wichtig im Leben eines jungen Mädchens, das ein wenig Normalität brauchte.
Und da war ich nicht hingegangen.
Gesprächsfetzen fielen mir jetzt wieder ein, dass sie mir den Tag und die Uhrzeit genannt hatte und ich versprochen hatte, zu kommen und sie zu unterstützen. Sie hatte mich bei unserer letzten Begegnung diese Woche sogar ausdrücklich daran erinnert. Ich hatte es registriert und war dann ausgegangen, um in einer Bar in der Nähe meines Apartments Tequila-Dienstag zu feiern. Zu sagen, dass ihre Show mir entfallen war, war eine Untertreibung.
»Scheiße, tut mir leid, Küken. Ich hab versucht, eine SMS zu schicken …« Ich hielt mein Telefon hoch, um es ihnen zu zeigen, nur dass es stattdessen die Wodkaflasche war, die ich zu fassen bekam. Ich schob sie hastig zurück in die Tasche.
»Wir mussten unsere Telefone während der Show ausstellen«, erklärte Neil. Er war der dritte Dhampir in der Gruppe, die jüngste Ergänzung des Teams von Palm Springs. Er war mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen, vielleicht weil er seinen eigenen Kummer hatte. Er hatte sich bis über beide Ohren in ein Dhampir-Mädchen verliebt, das wie vom Erdboden verschwunden war, obwohl Olive Sinclairs Schweigen im Gegensatz zu dem von Sydney höchstwahrscheinlich persönlich begründet war und nicht an einer Entführung durch Alchemisten lag.
»Und … wie ist es gelaufen?«, versuchte ich es. »Ich wette, deine Sachen waren der Hammer, oder?«
Ich kam mir so unglaublich dumm vor, dass es kaum auszuhalten war. Vielleicht konnte ich nicht gegen das ankämpfen, was die Alchemisten Sydney angetan hatten. Vielleicht konnte ich mich auch nicht auf eine Prüfung vorbereiten. Aber Herrgott nochmal, ich hätte zumindest in der Lage sein sollen, es zu der Modenschau dieses Mädchens zu schaffen! Alles, was ich hatte tun müssen, war hingehen, dasitzen und applaudieren. Ich hatte selbst dabei versagt, und die Last dieser Schuld war plötzlich erdrückend. Ein schwarzer Nebel erfüllte meinen ganzen Verstand und drückte mich nieder, führte dazu, dass ich alles und jeden hasste – am meisten mich selbst. Kein Wunder, dass ich Sydney nicht retten konnte. Ich konnte nicht mal auf mich selbst aufpassen.
Das brauchst du auch nicht, flüsterte Tante Tatiana in meinem Kopf. Ich werde auf dich aufpassen.
Ein Funke Mitgefühl tauchte in Jills Augen auf, als sie die dunkle Stimmung spürte, die mich überkam. »Es war toll. Keine Angst – wir werden dir Fotos zeigen. Sie hatten einen Profifotografen da, der alles aufgenommen hat, und es wird online gehen.«
Ich versuchte, diese Dunkelheit zu verdrängen und brachte ein angespanntes Lächeln zustande. »Freut mich zu hören. Und jetzt, wie wär’s denn, wenn wir alle ausgehen und feiern? Das geht auf mich.«
Jill machte ein langes Gesicht. »Angeline und ich essen mit einer Lerngruppe. Ich meine, vielleicht könnte ich absagen. Die Prüfungen sind erst in einem Monat, deshalb könnte ich immer noch …«
»Vergiss es«, sagte ich und stand auf. »Wenigstens einer in dieser Verbindung muss fit für seine Prüfungen sein. Viel Spaß. Man sieht sich.«
Niemand versuchte, mich aufzuhalten, aber Trey Juarez schloss sich mir bald an. Er war vielleicht das seltsamste Mitglied in unserem Kreis: ein Mensch, der einst Teil einer Gruppe von Vampirjägern gewesen war. Er hatte mit ihnen gebrochen, sowohl weil sie Psychos waren, als auch weil er sich – gegen alle Vernunft – in Angeline verliebt hatte. Diese beiden waren die Einzigen in unserer kleinen Gruppe mit einem ansatzweise glücklichen Liebesleben, und ich wusste, dass sie es für uns andere unglückliche Seelen herunterzuspielen versuchten.
»Wie kommst du nach Hause?«, fragte Trey.
»Wer sagt denn, dass ich nach Hause fahre?«, gab ich zurück.
»Ich. Du solltest jetzt nicht ausgehen und feiern. Du siehst scheiße aus.«
»Du bist heute schon der Zweite, der mir das sagt.«
»Na, vielleicht hörst du dann endlich zu«, erwiderte er und führte mich zu dem Studentenparkplatz. »Komm, ich fahre.«
Dieses Angebot fiel ihm leicht, weil er mein Mitbewohner war.
Aber das war nicht von Anfang an so gewesen. Er war Internatsschüler an der Amberwood gewesen und hatte mit den anderen in der Schule gewohnt. Seine frühere Gruppe, die Krieger des Lichts, hatten dieselben Probleme mit dem Kontakt zwischen Menschen und Vampiren wie die Alchemisten. Während diese es dadurch lösten, dass sie die Existenz von Vampiren vor normalen Menschen verbargen, wählten die Krieger einen brutaleren Ansatz und jagten Vampire. Sie behaupteten zwar, nur hinter Strigoi her zu sein, aber sie waren auch keine Freunde der Moroi oder Dhampire.
Nachdem Treys Vater von Angeline erfahren hatte, hatte er eine andere Vorgehensweise gewählt als Sydneys Vater. Statt seinen Sohn zu kidnappen und spurlos verschwinden zu lassen, hatte Mr Juarez Trey einfach enterbt und ihm alle Gelder gestrichen. Zum Glück für Trey war aber das Schuldgeld bereits bis zum Ende des Schuljahres bezahlt gewesen. Für Kost und Logis galt das jedoch nicht, und so hatte man Trey vor einigen Monaten aus dem Amberwood-Wohnheim hinausgeworfen. Darum hatte er vor meiner Tür gestanden und angeboten, mir von seinen mageren Einkünften aus dem Café Miete zu zahlen, um die Highschool an der Amberwood beenden zu können. Ich hatte ihn willkommen geheißen und das Geld abgelehnt, weil ich wusste, dass Sydney es so gewollt hätte. Meine einzige Bedingung war gewesen, dass ich ihn nicht mit Angeline beim Rummachen auf meinem Sofa erwischen dürfe, wenn ich nach Hause kam.
»Ich bin nutzlos«, sagte ich nach mehreren Minuten unbehaglichen Schweigens im Wagen.
»Wie meinst du das?«, fragte Trey.
Ich warf ihm einen Blick zu. »Du weißt genau, was ich meine. Ich hab’s vermasselt. Niemand verlangt mehr viel von mir. Ich hätte nur daran denken müssen, zu ihrer Modenschau zu gehen, und ich habe es vergeigt.«
»Dein Leben war in letzter Zeit echt beschissen«, meinte er diplomatisch.
»Das von allen anderen doch auch. Sieh nur dich an. Deine ganze Familie leugnet deine Existenz und hat alles getan, damit du von der Schule fliegst. Du hast eine Übergangslösung gefunden, schreibst weiter gute Noten und machst deinen Sport, und du hast es geschafft, dabei einige Stipendien zu ergattern«, seufzte ich. »In der Zwischenzeit bin ich vielleicht in einem Grundkurs für Kunst durchgefallen. Sogar in mehreren, falls ich diese Woche noch mehr Prüfungen habe – was gut sein kann. Ich weiß es nicht mal.«
»Ja, aber ich habe immer noch Angeline. Und dadurch lohnt es sich, den ganzen anderen Mist zu ertragen. Während du …« Trey konnte den Satz nicht beenden, und ich sah Schmerz auf seinen gebräunten Zügen aufblitzen.
Meine Freunde hier in Palm Springs wussten über Sydney und mich Bescheid. Sie waren die Einzigen in der Moroi-Welt (oder der menschlichen Welt, die die Moroi beschützte), die etwas über unsere Beziehung wussten. Es hatte sie sehr mitgenommen, was mir und auch Sydney geschehen war. Sie hatten Sydney ebenfalls geliebt. Natürlich nicht so wie ich, aber sie war ein ungemein loyaler Mensch, der enge Freundschaften schloss.
»Mir fehlt sie auch«, sagte Trey leise.
»Ich hätte mehr tun sollen«, erwiderte ich und rutschte in meinem Sitz nach unten.
»Du hast viel getan. Mehr, als mir eingefallen wäre. Und nicht nur das Traumwandeln. Ich meine, ihren Dad hast du ständig bedrängt, die Moroi unter Druck gesetzt und dieser Maura das Leben zur Hölle gemacht … du hast alles versucht.«
»Nerven kann ich gut«, gab ich zu.
»Du bist nur gegen eine Mauer gelaufen, das ist alles. Sie sind einfach zu gut darin, Sydneys Gefängnis geheim zu halten. Aber diese Mauer wird einen Riss bekommen, und du wirst da sein, um diesen Riss zu finden. Und ich werde an deiner Seite stehen. Genau wie die anderen von uns auch.«
Die aufmunternden Worte waren ungewöhnlich für ihn, verbesserten meine Stimmung aber kein bisschen. »Ich weiß nicht, wie ich diesen Riss finden soll.«
Trey riss die Augen auf. »Marcus.«
Ich schüttelte den Kopf. »Seine Spuren sind doch auch längst erschöpft. Ich habe ihn seit einem Monat nicht mehr gesehen.«
»Nein.« Als er vor meinem Apartment-Gebäude anhielt, zeigte Trey nach vorn. »Da. Marcus.«
Und tatsächlich. Dort auf der Eingangstreppe saß Marcus Finch, der rebellische Ex-Alchemist, der Sydney zu eigenständigem Denken ermutigt und – vergeblich – versucht hatte, sie für mich zu finden. Ich hatte die Tür schon aufgemacht, noch bevor Trey den Wagen ganz zum Stehen gebracht hatte.
»Er wäre nicht persönlich hier, wenn er keine Neuigkeiten hätte«, sagte ich aufgeregt. Ich sprang aus dem Wagen und rannte über den Rasen, meine frühere Lethargie war von einer neuen Zielstrebigkeit ersetzt worden. Das war es. Marcus war durchgekommen. Marcus hatte Antworten gefunden.
»Was ist los?«, fragte ich. »Hast du sie gefunden?«
»Nicht direkt.« Marcus stand auf und strich sich das blonde Haar zurück. »Lass uns reingehen und reden.«
Trey war fast genauso ungeduldig wie ich, als wir endlich mit Marcus im Wohnzimmer angekommen waren. Wir standen beide in der gleichen Haltung da, die Arme vor der Brust verschränkt, und starrten ihn an. »Also?«, fragte ich.
»Ich habe eine Liste von Orten, die möglicherweise als Umerziehungseinrichtungen der Alchemisten benutzt worden sein könnten«, begann Marcus, der nicht annähernd so enthusiastisch wirkte, wie er es bei einer solchen Nachricht hätte sein sollen. Ich packte ihn am Arm.
»Das ist unglaublich! Wir werden anfangen, sie zu überprüfen, und …«
»Es sind dreißig«, unterbrach er mich.
Ich ließ die Hand sinken. »Dreißig?«
»Dreißig«, wiederholte er. »Und wir wissen nicht genau, wo sie sind.«
»Aber du hast gerade gesagt …«
Marcus hielt eine Hand hoch. »Lass mich erst mal alles erklären. Dann kannst du reden. Diese Liste, die meine Quellen haben, besteht aus Städten in den Vereinigten Staaten, die die Alchemisten für die Umerziehung und einige andere Zentralen ausgekundschaftet haben. Die Liste ist mehrere Jahre alt, und meine Quellen bestätigen zwar, dass sie ihre gegenwärtige Umerziehungseinrichtung tatsächlich in einer Stadt, die auf der Liste steht, gebaut haben, aber wir wissen nicht mit Bestimmtheit, für welche sie sich am Ende entschieden haben – oder wo genau sich die Einrichtung an diesem Ort befindet. Gibt es Möglichkeiten, es herauszufinden? Sicher, und ich kenne sogar Leute, die anfangen können herumzusuchen. Aber wir werden die Städte alle nacheinander abklappern müssen, und wir werden für jede eine ganze Weile brauchen.«
All die Hoffnung und Begeisterung, die ich bei Marcus’ Anblick empfunden hatte, zerbrach und verging. »Und lass mich raten: ›Eine Weile‹ sind einige Tage?«
Er verzog das Gesicht. »Es wird von Fall zu Fall verschieden sein, je nach den Schwierigkeiten, die sich bei den Nachforschungen in jeder Stadt auftun mögen. Könnte ein paar Tage dauern, eine Stadt von der Liste zu streichen. Vielleicht auch einige Wochen.«
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich nach dem Examen und Jill noch schlechter fühlen konnte, aber anscheinend hatte ich mich geirrt. Mutlos warf ich mich auf die Couch. »Einige Wochen mal dreißig. Das könnte über ein Jahr dauern.«
»Außer wir haben Glück, und sie ist in einer der ersten Städte, in denen wir suchen.« Aber ich merkte, dass nicht einmal er das für wahrscheinlich hielt.
»Yeah, tja, ›Glück haben‹ ist nicht ganz der richtige Ausdruck, um zu beschreiben, wie es bisher für uns gelaufen ist«, bemerkte ich. »Ich sehe nicht, warum sich das jetzt ändern sollte.«
»Es ist besser als nichts«, wandte Trey ein. »Es ist die erste echte Spur, die wir haben.«
»Ich muss ihren Dad finden«, murmelte ich. »Ich muss ihn einfach finden und ihn mit einem höllischen Zwang belegen, damit er mir sagt, wo sie ist.« Alle Versuche, Jared Sage aufzuspüren, hatten sich bislang jedoch als erfolglos erwiesen. Ich hatte ihn allerdings ans Telefon bekommen, und er hatte prompt wieder aufgelegt. Am Telefon funktionierte Zwang nicht so gut.
»Aber selbst wenn du ihn finden würdest, er würde es wahrscheinlich nicht wissen«, sagte Marcus. »Sie hüten Geheimnisse voreinander, eben um sich gegen erzwungene Geständnisse zu schützen.«
»Und damit sind wir keinen Schritt weiter.« Ich stand auf und ging in die Küche, um mir einen Drink zu machen. »Komm mich in einem Jahr holen, wenn du sicher bist, dass deine Liste eine Sackgasse war.«
»Adrian …«, begann Marcus, der ratloser wirkte, als ich ihn je gesehen hatte. Normalerweise war er nämlich das dreiste Selbstbewusstsein in Person.
Treys Antwort war pragmatischer. »Keine Drinks mehr. Du hattest heute schon zu viele, Mann.«
»Lass mich das selbst beurteilen«, blaffte ich. Statt mir tatsächlich einen Drink zu machen, schnappte ich mir am Ende einfach nur zwei Schnapsflaschen. Niemand versuchte mich aufzuhalten, als ich in mein Zimmer ging und die Tür zuknallte.
Bevor ich meine Ein-Mann-Party begann, unternahm ich einen weiteren Versuch, Sydney zu erreichen. Es war nicht leicht, da ich immer noch Restalkohol von dem Wodka heute Nachmittag intus hatte, aber dann gelang mir immerhin ein zaghafter Zugriff auf Geist. Wie gewöhnlich war da nichts, aber Marcus’ Gewissheit, dass sie sich in den Vereinigten Staaten befand, hatte den Wunsch in mir geweckt, es zu versuchen. An der Ostküste war früher Abend, und ich musste es nachprüfen, nur für den Fall, dass sie früh ins Bett gegangen war.
Anscheinend aber nicht.
Ich verlor mich bald in den Flaschen und hatte den verzweifelten Drang, alles wegzuwischen. Die Schule. Jill. Sydney. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich war, sich so scheiße zu fühlen und so schwarze und starke Gefühle zu haben, dass es keinen Weg gab, sie in irgendeine Form von konstruktiver Empfindung zu verwandeln. Als ich damals mit Rose Schluss gemacht hatte, hatte ich noch gedacht, kein Verlust könne schrecklicher sein. Ich hatte mich aber geirrt. Sie und ich, wir hatten nie etwas wirklich Ernstes miteinander gehabt. Was ich mit ihr verloren hatte, war lediglich eine Möglichkeit.
Aber mit Sydney … mit Sydney hatte ich alles gehabt – und alles verloren. Liebe, Verständnis, Respekt. Das Gefühl, dass wir beide bessere Menschen geworden waren, weil wir einander hatten, und dass wir es mit allem aufnehmen konnten, solange wir zusammen waren. Nur dass wir jetzt eben nicht mehr zusammen waren. Sie hatten uns auseinandergerissen, und ich wusste nicht, was nun geschehen würde.
Die Mitte hält. Das war der Satz gewesen, den Sydney nach dem Gedicht »Das zweite Kommen« von William Butler Yeats für uns geprägt hatte. Manchmal, in meinen dunkelsten Momenten, befürchtete ich allerdings, dass der ursprüngliche Wortlaut passender war: Alles zerfällt, die Mitte hält nicht mehr.
Ich betrank mich bis zur Bewusstlosigkeit, nur um mitten in der Nacht mit rasenden Kopfschmerzen aufzuwachen. Mir war auch übel, aber als ich ins Badezimmer torkelte, kam nichts hoch. Ich fühlte mich einfach elend. Vielleicht lag es daran, dass Sydneys Haarbürste noch da war und mich an sie erinnerte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich das Abendessen ausgelassen hatte und mich nicht daran erinnern konnte, wann ich das letzte Mal Blut getrunken hatte. Kein Wunder, dass ich in so schlechter Verfassung war. Meine Alkoholtoleranz hatte sich im Lauf der Jahre dermaßen stark erhöht, dass ich mich deswegen selten krank fühlte, darum musste ich mich diesmal wirklich selbst fertiggemacht haben. Klug wäre jetzt gewesen, literweise Wasser zu trinken, aber stattdessen begrüßte ich lieber das selbstzerstörerische Verhalten. Ich kehrte zu einem weiteren Drink in mein Zimmer zurück und schaffte nur, mich noch schlechter zu fühlen.
Mein Kopf und Magen beruhigten sich gegen Morgengrauen, und es gelang mir schließlich, in meinem eigenen Bett in einen unruhigen Schlaf zu fallen. Der wurde einige Stunden später von einem Klopfen an der Tür unterbrochen. Ich glaube, das Klopfen war ziemlich leise, aber weil ich immer noch etwas Kopfschmerzen hatte, fühlte es sich wie ein Vorschlaghammer an.
»Geh weg«, sagte ich und spähte verschlafen zur Tür.
Trey steckte den Kopf herein. »Adrian, hier ist jemand, mit dem du reden musst.«
»Ich hab doch schon gehört, was der tollkühne Marcus zu sagen hat«, schoss ich zurück. »Ich bin fertig mit ihm.«
Die Tür wurde weiter geöffnet, und jemand ging an Trey vorbei. Obwohl mir von der Bewegung schwindlig wurde, konnte ich mich aufrichten und besser hinschauen. Dann klappte mir der Unterkiefer runter, und ich fragte mich, ob ich halluzinierte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen. Normalerweise bildete ich mir nur Tante Tatiana ein, aber diese Frau da war sehr lebendig und schön, als das Morgenlicht ihre ausgeprägten Wangenknochen und ihr blondes Haar beleuchtete. Aber sie konnte unmöglich hier sein.
»Mom?«, krächzte ich.
»Adrian.« Sie kam herein, setzte sich neben mich aufs Bett und berührte sanft mein Gesicht. Ihre Hand auf meiner fiebrigen Haut fühlte sich kühl an. »Adrian, es ist Zeit, nach Hause zu kommen.«
KAPITEL 3
SYDNEY
Ich konnte den Alchemisten ihre Lichtshow-Schocktaktik verzeihen, denn sobald ich wieder einigermaßen in der Lage war zu sehen, boten sie mir eine Dusche an.
Die Wand in meiner Zelle ging auf, und ich wurde von einer jungen Frau begrüßt, die vielleicht fünf Jahre älter war als ich. Sie trug die Art eines klassischen Kostüms, wie es die Alchemisten lieben, dazu das schwarze Haar stramm zu einer eleganten Banane hochgesteckt. Ihr Make-up war tadellos, außerdem roch sie nach Lavendel. Die goldene Lilie auf ihrer Wange leuchtete. Meine Sehkraft war noch nicht ganz wiederhergestellt, aber als ich neben ihr stand, wurde ich mir meiner gegenwärtigen Verfassung deutlich bewusst. Ich hatte mich seit Ewigkeiten nicht mehr richtig gewaschen, und mein Hemd war kaum mehr als ein Lumpen, mit dem man die Fußböden schrubben konnte.
»Mein Name ist Sheridan«, sagte sie kühl und ging nicht näher darauf ein, ob das ihr Vorname oder ihr Nachname war. Ich fragte mich, ob sie zu den Leuten gehörte, die sich hinter der Stimme in meiner Zelle befanden. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie in Schichten arbeiteten und irgendeine Art von Computerprogramm benutzten, damit die Stimme immer gleich klang. »Ich bin hier die derzeitige Direktorin. Folgen Sie mir bitte.«
Sie bog in ihren schwarzen, hochhackigen Lederschuhen in den Flur ein, und ich folgte ihr schweigend, weil ich mir noch nicht zutraute, etwas zu sagen. Obwohl ich in meiner Zelle einige Bewegungsfreiheit gehabt hatte, hatte ich auch Beschränkungen ertragen müssen und war nicht viel herumgelaufen. Meine steifen Muskeln protestierten gegen die Veränderungen, und ich ging langsam hinter ihr her, einen qualvollen, barfüßigen Schritt nach dem anderen. Unterwegs kamen wir an einer Reihe unmarkierter Türen vorbei, und ich fragte mich, was sich dahinter verbarg. Weitere dunkle Zellen und blecherne Stimmen? Nichts schien als Ausgang gekennzeichnet zu sein, was mir sofort Sorgen machte. Es gab auch keine Fenster oder irgendwelche anderen Hinweise darauf, wie man aus diesem Gebäude herauskam.
Sheridan erreichte lange vor mir den Aufzug und wartete geduldig auf mich. Als wir beide im Lift standen, fuhren wir ein Stockwerk hinauf und traten in einen Flur, der genauso kahl war. Eine Tür führte zu einem Waschraum mit Fliesenboden und Gemeinschaftsduschen. Wie in einem Fitnesscenter sah das aus. Sheridan zeigte auf eine Kabine, die mit Seife und Shampoo ausgestattet war.
»Das Wasser läuft fünf Minuten, sobald es aufgedreht ist«, warnte sie. »Also nutzen Sie es klug. Wenn Sie fertig sind, werden Kleider für Sie bereitliegen. Ich warte im Flur.«
Sie verließ die Umkleidekabine, um mir den Anschein von Privatsphäre zu bieten, aber ich wusste ohne jeden Zweifel, dass ich immer noch beobachtet wurde. Ich hatte alle Illusionen von Schamgefühl verloren, sobald ich hier angekommen war. Also begann ich das Hemd auszuziehen, als ich neben mir an der Wand einen Spiegel bemerkte, und wichtiger noch, wer mir daraus entgegenblickte.
Ich hatte ja schon gewusst, dass ich in schlechter Verfassung war, aber die Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht zu sehen, das war noch eine ganz andere Erfahrung. Das Erste, was mir auffiel, war, wie viel Gewicht ich verloren hatte – Ironie des Schicksals, wenn man meine lebenslange Besessenheit bedachte, dünn zu bleiben. Dieses Ziel hatte ich eindeutig erreicht, erreicht und überschritten. Aus dünn war unterernährt geworden, und es zeigte sich nicht nur an der Art, wie mir das Hemd von meinem mageren Körper herabhing, sondern auch an der Hagerkeit meines Gesichts. Das ausgezehrte Aussehen wurde von dunklen Schatten unter den Augen und einer allgemeinen Blässe durch Sonnenmangel noch verstärkt. Ich sah aus, als hätte ich mich gerade von einer lebensbedrohlichen Krankheit erholt.
Mein Haar war ebenfalls in schlechter Verfassung. Ich hatte mir eingebildet, es im Dunkeln ganz anständig gewaschen zu haben, aber das erwies sich jetzt als Witz. Die Strähnen waren schlaff und fettig und hingen traurig und verfilzt von mir herab. Es bestand zwar kein Zweifel, dass ich noch immer blond war, aber die Farbe war stumpf geworden, viel dunkler von dem Dreck und dem Schweiß, den ich mit einem Waschlappen einfach nicht hatte wegschrubben können. Adrian hatte immer gesagt, mein Haar sei wie Gold – und mich damit aufgezogen, dass ich einen Heiligenschein hätte. Aber was würde er jetzt sagen?
Adrian liebt mich nicht wegen meines Haares, dachte ich und blickte mir in die Augen. Sie waren ruhig und braun. Immer noch unverändert. Das ist alles äußerlich. Meine Seele, meine Aura, mein Charakter … sie sind unverändert.
Entschlossen drehte ich mich von dem Spiegelbild weg, als mir noch etwas anderes auffiel. Mein Haar war länger als beim letzten Mal, als ich es gesehen hatte, etwa drei Zentimeter länger. Obwohl ich mir mehr als bewusst darüber war, dass meine Beine dringend eine Rasur brauchten, hatte ich in der Zelle kein Gefühl dafür gehabt, was das Haar auf meinem Kopf betraf. Jetzt versuchte ich mich daran zu erinnern, wie schnell Haare wuchsen. Ungefähr anderthalb Zentimeter im Monat? Das ließ auf mindestens zwei Monate schließen, vielleicht drei, wenn ich die schlechte Ernährung miteinbezog. Der Schock darüber war erschreckender als mein Aussehen.
Drei Monate! Sie haben mir drei Monate gestohlen und mich in der Dunkelheit mit Drogen betäubt.
Und was war mit Adrian passiert? Mit Jill? Mit Eddie? In drei Monaten konnte ein ganzes Leben für sie vergangen sein. Waren sie sicher und wohlauf? Immer noch in Palm Springs? Neue Panik stieg in mir auf, und ich versuchte energisch, sie zu unterdrücken. Ja, es war viel Zeit vergangen, aber ich durfte mich von dieser Wahrheit nicht beeinflussen lassen. Die Alchemisten spielten schon genug Psychospielchen mit mir, ohne dass ich ihnen half.
Aber trotzdem … drei Monate.
Ich streifte meine armselige Kleidung ab, trat in die Duschkabine und zog den Vorhang hinter mir zu. Als ich das Wasser aufdrehte und es heiß herauskam, konnte ich mich nur mühsam beherrschen, nicht vor Begeisterung zu Boden zu sinken. Während der letzten drei Monate hatte ich so gefroren, und jetzt war sie hier, alle Wärme, die ich mir nur wünschen konnte. Nein, nicht