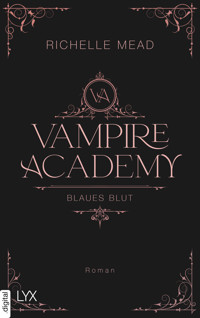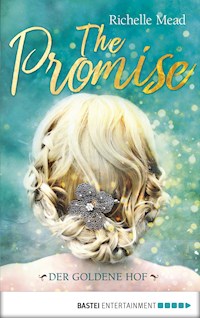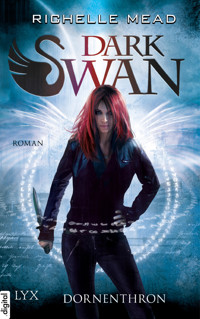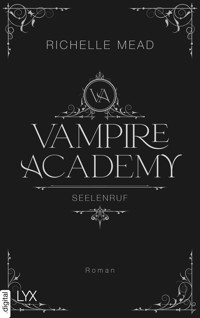
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vampire-Academy-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nach ihrer langen Reise zu Dimitris Geburtsort in Sibirien ist Rose Hathaway endlich an die Vampirakademie und zu ihrer besten Freundin Lissa zurückgekehrt. Die beiden Mädchen stehen kurz davor, ihren Abschluss zu machen und können es kaum erwarten, die Akademie zu verlassen. Doch Rose trauert immer noch um den Verlust ihrer großen Liebe, und bald scheinen ihre schlimmsten Befürchtungen wahr zu werden. Dimitri hat ihr Blut gekostet und ist nun auf der Jagd nach ihr. Und dieses Mal wird er nicht eher ruhen, bis Rose sich ihm angeschlossen hat ... für immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Richelle Mead
Seelenruf
Roman
Ins Deutsche übertragen von Michaela Link
Für meinen Agenten: Jim McCarthy.Danke, dass Sie sich all den Schwierigkeiten gewidmet haben.Ohne Sie wäre dieses Buch nicht möglich gewesen!
1
Eine Morddrohung ist kein Liebesbrief – selbst wenn die Person, die sie verfasst, immer noch behauptet, den Adressaten zu lieben. Allerdings hatte ich, die selbst einmal versucht hatte, jemanden zu töten, den ich liebte, vielleicht kein Recht, darüber zu urteilen.
Der heutige Brief kam genau zur richtigen Zeit – nichts anderes hätte ich erwarten sollen. Ich hatte ihn bisher vier Mal gelesen, und obwohl die Zeit knapp war, konnte ich nicht anders: Ich las ihn noch ein fünftes Mal.
Meine liebste Rose,
einer der wenigen Nachteile des Erwecktseins besteht darin, dass wir keinen Schlaf mehr benötigen; daher träumen wir auch nicht mehr. Es ist eine Schande, denn wenn ich träumen könnte, würde ich gewiss von dir träumen. Ich würde davon träumen, wie du riechst und wie sich dein dunkles Haar zwischen meinen Fingern anfühlt: wie Seide. Ich würde von der Glattheit deiner Haut träumen … und von der Wildheit deiner Lippen, wenn wir uns küssen.
Ohne Träume muss ich mich mit meiner eigenen Fantasie begnügen – was beinahe genauso gut ist. Ich kann mir all diese Dinge sehr präzise vorstellen, ebenso wie ich mir ausmalen kann, wie es sein wird, wenn ich dein Leben von dieser Welt nehme. Es ist etwas, das tun zu müssen ich zwar bedaure, aber du hast meine Entscheidung unausweichlich gemacht. Deine Weigerung, dich mir in ewigem Leben und ewiger Liebe anzuschließen, lässt mir keine andere Wahl. Ich kann doch nicht zulassen, dass jemand, der so gefährlich ist wie du, einfach weiterlebt. Und selbst wenn ich deine Erweckung erzwingen würde – du hast dir unter den Strigoi so viele Feinde gemacht, dass dich einer von ihnen gewiss töten würde. Wenn du aber ohnehin sterben musst, dann soll es durch meine Hand geschehen. Durch die Hand keines anderen.
Nichtsdestoweniger wünsche ich dir heute alles Gute für deine Prüfungen – nicht dass du Glück bräuchtest. Wenn sie dich tatsächlich dazu zwingen, sie abzulegen, verschwenden alle nur ihre Zeit. Du bist die Beste in dieser Gruppe, und von heute Abend an wirst du die Markierung deines Versprechens tragen. Das bedeutet natürlich, dass du eine umso größere Herausforderung darstellen wirst, wenn wir uns wiedersehen – was ich ohne jeden Zweifel genießen werde.
Wir werden uns wiedersehen. Wenn du deinen Abschluss hast, wird man dich aus der Akademie fortschicken, und sobald du dich außerhalb der Schutzzauber aufhältst, werde ich dich finden. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an dem du dich vor mir verstecken kannst. Ich beobachte dich.
In Liebe,
Dimitri
Trotz seiner guten Wünsche fand ich den Brief alles andere als inspirierend. Ich warf ihn aufs Bett, machte mich auf den Weg und versuchte, seine Worte nicht zu sehr an mich herankommen zu lassen, obwohl es ziemlich unmöglich war, sich von etwas Derartigem nicht in Angst versetzen zu lassen. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an dem du dich vor mir verstecken kannst.
Daran hatte ich keinerlei Zweifel. Ich wusste ja, dass Dimitri Spione hatte. Seit sich mein ehemaliger Lehrer und späterer Geliebter in einen bösen, untoten Vampir verwandelt hatte, war er auch zu einer Art Anführer unter ihnen geworden – das hatte ich sogar noch beschleunigt, als ich seine ehemalige Chefin tötete. Ich vermutete, eine Menge seiner Spione waren Menschen, die nur darauf warteten, dass ich den Schutz meiner Schule verließ. Kein Strigoi konnte vierundzwanzig Stunden am Tag Wache halten. Menschen konnten es jedoch, und erst vor kurzem hatte ich erfahren, dass jede Menge Menschen bereit waren, den Strigoi zu dienen: als Gegenleistung für das Versprechen, eines Tages verwandelt zu werden. Diese Menschen waren der Meinung, das ewige Leben sei es wert, ihre Seelen zu korrumpieren und andere zu töten, um selbst zu überleben. Diese Menschen machten mich ganz krank.
Aber die Menschen waren nicht der Grund, warum meine Schritte ins Stocken gerieten, während ich durch das Gras ging, das unter dem Einfluss des Sommers hellgrün geworden war. Es war Dimitri. Immer Dimitri. Dimitri, der Mann, den ich liebte. Dimitri, der Strigoi, den ich retten wollte. Dimitri, das Ungeheuer, das ich höchstwahrscheinlich würde töten müssen. Die Liebe, die wir miteinander geteilt hatten, brannte immerzu in mir, ganz gleich, wie oft ich mich antrieb weiterzuziehen, ganz gleich, wie fest die Welt davon überzeugt schien, dass ich tatsächlich bereits weitergezogen war. Er war immer bei mir, immer in meinen Gedanken, und immer zwang er mich, mich selbst zu befragen.
„Du siehst aus, als wärest du bereit, es mit einer ganzen Armee aufzunehmen.“
Ich tauchte aus meinen dunklen Gedanken auf. So fixiert war ich auf Dimitri und seinen Brief gewesen, dass ich auf dem Weg quer über den Campus nichts von der Welt wahrgenommen hatte, nicht einmal Lissa, meine beste Freundin, die sich mir gerade mit einem mild spöttischen Lächeln auf dem Gesicht anschloss. Es kam nur selten vor, dass sie mich irgendwie überraschte, denn wir teilten ein psychisches Band, das dafür sorgte, dass ich ihre Gegenwart und ihre Gefühle stets wahrnehmen konnte. Ich musste also ziemlich abgelenkt sein, um sie nicht zu bemerken, und wenn mich jemals etwas abgelenkt hatte, dann war es diese Morddrohung.
Ich schenkte Lissa ein Lächeln, von dem ich hoffte, dass es überzeugend wirkte. Sie wusste, was mit Dimitri geschehen war und dass er nur darauf wartete, mich zu töten, nachdem ich – erfolglos – versucht hatte, ihn zu töten. Nichtsdestoweniger machten ihr die Briefe, die ich jede Woche von ihm bekam, Sorgen. Und sie hatte schon genug Probleme mit ihrem eigenen Leben, ohne dass mein untoter Stalker auch noch auf die Liste kam.
„Irgendwie nehme ich es wirklich mit einer ganzen Armee auf“, stellte ich fest. Es war früh am Abend, aber im Spätsommer stand die Sonne zu dieser Zeit noch immer am Himmel von Montana und tauchte uns in ein goldenes Licht. Ich fand es zwar herrlich, aber als Moroi – ein friedfertiger, lebendiger Vampir – würde Lissa irgendwann durch das Licht geschwächt werden und sich unbehaglich fühlen.
Lachend warf sie sich das platinblonde Haar über die Schulter. Die Sonne ließ die helle Farbe in einem engelsgleichen Leuchten erscheinen. „Ja, wahrscheinlich. Ich dachte gar nicht, dass du dir solche Sorgen machen würdest.“
Ich konnte ihren Gedankengang verstehen. Selbst Dimitri hatte gesagt, dies wäre doch nur Zeitverschwendung für mich. Schließlich war ich nach Russland gegangen, um nach ihm zu suchen, hatte realen Strigoi gegenübergestanden – und eine ganze Anzahl von ihnen sogar eigenhändig getötet. Vielleicht hätte ich vor den bevorstehenden Prüfungen keine Angst haben sollen, aber all das Trara und die Erwartung der anderen lasteten plötzlich schwer auf mir. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Was, wenn ich es nicht konnte? Was, wenn ich nicht so gut war, wie ich dachte? Die Wächter, die mich hier herausforderten, mochten vielleicht keine echten Strigoi sein, aber sie waren immerhin geübt und hatten schon erheblich länger gekämpft als ich. Arroganz konnte mir eine Menge Scherereien eintragen, und wenn ich scheiterte, würde ich es vor all den Leuten tun, denen doch an mir lag. Vor all diesen Leuten, die solches Vertrauen in mich hatten.
Aber noch etwas bereitete mir Kopfzerbrechen.
„Ich mache mir Sorgen: wegen des Einflusses, den diese Zensuren auf meine Zukunft haben“, sagte ich. Das war die Wahrheit. Die Prüfungen waren für eine Wächternovizin wie mich das Abschlussexamen an der St. Vladimir’s Academy. Wie ich sie bestand, gab den Ausschlag dafür, welchem Moroi ich als Wächter zugeteilt werden würde.
Durch unser Band spürte ich Lissas Mitgefühl – und auch ihre Sorge. „Alberta denkt, es bestünde eine gute Chance, dass wir zusammenbleiben können – und dass du nach wie vor meine Wächterin sein wirst.“
Ich verzog das Gesicht. „Ich vermute, Alberta hat das nur gesagt, um zu verhindern, dass ich die Schule verlasse.“ Ich war vor einigen Monaten von der Akademie abgegangen, um nach Dimitri zu suchen, und dann nach dem Teilerfolg meiner Mission an die Schule zurückgekehrt – etwas, das in meiner akademischen Akte allerdings nicht gut aussah. Außerdem war da noch die winzige Tatsache, dass mich die Königin der Moroi, Tatiana, hasste und wahrscheinlich alle Hebel in Bewegung setzen würde, um Einfluss auf meine Zuteilung zu nehmen. Aber das war eine andere Geschichte. „Ich vermute, Alberta weiß, dass sie mir nur unter einer einzigen Bedingung erlauben würden, dich zu beschützen: Ich müsste die letzte Wächterin auf Erden sein. Und selbst dann wären meine Chancen immer noch ziemlich gering.“
Vor uns wurde das Brüllen einer großen Menge laut. Einer der vielen Sportplätze der Schule war in eine Arena verwandelt worden, die es wahrscheinlich mit einer Einrichtung aus den römischen Gladiatorentagen aufnehmen konnte. Die Tribünen waren ausgebaut worden, und statt schlichter Holzsitze standen jetzt luxuriös gepolsterte Bänke dort, mit Markisen überdacht, die die Moroi vor der Sonne schützen sollten. Rings um den Platz flatterten Banner in bunten Farben im Wind. Ich konnte sie zwar noch nicht sehen, aber ich wusste, dass in der Nähe des Stadioneingangs irgendeine Art von Baracke erbaut worden war; mit flatternden Nerven warteten dort die Novizen. Der Sportplatz selbst war gewiss in einen Hinderniskurs für gefährliche Tests umgewandelt worden. Und nach dem ohrenbetäubenden Jubel zu schließen hatten sich bereits viele Zuschauer eingefunden, um diesem Ereignis beizuwohnen.
„Ich gebe die Hoffnung nicht auf“, sagte Lissa. Durch das Band spürte ich, dass sie es ernst meinte. Ihr unerschütterlicher Glaube und ihre Zuversicht, die selbst den schrecklichsten Martyrien standhielt, hatte sie schon immer ausgezeichnet. So stand sie in einem scharfen Gegensatz zu meinem gerade erst erworbenen Zynismus. „Und ich habe etwas, das dir heute vielleicht helfen wird.“
Sie blieb stehen, griff in die Tasche ihrer Jeans und förderte einen kleinen, silbernen Ring zutage, der mit winzigen Steinen bedeckt war, die wie Peridot aussahen.
Ich brauchte kein Band, um zu verstehen, was sie mir da anbot.
„Oh, Liss … Ich weiß nicht. Ich will keinen, ähm, unfairen Vorteil.“
Lissa verdrehte die Augen. „Das ist doch nicht das Problem, und du weißt das auch. Dieser Ring ist ganz okay, ich schwöre es.“
Der Ring, den sie mir anbot, war ein Amulett, getränkt in jene seltene Art von Magie, über die sie gebot. Alle Moroi besaßen die Kontrolle über eins der fünf Elemente. Erde, Luft, Wasser, Feuer oder Geist. Geist war das seltenste – so selten, dass seine Kontrolle im Lauf der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten war. Dann waren Lissa und einige andere in letzter Zeit als Benutzer von Geist hervorgetreten. Im Gegensatz zu anderen Elementen, die ihrem Wesen nach körperlicherer Natur waren, knüpfte sich Geist an den Verstand und an alle möglichen psychischen Phänomene. Niemand verstand dieses Element zur Gänze.
Die Fertigung von Zaubern mit Geist war etwas, womit Lissa erst kürzlich zu experimentieren begonnen hatte – und sie war nicht sehr geschickt darin. Ihre größte Geistfähigkeit war das Heilen, daher versuchte sie immer wieder, heilende Zauber zu fertigen. Der letzte war ein Armband gewesen, das meinen Arm allerdings versengt hatte.
„Dieser Ring funktioniert. Nur ein wenig, aber er wird helfen, während der Prüfung die Dunkelheit fernzuhalten.“
Ihr Tonfall klang unbekümmert, aber wir wussten beide um den Ernst ihrer Worte. All die Gaben des Geistes hatten diesen Preis: eine Dunkelheit, die sich in Form von Wut und Verwirrung zeigte und die zu guter Letzt zu Wahnsinn führte. Eine Dunkelheit, die durch unser Band auch manchmal in mich einsickerte. Man hatte Lissa und mir erklärt, dass wir sie mit Zaubern und ihrer Heilkunst abwehren könnten. Auch das war etwas, das wir noch nicht gemeistert hatten.
Gerührt von ihrer Anteilnahme schenkte ich ihr ein schwaches Lächeln – und nahm den Ring an. Er verbrühte mir nicht die Hand, was ich als ein vielversprechendes Zeichen wertete. Der Ring war winzig und passte nur an meinen kleinen Finger. Als ich ihn überstreifte, spürte ich nicht das Geringste. Manchmal war das bei heilenden Zaubern so. Oder es konnte auch bedeuten, dass der Ring vollkommen unwirksam war. Wie auch immer, er hatte zumindest keinen Schaden angerichtet.
„Danke“, sagte ich. Ich spürte die Freude, die in ihr aufstieg, dann setzten wir unseren Weg fort.
Ich streckte die Hand aus und bewunderte das Glitzern der grünen Steine. Schmuck war keine besonders gute Idee, wenn es um die Art von körperlichen Prüfungen ging, die mir bevorstanden. Aber ich würde Handschuhe tragen, um ihn zu verdecken.
„Schwer zu glauben, dass wir nach diesen Prüfungen hier fertig und draußen in der realen Welt sein werden“, überlegte ich zwar laut, dachte über meine Worte aber nicht richtig nach.
Lissa versteifte sich, und ich bedauerte sofort, dies gesagt zu haben. Draußen in der realen Welt zu sein bedeutete, dass Lissa und ich eine Aufgabe in Angriff nehmen würden, bei der zu helfen sie mir vor einigen Monaten – unglücklich – versprochen hatte.
In Sibirien hatte ich erfahren, dass es möglicherweise einen Weg gab, um Dimitri wieder in einen Dhampir, wie ich einer war, zurückzuverwandeln. Es war eine wüste Theorie – wahrscheinlich eine Lüge –, und wenn man bedachte, wie sehr er darauf fixiert war, mich zu töten, gab ich mich keinen Illusionen hin. Mir bliebe gewiss nichts anderes übrig, als ihn zu töten, wenn es auf die Frage Er oder ich hinauslief. Aber wenn es eine Möglichkeit gab, ihn retten zu können, bevor das geschah, musste ich mehr darüber in Erfahrung bringen.Bedauerlicherweise hatten wir bisher nur eine einzige Spur, wie wir dieses Wunder wahr machen konnten, und das war ein Verbrecher. Und nicht irgendein Verbrecher, sondern ausgerechnet Victor Dashkov, ein königlicher Moroi, der Lissa gefoltert und uns mit allen möglichen Gräueltaten das Leben zur Hölle gemacht hatte. Der Gerechtigkeit war Genüge getan worden: Man hatte Victor ins Gefängnis gesperrt – was die Dinge nur noch komplizierter machte. Wir hatten herausgefunden, dass er, solange ihm ein Leben hinter Gittern bestimmt war, keinen Grund sah, sein Wissen über seinen Halbbruder mit anderen zu teilen – und dieser Halbbruder war die einzige Person, die angeblich schon einmal einen Strigoi gerettet hatte. Ich war – wahrscheinlich unbegründet – zu dem Schluss gekommen, dass Victor uns die Information geben würde, wenn wir ihm das anboten, was ihm sonst niemand anbieten konnte: die Freiheit.
Die Idee war aus einer ganzen Anzahl von Gründen keineswegs narrensicher. Erstens wusste ich nicht, ob es überhaupt funktionieren würde. Das war doch eine ziemlich große Sache. Zweitens hatte ich keine Ahnung, wie man einen Gefängnisausbruch inszenierte, geschweige denn, dass ich wusste, wo sich sein Gefängnis überhaupt befand. Und zu guter Letzt gab es da noch die Tatsache, dass wir unseren Todfeind freilassen würden. Das war schon für mich niederschmetternd, aber für Lissa bedeutete es eine Katastrophe. Doch so sehr die Idee sie auch beunruhigte – und das tat sie –, sie hatte doch entschlossen geschworen, mir zu helfen. Ich hatte ihr während der letzten Monate Dutzende von Malen angeboten, sie ihres Versprechens zu entbinden, aber sie ließ sich gar nicht davon abbringen. Natürlich würde ihr Versprechen am Ende vielleicht keine Rolle spielen, wenn man bedachte, dass wir keine Möglichkeit hatten, das Gefängnis auch nur zu finden.
Ich versuchte, das verlegene Schweigen zwischen uns zu füllen, indem ich stattdessen erklärte, in Wirklichkeit davon gesprochen zu haben, dass wir ihren Geburtstag in der nächsten Woche stilgerecht würden feiern können. Meine Versuche wurden durch Stan unterbrochen, einen meiner langjährigen Lehrer. „Hathaway!“, blaffte er, während er sich uns vom Sportplatz aus näherte. „Nett von Ihnen, dass Sie sich uns anschließen. Kommen Sie jetzt mal auf der Stelle her!“
Alle Gedanken an Victor verschwanden aus Lissas Kopf. Sie umarmte mich schnell. „Viel Glück“, flüsterte sie. „Nicht dass du es brauchst.“
Stans Miene sagte mir, dass diese Zehnsekundenverabschiedung zehn Sekunden zu lange gedauert hatte. Ich schenkte Lissa ein dankbares Grinsen, dann machte sie sich auf den Weg, um unsere Freunde auf den Tribünen zu suchen, während ich hinter Stan hereilte.
„Sie haben Glück, dass Sie nicht zu den Ersten gehören“, knurrte er. „Die Leute haben sogar Wetten darauf abgeschlossen, ob Sie überhaupt auftauchen würden oder nicht.“
„Wirklich?“, fragte ich wohlgelaunt. „Welche Quoten wurden denn geboten? Denn ich könnte meine Meinung ja immer noch ändern und selbst eine Wette abgeben. Mir so ein kleines Taschengeld dazuverdienen.“
Mit zusammengekniffenen Augen warf er mir einen warnenden Blick zu, der keiner Worte bedurfte, während wir in den Wartebereich traten, der an das Sportfeld angrenzte und den Tribünen gegenüber lag. Es hatte mich in den vergangenen Jahren immer erstaunt, wie viel Arbeit in diese Prüfungen investiert wurde, und jetzt, da ich das Ganze aus der Nähe sah, war ich nicht weniger beeindruckt als früher. Die Baracke, in der die Novizen warteten, war aus Holz gebaut, komplett mit Dach. Das Gebäude sah aus, als sei es schon seit einer Ewigkeit Teil des Stadions gewesen. Es war in bemerkenswerter Geschwindigkeit errichtet worden und würde nach Ende der Prüfungen genauso schnell wieder abgebaut werden. Durch eine Tür, durch die drei Personen gleichzeitig gepasst hätten, konnte man einen Teil des Feldes sehen, wo eine meiner Klassenkameradinnen ängstlich darauf wartete, aufgerufen zu werden. Alle möglichen Hindernisse waren dort aufgestellt worden: Herausforderungen, um Balance und Koordination zu testen, während man gleichzeitig kämpfen und den erwachsenen Wächtern ausweichen musste, die hinter Gegenständen und Ecken lauern mochten. An einem Ende des Feldes waren Holzwände aufgestellt worden, die ein dunkles, verwirrendes Labyrinth schufen. Über anderen Bereichen hingen Netze und wacklige Podeste, geschaffen, um zu prüfen, wie gut wir unter schwierigen Bedingungen kämpfen konnten.
Einige der anderen Novizen drängten sich in der Tür zusammen und hofften, sich einen Vorteil verschaffen zu können, indem sie die Prüflinge vor ihnen beobachteten. Ich tat das nicht. Ich wollte blind hinausgehen, damit zufrieden, es mit allem aufzunehmen, was sie mir in den Weg warfen. Wenn ich jetzt den Parcours studierte, würde ich nur zu viel nachdenken und in Panik geraten. Was ich brauchte, war Gelassenheit.
Also lehnte ich mich an eine der Barackenwände und beobachtete die Leute um mich herum. Offenbar war ich tatsächlich die Letzte, die aufgetaucht war, und ich fragte mich, ob einige Leute wirklich Geld verloren hatten: bei Wetten auf mich. Tuschelnd standen einige meiner Klassenkameraden in Gruppen zusammen. Andere machten Dehn- und Aufwärmübungen. Wieder andere standen bei Lehrern, die ihre Mentoren gewesen waren. Diese Lehrer redeten eindringlich auf ihre Schüler ein und gaben ihnen noch in der letzten Minute Ratschläge. Ich hörte immer wieder Worte wie Konzentrieren Sie sich und Ganz ruhig.
Beim Anblick der Lehrer krampfte sich mir das Herz zusammen. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte ich mir diesen Tag ganz anders ausgemalt. Ich hatte mir vorgestellt, dass Dimitri und ich beieinanderstehen würden; er hätte mir gesagt, dass ich dies ernst nehmen solle und nicht die Gelassenheit verlieren dürfe, wenn ich draußen auf dem Feld war. Alberta hatte seit meiner Rückkehr aus Russland eine Menge Zeit als meine Mentorin geopfert, aber als Hauptmann war sie jetzt selbst draußen auf dem Feld und mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Sie hatte keine Zeit, hier hereinzukommen und mir die Hand zu halten. Freunde von mir, die mir vielleicht hätten Trost bieten können – Eddie, Meredith und andere –, waren mit ihren eigenen Ängsten beschäftigt. Ich war also allein.
Ohne sie oder Dimitri – oder, nun ja, ohne überhaupt irgendjemanden – durchströmte mich ein überraschendes, schmerzhaftes Gefühl der Einsamkeit. Dies war nicht richtig so. Ich hätte nicht allein sein dürfen. Dimitri hätte hier bei mir sein sollen. So hätte es sich abspielen müssen. Ich schloss die Augen und gestattete mir, so zu tun, als sei er wirklich hier, nur wenige Zentimeter entfernt, während wir miteinander sprachen.
„Keine Sorge, Genosse. Ich schaffe das mit verbundenen Augen. Zur Hölle, vielleicht werde ich es sogar so machen. Hast du irgendetwas, das ich benutzen kann? Wenn du nett zu mir bist, erlaube ich dir sogar, mir die Augenbinde selbst anzulegen.“ Da diese Fantasie aber stattgefunden hätte, nachdem wir miteinander geschlafen hatten, bestand eine starke Wahrscheinlichkeit, dass er mir später geholfen hätte, diese Augenbinde abzulegen – neben anderen Dingen.
Ich konnte das entnervte Kopfschütteln, das mir das eingetragen hätte, sehr genau vor mir sehen. „Rose, ich schwöre, manchmal fühlt es sich so an, als sei jeder Tag mit dir meine eigene persönliche Prüfung.“
Aber ich wusste, er hätte trotzdem gelacht, und der Blick des Stolzes und der Ermutigung, den er mir geschenkt hätte, bevor ich aufs Feld ging, wäre alles gewesen, was ich gebraucht hätte, um die Tests zu überstehen …
„Meditierst du?“
Ich öffnete die Augen, erstaunt über die Stimme. „Mom? Was machst du denn hier?“
Meine Mutter, Janine Hathaway, stand vor mir. Sie war einige Zentimeter kleiner als ich, hatte aber genug Power, um es mit jemandem aufzunehmen, der doppelt so groß war wie ich. Der gefährliche Ausdruck auf ihrem gebräunten Gesicht forderte jeden heraus, es mit ihr aufzunehmen. Sie schenkte mir ein schiefes Lächeln und stemmte eine Hand in die Hüfte.
„Hast du wirklich gedacht, ich würde nicht kommen, um dich zu beobachten?“
„Keine Ahnung“, gab ich zu und hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich an ihr gezweifelt hatte. Sie und ich, wir hatten im Laufe der Jahre nicht viel Kontakt zueinander gehabt, und erst durch die jüngsten Ereignisse – von denen die meisten schlecht gewesen waren – hatten wir allmählich begonnen, wieder eine Verbindung herzustellen. Die meiste Zeit wusste ich immer noch nicht, wie ich zu ihr stehen sollte. Ich schwankte zwischen der Sehnsucht eines kleinen Mädchens nach seiner abwesenden Mutter und dem Groll eines Teenagers, der von der Mutter verlassen worden war. Außerdem war ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihr verziehen hatte, dass sie mich bei einem Schaukampf versehentlich geboxt hatte. „Ich hab angenommen, du hättest, du weißt schon, Wichtigeres zu tun.“
„Auf keinen Fall hätte ich dies hier versäumen können.“ Mit dem Kopf deutete sie auf die Tribünen, und ihre kastanienbraunen Locken umspielten ihr Gesicht. „Das Gleiche gilt übrigens für deinen Vater.“
„Was?“
Ich eilte zur Tür und spähte hinaus. Der Ausblick auf die Tribünen war nicht gerade fantastisch, dank all der Hindernisse auf dem Platz. Aber er war doch gut genug. Und da saß er: Abe Masur. Er war mit seinem schwarzen Bart und Schnurrbart und dem smaragdgrünen Schal, den er verknotet über seinem Smokinghemd trug, leicht zu entdecken. Ich konnte sogar gerade noch das Glitzern seines goldenen Ohrrings ausmachen. Er musste in dieser Hitze schier schmelzen, aber ich vermutete, dass mehr dazu nötig war als nur ein wenig Schweiß, damit er seinen protzigen Modestil aufgab.
Wenn die Beziehung zu meiner Mutter schon flüchtig war, so war die Beziehung zu meinem Vater praktisch nicht existent. Ich hatte ihn im Mai erst kennengelernt, und selbst da hatte ich lediglich nach meiner Rückkehr herausgefunden, dass ich seine Tochter war. Alle Dhampire hatten ein Elternteil, das ein Moroi war, und in meinem Fall traf dies auf meinen Vater zu. Ich war mir immer noch nicht sicher, wie ich ihn eigentlich fand. Sein Hintergrund blieb größtenteils ein Rätsel, aber es gab jede Menge Gerüchte, nach denen er mit illegalen Geschäften zu tun hatte. Außerdem benahmen sich die Leute so, als hielte sie die Angst vor gebrochenen Kniescheiben davon ab, ihm auch nur ansatzweise in die Quere zu kommen, und obwohl ich nur wenige Anzeichen dafür gesehen hatte, überraschte es mich doch nicht besonders. In Russland nannte man ihn Zmey: die Schlange.
Während ich ihn erstaunt anstarrte, kam meine Mom herbeigeschlendert. „Er wird glücklich sein, dass du es rechtzeitig geschafft hast“, bemerkte sie. „Er hat eine große Wette laufen, ob du wohl auftauchen würdest oder nicht. Er hat sein Geld auf dich gesetzt, falls du dich dann besser fühlst.“
Ich stöhnte. „Natürlich. Natürlich ist er der Buchmacher. Ich hätte es schon wissen müssen, als …“ Mir klappte der Unterkiefer herunter. „Redet er mit Adrian?“
Jepp. Neben Abe saß Adrian Ivashkov – mehr oder weniger mein Freund. Adrian war ein königlicher Moroi – und ein weiterer Benutzer von Geist – so wie Lissa. Er war verrückt nach mir (und oft einfach nur verrückt), seit wir uns das erste Mal begegnet waren, aber ich hatte immer nur Augen für Dimitri gehabt. Nach dem Fehlschlag in Russland war ich zurückgekehrt und hatte Adrian versprochen, ihm eine Chance zu geben. Zu meiner Überraschung waren die Dinge zwischen uns … ganz gut gewesen. Eigentlich sogar großartig. Er hatte einen Aufsatz für mich geschrieben, darüber, warum es eine kluge Entscheidung sei, mit ihm auszugehen. Der Aufsatz hatte solche Dinge eingeschlossen wie: „Ich werde das Rauchen aufgeben, es sei denn, ich brauche wirklich, wirklich eine Zigarette.“ Und: „Ich werde jede Woche romantische Überraschungen inszenieren, wie zum Beispiel: ein improvisiertes Picknick, Rosen oder einen Ausflug nach Paris – aber keins dieser drei Dinge, denn die sind ja jetzt keine Überraschungen mehr.“
Das Zusammensein mit ihm war nicht so, wie es mit Dimitri gewesen war, andererseits vermutete ich aber auch, dass keine zwei Beziehungen jemals genau gleich sein können. Schließlich waren es verschiedene Männer. Ich wachte immer noch ständig auf und litt unter dem Verlust Dimitris und unserer Liebe. Ich quälte mich wegen meines Unvermögens, ihn in Sibirien zu töten und von seinem untoten Zustand zu befreien. Trotzdem, diese Verzweiflung bedeutete nicht, dass mein Liebesleben ganz vorüber war – etwas, das zu akzeptieren ich eine Weile gebraucht hatte. Es war hart weiterzuziehen, aber Adrian machte mich tatsächlich glücklich. Und für den Augenblick war das genug.
Doch das bedeutete nicht zwangsläufig, dass ich auch wollte, dass er mit meinem Piratenmafiavater auf Tuchfühlung ging.
„Sein Einfluss wird ihm nicht guttun!“, protestierte ich.
Meine Mutter schnaubte. „Ich bezweifle, dass Adrian Abe allzu sehr beeinflussen wird.“
„Nicht Adrian! Abe. Adrian versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Abe wird alles vermasseln.“ Neben dem Rauchen hatte Adrian in seinem Traktat über unsere Beziehung geschworen, er werde das Trinken und andere Laster aufgeben. Ich blinzelte zu ihm und Abe auf der überfüllten Tribüne hinüber und versuchte dahinterzukommen, welches Thema denn so interessant sein mochte. „Worüber reden sie?“
„Ich glaube, dass ist gerade jetzt das geringste deiner Probleme.“ Wenn Janine Hathaway irgendetwas war, dann praktisch. „Mach dir weniger Sorgen um die beiden und mehr um diesen Parcours hier.“
„Denkst du, sie reden über mich?“
„Rose!“ Meine Mutter versetzte mir einen leichten Schlag auf den Arm, und ich zwang mich, den Blick wieder auf sie zu richten. „Du musst das ernst nehmen. Bleib ruhig und lass dich nicht ablenken.“
Ihre Worte waren dem, was Dimitri in meiner Fantasie gesagt hatte, so ähnlich, dass sich ein kleines Lächeln in meine Züge stahl. Ich war also doch nicht allein hier draußen.
„Was ist denn so komisch?“, fragte sie argwöhnisch.
„Nichts“, erwiderte ich und umarmte sie. Zuerst war sie steif und dann entspannt, und schließlich erwiderte sie meine Umarmung sogar für einen Moment, bevor sie zur Seite trat. „Ich bin froh, dass du hier bist.“
Meine Mutter war nicht der übermäßig liebevolle Typ, und ich musste sie überrascht haben. „Nun“, sagte sie, offensichtlich verwirrt, „ich habe dir ja gesagt, dass ich dies nicht versäumen wollte.“
Ich sah zu den Tribünen hinüber. „Was dagegen Abe betrifft, bin ich mir nicht so sicher.“
Oder … Moment mal. Mir kam ein seltsamer Gedanke. Nein, doch nicht so seltsam. Zwielichtig oder nicht, Abe hatte Beziehungen – Beziehungen, die weit genug reichten, um eine Nachricht zu Victor Dashkov ins Gefängnis zu schmuggeln. Abe war derjenige gewesen, der nach Informationen über Robert Doru gefragt hatte – das war Victors ebenfalls geistnutzender Bruder – , um mir einen Gefallen zu tun. Als Victor daraufhin die Nachricht geschickt hatte, dass er keinen Grund habe, Abe in dieser Hinsicht zu helfen, hatte ich die Unterstützung meines Vaters prompt abgeschrieben und sofort die Idee zu einem Gefängnisausbruch entwickelt. Aber jetzt …
„Rosemarie Hathaway!“
Es war Alberta, die mich aufrief, ihre Stimme tönte laut und klar über den Platz. Sie war wie eine Trompete, wie ein Ruf in die Schlacht. Alle Gedanken an Abe und Adrian – und ja, selbst an Dimitri – verschwanden plötzlich aus meinem Kopf. Ich glaube, meine Mutter wünschte mir noch viel Glück, aber der genaue Wortlaut entging mir, während ich auf Alberta zuschritt. Adrenalin schoss in meine Adern. Meine ganze Aufmerksamkeit war jetzt auf das gerichtet, was vor mir lag: Die Prüfung, die mich endlich zur Wächterin machen würde.
2
Meine Prüfungen waren wie ein Nebel.
Da sie den wichtigsten Teil meiner Ausbildung in St. Vladimir darstellten, sollte man meinen, dass ich alles in perfekten, kristallenen Details im Gedächtnis behalten hätte. Doch es trat genau das ein, was mir schon vorher durch den Kopf gegangen war. Wie konnte dies an das heranreichen, was ich bereits erlebt hatte? Wie konnten sich diese gestellten Kämpfe mit einem Mob von Strigoi vergleichen lassen, die über unsere Schule herfielen? Ich hatte bei diesen Kämpfen überwältigend schlechte Chancen gehabt und nicht gewusst, ob jene, die ich liebte, noch lebten oder bereits tot waren. Und wie konnte ich, nachdem ich mit Dimitri gekämpft hatte, einen sogenannten Kampf mit einem der Lehrer der Schule fürchten? Dimitri war so gefährlich gewesen wie ein Dhampir und noch schlimmer als ein Strigoi.
Nicht dass ich vorhatte, die Prüfungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie waren ernst. Novizen fielen ständig durch, und ich hatte keineswegs die Absicht, einer davon zu sein. Ich wurde von allen Seiten angegriffen, von Wächtern, die für Moroi gekämpft und sie verteidigt hatten, noch bevor ich geboren worden war. Die Arena war nicht eben, was alles noch komplizierter machte. Sie hatten sie mit Gerätschaften und Hindernissen gefüllt, Balken und Stufen, die mein Gleichgewicht prüften – darunter eine Brücke, die mich schmerzhaft an jene letzte Nacht erinnerte, in der ich Dimitri gesehen hatte. Ich hatte ihn hinuntergestoßen, nachdem ich ihm einen silbernen Pflock ins Herz gerammt hatte – einen Pflock, der allerdings während seines Sturzes hinab in den Fluss aus seinem Fleisch gefallen war.
Die Brücke der Arena unterschied sich ein wenig von jener Brücke aus massivem Holz, auf der ich in Sibirien mit Dimitri gekämpft hatte. Diese war wacklig gewesen, ein schlampig errichteter Bohlenweg, der nur Seile als Geländer besaß. Bei jedem Schritt zitterte die ganze Brücke und schwang hin und her. Löcher in den Brettern zeigten mir, wo ehemalige Klassenkameraden (zu ihrem Pech) Schwachstellen entdeckt hatten. Der Test, den sie auf der Brücke für mich bereithielten, war höchstwahrscheinlich der schlimmste von allen. Mein Ziel war es, einen Moroi von einer Gruppe von Strigoi, die mich verfolgte, zu entfernen. Mein Moroi wurde von Daniel gespielt, einem neuen Wächter, der zusammen mit anderen an die Schule gekommen war, um all jene zu ersetzen, die bei dem Angriff getötet worden waren. Ich kannte ihn noch nicht sehr gut, aber für diese Übung stellte er sich vollkommen fügsam und hilflos – sogar ein wenig furchtsam, genauso wie jeder Moroi, den ich bewachte, hätte empfinden können.
Er leistete ein wenig Widerstand, als es darum ging, auf die Brücke zu treten, und ich benutzte meinen ruhigsten, schmeichelndsten Tonfall, um ihn endlich dazu zu bewegen vorauszugehen. Offenbar testeten sie ebenso unsere Fähigkeit der Menschenführung wie unsere Kampfkraft. Nicht weit hinter uns näherten sich, wie ich wusste, die Wächter, die die Strigoi spielten.
Daniel trat vor, und ich war sein Schatten und sprach weiter beruhigend auf ihn ein, während all meine Sinne hellwach waren. Die Brücke schwang wild hin und her, und jäh begriff ich, dass unsere Verfolger zu uns gestoßen waren. Ich schaute zurück und sah drei Strigoi hinter uns. Die Wächter, die sie spielten, machten ihre Sache bemerkenswert gut – sie bewegten sich mit ebenso großem Geschick und der gleichen Schnelligkeit, wie echte Strigoi es tun würden. Wenn wir nicht einen Zahn zulegten, würden sie uns überholen.
„Sie machen das großartig“, sagte ich zu Daniel. Es fiel mir schwer, den richtigen Tonfall beizubehalten. Wenn man einen Moroi anschrie, bekam er vielleicht einen Schock. Zu große Sanftheit würde ihn dagegen auf den Gedanken bringen, dass die Situation nicht ernst war. „Und ich weiß, dass Sie sich schneller bewegen können. Wir müssen unseren Vorsprung halten – die Strigoi kommen näher. Ich weiß, dass Sie das schaffen können. Kommen Sie.“
Ich musste diesen überzeugenden Teil der Prüfung bestanden haben, denn Daniel beschleunigte tatsächlich seinen Schritt – es genügte nicht ganz, um dem Tempo unserer Verfolger gerecht zu werden, aber es war immerhin ein Anfang. Wieder wackelte die Brücke wie verrückt. Daniel stieß einen überzeugenden, schrillen Schrei aus, erstarrte und hielt sich an den Seilen fest. Vor ihm sah ich einen weiteren Strigoi am gegenüberliegenden Ende der Brücke warten. Ich glaubte, sein Name lautete Randall, er war ein weiterer neuer Lehrer. Ich war zwischen ihm und der Gruppe hinter mir eingekeilt. Aber Randall blieb still stehen und wartete auf dem ersten Brett der Brücke, so dass er sie schütteln und die Überquerung für uns erschweren konnte.
„Gehen Sie weiter“, drängte ich, während sich meine Gedanken überschlugen. „Sie können es schaffen.“
„Aber da ist ein Strigoi! Wir sitzen in der Falle“, rief Daniel.
„Keine Sorge. Ich werde mich um ihn kümmern. Gehen Sie einfach.“
Diesmal klang meine Stimme düster, und Daniel schlich weiter, getrieben von meinem Befehl. Die nächsten Sekunden verlangten ein perfektes Timing von mir. Ich musste die Strigoi zu beiden Seiten beobachten und Daniel in Bewegung halten. Die ganze Zeit über musste ich den Überblick darüber behalten, wo auf der Brücke wir uns befanden. Als wir fast drei Viertel des Weges zurückgelegt hatten, zischte ich: „Lassen Sie sich sofort auf alle viere fallen! Schnell!“
Er gehorchte und blieb stehen. Ich kniete mich unverzüglich hin, wobei ich leise weitersprach: „Ich werde Sie jetzt gleich anschreien. Ignorieren Sie das einfach.“ Mit lauterer Stimme rief ich, damit die Strigoi hinter uns es hörten: „Was tun Sie da? Wir dürfen doch nicht stehen bleiben!“
Daniel rührte sich nicht von der Stelle, und ich sprach wieder leiser: „Gut so. Sehen Sie, wo die Seile die Bretter mit dem Geländer verbinden? Halten Sie sich daran fest. Halten Sie sich so gut fest, wie Sie können, und lassen Sie nicht los, was auch immer geschehen mag. Wenn nötig, wickeln Sie sich die Seile um die Hände. Tun Sie es jetzt!“
Er gehorchte. Die Uhr tickte, und ich verschwendete keinen weiteren Moment. Mit einer einzigen Bewegung und ohne mich aus der Hocke aufzurichten, drehte ich mich um und sägte mit einem Messer, das man mir neben meinem Pflock noch gegeben hatte, an den Seilen. Die Klinge war scharf, Gott sei Dank. Die Wächter, die die Prüfung leiteten, pfuschten nicht herum. Das Messer durchtrennte die Seile nicht sofort, aber ich zerschnitt sie so schnell, dass der Strigoi auf der anderen Seite keine Zeit zum Reagieren hatte.
Die Seile rissen genau zu dem Zeitpunkt, in dem ich Daniel einmal mehr daran erinnerte, sich festzuhalten. Die beiden Hälften der Brücke schwangen auf ihr hölzernes Gerüst zu, gezogen von dem Gewicht der Personen, die sich darauf befanden. Nun, unsere Hälfte tat es zumindest. Daniel und ich waren vorbereitet gewesen. Die drei Verfolger hinter uns jedoch nicht. Zwei fielen. Einem gelang es mit knapper Not, sich an einem Brett festzuhalten und es ein wenig zu verschieben, bevor er seinen Griff absicherte. Die tatsächliche Fallhöhe betrug etwa einen Meter achtzig, aber man hatte mir schon erklärt, ich solle so tun, als seien es mindestens fünfzehn Meter – eine Höhe, die Daniel und mich töten würde, falls wir stürzten.
Gegen alle Wahrscheinlichkeit hielt er sich noch immer am Seil fest. Ich tat das Gleiche, und sobald das Seil und das Holz flach auf den Seiten des Gerüsts auflagen, kletterte ich wie an einer Leiter daran hinauf. Es war nicht einfach, über Daniel zu steigen, aber ich schaffte es und bekam eine weitere Chance zu sagen, dass er sich festhalten solle. Randall, der vor uns gewartet hatte, war nicht gestürzt. Er hatte jedoch auf der Brücke gestanden, als ich sie durchgeschnitten hatte, und war überrascht genug gewesen, um das Gleichgewicht zu verlieren. Nachdem er sich schnell wieder erholt hatte, versuchte er jetzt, an den Seilen bis zum Ende der Brücke hinaufzuklettern. Er war seinem Ziel viel näher als ich, doch es gelang mir, ihn am Bein zu packen und aufzuhalten. Ich zog ihn zu mir her. Er konnte sich weiter an der Brücke festhalten, und so kämpften wir. Ich wusste, dass ich ihn wahrscheinlich nicht herunterziehen konnte, aber ich schaffte es immerhin, näher heranzukommen. Schließlich ließ ich das Messer in meiner Hand los und schaffte es, den Pflock aus meinem Gürtel zu ziehen – eine Bewegung, die mein Gleichgewicht auf die Probe stellte. Randalls unbeholfene Position verschaffte mir die freie Bahn zu seinem Herzen, und ich nutzte diese Chance.
Für die Prüfung hatten wir Pflöcke mit stumpfer Spitze, die die Haut nicht durchstechen würden, die wir jedoch mit genügend Wucht benutzen konnten, um unsere Gegner davon zu überzeugen, dass wir wussten, was wir taten. Mein Treffer war großartig, und Randall, der einräumte, dass es ein tödlicher Angriff gewesen wäre, löste die Hände von den Seilen und ließ sich von der Brücke fallen.
Jetzt blieb nur noch die quälende Aufgabe, Daniel zu beschwatzen hinaufzuklettern. Es dauerte lange, aber auch diesmal benahm er sich genauso, wie ein verängstigter Moroi es vielleicht täte. Ich war dafür dankbar, dass er nicht zu dem Schluss gekommen war, dass sich ein richtiger Moroi nicht so lange hätte festhalten können und gestürzt wäre.
Nach dieser Herausforderung kamen noch viele weitere, aber ich verlangsamte mein Tempo nicht und ließ mich auch nicht von Erschöpfung beeinträchtigen. Ich verfiel in den Kampfmodus, konzentrierte meine Sinne auf elementare Instinkte: kämpfen, ausweichen, töten.
Und während ich mich auf diese Dinge ausrichtete, musste ich weiterhin erfindungsreich sein und mich nicht einlullen lassen. Andernfalls würde ich auf eine Überraschung wie die Brücke nicht reagieren können. Ich wurde mit allem fertig und mühte mich weiter, ohne an irgendetwas anderes zu denken als an die Erfüllung der vor mir liegenden Aufgaben. Ich versuchte, meine Lehrer nicht als Leute zu betrachten, die ich kannte. Ich behandelte sie wie Strigoi. Ich hielt mich nicht zurück.
Als ich endlich fertig war, hätte ich es beinahe nicht bemerkt. Ich stand einfach nur in der Mitte des Feldes und wurde nicht länger angegriffen. Ich war allein. Allmählich nahm ich die Einzelheiten der Welt um mich herum wieder deutlicher wahr. Die Menge auf den Tribünen, die jubelte. Einige Lehrer, die einander zunickten, während sie in den Applaus einstimmten. Das Hämmern meines eigenen Herzens.
Erst als eine grinsende Alberta an meinem Arm zog, wurde mir klar, dass es vorüber war. Die Prüfung, auf die ich mein Leben lang gewartet hatte, vollendet in einer Zeitspanne, die sich wie ein einziger Wimpernschlag angefühlt hatte.
„Kommen Sie“, sagte sie, legte mir einen Arm um die Schultern und führte mich auf den Ausgang zu. „Sie brauchen etwas Wasser und sollten sich hinsetzen.“
Benommen ließ ich mich vom Feld führen, an dessen Rändern die Leute noch immer jubelten und meinen Namen riefen. Hinter uns hörte ich jemanden sagen, sie müssten eine Pause einlegen und die Brücke reparieren. Alberta brachte mich in den Wartebereich und drückte mich sanft auf eine Bank. Jemand anders setzte sich neben mich und reichte mir eine Wasserflasche. Ich schaute hinüber und sah meine Mutter. Ihr Gesicht hatte einen Ausdruck, den ich noch nie zuvor gesehen hatte: purer, strahlender Stolz.
„Das war’s also?“, fragte ich schließlich.
Sie überraschte mich abermals mit einem ehrlich erheiterten Gelächter. „Das war’s?“, wiederholte sie. „Rose, du warst fast eine Stunde dort draußen. Du bist mit fliegenden Fahnen durch diese Prüfung gerauscht – wahrscheinlich eine der besten Prüfungen, die diese Schule je gesehen hat.“
„Wirklich? Es fühlte sich nur so …“ Einfach war nicht das richtige Wort. „Es war wie ein Nebel, das ist alles.“
Meine Mom drückte mir die Hand. „Du warst umwerfend. Ich bin ja so stolz auf dich.“
Dann begriff ich erst wirklich – und spürte, dass sich ein Lächeln auf meinen eigenen Lippen ausbreitete. „Wie geht es jetzt weiter?“, fragte ich.
„Jetzt wirst du zu einer Wächterin.“
Ich war viele Male tätowiert worden, aber keins dieser Ereignisse reichte auch nur ansatzweise an das Zeremoniell und den Trubel heran, mit denen die Tätowierung meines Mals des Versprechens einherging. Bisher hatte ich Molnijas für Tötungen von Strigoi erhalten, die mir unter unerwarteten, tragischen Umständen gelungen waren: im Kampf gegen die Strigoi in Spokane, bei der Abwehr des Strigoi-Angriffs auf die Schule – Ereignisse, die Grund zur Trauer waren, nicht zum Feiern. Ich hatte so viele Strigoi zur Strecke gebracht, dass wir irgendwie den Überblick verloren hatten, und während die Tätowierungskünstler unter den Wächtern noch immer versuchten, jeden einzelnen getöteten Strigoi zu verzeichnen, hatten sie mir schließlich eine sternenförmige Tätowierung gemacht, die eine fantasievolle Art war, um zu sagen, dass ich in einer wahren Schlacht gekämpft und wir den Überblick verloren hatten.
Das Tätowieren ist kein schneller Prozess, selbst wenn man nur eine kleine Tätowierung bekommt, und meine gesamte Abschlussklasse musste versorgt werden. Die Zeremonie fand in dem Raum statt, der für gewöhnlich der Speisesaal der Akademie war, ein Raum, den die Wächter auf bemerkenswerte Weise zu etwas so Großartigem und Kunstvollem umwandeln konnten, wie wir es am Königshof vorfanden. Zuschauer – Freunde, Verwandte, Wächter – füllten den Saal, während uns Alberta nacheinander aufrief und unsere Punktezahl verlas, wobei wir selbst auf den Tätowierer zugingen. Die Punkte waren wichtig. Sie würden öffentlich gemacht werden und hatten zusammen mit unseren allgemeinen Schulzensuren Einfluss auf unsere Zuteilungen. Moroi konnten bestimmte Zensuren für ihre Wächter erbitten. Lissa hatte natürlich um mich gebeten, aber nicht einmal die besten Punktezahlen der Welt würden wohl all die Missetaten aufwiegen können, die in meiner Akte vermerkt waren.
Es waren jedoch keine Moroi bei dieser Zeremonie zugegen, abgesehen von den wenigen, die die frischgebackenen Absolventen eingeladen hatten. Alle anderen Anwesenden waren Dhampire: entweder etablierte Wächter oder zukünftige Wächter wie ich. Die Gäste saßen im hinteren Teil des Raums, und die ranghöchsten Wächter saßen vorn. Meine Klassenkameraden und ich standen während der ganzen Zeremonie, vielleicht als eine Art letzte Prüfung unserer Ausdauer.
Mir machte es nichts aus. Ich hatte meine zerrissenen, schmutzigen Kleider abgelegt und schlichte Baumwollhosen und einen Pullover angezogen, ein Outfit, das gleichzeitig schick und etwas feierlich schien. Es war eine gute Wahl, weil die Luft im Raum vor Anspannung zum Schneiden dick war. Alle Gesichter zeigten eine Mischung aus Freude über unseren Erfolg und Sorge, was unsere neue und tödliche Rolle in der Welt betraf. Ich sah mit leuchtenden Augen zu, wie meine Freunde aufgerufen wurden, überrascht und beeindruckt über viele der Punktezahlen.
Eddie Castile, ein enger Freund, schnitt im Personenschutz besonders gut ab. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, während ich beobachtete, wie der Tätowierer Eddie seine Markierung eintrug. „Ich frage mich, wie er seinen Moroi über die Brücke bekommen hat“, murmelte ich leise. Eddie war ziemlich erfinderisch.
Neben mir stand eine andere Freundin, Meredith, die mich verwirrt ansah. „Wovon redest du?“ Sie sprach genauso leise.
„Wir wurden mit einem Moroi auf die Brücke gejagt. Meiner war Daniel.“ Sie wirkte noch immer ratlos, und ich holte zu einer genaueren Erklärung aus. „An beiden Enden der Brücke hatten sie Strigoi postiert.“
„Ich habe die Brücke überquert“, flüsterte sie, „aber ich war allein, als sie mich gejagt haben. Ich habe meinen Moroi durch ein Labyrinth geführt.“
Ein wütender Blick von einem anderen Klassenkameraden in unserer Nähe brachte uns zum Schweigen, und ich verbarg mein Stirnrunzeln. Vielleicht war ich nicht die Einzige, die die Prüfung wie in einem Nebel durchlaufen hatte. Meredith hatte da etwas durcheinandergebracht.
Als mein Name aufgerufen wurde, hörte ich einige Leute nach Luft schnappen, als Alberta meine Punktezahl verlas. Bisher hatte ich von allen am besten abgeschlossen. Und ich war irgendwie froh darüber, dass sie meine akademischen Zensuren nicht auch verlas. Sie hätten dem Rest meiner Darbietung ganz und gar den Glanz genommen. Ich hatte in meinen Kampfkursen immer gute Leistungen gebracht, aber Mathe und Geschichte … nun, da ließen die Noten ein wenig zu wünschen übrig, vor allem, da ich offenbar die halbe Zeit von der Schule abgegangen und zurückgekommen war.
Mein Haar wurde zu einem festen Knoten gesteckt und jede einzelne Strähne mit Haarnadeln befestigt, so dass der Tätowierer ungehindert arbeiten konnte. Ich beugte mich vor, um ihm einen guten Blick zu verschaffen, und hörte ihn dann überrascht aufkeuchen. Da mein Nacken bereits mit Tätowierungen bedeckt war, würde er einfallsreich sein müssen. Im Allgemeinen war ein frischgebackener Wächter ein unbeschriebenes Blatt. Dieser Bursche war jedoch ziemlich gut und schaffte es, das Mal des Versprechens doch noch in der Mitte meines Nackens anzubringen. Das Mal des Versprechens sah aus wie ein in die Länge gezogenes S mit eingerollten Enden. Er fügte es zwischen die Molnijas ein und ließ es sich wie in einer Umarmung um sie herum schlingen. Die Prozedur tat weh, aber ich behielt eine ausdruckslose Miene bei und weigerte mich zusammenzuzucken. Das endgültige Ergebnis zeigte er mir im Spiegel, bevor er es verband, damit es sauber heilen konnte.
Danach kehrte ich zu meinen Klassenkameraden zurück und beobachtete, wie die Übrigen ihre Tätowierungen erhielten. Was bedeutete, dass wir noch einmal zwei Stunden stehen mussten. Aber mir machte es nichts aus. Mir schwirrte von all dem, was heute geschehen war, noch immer der Kopf. Ich war eine Wächterin. Eine richtige, waschechte Wächterin. Und mit diesem Gedanken kamen Fragen auf. Was würde jetzt geschehen? Würde meine Punktezahl gut genug sein, um die Minuspunkte für schlechtes Benehmen in meiner Akte auszulöschen? Würde ich Lissas Wächterin werden? Und was war mit Victor? Was war mit Dimitri?
Unbehaglich trat ich von einem Fuß auf den anderen, als mir die volle Wucht der Wächterzeremonie bewusst wurde. Hier ging es nicht um Dimitri und Victor. Hier ging es um mich – um den Rest meines Lebens. Die Schule war vorüber. Es würde keine Lehrer mehr für mich geben, die jede meiner Bewegungen verfolgten oder mich korrigierten, wenn ich Fehler machte. Alle Entscheidungen würden bei mir liegen, wenn ich dort draußen war und jemanden beschützte. Moroi und jüngere Dhampire würden mich als Autorität betrachten. Und ich würde nicht länger den Luxus haben, mich in der einen Minute im Kampf zu üben und in der nächsten in meinem Zimmer herumzulungern. Es würde keine Kurse mehr geben. Ich würde ständig im Dienst sein. Der Gedanke war erschreckend, der Druck beinahe zu groß. Ich hatte den Abschluss immer mit Freiheit gleichgesetzt. Jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. Welche neue Form würde mein Leben annehmen? Wer würde darüber entscheiden? Und wie konnte ich Victor erreichen, wenn ich als Wächterin jemand anderem als Lissa zugeteilt wurde?
Quer durch den Raum fing ich Lissas Blick auf. In ihren Augen brannte ein Stolz, der dem meiner Mutter gleichkam, und sie grinste, als sich unsere Blicke trafen.
Nimm diesen Ausdruck vom Gesicht, tadelte sie mich durch das Band. Du solltest nicht so ängstlich dreinschauen, nicht heute. Du musst doch feiern.
Ich wusste, dass sie recht hatte. Ich konnte mit dem, was nun kam, fertigwerden. Meine Sorgen, die zahlreich schienen, konnten noch einen Tag länger warten – insbesondere, da die überschwängliche Stimmung meiner Freunde und meiner Familie sicherstellte, dass ich tatsächlich feiern würde. Abe hatte mit seinem Einfluss, der sich praktisch überallhin zu erstrecken schien, einen kleinen Festsaal gemietet und eine Party für mich arrangiert, die eher einer königlichen Debütantin angemessen schien, nicht aber irgendeinem niederen, verwegenen Dhampir.
Vor dem Fest zog ich mich noch einmal um. Hübschere Partykleider schienen mir jetzt angemessener zu sein als mein formelles Outfit für die Zeremonie. Ich zog ein kurzärmeliges, smaragdgrünes Etuikleid an und hängte mir meinen Nazar um den Hals, obwohl er nicht dazu passte. Der Nazar war ein kleiner Anhänger, der wie ein Auge aussah, mit verschiedenen Blauschattierungen, die ihn umrahmten. In der Türkei, Abes Heimatland, glaubte man daran, dass er Schutz bot. Abe hatte ihn vor Jahren meiner Mutter geschenkt, und sie hatte ihn ihrerseits mir geschenkt.
Nachdem ich mich geschminkt und mein verheddertes Haar zu langen, dunklen Wellen gebürstet hatte (denn meine Tätowierungsverbände passten überhaupt nicht zu dem Kleid), sah ich kaum noch wie jemand aus, der imstande war, gegen Ungeheuer zu kämpfen oder auch nur einen Boxhieb zu landen. Nein – das war auch wieder nicht ganz wahr, begriff ich einen Moment später. Als ich in den Spiegel blickte, sah ich zu meiner Überraschung einen gehetzten Ausdruck in meinen braunen Augen. In ihnen lag Schmerz, Schmerz und Verlust, den nicht einmal das hübscheste Kleid und das perfekteste Make-up verbergen konnten.
Ich ignorierte es jedoch und machte mich auf den Weg zur Party, wobei ich prompt Adrian über den Weg lief, kaum dass ich mein Wohnheim verlassen hatte. Ohne ein Wort riss er mich in die Arme und erstickte mich mit einem Kuss. Es erwischte mich vollkommen unerwartet. Was ganz passend war. Untote Kreaturen überraschten mich nicht, aber ein schnippischer königlicher Moroi vermochte dies durchaus.
Und was war das für ein Kuss, dem ich mich mit beinahe schlechtem Gewissen hingab. Als ich anfangs mit Adrian ausgegangen war, hatte ich noch Sorgen gehabt, aber viele von ihnen waren mit der Zeit verschwunden. Nachdem ich ihn so lange beobachtet hatte, wie er schamlos flirtete und nichts ernst nahm, hatte ich niemals erwartet, in unserer Beziehung eine solche Hingabe von seiner Seite zu erleben. Ich hatte auch nicht erwartet, dass meine Gefühle für ihn wachsen würden – was so widersprüchlich schien, wenn man bedachte, dass ich noch immer Dimitri liebte und unmögliche Wege ausheckte, um ihn zu retten.
Ich lachte, als Adrian mich wieder auf den Boden stellte. In der Nähe waren einige jüngere Moroi stehen geblieben, um uns zu beobachten. Moroi, die mit Dhampiren gingen, waren in unserem Alter nicht so ungewöhnlich, aber ein berüchtigter Dhampir, der mit dem Großneffen der Moroi-Königin ausging? Das schien doch ziemlich daneben – vor allem, da allgemein bekannt war, wie sehr mich Königin Tatiana hasste. Bei meiner letzten Begegnung mit ihr waren nur wenige Zeugen zugegen gewesen; damals hatte sie mich angeschrien und mir befohlen, mich von Adrian fernzuhalten. Aber solche Dinge sprechen sich immer herum.
„Gefällt euch die Show?“, fragte ich unsere Voyeure. Als sie begriffen, dass sie aufgeflogen waren, setzten die jungen Moroi hastig ihren Weg fort. Ich wandte mich wieder zu Adrian um und lächelte. „Was war das? Das war ein ziemlich heftiger Kuss, um mich in der Öffentlichkeit damit zu überraschen.“
„Das“, sagte er großspurig, „war deine Belohnung dafür, dass du bei diesen Prüfungen so viele Arschtritte verteilt hast.“ Er hielt inne. „Außerdem war er dafür, dass du in diesem Kleid richtig heiß aussiehst.“
Ich bedachte ihn mit einem schiefen Blick. „Belohnung, hm? Merediths Freund hat ihr Diamantohrringe geschenkt.“
Er griff nach meiner Hand und zuckte sorglos die Achseln, während wir uns auf den Weg zur Party machten. „Du willst Diamanten? Ich werde dir Diamanten geben. Ich werde dich damit überhäufen. Zur Hölle, ich werde dir ein Kleid aus Diamanten machen lassen. Aber es wird ziemlich dürftig ausfallen.“
„Ich glaube, ich werde mich doch lieber mit dem Kuss zufriedengeben“, erwiderte ich und malte mir aus, wie Adrian mich wie ein Dessousmodel einkleidete. Oder eine Stangentänzerin. Der Hinweis auf den Schmuck hatte außerdem eine unerwünschte Erinnerung an die Oberfläche treiben lassen. Als mich Dimitri in Sibirien gefangen gehalten und mit seinen Bissen in einen Zustand wonnevoller Fügsamkeit eingelullt hatte, hatte er mich ebenfalls mit Schmuck überschüttet.
„Ich wusste, dass du eine echte Kanone bist“, fuhr Adrian fort. Eine warme Sommerbrise verwuschelte das braune Haar, das er jeden Tag so sorgfältig frisierte. Und mit seiner freien Hand versuchte er geistesabwesend, es wieder glatt zu streichen. „Aber wie unglaublich du wirklich bist, das habe ich erst begriffen, als ich dich da draußen die Wächter habe purzeln lassen sehen.“
„Bedeutet das, dass du jetzt netter zu mir sein wirst?“, zog ich ihn auf.
„Ich bin immer nett zu dir“, sagte er hochfahrend. „Weißt du, wie sehr ich mich genau jetzt nach einer Zigarette sehne? Aber nein. Mannhaft erdulde ich den Nikotinentzug – nur für dich. Aber ich glaube, dass ich jetzt, nachdem ich dich dort draußen gesehen habe, in deiner Nähe ein wenig vorsichtiger sein werde. Und dein verrückter Dad wird ebenfalls dafür sorgen, dass ich vorsichtig bin.“
Ich stöhnte und dachte daran, dass Adrian und Abe zusammengesessen hatten. „Gott. Musstest du wirklich in seiner Nähe rumlungern?“
„He, er ist doch ganz umwerfend. Ein wenig unbeständig zwar, aber umwerfend. Wir sind großartig miteinander ausgekommen.“ Adrian öffnete die Tür zu dem Gebäude, in dem das Fest stattfinden sollte. „Und er ist auf seine Weise ebenfalls eine Kanone. Ich meine, jeder andere Mann, der solche Schals trüge – man würde ihn doch unter lautem Gelächter aus der Schule treiben. Nicht so Abe. Er würde irgendjemanden genauso übel vermöbeln, wie du es tätest. Wirklich …“ Adrians Stimme bekam einen nervösen Unterton. Ich warf ihm einen überraschten Blick zu.
„Wirklich was?“
„Nun … Abe sagte, er möge mich. Aber er hat auch klargestellt, was er mit mir machen würde, sollte ich dir jemals wehtun oder mich irgendeiner anderen Schandtat schuldig machen.“ Adrian verzog das Gesicht. „Tatsächlich hat er in sehr plastischen Einzelheiten beschrieben, was er dann täte. Danach ist er einfach so zu irgendeinem anderen, erfreulicheren Thema gesprungen. Ich mag diesen Burschen, aber er ist auch beängstigend.“
„Dazu hat er kein Recht!“ Ich blieb vor dem Raum stehen, in dem die Party stattfinden sollte. Durch die Tür hörte ich das Summen von Gesprächen. Anscheinend waren wir unter den Letzten, die eintrafen. Ich schätzte, dies bedeutete, dass ich einen großen Auftritt hinlegen würde, wie er dem Ehrengast zukam. „Er hat kein Recht dazu, meine Freunde zu bedrohen. Ich bin achtzehn Jahre alt. Erwachsen. Ich brauche seine Hilfe nicht. Ich kann meine Freunde selbst bedrohen.“
Meine Entrüstung erheiterte Adrian, und er bedachte mich mit einem schrägen Lächeln. „Ich stimme dir ja zu. Aber das bedeutet nicht, dass ich es riskieren werde, seinen ‚Rat‘ nicht ernst zu nehmen. Mein Gesicht ist zu hübsch, um es aufs Spiel zu setzen.“
Sein Gesicht war wirklich hübsch, aber das hinderte mich nicht daran, entnervt den Kopf zu schütteln. Ich streckte die Hand nach dem Türgriff aus, aber Adrian zog mich zurück.
„Warte“, sagte er.
Er zog mich abermals in die Arme, und unsere Lippen trafen sich zu einem weiteren heißen Kuss. Dicht an ihn gedrückt verwirrten mich meine eigenen Gefühle und die Erkenntnis, dass ich bald einen Punkt erreichte, an dem ich mehr wollte als nur Küsse.
„Okay“, murmelte Adrian, als wir uns endlich voneinander lösten. „Jetzt können wir hineingehen.“
Er hatte den gleichen unbeschwerten Tonfall, aber in seinen dunkelgrünen Augen entdeckte ich das Brennen von Leidenschaft. Ich war offenbar nicht die Einzige, die mehr in Erwägung zog als nur Küsse. Bisher hatten wir ein Gespräch über das Thema Sex vermieden, und er war tatsächlich sehr gut darin gewesen, mich nicht zu bedrängen. Ich vermutete, er wusste, dass ich nach Dimitri einfach noch nicht dazu bereit war. Aber in Augenblicken wie diesen konnte ich erkennen, wie schwierig es für Adrian sein musste, sich zurückzuhalten.
Etwas in mir wurde weicher, ich stellte mich auf die Zehenspitzen und gab ihm noch einen Kuss. „Was war das?“, fragte er einige Sekunden später.
Ich grinste. „Deine Belohnung.“
Nachdem wir es endlich auf die Party geschafft hatten, begrüßten mich alle im Raum mit Jubel und stolzem Lächeln. Vor langer Zeit hatte es mir ungeheuer gutgetan, so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Dieses Verlangen war inzwischen ein wenig blasser geworden, aber jetzt setzte ich eine selbstbewusste Miene auf und nahm das Lob derer, die ich liebte, mit Stolz und Glück entgegen. Triumphierend hob ich die Hände, was mir weiteren Applaus eintrug.
Meine Party wirkte beinahe ebenso nebelhaft wie meine Prüfungen. Man weiß nie wirklich, wie viele Leute einen mögen, bis sie alle auftauchen, um einen zu unterstützen. Es machte mich bescheiden und zugleich auch beinahe ein wenig weinerlich. Das behielt ich jedoch für mich. Ich konnte doch kaum auf meiner eigenen Siegesfeier in Tränen ausbrechen.
Alle wollten mit mir reden, und ich war überrascht und erfreut, wann immer jemand Neues an mich herantrat. Es kam nicht oft vor, dass ich all die, die ich am meisten liebte, an einem Ort beisammen hatte, und mit einiger Beklommenheit wurde mir bewusst, dass sich eine solche Gelegenheit vielleicht nie wieder bieten würde.
„Na, jetzt hast du endlich eine Lizenz zum Töten. Das wurde aber auch Zeit.“
Ich drehte mich um und begegnete dem amüsierten Blick von Christian Ozera, einer einstigen Nervensäge, die inzwischen zu einem guten Freund geworden war. Tatsächlich war er ein so guter Freund, dass ich in meiner glückseligen Inbrunst die Arme ausstreckte und ihn an mich zog – etwas, womit er offenkundig nicht gerechnet hatte. Heute überraschte ich alle.
„Hey“, sagte er errötend und wich zurück. „Das passt. Du bist das einzige Mädchen, das bei dem Gedanken ans Töten so emotional wird. Ich möchte gar nicht daran denken, was da vor sich geht, wenn du mit Ivashkov allein bist.“
„Das musst du gerade sagen. Dich juckt es doch in allen Fingern, selbst dort hinauszugehen.“
Christian gab mit einem Achselzucken zu verstehen, dass er mir zustimmte. Es war eine Standardregel in unserer Welt: Wächter beschützten Moroi. Moroi wurden nicht in Kämpfe verwickelt. Doch nach den letzten Strigoi-Angriffen hatten viele Moroi – wenn auch kaum eine Mehrheit – angefangen zu argumentieren, dass es für die Moroi an der Zeit sei, selbst für sich einzutreten und den Wächtern zu helfen. Feuerbenutzer wie Christian waren besonders wertvoll, da das Verbrennen als eine der besten Methoden galt, um einen Strigoi zu töten (neben der Pfählung und der Enthauptung). Die Bewegung, die sich dafür aussprach, Moroi im Kämpfen zu unterweisen, wurde gegenwärtig – und mit Absicht – von der Moroi-Regierung gebremst. Aber das hatte einige Moroi nicht daran gehindert, im Geheimen zu trainieren. Christian war einer von ihnen. Als ich an ihm vorbeischaute, blinzelte ich erstaunt. Bei ihm stand ein Mädchen, und zwar eins, das mir kaum aufgefallen war.
Jill Mastrano wirkte wie ein Schatten neben ihm. Eine Moroi aus der ersten Klasse – nun, bald aus der zweiten –, hatte Jill erklärt, dass sie ebenfalls kämpfen wolle. Sie war quasi zu Christians Schülerin geworden.
„Hey, Jill“, sagte ich und schenkte ihr ein freundliches Lächeln. „Danke, dass du gekommen bist.“
Jill errötete. Sie war entschlossen zu lernen, sich selbst zu verteidigen, aber in der Nähe von anderen – vor allem in der Nähe von solchen Berühmtheiten wie mir – geriet sie leicht außer sich. Aus Nervosität begann sie dann zu schwafeln. „Ich musste einfach“, erwiderte sie und strich sich das lange, hellbraune Haar aus dem Gesicht. Wie immer war es ein Wirrwarr von Locken. „Ich meine, es ist so cool, was du getan hast. Bei den Prüfungen. Alle waren erstaunt. Ich habe einen der Wächter sagen hören, er habe noch nie so etwas wie dich gesehen. Als Christian also fragte, ob ich mitkommen wolle, musste ich natürlich kommen. Oh!“ Ihre hellgrünen Augen weiteten sich. „Ich habe dir noch nicht mal gratuliert. Tut mir leid. Herzlichen Glückwunsch.“
Christian kämpfte um eine ernste Miene. Ich unternahm keine solche Anstalten und umarmte sie ebenfalls lachend. Ich stand ernsthaft in Gefahr, ganz warm und weich und duselig zu werden. Wahrscheinlich würde man mir meinen beinharten Wächterstatus entziehen, wenn ich so weitermachte. „Danke. Seid ihr zwei schon bereit, es mit einer Strigoi-Armee aufzunehmen?“
„Bald“, antwortete Christian. „Aber vielleicht werden wir deine Verstärkung brauchen.“ Er wusste genauso gut wie ich, dass Strigoi weit außerhalb ihrer Liga spielten. Seine Feuermagie hatte mir sehr geholfen, aber was, wenn er auf sich allein gestellt war? Das wäre sicher eine andere Geschichte. Er und Jill brachten sich selbst die offensive Benutzung von Magie bei, und wenn ich zwischen den Kursen Zeit gehabt hatte, so hatte ich sie einige Kampfzüge gelehrt.
Jills Gesicht wurde ein klein wenig länger. „Es wird aufhören, sobald Christian fort ist.“
Ich wandte mich wieder an ihn. Es war keine Überraschung, dass er die Akademie verlassen würde. Wir würden sie alle verlassen. „Was wirst du mit dir anfangen?“, erkundigte ich mich.
Es war eine übliche Praxis, dass frischgebackene Wächter nach dem Abschluss an den Königshof der Moroi gingen, um sich zu orientieren und ihre Aufträge zu bekommen. Wir alle würden in einigen Tagen aufbrechen. Als ich Christians Blick folgte, sah ich auf der anderen Seite des Raumes seine Tante, und bei Gott, sie unterhielt sich gerade mit Abe.