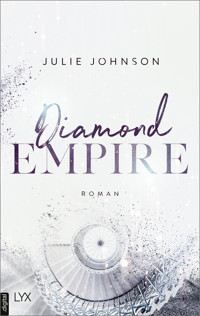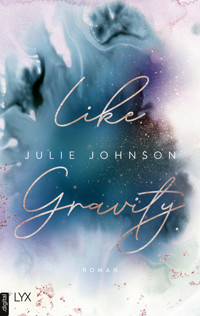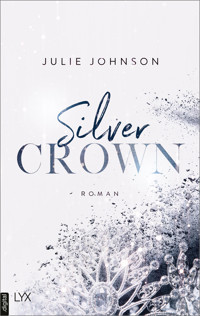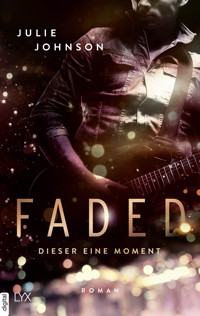14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wind Weaver
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal der Welt liegt in ihren Händen. Niemand darf wissen, dass Rhya ein Halbling ist – halb Fae, halb Mensch –, denn Fae werden in Anwyvn gnadenlos verfolgt. Bei einem Überfall auf ihr Dorf gelangt Rhyas wahres Wesen ans Licht. Gefesselt an einen Baum, erwartet sie ihre Hinrichtung. Doch im letzten Moment stellt sich der mysteriöse General Scythe gegen seine eigenen Männer und entführt sie in die rauen Nordlande, nachdem er ein Zeichen auf ihrer Brust entdeckt hat. Sie ist die letzte Windweberin. Rhya trägt die Macht in sich, den Wind zu rufen, eine Kraft, von der sie bisher nichts ahnte. Auf ihrer Flucht vor den Häschern Anwyvns muss Rhya nicht nur lernen, ihre Kräfte zu beherrschen, sondern auch den verzehrenden Gefühlen für ihren düsteren Retter widerstehen. Wird sie ihre Bestimmung erfüllen – oder daran zerbrechen? Der Auftakt der epischen Romantasy-Reihe Tropen: Morally Grey Hero, Only One Bed, Slow Burn, Enemies to Lovers, Forced Proximity, Hurt Hero, Hunted Heroine Band 1: The Wind Weaver Band 2: The Sea Spinner
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
The Wind Weaver
Julie Johnson stammt aus dem Nordosten der USA und ist internationale Bestsellerautorin. Wenn sie nicht gerade schreibt, sammelt sie Stempel im Reisepass. Sie hat über 20 Romane veröffentlicht, die in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt wurden. Julie ist auf Instagram (@author_julie) und man kann auf ihrer Website (www.juliejohnsonbooks.com) mit ihr in Kontakt treten.Christiane Sipeer studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf und überträgt Belletristik und Sachbücher aus dem Englischen, unter anderem von Esther Perel und Kate Young. Sie lebt in Leipzig.
In Anwyvn, einer vom Krieg zerrissenen und zerrütteten Welt, gilt Magie als Fluch und Fae werden unbarmherzig gejagt. Rhya Fleetwood, die als Waisenkind bei ihrem Ziehvater aufwächst, musste ein Leben lang ihre spitzen Ohren verbergen. In den Fängen des rätselhaften und furchterregenden Kommandanten Scythe, der sie vor dem sicheren Tod bewahrte, entdeckt sie ihre Kräfte.Rhya ist der Schlüssel zum Schicksal der Welt, denn sie ist die Windweberin, eine von vier verstreuten Seelen in Anwyvn, die dazu bestimmt sind, das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen – oder bei dem Versuch zu sterben. Auf der Flucht mit dem Kommandanten erkennt Rhya, dass Scythe nicht der ist, für den er sich ausgibt, und seine ganz eigenen Pläne verfolgt …
Julie Johnson
The Wind Weaver
Sturmverführt
Aus dem Englischen von Christiane Sipeer
Forever by Ullsteinwww.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel The Wind Weaver bei Ace Books, einem Imprint von Penguin Random House, LLC, New York.Forever by Ullstein© 2025 by Julie Johnson© der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 BerlinAlle Rechte vorbehaltenPublished by arrangement with Bookcase Literary Agency.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: © Art by KalynneKarte: © Julie Johnson und Alison CnockaertAutorenfoto: © Julie JohnsonE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-98978-037-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Landkarte
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Glossar
Danksagung
Leseprobe: Glory of Broken Dreams
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Landkarte
Landkarte
Prolog
DIE SÄUBERUNG
Anwyvnisches Lied vom Aufstand
Die Zeit der Sterblichen begann
Als Eisenheere zogen
Gen Nord
Das Reich der Fae in Flammen stand
Der Magie Blut
Floss fort
Hört!
Hinfort mit böser Zauberei
Die Plage des Lands
Gebannt
Adieu dem schauerlichen Wind
Der feget durch
Den Wald
Hört!
Nun herrscht wer Faust und Schwert erhebt
Menschenmacht
Ungebrochen
Die Halblingsjagd ist nun eröffnet
Ihre Brut
Erstochen
Kapitel 1
Die Schlinge scheuert mir am Hals, eine todbringende Kette.
Ich spüre meinen Puls als stetigen Stakkatoschlag unter der empfindlichen Haut. Angst habe ich keine mehr. Die war mit den Händen gekommen, die mich schmerzhaft gepackt, und mit den knurrenden Jagdhunden, die mich durch das wilde Marschland verfolgt hatten. Dann war sie gemeinsam mit der Sonne hinter den Horizont getaucht und in der erdrückenden Dunkelheit verschwunden.
Wie sagte Eli immer?
Angst bedeutet bloß, dass du etwas zu verlieren hast.
Jetzt bleibt mir nichts mehr. Nur noch mein Leben, und das ist niemandem mehr viel wert.
Schon gar nicht meinen Entführern.
»Verschlagenes kleines Biest, was?« Irgendwo zu meiner Linken stößt jemand ein barsches Lachen aus. »Haben die halbe Einheit gebraucht, um sie aufzuspüren. Ein Dutzend Männer. Drei Tage mussten wir in dem verdammten Sumpf zubringen, mit lauter Wespen und Schlangen und Spinnen. Knietief im Matsch und Moor und wer weiß was für einem Mist. Als es gestern dunkel wurde, ist sie uns beinahe aus dem Netz geschlüpft.« Seine Spucke trifft mich an der Wange. »Drecksfae.«
Die zweite Stimme klingt jünger und bebt ein wenig. Ein frischer Rekrut vielleicht, den das endlose blutige Kriegsspiel der Sterblichen noch nicht so abgestumpft hat. »Sie ist einfach … sie ist so jung.«
»Lass dich nicht vom Schein trügen, Junge. Nichts als Faetrickserei. Sie verbergen ihre wahre Natur hinter hübschen Gesichtern und lieblichem Lächeln, genau wie giftige Blumen. Früher einmal konnten dir manche von ihnen mit ihrem Trugzauber alles Mögliche vormachen. Oder dich direkt in den Abgrund locken, während du felsenfest davon überzeugt warst, einfach bloß über eine Wiese voller Gänseblümchen zu hüpfen.«
Der jüngere Soldat holt hörbar Luft. Sein Schrecken bleibt mir trotz meiner Augenbinde nicht verborgen.
»Keine Angst, Junge. Solche Magie hat hier in der Gegend seit knapp zwei Jahrhunderten niemand mehr beobachtet.« Der mit der barschen Stimme lacht in sich hinein. »Wenn wir mal welche erwischen, so wie das mickrige Ding hier, sind es meistens Halblinge. Überbleibsel aus der Zeit vor der Säuberung, als Mischehen noch nicht verboten waren. Die können genauso wenig zaubern wie du und ich.«
Darauf folgt gedehntes Schweigen. Zwischen den beiden Männern eröffnet sich ein Abgrund der Stille.
»Was natürlich nicht heißt, dass sie völlig wehrlos sind«, fährt der ältere Krieger beinahe wie zur Rechtfertigung fort. »Die würde uns im Schlaf aufschlitzen, wenn wir nicht aufpassen. Vergiss das nie.«
»Wie habt Ihr sie am Ende gefangen?«
»Haben sie an der Roten Klamm zur völligen Erschöpfung getrieben. Das Erz im Gestein dort verwirrt sie. Dann leidet ihr Orientierungssinn, und sie können nicht mehr klar denken.« Er atmet geräuschvoll aus. »Kein Feind ist unbesiegbar, nicht mal ein verdammter Spitz.«
Bei dem Schimpfwort spanne ich mich an, und die Fesseln schneiden mir in die Brust, obwohl ich versuche, mich nicht zu rühren. Spitz. Diese Beleidigung verwenden die Soldaten, die mich gefangen halten, ständig, zischen sie mir bei der Wachablösung leise zu oder werfen am Lagerfeuer unbekümmert damit um sich. Als würde es ihre Barbarei irgendwie leichter erträglich machen, eine ganze Art auf ihr auffälligstes Merkmal – die spitzen Ohren – zu reduzieren. Jedes Mal, wenn ich das Wort höre, regt sich stiller Zorn in meinem Innern. Wie ein verletztes wildes Tier, das sich nach Vergeltung sehnt, die mir niemals zuteilwerden wird.
Götter der Himmel, schenkt mir Rache im nächsten Leben.
»So schwer ist es auch wieder nicht, sie zu töten. Brauchst nur die richtige Waffe«, prahlt der ältere Soldat mit seinem Wissen. »Eisen ist natürlich am besten. Aber in Wahrheit kann man sie auch einfach mit irgendwas abstechen. Spitze bluten genau wie alle anderen Tiere im Wald. Hat dich dein Alter nie zum Jagen mitgenommen? Hast du noch nie ein Reh ausgeweidet?«
»Nein … Ich … Wir …« Der junge Soldat tritt von einem Fuß auf den anderen, man hört das Laub unter seinen Stiefeln rascheln. »Wir sind Kleinbauern, Herr.«
»Kleinbauern?«
»Ja, Herr. Wir verzehnten ein Stück Land an der Küste. Bauen hauptsächlich Eisbeeren an.«
Der Ältere schnaubt. »Eisbeeren? Na, das passt ja gut zu dem Einsatz hier, das kann ich dir sagen. Schweinekalt so nah an den Cimmerer Bergen.«
Hinter meiner Augenbinde stelle ich mir die Situation vor. Ein Soldatenlager, alle seit Wochen unterwegs und witterungsgeplagt. Das knisternde Feuer soll die Kälte abhalten – und Wölfe. Eine einfache Mahlzeit köchelt auf den Kohlen.
Der Wind trägt den Geruch von Fleisch zu mir herüber, und mein Magen knurrt. Höchstwahrscheinlich Hase oder Ochse. Vielleicht Wildschwein, falls einer von ihnen gut genug mit Pfeil und Bogen umgehen kann. In ihren Reihen gibt es doch sicher Jäger. Männer, die auch andere Beute aufspüren können als mich und meinesgleichen. Wobei sie, wenn man uns essen könnte, das vermutlich auch tun würden.
Dieser Winter ist besonders erbarmungslos.
Ich frage mich, welchem Königreich sie wohl angehören, welchem der kriegerischen Herrscher sie ihren Eid geschworen haben. Wahrscheinlich demjenigen, der seine Truppen nach Seahaven geschickt und den Sternenwald angezündet hat – und damit das einzige Zuhause, das ich jemals hatte.
Jemand zieht an den Fesseln an meinen wunden Handgelenken. Ich höre das zischende Geräusch, kurz bevor mich der Schmerz durchfährt. Es riecht nach verkohltem Fleisch.
Es ist mein eigenes, das verbrennt.
Ich muss meine ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht zu schreien – aber diese Genugtuung werde ich den Soldaten nicht geben. Ich atme tief durch und presse das Rückgrat gegen die Rinde des Baums, an den sie mich gebunden haben, versuche, nicht ohnmächtig zu werden.
Ihr Götter, wie das wehtut.
»Siehst du die Blasen?«, fragt der Ältere. »Als hätte ich sie mit einem lodernden Scheit berührt!«
»J-ja«, stammelt der Junge. »Ich sehe es.«
Das Eisen lässt eine immer weiter anschwellende Flut der Qual aufbranden – auch jetzt noch, obwohl meine Handgelenke ohnehin schon beinahe bis auf die Knochen und Sehnen versengt sind. Jede Bewegung der Ketten löst neue Pein aus.
»Wann …« Der junge Rekrut räuspert sich. »Wann werden sie sie …«
»Sie aufhängen? Kann nicht mehr lange dauern. Commander Scythe wird bis Mitternacht eintreffen. Der Captain sagt, wir dürfen sie ohne seine Genehmigung nicht anrühren.«
»Wieso?«
»Will sich wohl selbst vergewissern, dass sie auch wirklich tot sind, oder so. Noch mal gegen die Asche treten, ob sich nicht doch noch was rührt. Scheint mir übertrieben, aber so lautet der Befehl von König Eld, also halte ich mich dran. Erst aufhängen, dann abfackeln.« Ich höre, wie eine Feldflasche entkorkt wird. Schluckgeräusche. Durchatmen. »Bei Faehinrichtungen geht der Aberglaube gern mal mit den Leuten durch. Wirst schon sehen, Junge.«
»Ach so …« Der junge Mann klingt nicht ganz überzeugt. »Als ich mich verpflichtet habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir Halblinge jagen müssen. Ich wusste gar nicht, dass es noch welche gibt.«
»Sind auch nicht mehr viele. Schon gar nicht so weit oben in den Mittlanden. Unten in den Südlanden herrschen … andere Gepflogenheiten. Du solltest den Himmeln danken, dass du nicht an der Grenze zu den Reaches stationiert bist. Da dreht sich einem der Magen um, nach allem, was ich gehört habe. Und dabei habe ich gar nicht viel gehört.«
Mein Herz setzt aus. Mir sind die Gerüchte darüber nicht erspart geblieben, was in den Südlanden mit Halblingen geschieht. Nicht alle jedenfalls. Eines Abends gab Eli mir bei einem guten Schluck Whiskey einen kurzen Einblick in diese Finsternis.
Womöglich töten sie dich nicht direkt, Rhya, aber das wirst du dir noch wünschen, bevor sie mit dir fertig sind …
Ich zwinge mich, diese Gedankengänge zu unterdrücken. Sie führen zu nichts Gutem.
»Junge, bewahre einfach einen kühlen Kopf, eine ruhige Hand und stell keine Fragen. Dann passiert dir schon nichts. Das ist ein Job wie jeder andere – hör nicht auf irgendwelches Gerede.« Der ältere Mann spricht leiser weiter. »Ich schwöre dir, manchen Männern geht richtig einer ab, wenn eine Fae am Strick baumelt. Das ist noch mal eine ganz andere Mordlust, verstehst du?«
»Wie abscheulich!«
»Aye. Ist aber so.« Er trinkt noch einen ordentlichen Schluck aus der Flasche. »Vor langer Zeit, als ich genauso ein Jungspund war wie du, gab es hier in der Gegend noch mehr Spitze. Meine Einheit ist eines Tages über eine ganze Familie gestolpert, die hatten sich in einer Höhle hinter einem Wasserfall versteckt. Mit grünlicher Haut und Haaren wie Schilf …«
Grünliche Haut?
Haare wie Schilf?
Wo nehmen die bloß diese albernen Geschichten her? Aus Kindermärchen? Abgesehen von unseren Ohren sind wir Halblinge praktisch nicht von Menschen zu unterscheiden. Aber vermutlich ist es leichter zu rechtfertigen, ein mythologisches Monster zu töten als ein lebendiges Wesen. Etwas und nicht jemanden.
Der Krieger flüstert nun fast. »In der Avianstraße hatten wir große Verluste erlitten. Die blutigste Schlacht seit hundert Jahren. Und es kamen immer mehr von Sorens Männern. Haben uns immer wieder zurückgeschlagen. Die Stimmung war im Keller. Die Truppe brauchte ein Erfolgserlebnis. Als uns dann diese Fae in den Schoß gefallen sind …«
Eine ungute Vorahnung jagt mir kalte Schauer über den Rücken, und das trotz der glühenden Schmerzen an meinen Handgelenken. Ich schließe die Augen hinter der Binde und wünsche, ich könnte die Ohren ebenso verschließen. Ich will nichts davon hören, wie eine unschuldige Familie abgeschlachtet wurde, kann keine Einzelheiten dazu ertragen, wie Mutter, Vater und Kinder von verrohten Kriegern auseinandergerissen wurden. Nicht jetzt, wo mein eigener unmittelbar bevorstehender Tod mir so fest gegen die Luftröhre drückt.
Eine Stiefelspitze scharrt über den Boden, und der Mann hustet. »Eins steht fest, was ich an dem Tag alles gesehen habe … nun, so einen Anblick vergisst man nicht so leicht. Auch nach zehn Jahren nicht.«
Wieder herrscht Schweigen. Der Jüngere sagt nichts, wahrscheinlich haben ihm die grausamen Bilder die Sprache verschlagen, die sein Kamerad heraufbeschworen hat. Ich bin nicht töricht genug, zu glauben, dass seine Zurückhaltung irgendeiner Art Mitgefühl für mich entspringt. Viel naheliegender ist, dass er einfach das tut, was ihm aufgetragen wurde – seine Meinung für sich zu behalten.
Er wird mal einen guten Soldaten abgeben.
Die Stille wird vom Klopfen einer Hand gegen eine Schulter unterbrochen. »Du bist ja weiß wie eine Wand, Junge. Hol dir doch ein bisschen Wildbret, solange noch was da ist. Und bring mir auch was mit, ja? Ich bewache die Gefangene.«
Ich höre sich entfernende Schritte, dann, wie sich jemand an einen Baumstamm lehnt. Weiter weg erklingt Stimmengewirr – noch mehr Soldaten, die um das Feuer sitzen und ihr Abendessen in sich hineinschlingen. Einen Augenblick später vernehme ich, wie eine Messerklinge leise über Holz schabt. Was mein Aufpasser wohl schnitzen mag?
Eine Sigille für irgendeinen Gott, den er anbetet? Ein Andenken für die Frau, die er in seiner Heimat zurückgelassen hat? Ein Spielzeug, mit dem seine kleine Tochter spielen kann, wenn er endlich von seinem Feldzug heimkehrt?
Zehn Jahre, hatte er gesagt. Zehn Jahre Krieg. Zehn Jahre als Soldat. Zehn Jahre bluten, kämpfen, töten.
Da gibt es doch sicher noch ein Leben jenseits von alldem. Sicher wartet irgendwo eine Familie auf diesen Mann. Wird er ihnen von dem Faemädchen erzählen, das er, um sie zu beschützen, ermordet hat? Ihnen genüsslich von ihrer fleckigen Fratze und heraushängenden Zunge berichten, wie sie da im Schein der Fackeln an einem Ast baumelte?
Der furchtlose Held, er tötet das Biest.
Hurra!
Aber so wie er mit seinem jungen Kameraden gesprochen hat, kann ich mir das nicht vorstellen. Ihm wird die Aufgabe keinen Spaß machen – aber ausführen wird er sie dennoch und ohne Zögern den Befehlen seines Captains Folge leisten.
Über mir ächzen die Äste wie eine Totenglocke.
Ich bin froh, dass sie mich im Dunkeln töten wollen, unter den Sternen. Irgendwie wäre es viel schlimmer, bei Sonnenschein zu sterben, während eine leise Brise durch das Gras unter meinen Füßen streicht. Dunkle Schatten bilden einen besseren Rahmen für meinen Genickbruch.
Rhya Fleetwoods letzter Atemzug.
Schutzbefohlene des geschätzten Eli Fleetwood.
Waise.
Fae.
Halbling.
Flüchtling.
Spitz.
In gewisser Weise wird es eine Erleichterung sein. Nach den ganzen Monaten auf der Flucht endlich Ruhe zu finden. Seit sie Eli hingerichtet und den Sternenwald gemeinsam mit unserem Häuschen in Schutt und Asche gelegt haben, gibt es für mich keinen Rückzugsort mehr auf der Welt. Keine starken, beschützenden Arme, in die ich mich flüchten kann, wenn ich mit den Haaren an einem Strauch hängen bleibe oder mir an einem Stein im Flussbett den Knöchel verknackse. Kein warmes Bett mehr, in das ich am Ende eines kühlen Herbsttags kriechen kann.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bevor sie mich gefangen nahmen, hatte ich mich seit Wochen verlaufen, irrte auf der Suche nach Trost umher, den es nicht mehr gab, und lebte von gummiartigen Pilzen aus der harten Erde und kalten Forellen aus noch kälteren Bächen. Als ich vor fünf Tagen ein Dorf entdeckte, war der Duft nach frischem Brot, der von einer steinernen Fensterbank ausging, zu verlockend, um ihn zu ignorieren.
Wie ich meine eigene Dummheit verfluche. Ich weiß genau, was Eli jetzt sagen würde. Das Herz macht dich weich. Der Magen macht dich schwach. Achte nicht auf ihre flüchtigen Regungen. Lass dich stets vom Denken lenken.
Aber ein Moment der Schwäche brachte mich dazu, seine Lehren zu missachten. Der nagende Hunger ließ mich unvorsichtig werden, vernebelte mir die Sinne. Ich bin von Natur aus schnell, aber an jenem Tag war ich nicht schnell genug. Als ich vom Waldrand auf das verfallene Haus zulief, hörte ich das Klacken des Stiefelabsatzes auf dem Steinboden im Innern nicht, ebenso wenig das Spannen des Bogens, bis der Pfeil über meinen Kopf hinwegzischte. Und da war es längst zu spät.
Viel zu spät.
Von jenem Augenblick an bestand mein Leben nur noch aus kopfloser Flucht. Ich rannte, bis ich keine Luft mehr bekam, bis meine Glieder ganz entkräftet waren und meine nackten Füße blutige Spuren auf Steinen und an Flussufern hinterließen. Sie verfolgten mich – erst die Dorfbewohner selbst, dann die von ihnen gerufenen Soldaten. Durch den Wald, über ein Feld und schließlich in sumpfiges Marschland. Beinahe konnte ich sie in dem fauchenden, rülpsenden Morast abschütteln, wo die Luft klebrig wie Sirup war und Insektenschwärme am helllichten Tag die Sonne verdunkelten.
Beinahe.
Wie hätte ich auch wissen sollen, dass sie mich auf eine tiefe Klamm zutrieben? Die Rote Klamm wird sie von den Soldaten genannt. Wegen der rostroten Farbe ihrer steilen Hänge. Im Gestein sind große Eisenvorkommen eingeschlossen, so groß, dass sie mich schon an guten Tagen erschöpfen würden. Und ein guter Tag war das ganz und gar nicht.
Ich spürte, wie mir das Erz bei jedem Schritt mehr Kraft abzapfte, während die Männer immer näher kamen. Meine Beine knickten ein, drohten, ganz nachzugeben. Selbst wenn sie es nicht getan hätten, am Abgrund angekommen ging es ohnehin nicht weiter. Es sei denn, ich wäre über die Kante gesprungen, um ins Nichts und damit in den Tod zu stürzen.
Im Nachhinein betrachtet, während die glühenden Fesseln meine Handgelenke fest im Griff haben, eine dicke Schlinge um meinen Hals liegt und der Scheiterhaufen schon auf mich wartet … wäre mir der schnelle Fall lieber. Dann würde ich wenigstens durch meine eigene Hand sterben. Durch meine eigene Entscheidung.
Meine letzte Entscheidung.
Götter, ich bin so müde. Die Schlinge ist so schwer, dass ich den Kopf nicht mehr aufrecht halten kann. Ich sacke schlaff in mich zusammen und bin froh, dass Eli mich nicht so sehen kann. Er hat mir beigebracht, mich zu wehren. Tapfer zu sein. Willensstark, mit klarem Verstand und reinem Herzen.
Ich habe ihn enttäuscht.
Ich habe mich selbst enttäuscht.
Bei dem Gedanken ist mir nach Weinen zumute, aber ich habe nicht mehr die Kraft dazu. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Bissen gegessen oder einen Schluck getrunken habe. Meine Zunge ist staubtrocken, und die Vorstellung einer warmen Mahlzeit ist mir so fremd wie das Land, in dem ich gefangen genommen wurde.
Ich versuche mich, trotz Schmerz und Erschöpfung, die meinen Körper heimsuchen, zu konzentrieren.
Was hat der Soldat gesagt?
König Eld.
Die Avianstraße.
Blutigste Schlacht seit hundert Jahren.
Mein schmerzvernebeltes Hirn ruft eine Landkarte mit vielen Königreichen auf. Unablässig neu aufgeteilte Feudalländereien mit ständig wechselnden Papierkönigen. Papierkönige. So nennt Eli sie immer – nannte. Denn sie herrschen nicht dank göttlicher Vorsehung, sondern haben sich selbst mit Tinte und Feder zu Herrschern erkoren, und ihre Titel sind so spröde wie das Pergament, auf das sie gekritzelt wurden. Ein Machthaber ist rasch durchgestrichen und durch einen anderen ersetzt.
Lohnt kaum, sich ihre Namen zu merken, hatte Eli einmal gemurmelt und dabei die runzligen Hände auf seine große Sammlung ausgebreiteter Schaubilder gelegt. Die verdammten Grenzen verschieben sich mit jeder großen Schlacht …
Ich muss diese Karten Hunderte Male studiert haben, aber im Augenblick ist meine Erinnerung dünn wie Spinnfäden, ich kann sie mir unmöglich ins Gedächtnis rufen. Königreiche zerfallen wie kleine Splitter eines zerstörten Schilds, bevor ich sie richtig zusammensetzen kann.
Carvage.
Eastwood.
Lordale.
Nythien.
Dymmerien.
Die Reaches.
Die Namen verschwimmen, die Buchstabentinte verläuft. Nicht zu entziffern. Und letztlich bedeutungslos. Meine Seele wird in die Himmel zurückkehren, wo auch immer mein Körper verbrannt wird. Ein schwacher Trost, aber ich klammere mich dennoch daran.
Ich bin weit fort von zu Hause, so viel weiß ich sicher. Wo sie mich auch hingebracht haben, das Land ist karg. Nicht bloß wegen der Kälte – es ist vollkommen leblos. Ich spüre keinerlei Pulsieren von Macht im Boden unter meinen Füßen, höre kein uraltes Flüstern in diesem Hain halb toter Bäume. Und selbst wenn ich es könnte … ich bin nach Tagen panischer Flucht so schwach – nachdem Pfeile über meinen Kopf hinweggeflogen sind, Jagdhunde mir in die Wade gebissen und Fackeln mich in die Enge getrieben haben wie ein wildes Tier –, wahrscheinlich würde es mir gar nichts nützen.
Sonnenlicht kann eine Blume an der Schwelle des Todes auch nicht mehr retten.
Das spielt ohnehin keine Rolle mehr, sage ich mir und lehne mich an meinen Galgenbaum. Das Schnitzen meiner Wache an dem Holzscheit bildet ein gleichmäßiges Metronom, das die Sekunden bis zu meiner Hinrichtung herunterzählt. Jetzt ist alles egal, Rhya. Morgen früh bist du nur noch ein Häufchen Asche.
Kapitel 2
Ich muss kurz eingenickt sein, denn irgendwann werde ich ruckartig von Hufgetrappel geweckt. Ein einzelner Reiter kommt schnell durch den Wald auf uns zu.
Ist der Commander also endlich da.
Der Boden unter meinen Füßen bebt, als der Neuankömmling ins Lager donnert. Beim Absteigen rasselt seine Kettenrüstung, und seine Stiefel schlagen dumpf auf der Erde auf. Mir sind immer noch die Augen verbunden, sodass ich in der Dunkelheit nicht einmal Schemen erkennen kann. Ich lausche angestrengt, ob ich Unterhaltungsfetzen verstehen kann.
»Commander Scythe. Welche Ehre, Euch hier zu haben, edler Herr. Eine Ehre.«
»Burrows.« Seine Antwort ist knapp.
»Herr, wenn Ihr erlaubt, Eure Taktik bei der Schlacht von Ygri letztes Frühjahr war einfach brillant. Diese nythischen Dreckskerle hat es dahingerafft wie Getreidehalme bei der Ernte. So etwas habe ich noch nie gesehen, dabei bin ich schon seit Jahren …«
»Captain, wenn mir der Sinn nach sinnloser Schmeichelei stünde, würde ich ins Bordell gehen. Bringt mich zur Gefangenen. Sofort.«
»J-ja, Herr«, stottert Burrows. »Hier entlang.«
Die Schritte nähern sich und werden lauter. Ich hole tief Luft und wappne mich innerlich. Trotzdem bleibt mein Herz beinahe stehen, als mir die Augenbinde vom Gesicht gerissen wird.
Fackeln leuchten auf und blenden mich, nachdem ich so viele Stunden in der Dunkelheit verbracht habe. Ich blinzele, um die grellen Pünktchen loszuwerden, aber es hilft kaum. Ich sehe Sterne. Kräftige Finger fahren mir ins schmutzige Haar und zerren meinen hängenden Kopf mit einem unsanften Ruck hoch. Mit der anderen Hand packt er die Schlinge und schnürt mir damit die Luft ab. Ich kann nicht mehr atmen.
Ich dachte, das hätte ich hinter mir – die Angst.
Irrtum.
Mein Herzschlag setzt aus, als ich nach und nach sein Gesicht erkenne. Teilweise zumindest, denn er trägt einen schweren schwarzen Helm. Ein Nasensteg aus Metall unterteilt seine Züge in zwei gnadenlose Hälften. Die dichten Augenbrauen sind auf beiden Seiten zur Mitte gezogen, und direkt darunter starren mich zwei unendlich dunkle Augen an. Im flackernden Schein der Fackeln wirkt er eher wie ein Dämon als wie ein Mensch.
»Wo habt ihr die denn her, von einem Friedhof?« Sein Griff in meinem Haar wird noch fester, meine Kopfhaut brennt. »Stinkt ja wie eine Woche altes Aas.«
»Frogmyre-Sumpf«, antwortet der Mann mit dem langen Bart links neben dem Commander. Captain Burrows. Ich erkenne ihn sofort – er war es, der mir den Strick um den Hals gelegt hat, als sie mich an der Schlucht erwischten. Das andere Ende hatte er an seinem Sattel festgebunden, dann schleppten sie mich in ihr Lager, wobei ich hinter ihm herlaufen musste, sonst hätten sie mich einfach mitgeschleift. Als meine blutenden Füße nach fast einer Stunde nachgaben und ich zusammenbrach, rieb er mir Pferdemist von seinem Gaul ins Gesicht und lachte voller hemmungsloser Schadenfreude.
Er klebt mir immer noch in den Haaren, die normalerweise hellen Strähnen haben das stumpfe Braun von getrocknetem Dung angenommen. Bei dem Geruch würde sich selbst der stärkste Magen umdrehen. Unter seinem Nasenschirm bläht der Commander die Nasenflügel. Er presst die Lippen zusammen und mustert mich von Kopf bis Fuß, als wolle er sich jedes Detail einprägen – die morastbedeckte Haut, den vor Schmutz starrenden Rock, die furchtgeweiteten Augen.
»Ist ganz schön mitgenommen, nicht?«
»Die Spitzschlampe hat sich drei Tage von uns jagen lassen.« Burrows betrachtet mich voller Abscheu. »Kann froh sein, dass wir nicht noch Schlimmeres mit ihr gemacht haben.«
Einige der umstehenden Soldaten murmeln zustimmend. Ihre Verachtung ist ebenso deutlich spürbar wie ihre Ungeduld. Sie wollen mich endlich hängen sehen.
Scythe schweigt. Er schenkt seinen Untergebenen keinerlei Beachtung. Stattdessen richtet er seine Aufmerksamkeit auf meine Handgelenke, wo die eisernen Fesseln meine Haut bis zur Unkenntlichkeit verbrannt haben. Von den qualvollen Schmerzen wird mir ganz schwindelig. Oder vielleicht auch vom Mangel an Luft, denn er lässt die Schlinge nicht einen Augenblick locker.
Burrows grinst und entblößt dabei seine Stummelzähne, die vom Tybaeablatt-Kauen ganz braun sind. »Eisen ist schon was Tolles, nicht wahr?«
»Burrows, eins solltet Ihr Euch für die Zukunft merken … Hinrichtungen unterliegen meiner Zuständigkeit, nicht Eurer. Wenn Ihr mir noch mal einen Halbling in einem solchen Zustand bringt, sorge ich dafür, dass Ihr zwei Wochen nicht richtig im Sattel sitzen könnt.«
Die Männer verstummen. Das war keine leere Drohung, und sein Tonfall verschärft die Wirkung nur noch: so sorgfältig ausdruckslos, als würde er über jahreszeitbedingte Wetterschwankungen sprechen. Sein Gesichtsausdruck – soviel ich davon unter dem Helm erkennen kann – wirkt ebenso ungerührt und unheimlich wie seine Stimme.
Die Soldaten schaffen es kaum, in die Richtung des Commanders zu schauen, ohne den Kopf einzuziehen. Lediglich meine Fesseln verhindern, dass ich es ihnen gleichtue. Das Seil um meinen Hals liegt so eng an, dass ich mich nicht rühren kann – nicht einmal dann, als er sein Gesicht nur noch eine Haaresbreite von meinem entfernt hält und mich ansieht wie ein Wolf sein Abendessen.
Wäre ich stark genug, würde ich ihm womöglich einen Kopfstoß verpassen. Ihn anspucken. Oder wenigstens finster anblicken. Aber in meinem Zustand ist es schon schwierig, bei Bewusstsein zu bleiben. Meine Lunge schreit nach Sauerstoff. Ich sehe schon wieder Sterne aufblitzen, und die Welt um mich herum versinkt im erstickten Delirium.
Falls Scythe mein Unwohlsein bemerkt, kümmert es ihn nicht weiter. »Ihr sagtet doch, an der hier sei etwas …«, murmelt er, »merkwürdig.«
»Ja, Herr.« Burrows schluckt nervös und tritt näher. »Sie hat ein unnatürliches Symbol auf der Haut. Ein Mal des Bösen, wenn Ihr mich fragt. So was hab ich noch nie gesehen, dabei bin ich schon lange auf der Jagd nach Spitzen.«
Bei diesen Worten scheint der ohnehin reglose Scythe förmlich zu versteinern. »Was für ein Mal?«
»Wir dachten erst, es sei eine Sklavenmarkierung. Es ist erhaben wie Narbengewebe, aber schwärzer als der Schwanz des Teufels.« Ein paar Männer lachen, aber es klingt eher nervös als belustigt. »Könnte eine Tätowierung sein«, fährt Burrows fort. »Aber solche Kunstfertigkeit besitzen nicht mal die fähigsten Tätowierer von Carvage. Aber seht selbst. Da, unter ihrem Kleid, direkt zwischen den …« Burrows bleiben die Worte im Hals stecken, als der Commander ruckartig den Kopf zu ihm umdreht.
»Unter ihrem Kleid?« Er hält inne, und die Luft selbst scheint den Atem anzuhalten, wie in dem Augenblick, bevor das Fallbeil nach unten saust. »Mir war nicht bewusst, dass Ihr Eure Gefangenen so gründlich inspiziert, Captain.«
»Das war nicht … Wir wollten nicht …« Burrows strafft bei der mitschwingenden Anschuldigung die Schultern. Unter Scythes Blick ist er noch blasser geworden. »Hab es gesehen, als wir ihr die Schlinge um den Hals gelegt haben, mehr nicht. Aber als einer meiner Männer den Fehler machte, es anzufassen …«
Burrows schüttelt den Kopf, als könne er immer noch nicht begreifen, was passiert war, als sein Stellvertreter mir am Rand der Schlucht das Kleid aufgerissen, das dünne Unterkleid runtergezerrt und mich unter den gierigen Blicken einer ganzen Kompanie entblößt hatte.
Was auch immer er mit mir machen wollte – und das war anhand des lüsternen Glanzes in seinen Augen deutlich zu erahnen gewesen –, es war unmöglich, sobald seine Finger mein seltsames Mal berührten.
»Was ist das denn?«, brummte er, und sein fauliger Atem streifte mein Gesicht, während er sich vorbeugte und mit zwei Fingern über mein Brustbein fuhr, das sich unter meinen panischen Atemzügen rasch hob und senkte. Bevor ich auch nur zurückzucken konnte, löste sich etwas in mir – ich weiß nicht, was, nur, dass es schon lange da ist und wie eine lauernde Schlange auf genau so eine Gelegenheit gewartet hat – und schlug aus der Mitte meiner Brust zu. Der Soldat schreckte zurück, als hätte er sich verbrannt, und hielt sich mit einem Aufheulen die Hand, das als gequältes Echo durch die Rote Klamm hallte.
Ich war so erschrocken, wie er sich vor mir auf der Erde wälzte, dass ich einen Moment brauchte, mein Hemd wieder hochzuziehen und das verschnörkelte Muster zu verdecken. Ich berührte es vorsichtig, als ich mein Kleid mit zitternden Fingern wieder zuschnürte, und rechnete beinahe damit, dass es glühen würde. Aber es fühlte sich so kühl an wie immer – etwas kühler noch als der Rest meiner Haut, so wie üblich, selbst wenn ich Fieber bekam oder mich körperlich verausgabte.
Die Soldaten hatten den Blick besorgt zwischen mir und ihrem verletzten Kameraden hin- und herhuschen lassen. Als hätte ich den Mann absichtlich angegriffen. Als könnten sie die Nächsten sein.
Schön wäre es.
Eine solche Kraft wäre im Augenblick überaus praktisch. Doch in Wahrheit hatte ich nichts getan, um dem Mann die Fingerspitzen zu versengen. Zumindest nicht wissentlich. Und ich konnte den Vorgang auch nicht wiederholen, nachdem seine Kameraden mir die Eisen angelegt hatten – immerhin achteten sie nun viel mehr darauf, wo sie ihre Hände platzierten – und mich ins Lager führten.
»Da«, sagt Burrows plötzlich und streckt die Hand nach meinem Mieder aus. »Ich zeige es Euch.«
Scythe versperrt dem Captain mit seiner eindrucksvollen Gestalt den Weg, bevor er mich auch nur mit der Fingerspitze anfassen kann. »Ihr lasst die Hände von ihr!«
»Ich will doch bloß helfen! Wenn Ihr gesehen hättet, was mit meinem Stellvertreter passiert ist …«
»Ihr lasst die Hände von ihr!«
Burrows macht ein erstauntes Gesicht, dann verzieht sich seine Miene schnell zu zorniger Feindseligkeit. Es gefällt ihm nicht, zurechtgewiesen zu werden. Noch weniger gefällt es ihm, in seinem eigenen Lager nicht das Sagen zu haben. Aber er wäre töricht, Scythes Autorität infrage zu stellen. Er beißt die Stummelzähne zusammen, schluckt seinen Widerspruch runter und tritt einen Schritt zurück.
Die schmerzhaft festen Fesseln verhindern, dass ich zurückzucke, als Scythe mir mit einer Hand am Ausschnitt zieht und die Schnürung mit methodischen Bewegungen löst. Ich spüre die Last zahlreicher Blicke auf mir, obwohl seine gewaltige Gestalt mich weitgehend abschirmt. Mein Herz pocht so laut gegen meine Rippen, dass er es bestimmt hören kann.
Kalte Luft streicht über den oberen Teil meiner Brust, als der Commander mein Unterkleid runterzieht – keinen Zentimeter weiter als unbedingt notwendig – und das dreieckige Mal zur Hälfte freilegt. Demütigung und Grauen machen sich in mir breit. Wenn ich könnte, würde ich nach Luft schnappen, aber die Hand über meinem Kopf hält immer noch die Schlinge fest, sodass ich kaum atmen kann.
Ich beobachte sein Gesicht, während er das seltsame Symbol betrachtet, und versuche, seine Mimik zu deuten. Doch da ist nichts. Er ist ausdruckslos, seine Absichten ebenso unergründlich wie die verschlungenen Schnörkel und Spiralen, die er so gebannt anstarrt.
Ich will das Mal dazu bringen, ihn in die Flucht zu schlagen wie den Mann am Abgrund, wünsche mir, die Schlange aus unberechenbarer Macht würde wieder losschnellen und diesen neuen Feind verstümmeln, der da vor mir steht. Aber sie gehorcht nicht. Sie verharrt kalt und reglos in meiner Brust, die Giftzähne eingezogen und stumm, ihre Existenz genauso geheimnisvoll wie ihre Herkunft.
Eli zufolge trug ich das Mal schon, als er mich fand – ein Neugeborenes mit weißem Haar, ungewöhnlichen Augen und einem mysteriösen Zeichen auf der Brust, das so schwarz schien wie die Nacht selbst.
Versteck es lieber, Rhya, sagte er mir immer wieder, so oft, dass ich es bis zu meiner fünften Namensfeier schon nicht mehr hören konnte. Manche könnten es für ein verfluchtes Symbol halten, mein Kind.
Nach den Vorkommnissen an der Schlucht fürchte ich, sie könnten recht haben.
Scythe berührt mich nicht, er ist klug genug, auf Burrows’ Warnung zu hören. Aber sein Blick ist so intensiv, dass er mir beinahe die Haut verbrennt, während er langsam und geschickt mein Kleid wieder in einen angemessenen Zustand versetzt. Ich verstehe nicht recht, warum er sich überhaupt die Mühe macht – in Kürze werde ich nur noch ein Häufchen Asche sein –, aber seltsamerweise tröstet es mich, in meinen letzten Augenblicken auf Erden nicht entblößt der Belustigung von Fremden zu dienen.
»Die Fackel«, bellt Scythe unvermittelt und streckt seine freie Hand aus, ohne hinzusehen. »Her damit. Ich brauche Licht.«
Ein junger Rekrut tritt vor und reicht ihm zitternd die Fackel. Ich will mich losreißen, als Scythe sie mir vors Gesicht hält, aber die Fesseln lassen es nicht zu. Die Flamme ist unerträglich hell und glühend heiß. Meine Haut kribbelt in Erwartung der Schmerzen, und einen Moment bin ich gelähmt vor lauter Panik.
Er wird mich in Brand stecken, gleich hier und jetzt.
Ich schließe unwillkürlich die Augen, will meinem Feind und meinem unausweichlichen Schicksal nicht ins Auge sehen. Aber die Fackel kommt nicht näher. Stattdessen höre ich ein leises genervtes Grummeln, und Scythe lockert endlich die Schlinge um meinen Hals. Luft strömt mir durch die Kehle und füllt meine geplagte Lunge. Die anwesenden Soldaten quittieren mein stockendes Keuchen mit gedämpftem Gelächter.
»Lohnt sich kaum, die aufzuknüpfen«, meint Burrows. »Ist so schon halb tot. Meiner Meinung nach bloß Strickverschwendung.« Spucke fliegt mir entgegen, aber ich achte gar nicht darauf, wo sie landet. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, nach Luft zu schnappen.
Doch ich habe kaum Zeit, einmal richtig durchzuatmen, bevor mich eine große Hand an der linken Schulter packt und sie schüttelt. Scythes Ungeduld wird mit jedem Ruck seines Handgelenks deutlich. Er hat so viel Kraft, dass mir die Knochen klappern.
»Augen auf. Los.«
Über das laute Rauschen meines Pulses verstehe ich seinen Befehl kaum. Der Griff an meiner Schulter wird langsam schmerzhaft. Bis zum Morgengrauen werde ich noch mehr blaue Flecken bekommen – wenn ich dann überhaupt noch am Leben bin.
»Augen auf.«
Ich gehorche und sehe ihn durch einen Spalt hindurch an. Der Commander hält die Fackel hoch und taxiert mich mit einem Furcht einflößend strengen Blick. Er ist so imposant mit seiner breiten Brust und seiner hünenhaften Größe, dass er mein gesamtes Sichtfeld einnimmt. Eine Gestalt aus einem Albtraum. Es verlangt meiner schwindenden Tapferkeit alles ab, seinem bohrenden Blick nicht auszuweichen.
Will er mir in die Augen sehen, während er mein Leben auslöscht? Will er sehen, wie ihr Licht verlischt, wenn er mir die Klinge zwischen die Rippen stößt?
Ich weigere mich, zu blinzeln. Wenn das mein letzter Moment auf dieser Welt ist, sollte ich ihn offenen Auges erleben. Ich mache mich auf den Schmerz gefasst, doch dann …
Scythes streng zugekniffener Mund entspannt sich, nur ganz kurz, und er hat sich so schnell wieder im Griff, dass ich es gar nicht bemerkt hätte, wenn er nicht so nah vor mir stünde. Aber wenn auch nur flüchtig, sehe ich so etwas wie … Schock.
Kann es wirklich Schock sein?
»Unmöglich«, flüstert er so finster, dass es mir eiskalt den Rücken runterläuft.
»Wie bitte, Herr?« Burrows steht ein paar Schritte hinter ihm. »Das habe ich nicht verstanden.«
»Nichts.« Scythes Ton klingt wieder so barsch wie zuvor, aber er dreht sich nicht zum Captain um. Er sieht mir immer noch in die Augen und sucht in ihren Tiefen nach verborgenen Offenbarungen. Seine sind unergründlich. Zwei dunkle Seen, in denen sich nichts spiegelt als das Flackern der Fackel in seiner Hand. Die Gedanken einer Statue wären leichter zu erraten.
So verharren wir eine ganze Weile. Kaum merklich verstärkt er den Griff um die Fackel. In der Stille spüre ich viel mehr, als dass ich es sehe, wie er Luft holt und sich bereit macht.
»Sollen wir sie jetzt aufhängen?«, fragt Burrows träge. »Es ist gleich Mitternacht, und wir müssen bei Tagesanbruch weiter an die Südfront. König Eld hat Verstärkung angefordert. Wie es aussieht, macht nythisches Gesindel in der Grenzregion Är…«
Der Captain spricht den Satz nicht zu Ende. Das Wort Ärger ist erst halb aus seiner Kehle, als die Klinge des Commanders hineinfährt, ihm mit einem sauberen Schnitt die Luftröhre durchtrennt und ihn kurzerhand enthauptet. Ich habe Scythe nicht einmal nach der Waffe auf seinem Rücken greifen sehen. Die anderen anscheinend auch nicht. Die Schafe werden kalt erwischt, als sich der Wolf in ihrer Mitte zu erkennen gibt.
Burrows’ Kopf ist noch nicht einmal auf der Erde gelandet, da wirbelt Scythe herum – die Fackel in der einen und das Schwert in der anderen Hand – und schwingt seine Klinge mit einer Leichtigkeit durch zwei Soldaten, als würde er Blumenstiele im Garten abschneiden. Noch eine Drehung, und zwei weitere Männer gehen zu Boden, ihre Gliedmaßen zertretene Blüten.
Fünf Tote im Handumdrehen.
Bis die verbliebenen Soldaten begreifen, was vor sich geht, und ihre eigenen Waffen zücken wollen, ist es längst zu spät. Scythe ist so schnell, dass seine Bewegungen kaum zu erkennen, geschweige denn abzuwehren sind.
Ein Krieger bekommt die brennende Fackel ins Gesicht, und seine grauenvollen Schreie schallen durch die Nacht. Sechs weitere treffen kleine, präzise geworfene Dolche im Nacken, und sie kippen einfach um, ihr Lebenssaft versickert in der Erde. Den Rest, der sich umdreht und, so schnell es geht, in den Schutz des dunklen Waldes fliehen will, verfolgt und tötet er mit der geübten Leichtigkeit eines geborenen Killers.
Während Scythe seinen todgeweihten Opfern nachstellt, bin ich zum ersten Mal seit meiner Gefangenschaft allein. Doch weil ich immer noch an den Baum gebunden bin und die Leichen meiner Entführer um mich verstreut liegen, habe ich zu viel Angst, um erleichtert zu sein. Stattdessen scheint mir in der plötzlichen Stille das Herz jeden Moment aus der Brust zu springen und vor die Füße zu fallen.
Erschrocken lasse ich den Blick über das dunkle Lager schweifen. Der Tote direkt neben mir ist fast noch ein Junge. Seine offenen Augen sind auf den Nachthimmel gerichtet, aber er kann ihn nicht mehr sehen. War er der junge Rekrut, der vor wenigen Stunden noch um Rat gebeten hat? Wahrscheinlich spielt das keine Rolle. Dennoch plagt mich unangebrachtes Mitgefühl.
Er hätte es genossen, dich hängen zu sehen, Rhya, rufe ich mir in Erinnerung. Seit wann bist du so schwach?
Ich habe keine Zeit für albernes Mitleid – auch nicht mit einem unschuldigen Zufallsopfer. Auf mich warten viel größere Probleme. Denn obwohl Scythe meine Entführer getötet hat, ist er nicht hier, um mich zu retten. Daran besteht für mich kein Zweifel.
Ich zähle weniger als fünf Minuten, bis er wieder auf die Lichtung tritt, sein Umhang weht hinter ihm wie bei Gevatter Tod in alten Märchen, sein Helm schimmert dunkelsilbern im mitternächtlichen Mondschein. Mit grimmiger Effizienz zieht er seine Dolche aus den Halsschlagadern der Gefallenen und steckt sie einen nach dem anderen wieder an ihren Platz in seinem Brustgurt.
Er ist nicht mal außer Atem.
Der Säbel in seiner Hand ist schwarz vor Blut. Im schwachen Schein des langsam ausgehenden Feuers sehe ich zu, wie er ihn an Burrows’ enthaupteter Leiche abwischt. Als er wieder glänzt, richtet Scythe sich zu voller Größe auf und holt so tief Luft, dass seine Brust noch breiter wirkt.
Langsam dreht er sich um, und mir bleibt die Luft weg, als er mir in die Augen sieht und mich damit noch wirksamer am Bewegen hindert als meine Fesseln. Mit zwei Schritten steht er vor mir. Ich versuche, nicht zu schreien, als er das Schwert hebt, aber ein ängstliches Jammern entfährt mir dennoch.
Bei dem Geräusch hält er inne. Er zieht eine Augenbraue hoch, als wäre er überrascht, aber seine Lippen bleiben fest aufeinandergepresst. Wir schauen einander einen Moment an, scheinen in der Stille der Nacht beide den Atem anzuhalten.
Mach schon. Ich lege meinen ganzen schwachen Mut in meinen Blick. Bringen wir es endlich hinter uns.
Als hätte er meine Aufforderung gehört, vollführt er eine rasche Bewegung mit dem Säbel und setzt einen sauberen Schnitt. Allerdings schneidet er mir nicht den Kopf ab, sondern die Schlinge um den Hals. Der Strick landet auf der Erde, und mit einem weiteren Ruck löst er die Fesseln an meinem Oberkörper.
Endlich frei, kippe ich vorwärts in den Dreck. Meine tauben Beine können mich nicht mehr aufrecht halten und meine immer noch in Eisen gelegten Hände meinen Sturz kaum abfangen. Schmerz schießt mir durch die Schläfe, als ich mit dem Kopf auf die harte Erde pralle. Der Sauerstoff wird mir auf einen Schlag aus der Lunge gepresst, und ich bleibe keuchend liegen.
Als ich die Augen wieder aufbekomme, sehe ich mich einem bekannten Vollbart und pockennarbigen Wangen gegenüber. Burrows’ abgetrennter Kopf ist so nah, dass ich ihn küssen könnte. Ich schreie auf und rolle mich auf die Seite, will mich mit den gefesselten Händen verzweifelt und unbeholfen aufrichten. Die Erde um mich herum ist getränkt mit dem Blut der Soldaten. Ich versuche, es auszublenden, während ich mich stückchenweise vorwärtsziehe, vorbei an Leichenteilen und Wurzeln, wobei ich immer wieder nach Erdklumpen und Laub greife. Jeder Zentimeter bedeutet Höllenqualen für meine geschundenen Handgelenke.
»Steh auf.«
Die Stimme von oben klingt kalt. Ich beschließe, sie zu ignorieren.
Möglicherweise höre ich ein Seufzen, aber wer weiß. Ich bin viel zu sehr mit meinem erbärmlichen Fluchtversuch beschäftigt. Nachdem ich vielleicht zwei Handbreit zurückgelegt habe, packt mich Scythe an den Haaren und zerrt mich gewaltsam auf die Füße. Ich heule auf vor Schmerz, aber er lässt nicht los – er zieht mich einfach hinter sich her wie einen unartigen Hund.
Sekunden später haben wir die Lichtung überquert und die Massakrierten und ihr ordentliches Lager hinter uns gelassen. Das Feuer ist fast aus, es ist niemand mehr am Leben, der es am Brennen halten könnte. Am Rand der Lichtung grasen ein paar Pferde unter einem Baum. Unter den grau gescheckten Tieren mit weichen weißen Mäulern sticht ein Ross heraus – ein glänzend schwarzer Hengst, auf dem man perfekt getarnt durch die Nacht reiten kann. Er ist einige Hands größer als die anderen und trägt einen gepanzerten Sattel, geeignet fürs Schlachtfeld. Ein Schild aus Ketten bedeckt seine breite Nase.
Es erklärt sich von selbst, wessen Pferd das ist.
Scythe lässt mein Haar wieder los, aber nur, um mich grob über den Rücken des riesigen Pferds zu werfen – mit dem Gesicht nach unten, die Beine baumeln auf einer Seite und die gefesselten Hände auf der anderen. Kurz darauf wird der Lederriemen einer Satteltasche gründlich über meiner Mitte befestigt, damit ich nicht runterfalle.
Ich bin zu erschöpft, um gegen meine würdelose Lage zu protestieren.
Die bedrohliche Präsenz des Commanders weicht einen Augenblick, als er die angebundenen Pferde losmacht. Ich höre ihn leise mit der Zunge schnalzen und fest gegen mehrere Hinterteile klatschen. Dann entfernt sich die Kavallerie mit eifrigem Hufgetrappel vom Lager – und ihren toten Reitern. Ich hoffe, sie können ihren verfrühten Ruhestand in Frieden irgendwo in der Wildnis verbringen. Jetzt sind sie nicht mehr gezwungen, irgendwen in die Schlacht zu tragen, müssen sich nicht mehr den Launen blutrünstiger Könige unterwerfen. Sie können einfach den ganzen Tag den Wind und die Sonne genießen und auf endlosen Wiesen grasen.
Ich fürchte, mein Schicksal wird nicht ansatzweise so beschaulich sein.
Mit einem leisen Ächzen schwingt sich der Commander in den Sattel, tippt seinem Pferd mit den Fersen in die Seiten und treibt uns voran in die Dunkelheit.
Kapitel 3
Über dem Rücken des Hengstes hängend kann ich unmöglich einschlafen, jeder Schlag seiner Hufe bringt meine Knochen zum Beben wie ein Schmiedehammer einen Amboss. Doch irgendwann muss sich meine Erschöpfung dennoch gegen die Unannehmlichkeit durchgesetzt haben, denn als ich die Augen wieder aufmache, ist bereits die Morgendämmerung angebrochen und zieht rosa Streifen über den Himmel.
Ihr Götter, mir tut alles weh.
Mein Körper fühlt sich ausgewrungener an als ein alter Waschlappen. Schlaff und schlapp. Der Gurt um meine Mitte sitzt so fest, dass ich kaum Luft bekomme. Bis auf die Flanke des Pferds unter mir, den Stiefel meines Entführers im schmutzigen Steigbügel und die schnell vorbeiziehende Erde darunter sehe ich so gut wie nichts.
Wir reiten schnell. Richtung Nordwesten, dem Stand der Sonne am aschgrauen Himmel nach zu urteilen. Fort von den Sumpfgebieten, raus aus dem Wald – aber wohin, weiß ich nicht. Ich grübele, ob die Soldaten gestern Abend irgendetwas Hilfreiches verraten haben. Was hatte Burrows gesagt?
Wir müssen bei Tagesanbruch weiter an die Südfront. König Eld hat Verstärkung angefordert.
König Eld von …
Den Narrows?
Nein.
Dymmerien?
Nein.
Westlake?
Nein.
Verflucht sei mein mieses Gedächtnis. Verflucht sei ich, weil ich keine bessere Schülerin war. Verflucht sei Eli, dass er mir das Wissen nicht mit dem Stock eingebläut hat, statt mich geduldig zu ermuntern.
Beim Gedanken an Eli kommen mir beinahe die Tränen. Zwei Jahrzehnte lang hat er mich beschützt. Wäre er jetzt hier bei mir – wäre er noch am Leben –, würde es ihn umbringen, mich so zu sehen. Eine verdreckte, kaputte Puppe in den Händen ebenjenes Feindes, vor dem er mich sein ganzes Leben lang bewahren wollte. Ich bin dankbar, dass ich zu schwach zum Weinen bin.
Die Sonne steigt immer höher, während wir weiterreiten, die Hufe des Hengstes klappern beständig. Ich habe nicht die geringste Ahnung, in welchem Teil der Welt wir uns befinden. Anwyvn ist gigantisch, und bis vor ein paar Wochen kannte ich bloß einen winzigen Bruchteil davon. Die abgeschiedene Halbinsel Seahaven war von dem Augenblick an mein Zuhause, als Eli mich mutterseelenallein und eingewickelt in einem Körbchen am weißen Strand fand, und blieb es bis zu jener Nacht, in der die Truppen sie mit brennenden Fackeln überfielen.
Wir haben den dunklen Wald hinter uns gelassen. Von den riesigen Ahornbäumen und hoch aufragenden Eschen, die mir den letzten Monat über Schutz geboten haben, ist nichts mehr zu sehen. Hier stehen die Bäume nicht so dicht beisammen – ein Hain kahler Kiefern mit hellen kupferfarbenen Nadeln, die die vertrocknete Erde bedecken.
Es ist fast Mittag, als wir endlich anhalten. Ich bin so entkräftet, dass ich nicht mal den Kopf heben und einen Blick auf unsere Umgebung werfen kann. Ich spüre, wie Scythe sich im Sattel bewegt, dann höre ich seine Stiefel dumpf auf dem Boden landen. Sie treten in mein Sichtfeld, als er den Riemen löst, mit dem ich festgebunden bin, und ich bestaune ihre schlichte Machart.
Keine Sporen, keine Stahlkappen. Eine dicke Staubschicht auf den Schnürsenkeln. Das Leder ist von vielen Jahreszeiten gegerbt. Wie überraschend. Ich hätte gedacht, ein Soldat seines Rangs müsste nur mit dem Finger schnippen, um jederzeit eine nagelneue Ausrüstung zu bekommen.
»Runter mit dir.«
Seine tiefe Stimme ist vom langen Schweigen eingerostet und klingt alles andere als freundlich. Ich will meine Glieder in Bewegung setzen, aber sie sind zu steif. Ich bleibe weiter erbärmlich über dem Pferderücken hängen, meine Wirbelsäule unnatürlich gekrümmt. Ich fürchte schon, mich nie wieder richtig aufrichten zu können.
Scythe seufzt und verpasst mir einen äußerst unsanften Stoß. Mit erschrockenem Quieken rutsche ich auf den Schweif des Pferds zu, kann mich nicht festhalten und lande auf der Erde. Ich komme auf dem Rücken zum Liegen und wirbele eine Wolke aus Blütenstaub auf. Die Kiefernnadeln federn meinen Aufprall etwas ab, aber mir bleibt trotzdem die Luft weg. Eine ganze Weile kann ich mich nicht rühren, starre in den fahlen Himmel und stöhne hin und wieder vor Schmerzen.
Scythe führt das Pferd an einen nahe gelegenen Bach. Ich höre beide ausgiebig trinken und fahre mir neidisch mit der ausgetrockneten Zunge über die Lippen. Ganz flüchtig wünsche ich mir, er hätte mich schon im Lager getötet. Keine Ahnung, worauf er noch wartet. Vielleicht will er mich mitschleifen, bis ich nur noch ein vertrocknetes Gerippe bin.
Das wird ein langsamer Tod.
Plötzlich fällt ein Schatten über mich, etwas verdeckt die Sonne. Mein Entführer ist zurück. Ich schlage die Augen auf und sehe ihn an. Seine sind schwarz, selbst bei Tageslicht. Er trägt immer noch den schweren Helm, der sein Gesicht beinahe vollständig verbirgt. Der Nasenschirm aus Metall verjüngt sich nach unten hin zu einer scharfen Spitze, wodurch er beinahe schlangenartig wirkt, oder wie ein Drache. Er schaut auf mich herab und verzieht einen Mundwinkel, entweder angewidert oder verächtlich.
Ihr Götter, wie ich ihn hasse.
Ein Trinkschlauch aus Leder landet neben meinem Kopf.
»Trink.«
Ich greife nicht danach. Ich rühre keinen Muskel. Lieber verdurste ich, als ihm zu gehorchen. So töricht es auch ist, diese winzige Widersetzung ist alles, was mir von meiner Autonomie geblieben ist.
»Wie du willst.« Schulterzuckend dreht er sich um und geht davon. Sein nächster Satz weht mit dem Wind zu mir herüber, als sei er ihm gerade noch eingefallen. »Wir rasten erst bei Nacht wieder.«
Ich brauche drei Versuche, mich hinzusetzen, meine strapazierten Glieder beschweren sich die ganze Zeit. Vor Schmerz und Hunger bin ich ganz benommen, aber ich schaffe es, den Schlauch auf meinen Schoß zu ziehen. Die Eisen rasseln und brennen an meiner geschundenen Haut, als ich ihn an die Lippen hebe und gierig trinke.
Es schmeckt himmlisch.
Nach beschämend kurzer Zeit habe ich den Schlauch geleert. Mein seit Langem leerer Magen protestiert gegen das ungewohnte Völlegefühl, aber ich habe immer noch solchen Durst. Ich schaue rüber zu dem kleinen Strom, der über bemooste Steine gluckert, und überlege mir, mich ans Ufer zu schleppen und mir noch ein paar heilende Schlucke zu gönnen. Wenn ich genug Wasser trinke, dreht sich vielleicht nicht mehr alles. Und wenn sich nicht mehr alles dreht, komme ich womöglich darauf, wo Scythe mich hinbringt … und wie ich vorher entkommen kann … und …
Ohne Vorwarnung werde ich hochgezerrt, und der leere Trinkschlauch wird mir aus der Hand gerissen. Mein piepsiger Protest verwandelt sich in ein ängstliches Fauchen, als er mich mit der großen Hand fest an der Schulter packt.
»Wir müssen weiter«, brummt Scythe und zieht mich zurück zu seinem Pferd. Ich stemme die nackten Fersen gegen den Boden, vergebens. Er wischt meinen Widerstand beiseite wie ein störendes Insekt. Ich komme nicht einmal zu Wort, bevor er mich wieder auf den Rücken des Hengstes wirft. Das Wasser schwappt mir unangenehm im Magen herum, als er mich mit der gleichen mechanischen Gleichgültigkeit festzurrt, die er vermutlich bei einem Sack Getreide an den Tag legen würde.
Er sitzt auf und schnalzt mit der Zunge. Das Pferd reagiert sofort und verfällt in einen heftigen Galopp, den ich in jeder Faser meines mitgenommenen Körpers spüre.
Halt einfach durch, bis es Nacht wird, sage ich mir, um die Verzweiflung fernzuhalten. Das schaffst du schon, Rhya.
Aber bis dahin dauert es noch ewig.
Irgendwann wird mir bewusst, dass ich ziemlich krank bin. Das Fieber hat sich im Zuge von Durst und Erschöpfung eingeschlichen und sich hinter den zahllosen anderen Schmerzen und Wehwehchen meines Körpers versteckt. Aber als der Nachmittag zu Ende geht, lässt sich die Hitze nicht mehr leugnen, die sich trotz des kühlen nördlichen Klimas unserer Umgebung in meinen Adern ausbreitet. Meine Haut ist abwechselnd glühend heiß, dann kalt, dann wieder heiß. Mittlerweile bin ich dankbar für den Riemen, der mich festhält – ohne ihn würde mich mein gewaltiges Zittern vom Pferd werfen.
Ich sehe keinen Sinn darin, meinen Entführer über meinen Zustand zu informieren. Wie sollte er auch reagieren?
Komm, wir schlagen unser Lager auf. Dann bringe ich dir heiße Suppe und streichele dir übers Haar, bis es dir besser geht, genau wie Eli es immer gemacht hat, als du noch klein warst.
Ich bezweifle es.
Es dämmert noch nicht ganz, als wir unvermittelt am Waldrand anhalten, an dem die Bäume sich zu einer breiten, unbefestigten Straße hin lichten. Ich frage mich, ob wir uns so früh schon für die Nacht niederlassen, aber Scythe steigt weder ab noch erklärt er mir, warum wir so plötzlich stehen bleiben, nachdem wir den ganzen Tag mit halsbrecherischer Geschwindigkeit unterwegs waren.
Ich versuche, den Kopf zu heben, damit ich etwas erkennen kann, und murmele ein fiebriges »Hmpf?«.
Scythe fährt im Sattel herum. »Ruhe.«
Den Befehl flüstert er derart bedrohlich, dass es mir die Kehle zuschnürt. Wenn ich nicht gehorche, wird er mich wahrscheinlich, ohne zu zögern, k. o. schlagen. Warum er so ernst ist, wird mir aber bald klar. Keine halbe Minute später höre ich Stimmen, nach einer weiteren halben Minute ist die Straße vor uns voll mit einer Kompanie von Männern, die mit erhobenen Schilden und Schwertern auf dem Rücken in Reih und Glied marschieren. Fünfundzwanzig, vielleicht noch mehr. Ihre Uniformen sind nicht grün wie die von Captain Burrows und seiner Einheit, sondern blutrot. Ihre Wimpel tragen als Siegel zwei miteinander verschränkte Wendelringe, die als scharlachrote Stickerei in der Luft wehen.
Verborgen hinter Blättern und Zweigen sehen sie uns nicht. Was eindeutig Scythes Absicht ist. Aus unerfindlichen Gründen will er unsere Anwesenheit geheim halten.
Vielleicht …
Ein Funke Hoffnung glimmt in meiner Brust auf, erlischt aber sofort wieder. Bloß weil sie Scythes Feinde sind, macht sie das nicht zu meinen Freunden. Sie könnten mir genauso gut das Schwert ins Herz rammen, sobald ich um Hilfe rufe. Außerdem wäre es durchaus möglich, dass Scythe all diese Männer ebenso leicht niedermetzelt wie das Dutzend gestern.
Entmutigt schaue ich zu, wie die Soldaten vorbeimarschieren und um die Ecke biegen. Wir warten, bis ihre Schritte nach und nach verklingen. Als alles – bis auf Scythes gleichmäßige Atemzüge, ab und zu ein Zucken des Pferdeschweifs und das leise Rauschen des Winds in den Bäumen – wieder still und er sicher ist, dass die Soldaten weit weg sind, treibt er uns aus dem Wald, über die Straße und ins hohe Gras auf der anderen Seite.
Wir haben die Prärie erreicht.
Auf der flachen Ebene, wo wir weder Baumwurzeln noch Geröll ausweichen müssen, fällt der Hengst in einen noch schnelleren Galopp. Jeder Hufschlag hallt in meinem schmerzenden Schädel wider. Auch wenn er sich nicht äußert, nehme ich eine neue Anspannung an meinem Entführer wahr, eine Dringlichkeit, die heute Morgen noch nicht da war.
Wenn ich klarer denken könnte, würde mir vielleicht einfallen, woher ich das Siegel der Kompanie kenne – rote, miteinander verschränkte Wendelringe auf schwarzem Grund. Dann wäre mir unter Umständen bewusst, wie nahe sie uns auf den Fersen sind. Aber dem ist nicht so. Meine Gedanken sind verworren. Ich sehe die Welt wie durch einen Nebel, mein Körper befindet sich auf der einen Seite, mein Geist auf der anderen. Durch den Dunst kann ich die beiden nicht miteinander verbinden.
Das Flachland scheint endlos weiterzugehen, immer mehr brachliegende Felder. Wie der Rest der Mittlande ist auch dieser Teil vom Krieg verwüstet. Ein richtiges Ödland nach zweihundert Jahren Blutvergießen. Ehemals bestellte Felder sind nun Massengräber, die Bauern von einst längst unter der kargen Erde begraben.
Wir sehen keine Soldaten mehr. Wir sehen überhaupt niemanden. Die meisten Reisenden bleiben vermutlich auf der Straße und kehren am Abend in eine Herberge ein, trinken am Kamin ein Bier und essen eine warme Schüssel Eintopf, tauschen ihre müden Gäule gegen ausgeruhte. Eine solche Maßnahme ist bei Scythes Pferd nicht notwendig. Das riesige Tier scheint nie zu ermatten, ganz gleich, wie viele Wegstunden es rennt oder wie der Boden beschaffen ist. In meinem Delirium frage ich mich, ob es vielleicht von den großen Paexyri-Rössern abstammt. Der Legende nach konnten sie buchstäblich tagelang laufen und die Fae von einem Ende von Anwyvn ans andere tragen, ohne auch nur eine Trinkpause einzulegen. Manche glauben, sie hätten gigantische Flügel gehabt, denn ihre Schnelligkeit mutete eher wie Fliegen an.
Was für absurde Gedanken, selbst für mein fiebriges Hirn. Hätten die Paexyri wirklich existiert, wären sie mitsamt ihren Reitern der Säuberung zum Opfer gefallen. Der blutige Aufstand hatte niemanden elementaren Ursprungs verschont, den allmächtigen Kaiser ebenso wenig wie die kleinsten Fyrewischen. Sie wurden gemeinsam mit allen anderen magischen Wesen mit der gleichen brutalen Gründlichkeit ausgelöscht, mit der sich die Sterblichen jetzt in ihren endlosen Kriegen gegenseitig bekämpfen. Kurzsichtige Papierkönige ergreifen die Macht, untergraben die anderer, fallen beieinander ein und übereinander her, bis nichts mehr von dem Land übrig ist, über das sie herrschen wollen. Bis nichts mehr bleibt als Asche und alle Schönheit dahin ist, die Anwyvn einmal besaß.
Auf unserem Weg begegnen wir nur ganz gewöhnlichen Geschöpfen – zotteligen Rindern und ungeschorenen Schafen, die in der Sonne grasen. Doch auch die werden immer seltener, als die Landschaft sich von flachen Feldern zu sanften Hügeln und schließlich einem steilen Hang wandelt. An die Stelle von Gräsern treten Felsen und Steine. Beim Aufstieg hole ich angestrengt Luft und frage mich, ob meine Kurzatmigkeit auf die fortschreitende Krankheit oder die zunehmende Höhe zurückzuführen ist.
Bei Sonnenuntergang verschlimmert sich mein Fieber. Als wir unser Nachtlager aufschlagen, verliere ich immer wieder das Bewusstsein. Ich kann mich nicht erinnern, vom Pferd gestiegen zu sein, aber da stehe ich, und der Boden wankt unter meinen Füßen. Oder sind das meine Beine, die gleich nachgeben? Ich kann es nicht genau sagen.
Ein eiserner Griff packt mich, als die Welt sich zur Seite neigt. Scythes ernstes Gesicht tanzt vor meinen Augen. Er starrt mich schon wieder so an.
»Götter, du glühst ja.«
Schwebe ich?
Trägt er mich?
Muss er immer so ein Gesicht machen?
Ein fieberverrücktes Kichern will mir über die Lippen entweichen. Ich klammere mich verzweifelt an mein Bewusstsein, doch es fällt mir von Augenblick zu Augenblick schwerer. Die Dunkelheit kommt wieder näher, schwärzer als der Nachthimmel über uns, und will mich an sich reißen.
»Törichter Dickkopf«, zischt Scythe leise und legt mich auf einen flachen Stein. Er fühlt sich wunderbar kühl an. »Tot nützt du mir auch nichts.«
Jemand kichert. Kann sein, dass ich es bin.
»Hey.« Er klatscht mir auf die Wange. »Bleib bei mir. Bleib bei mir.«
Ich blinzele heftig und gebe mir Mühe, ihn zu fixieren. Vielleicht ist es das Fieber, das meinen Geist verwirrt, aber ich könnte schwören, dass ich in seinen zusammengekniffenen Augen etwas sehe, das vorher nicht da war – ein Anflug von Sorge, der so schnell wieder verschwunden ist, dass ich mir leicht einreden kann, es sei nichts als ein Produkt meiner Fieberfantasien gewesen.
Die schwarzen Augen sind das Letzte, was ich sehe, bevor die Krankheit mir ihren feuchtkalten Griff um den Hals legt und zudrückt, bis alle Lichter ausgehen.
Kapitel 4
Ich erwache allein.
Meine Lider wollen sich nicht öffnen lassen, sind vor Erschöpfung ganz schwer. Ich befinde mich in einer Art Höhle und lehne an einer bemoosten Felswand. Der Boden unter mir ist aus festgedrücktem Kies. Vom Himmel ist dank der steinernen Decke nichts als ein kleiner Spalt zu sehen, durch den ein wenig Sonne hereinscheint.
Ich weiß nicht, wie ich hierhergekommen bin.
Mir fallen nur Bruchstücke der Nacht ein. Augenblicke der Klarheit trotz Delirium. Das Blitzen eines Metallhelms im Mondlicht. Eine große Hand an meiner Stirn, die meine Temperatur fühlt. Ein Feuerstein, der gegen den Felsen geschlagen Flammen entfacht. Geheimnisvolle Augen, die mich aufmerksam mustern. Und eine Stimme, die mich im wankenden Dunkel heiser beschwört.
Bleib bei mir.