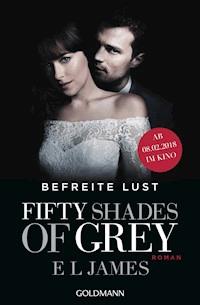9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
«Die Frau, die, mit Baudelaire zu sprechen, in meinen Träumen und in meinen Tagen der tiefste Schatten war und das hellste Licht, ist Thérèse, die Braut meines Bruders, später seine Frau ... Alle Regungen ihres Herzens und ihres Leibes kannten nur ein Ziel: die Begierden sich entfalten zu lassen und die Lust zu beschützen vor den Wechselfällen des Schicksals, vor den Bedrohungen durch den Zufall – Thérèse, schöne, kapriziöse Verwirklicherin der Phantasie.» So erinnert sich Francis, der Ich-Erzähler dieser erotischen Prosa, an jene junge Frau, in deren Bann er, sein älterer Bruder Philippe und Florence, seine kindhafte Freundin, während eines Sommers standen, der vom Aufflammen spontaner Gefühle und dem Taumel der Sinne erfüllt war. Sie gewährt ihnen Einweihung in die Mysterien des Fleisches und kundige Führung auf den vielfältigen Wegen der Lust und wird den ihr und einander Verfallenen Mittelpunkt des Lebens und maîtresse de plaisir. In den möblierten Zimmern des Quartier Latin wie in den prunkvollen Appartements der Faubourgs, im Kreis der zärtlich-schönen Freundinnen bei einem orgiastischen Weekend mit Gleichgesinnten auf einem Schloß in der Normandie und unter den blühenden, den Duft sinnlicher Vereinigung verströmenden Kastanien seines Parks erforschen und erfahren sie die Mannigfaltigkeit der Liebe. Ihre von Zuwendung und Zärtlichkeit erfüllte Gemeinsamkeit, ihre einander offenbarten Erinnerungen, aber auch die Spannung, die neue Reize schaffende Eifersucht und die Tristesse der Lust binden sie aneinander und an Thérèse, bis der Sommer vorüber ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
José Pierre
Thérèse oder Die Kastanienblüte
Aus dem Französischen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Die Frau, die, mit Baudelaire zu sprechen, in meinen Träumen und in meinen Tagen der tiefste Schatten war und das hellste Licht, ist Thérèse, die Braut meines Bruders, später seine Frau ... Alle Regungen ihres Herzens und ihres Leibes kannten nur ein Ziel: die Begierden sich entfalten zu lassen und die Lust zu beschützen vor den Wechselfällen des Schicksals, vor den Bedrohungen durch den Zufall – Thérèse, schöne, kapriziöse Verwirklicherin der Phantasie.»
So erinnert sich Francis, der Ich-Erzähler dieser erotischen Prosa, an jene junge Frau, in deren Bann er, sein älterer Bruder Philippe und Florence, seine kindhafte Freundin, während eines Sommers standen, der vom Aufflammen spontaner Gefühle und dem Taumel der Sinne erfüllt war. Sie gewährt ihnen Einweihung in die Mysterien des Fleisches und kundige Führung auf den vielfältigen Wegen der Lust und wird den ihr und einander Verfallenen Mittelpunkt des Lebens und maîtresse de plaisir.
Über José Pierre
José Pierre, geboren 1927 in Landes, gestorben 1999 in Paris, war ein profunder Kenner und Theoretiker des Surrealismus. 1971 organisierte er in Köln die Ausstellung «Der Geist des Surrealismus». «Thérèse oder Die Kastanienblüte» war sein erster Roman.
Inhaltsübersicht
Und sie bestürmen sie, die wie die erste blühende Kastanie,
der erste Hauch des Frühlings ist, der ihren Winterschmutz wegfegt
BENJAMIN PÉRET
Lichter von der Straße blitzen auf, Euphorbe lächelt leise zwischen Furcht und Lust,
Ich seh ihr Herz, es ist in diesem Augenblick gelöst von ihr und schneidend, es ist die erste Knospe der Kastanie, die rosenrot hervorbricht
ANDRÉ BRETON
Die Frau, die, um mit Baudelaire zu sprechen, «den tiefsten Schatten und das hellste Licht» in meine Träume und in mein Leben brachte, ist Thérèse, die Braut meines Bruders – und später seine Frau.
In jenem Winter, ich erinnere mich noch gut und werde mich noch lange daran erinnern, setzte mein Bruder Philippe uns, meine Eltern und mich, auf wenig feinfühlige Weise in Kenntnis. Es war etwa Mitte November. Als das Mittagessen sich dem Ende zuneigte (ich sehe noch das Stück Apfeltorte vor mir und wie ich es in der beklommenen Stille, die auf seine Erklärung folgte, auf dem Teller zerkrümelte, ohne es essen zu können), verkündete er uns mit kühler Sachlichkeit: «Heute abend stelle ich euch meine Verlobte vor.»
Mein Vater, trotz seiner Verwurzelung im Bürgertum ein Mann von recht liberalen Grundsätzen, hatte an sich halten müssen, um nicht aufzufahren. Eine Verlobung war für ihn Bestandteil eines Ritus, der eine bestimmte Anzahl von Stufen umfaßte, die man in genau festgelegter Reihenfolge hinter sich zu bringen hatte. Nun war jedoch mein Bruder, der sechs Jahre älter ist als ich, schon immer Gegenstand eines verschwiegenen, aber intensiven Kultes innerhalb unserer Familie gewesen, teils wegen seiner brillanten Leistungen in der Schule und an der Universität, teils seines ausgeglichenen Wesens wegen. Und so wagte es niemand – trotz gewisser heimlicher, leicht verständlicher Bedenken –, Einwände gegen seinen Entschluß zu erheben oder gar Erklärungen von ihm zu verlangen, die uns zu geben er auch ganz offensichtlich nicht bereit war. Er hatte, wofür ich ihm unendlich dankbar war, weder seine Stellung als ältester Sohn noch die Verehrung, die ihm von der Familie entgegengebracht wurde, je mißbraucht. Außerdem wirkte eine solche eigenmächtige Geste sicherlich eher annehmbar, weil es das erste Mal war, daß dergleichen geschah, und weil es schließlich und endlich nur ihn allein betraf. (Ich bin hier nur auf die Reaktion meines Vaters eingegangen, denn meine Mutter, schüchtern und still, wäre wohl nie auf die Idee gekommen, daß mein Bruder etwas Unannehmbares hätte sagen, tun oder auch nur denken können.)
Muß ich noch hinzufügen, daß die Bedenken, von denen ich sprach, nicht einmal zu einem Strohfeuer reichten? Am gleichen Abend erschien Thérèse, und sogleich standen wir in ihrem Bann. Hätte irgend jemand uns daran erinnert, meine Eltern oder mich, daß keiner von uns dreien nach seiner Meinung über die Verlobte gefragt worden war, wir hätten ihn energisch zurechtgewiesen! Welch ein bestrickendes Geschöpf.
Wir konnten es nicht fassen, und mein Bruder lachte sich ins Fäustchen, als er sah, wie wir die Waffen streckten und der Verzauberung erlagen, der er, gewiß nicht ohne erhebliche Mühe, mit sehr viel mehr Gelassenheit zu begegnen schien. Ich habe niemals Frauen, die mir etwas bedeuteten, zu beschreiben vermocht, und bei Thérèse vermag ich es noch weniger, nicht zuletzt vielleicht auch deshalb, weil ich fürchten müßte, daß ihr Bild, das nie aufgehört hat mich zu foltern, mich noch heftiger quälen würde, wenn ich es mit Worten zu beschwören versuchte …
Wir sahen Thérèse in jenem Winter fast jeden Abend, und für mich ist ihr Bild mit dem lodernden Kaminfeuer in unserem Salon verbunden. Gewöhnlich wurden die Scheite im Kamin schon wegen der damit verbundenen Arbeit nur ausnahmsweise angezündet, am Samstagabend oder an Festtagen. Doch wenn Thérèse da war, ich kann es nicht anders sagen, war das immer ein Fest! Ihr strahlender Blick, ihre geröteten Wangen, ihr weicher lachender Mund sind daher in meiner Erinnerung mit dem Knistern und Prasseln des Feuers und dem tanzenden Schein der Flammen verschmolzen, der ihr hübsches Gesicht so zärtlich streichelte. Vielleicht kam mir deshalb das Baudelaire-Wort ganz von selber in die Feder, als ich sie vorhin schildern wollte. Thérèse, Schatten und Licht. So sehe ich sie vor mir, so werde ich sie immer sehen, wie sie mir das Gesicht zuwandte, in das sich, je nachdem, wie sie stand, der Schein des Feuers oder die dunklen Schatten malten oder, häufiger noch, der fließende Übergang von Hell zu Dunkel …
Wenn das Gespräch verebbte, oder wenn sie schweigend ein wenig träumen wollte, kauerte sie gern vor dem Feuer und rauchte eine Zigarette. Ich versuchte dann, mich neben ihr hinzukauern, zum einen weil ich so den anderen den Rücken zukehrte und sie mein Gesicht nicht sehen konnten, zum andern weil ich Thérèse so in aller Ruhe betrachten konnte. Nur wenige hübsche Frauen verstehen es, eine Zigarette so zu rauchen, daß es auf harmonische Weise ihre Schönheit und ihre Persönlichkeit hervorhebt. Thérèse war eine von ihnen. Wenn sie rauchte lag in ihren Bewegungen zugleich ein Zeichen unmittelbarer Sinnlichkeit und ein wollüstiges Versprechen. Daß ich sie so aufmerksam betrachtete, mißfiel ihr nicht. Hin und wieder sah sie mich an, und bisweilen lächelte sie mir zu, hob leicht das Kinn und stieß ein wenig Rauch aus.
Sie war neunzehn Jahre alt und Philosophiestudentin, als mein Bruder sie bei gemeinsamen Freunden kennengelernt hatte. Philippe, von Natur aus ruhig und zurückhaltend, aber zu plötzlichen Ausbrüchen von Begeisterung und Zärtlichkeit fähig, hatte ihr sofort einen Heiratsantrag gemacht, und sie ihrerseits war zweifellos von seinen ausgeprägten guten Eigenschaften beeindruckt gewesen, insbesondere von seiner Rücksicht, die selten ist bei jungen Leuten, die es gewohnt sind, sich über intellektuelle Hindernisse hinwegzusetzen. Sie dagegen war ganz Schwung, Schönheit, Charme. Unter den Augen meines Bruders und wie in stillschweigendem Einverständnis zwischen ihr und ihm vervielfachte sie auf natürliche Weise ihre Fähigkeiten der physischen Verführung durch die der Heiterkeit, der Lebhaftigkeit und einer Intelligenz, die so flink war wie das Florett eines vollendeten Fechters. Wir brauchten einige Zeit, um uns daran zu gewöhnen, aber man konnte ihr nicht widerstehen. Selbst meine Mutter, die ihren Angriffen im Prinzip weniger preisgegeben war, betrachtete sie mit einer Mischung aus Bestürzung und Bewunderung, in der spürbar alles unterging, was an Vorbehalte hätte grenzen können.
Ich sprach von Angriffen, und ich meine das wörtlich. Im Verlauf jener langen, unglaublich heiteren und gelösten Winterabende lag sie ebensooft in unseren Armen wie in denen Philippes, ohne daß ihr Verhalten je unpassend gewirkt oder Verlegenheit hervorgerufen hätte. Andere Mädchen hätten sich nicht einen Bruchteil davon herausnehmen können, ohne jedermann lästig zu werden! Alles, was von ihr ausging, erschien uns ganz selbstverständlich, ganz zu schweigen von der Lust, die wir dabei empfanden, ohne es uns gegenseitig einzugestehen. Und überdies fühlte sich niemand verletzt, wenn sie sich gerade mit dem einen oder dem andern besonders beschäftigte. Ein teuflischer Zauber, der es ihr darüber hinaus gestattete, in absoluter Freiheit zu handeln, dank jener überlegenen Leichtigkeit, die Klugheit und Schönheit einem vom Glück begünstigten Wesen verleihen …
Fast von Anfang an nahm sie mir gegenüber eine Haltung ein, in der sich – in veränderlichen Proportionen – eine sehr weibliche Ironie, echte Zärtlichkeit, der bewußte Ton des Beschützers und einige regelrecht herausfordernde Züge mischten. Sie war abwechselnd oder in nicht recht definierbarer Zusammensetzung die große Schwester (sie war knapp drei Jahre älter als ich), ein «guter Kerl» von Kameradin oder die Unbekannte, der man bei einer Party begegnet ist und mit der man zu flirten versucht. Was in dieser Mischung aus Durchtriebenheit und Anmut am meisten hervortrat oder, genauer, was mich (aus gutem Grund) am meisten traf, war das vorgetäuschte Mitleid, das sie mir vor allen Leuten entgegenbrachte, weil ich so wenig Erfahrung mit Frauen hatte. Sie hatte mir kein Geständnis abringen müssen, um das herauszubekommen: ein Blick auf mich hatte ihr alles gesagt. Gewiß hätte ich das närrische Erbarmen, das sie mir zur Erheiterung meiner Familie in diesem Zusammenhang bekundete, nur schwer ertragen, wäre es nicht bei allem Spott und Hohn ein Vorwand gewesen für Worte, die Balsam in die schlimmsten Wunden meines Selbstbewußtseins gossen, und zugleich ein Vorwand für noch zärtlichere Berührungen.
Wenn ich heute daran denke, wie sie sich damals mir gegenüber verhielt, komme ich zu der Überzeugung, daß Thérèse mit untrüglichem psychologischen Scharfblick meine besondere Situation innerhalb der Familie durchschaute und ausnutzte: die klassische Situation des Jüngeren, dem ein älterer Bruder vorgezogen wird, weil er begabter ist als er, nicht nur auf geistigem Gebiet, sondern auch auf dem der Liebe (wie es allein schon Thérèses Gegenwart hinreichend bewies). Diese Situation, die ich wie auch meine Eltern und mein Bruder bisher nur mehr oder weniger dunkel empfunden hatte, wurde jetzt durch Thérèse offenkundig. Und während sie sie ins Licht rückte, ließ sie gleichzeitig meinen Bruder und meine Eltern Zeugen der Zärtlichkeiten werden, mit denen sie mich bedachte (vielleicht um sich so auch von gewissen Schuldgefühlen mir gegenüber zu befreien). Ich muß gleich hinzufügen, daß ich als Kind nie gelitten habe noch je ein unverbesserlicher Tunichtgut gewesen bin. Auch bin ich weder kränklich noch verunstaltet. Und wenn ich mit meinen siebzehn Jahren noch kein richtiges Liebesabenteuer erlebt hatte, war das sicherlich eher auf Gleichgültigkeit oder Schüchternheit als auf irgend etwas anderes zurückzuführen. Mein Hang zur Introversion allerdings ließ sich nicht leugnen, und Thérèse war die erste, die ihn bemerkte, obwohl sie keinerlei Anlaß zu solchen Beobachtungen hatte.
Wenn unsere Eltern sich spät abends zurückzogen, um zu Bett zu gehen, spielten wir mit gedämpfter Lautstärke Schallplatten, und wenn dann Thérèse im Schein des langsam verlöschenden Kaminfeuers mit mir tanzte, spürte ich voll Wonne, wie sie sich ganz meinen Armen überließ. Ich fühlte ihren warmen Leib, ihre schmale Taille, ihre geschmeidigen Hüften, die weiche Haut ihrer Wange, die an der meinen lag, den kräftigen Duft ihrer Haarflut (sagte ich schon, daß sie brünett war und daß ihr langes dunkles Haar ihr bis über die Schultern fiel?). Und mehr noch. Trotz meiner Unerfahrenheit bemerkte ich doch sehr schnell, daß sie meist keinen Büstenhalter unter ihrer dünnen Bluse trug (es war oft sehr warm in unserer Wohnung, wenn zusätzlich zur Heizung das Kaminfeuer brannte), und wenn sie sich an mich schmiegte, konnte ich deutlich ihre festen Brüste spüren. Manchmal, vor allem wenn zum Zauber der Musik und des Tanzes der leichte, durch den Champagner oder den Cognac hervorgerufene Rausch kam (oder, so glaube ich, wenn Thérèse dringender als sonst das Verlangen hatte, mit Philippe zu schlafen), geschah es auch, daß ich voller Verwirrung spürte, wie ihre Brüste schwollen und spitz wurden. Es war wie ein unerwartetes Geständnis, ein Geständnis, das überdies gar nicht für mich bestimmt war und das mich darum gleichermaßen entflammen wie entmutigen konnte. Gleichzeitig war es für mich die Offenbarung der fleischlichen Mysterien der Frau. Heranwachsende junge Männer, zumindest solche, die wie ich noch eine altmodische Erziehung genossen, neigen dazu, in der Frau nichts als das Objekt ihrer Begierde zu sehen – einen regungslosen Gegenstand ohne eigene sexuelle Bedürfnisse, so etwas wie ein Marmorbild. Thérèse lehrte mich (machte mir begreiflich), daß auch die Frau begehrt und daß ihr Körper ebenso erregbar ist wie der des Mannes (oh, diese Jungen, wie stolz sie darauf sind, daß ihr Penis steif werden kann!).
Und schon erkannte ich in blindem Vertrauen Thérèse als meine Lehrmeisterin an, auch wenn kein Wort darüber zwischen uns gewechselt wurde. Sie hatte ihre eigene Unterrichtsweise, bei der Vertraulichkeiten an die Stelle von Lektionen traten. Wenn wir schamlos eng aneinandergeschmiegt tanzten und sie unmerklich ihre Brüste an mir rieb, und ich mein erigiertes Glied gegen ihren Leib drückte, tauschte sie schweigend Vertraulichkeit gegen Vertraulichkeit, wobei sie mich daran gewöhnte, die erotischen Wünsche des Partners zu achten. Was nicht verhinderte, daß wie bei der Psychoanalyse die libidinöse Energie des Schülers sich auf die Lehrerin richtete! Denn lange konnte ich mich über die wahre Natur der Wünsche, die Thérèse in mir geweckt hatte, nicht hinwegtäuschen, zumal die Versuchung mit jedem Tag gebieterischer wurde. In der ersten Zeit suchte sich meine Phantasie, wenn Thérèse gegangen war und ich mich schlafen legte, einen Ersatz oder zumindest eine verkleinernde Maske für sie, damit meine Erregung zu einem einsamen, aber unvermeidlichen Ende kam. Doch diese kindliche List ließ sich angesichts der Tatsachen nur wenige Wochen lang aufrechterhalten. Und mein schlechtes Gewissen machte die Illusion, wie man sich wohl denken kann, zugleich süßer und bitterer, denn nun galt es Thérèse und Thérèse allein, wenn ich mich in das fest um mein Glied gewickelte Laken entlud. An der Art, wie sie mich an manchen Abenden betrachtete, wenn sie beim Tanzen den Grad meiner Erregung hatte ermessen können, merkte ich, daß sie es wußte. Und es konnte gar kein Zweifel darüber bestehen, denn einmal, als – ich weiß nicht mehr wie – das Gespräch auf das Thema kam, blickte sie mich an und erklärte, das einsame männliche Vergnügen sei für sie etwas Unverzeihliches, sofern lediglich Egoismus, Trägheit oder Hochmut der Grund dafür seien. In ihren Augen stellte diese Art der Befriedigung bei einem Menschen, wenn er sich nicht in irgendeiner Ausnahmesituation befinde (als Kind, als Kranker oder als Gefangener), nur eine Flucht vor der geteilten Liebe dar, bei der es nicht genügt, sich Lust zu verschaffen, sondern bei der man auch Lust schenken muß. (Es versteht sich, daß sie uns, meinen Bruder und mir, solche Reden nur hielt, wenn wir drei allein waren.)
Und tatsächlich wurde, sobald unsere Eltern uns allein ließen, die Atmosphäre zugleich gelöster und gespannter. Mein Bruder gab einiges von der Zurückhaltung auf, die er vor unserem Vater und unserer Mutter Thérèse gegenüber wahrte, und alles geschah so, als wäre es in seinen Augen ganz natürlich, daß auch ich mich ungezwungen zeigte. War er sich darüber im klaren, daß ich immer nur an Thérèse dachte? Daß ich jeden Tag sehnlich auf die Stunde wartete, da sie erschien, und mich in fieberhafter Erwartung fragte, ob ich sie an diesem Abend wieder an mich drücken könnte (wir tanzten nicht jeden Abend) oder ob sich beim Begrüßungskuß unsere Mundwinkel treffen würden, wie es manchmal geschah? Ich war so weit gekommen, daß ich mich in acht nahm, um mir nicht allzu sehr die Schrecken anmerken zu lassen, die das Warten in mir erregte, denn eine einzige Ungeschicklichkeit konnte genügen, um mein fragiles Glück von Grund auf zu erschüttern. Die von Tag zu Tag heißere Hölle, in der ich lebte, war zugleich mein Paradies. Denn wenn Thérèse manchmal etwas zu weit mit mir ging, war ich gewiß der letzte, der ihr einen Vorwurf daraus gemacht hätte …
Eines Abends, als sie besonders mutwillig und ausgelassen war, beschuldigte sie mich im Scherz vor meinem Bruder, daß ich sie beim Tanzen zu fest an mich gedrückt hätte. Verärgert wandte ich mich ab, um ein wenig zu schmollen, was von Zeit zu Zeit vorkam, da ich nur selten ihren lebhaften Späßen etwas entgegenzusetzen wußte. Bald kam sie an, um mich zu necken, während mein Bruder am anderen Ende des Zimmers unter einem Stapel Platten nach etwas Besonderem suchte. Da schob sie mir plötzlich spielerisch eine Weinbrandkirsche zwischen die Lippen. Was darauf folgte, geschah mit solcher Geschwindigkeit und Präzision, daß wir einen Augenblick lang wie vom Blitz getroffen dastanden: in dem Moment, in dem meine Zähne in die Kirsche bissen, streckte ich unwillkürlich die rechte Hand aus und ergriff mit Daumen und Zeigefinger die Spitze von Thérèses linker Brust – das alles mit einer Sicherheit, die um so überraschender war, als Thérèse, die mit dem Rücken zum Kamin, der einzigen Lichtquelle, stand, für mich nur eine Silhouette in dem allgemeinen Halbdunkel war. Und da die pflückende Bewegung plötzlich die Frucht reifen ließ, war die Kirsche, die ich zwischen meinen Fingern hielt, fast ebenso groß wie die, in die ich biß. Diese Geschichte könnte grotesk oder erfunden wirken, aber das gilt, glaube ich, für viele Dinge, die sich gleichwohl täglich ereignen. Ich für mein Teil gestehe, daß die Duplizität des Geschehens mich noch heute anrührt und daß die vollkommene Symmetrie und die verblüffende Exaktheit des Vorgangs mich immer wieder in Erstaunen gesetzt hat. Thérèse, die in meinem vom Feuerschein erhellten Gesicht die Zeichen einer ebenso intensiven wie flüchtigen Freude erkennen konnte (ihr eigenes Gesicht blieb im Dunkeln), lachte leise. Sie hatte sich von dem Augenblick an, als meine Finger sie berührten, nicht mehr bewegt. Ich nehme an, daß ihr Lachen mich erwachen ließ: meine Finger gaben ihre Beute frei. Und Thérèse entfernte sich und zündete sich eine Zigarette an.
Wie lange hat das Ganze gedauert? Wahrscheinlich nicht einmal eine Minute, aber es hat sich mir so tief eingeprägt, daß mir die kleinste Einzelheit noch deutlich vor Augen steht. An jenem Abend tanzte Thérèse ausschließlich mit meinem Bruder und hielt ihn so zärtlich umschlungen, als wollte sie mich für meine Kühnheit bestrafen. Ich dagegen verschmähte ostentativ – wie undankbar! – die Weinbrandkirschen und tat so, als hätte ich im Whisky das Mittel gegen meine Einsamkeit gefunden. Tatsächlich trank ich sehr viel mehr als sonst, und ich war alles andere als trinkfest – der Alkohol war sozusagen erst mit Thérèse in mein Leben eingetreten. Es wurde später als gewöhnlich, und schließlich hatten wir alle drei ganz schön getrunken. Da kein Eis mehr da war, ging ich leicht schwankend in die Küche, um welches aus dem Kühlschrank zu holen. Meine mir angeborene Ungeschicklichkeit wurde durch die Trunkenheit noch verstärkt; jedenfalls machte ich irgendwelchen Lärm und hörte Thérèse lachend sagen: «Horch mal, dein kleiner Bruder schlägt alles kaputt!»
Wütend drehte ich den Kaltwasserhahn weit auf und hielt den Eiswürfelbehälter darunter. Eine Hand, Thérèses Hand, legte sich auf meine und drosselte den Wasserstrahl ein wenig. Sie schmiegte sich ganz an mich und sagte leise: «Nicht so heftig, kleiner Bruder, du machst ja eine Überschwemmung!»
Unsere Blicke trafen sich, und während unsere Hände aufeinandergepreßt auf dem Hahn verharrten, stürzte ich mich auf ihren Mund, wie man sich ins Wasser stürzt. Ihre Lippen schmolzen unter den meinen, weich, warm, köstlich. Bei diesem Kuß geriet ich in eine solche Verzückung, daß mir gar nicht der Gedanke kam, sie zu berühren.
Von diesem Abend an war irgend etwas anders zwischen ihr und mir. Sie machte nicht einmal den Versuch, mir gegenüber so zu tun, als ob nur meine und ihre Trunkenheit der Grund für ihre flüchtige Hingabe gewesen wären, und mir zu raten, die beiden kleinen Zwischenfälle zu vergessen. Und hätte sie den Wunsch gehabt, meinen Übergriffen ein für allemal ein Ende zu setzen, wäre es ihr ohne weiteres möglich gewesen, mir eine Entschuldigung und das Versprechen abzuverlangen, mein Verhalten zu ändern. Aber weder in ihren Worten noch in ihrem Verhalten ließ sich auch nur die geringste Anspielung auf die Berührung und den Kuß entdecken. Und doch wußte ich, ich las es in ihrem Blick, daß sie beides nicht vergessen hatte, daß sie das, was geschehen war, keineswegs auslöschen wollte, und ich hatte das Gefühl, daß ich die Bedeutung dieser Tatsache nicht unterschätzen durfte.
Gewöhnlich fuhr mein Bruder sie gegen Mitternacht mit dem Wagen nach Hause. Aber sie wohnte nicht sehr weit von uns, und manchmal, bei schönem Wetter, gingen sie zu Fuß und forderten mich auf, sie zu begleiten. Da ich nur in diesem Fall gebeten wurde, den Anstandswauwau zu spielen, wird man leicht begreifen, daß ich bald dazu neigte, das Auto meines Bruders als Vorzimmer der Hochzeitsnacht zu betrachten. Wahrscheinlich täuschte ich mich nicht. Trotz der Zurückhaltung, die er sich auferlegte, konnte mein Bruder an manchen Abenden vermutlich nicht umhin, Thérèse glühendere Beweise seiner Zuneigung zu liefern, als er es sonst in meiner Gegenwart tat. Dennoch, und wie seltsam das auch scheinen mag, erkannte ich bald, daß es alle beruhigte, wenn ich so oft das Licht hielt – sei es bei uns in der Wohnung, wenn meine Eltern sich zurückgezogen hatten, sei es unterwegs, wenn mein Bruder seine Braut nach Hause brachte. In erster Linie galt das für meine Eltern, die aus bürgerlichen Moralvorstellungen heraus offenkundig nicht wünschten, daß die Verlobten auf dem Wohnzimmersofa miteinander schliefen. Zu meiner Überraschung glaubte ich jedoch ein wenig später zu bemerken, daß anscheinend auch Philippe nicht sonderlich daran gelegen war, allzu oft mit Thérèse allein zu sein, und daß ich ihn gleichsam vor ihr beschützte, das heißt vor seinem Wunsch, mit ihr zu schlafen. Fürchtete er, daß es seine Studien beeinträchtigte und somit seiner Karriere schaden könnte? Es war sein letztes Jahr an einer Ingenieurschule, und er war schon als hochbegabt aufgefallen: er mußte unbedingt ein glänzendes Examen machen, um eine gute Stellung zu bekommen, und das um so mehr, als bereits Einigkeit darüber bestand, daß unmittelbar nach der Abschlußprüfung die Hochzeit stattfinden sollte.
Wie vernünftig sich Philippe auch zu geben versuchte, an einer solchen Entscheidung ließ sich, wie man sich denken kann, nicht ohne innere Kämpfe festhalten. Er konnte sichtlich nicht darauf zählen, daß Thérèse ihn in seinem Vorsatz, vorläufig Enthaltsamkeit zu üben, bestärkte. Selbst für so wenig erfahrene Augen wie die meinen war es klar erkennbar, daß Thérèse die Liebe anzog wie der Magnet die Eisenfeilspäne, und ich weiß noch, wie ich mich eines Tages, als ich mit ihr durch die griechische Abteilung des Louvre ging, dabei ertappte, daß ich heimlich beobachtete, ob sich unter ihren Blicken nicht die Feigenblätter der Apollo- und Merkur-Statuen hoben. Ich meine das fast ernst. Jedenfalls war sie die einzige, die Grund hatte, sich nicht über meine Funktion als Aufpasser zu freuen. Doch war sie mir deswegen nicht böse, sondern beschloß, da ich kraft allgemeiner Übereinkunft dieses Amtes waltete, das Beste daraus zu machen. Ohne falsche Bescheidenheit sei gesagt, daß meine unbedeutenden Vorzüge dabei meiner Ansicht nach nicht die geringste Rolle spielten. Gewiß, ich hatte vielleicht dank meines Bruders gutem Beispiel den Vorzug, nicht die unerträgliche Arroganz siebzehnjähriger Jungen zur Schau zu tragen, die so stark dazu beiträgt, daß gleichaltrige Mädchen sich oft älteren Männern zuwenden. Doch bin ich nach wie vor davon überzeugt, daß in den Augen von Thérèse mein Hauptvorzug darin bestand, daß ich bis über die Ohren verliebt in sie war. Im übrigen war, so glaube ich, das Verlangen nach Glück bei ihr so ausgeprägt, daß sie es sich gewissermaßen zum Gesetz gemacht hatte, die Dinge zu nehmen, wie sie kamen, auch wenn sie ihr eigentlich gegen den Strich gingen, sicherlich in der Hoffnung, sie so zum Guten wenden zu können.
Nicht lange nach dem Tag, an dem ich sie geküßt hatte, verbrachten wir wieder einen sehr langen Abend, an dem wir alle drei mehr als gewöhnlich tranken. Aber diesmal trank Philippe am meisten, so daß Thérèse und ich ihn schließlich in sein Zimmer bringen mußten. Er ließ es nicht zu, daß wir ihm beim Auskleiden halfen und ihn zu Bett brachten, fragte mich jedoch, bemüht, die kurze Bitte klar auszusprechen: «Begleitest du Thérèse nach Hause?»
Ich half Thérèse in den Mantel, und wir brachen auf. Es war eine eisige, sternklare Nacht. Thérèse, die sich bei mir eingehängt hatte, sagte nichts, und ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Zum erstenmal waren wir beide allein, doch meine Freude grenzte fast an Panik, so sehr fühlte ich mich abhängig von Thérèses Willen – bis in die kleinste Handbewegung, bis zum leisesten Atemhauch. Sie wollte sich eine Zigarette anzünden, und da es windig war, blieben wir einander zugewandt stehen, und ich bildete mit meinem ausgebreiteten Mantel eine Art Windschutz gegen den Nordost. Als ihre Zigarette brannte, hob sie mir im Licht einer nahen Straßenlaterne ihr Gesicht entgegen, so daß ihre Augen mir ungewöhnlich hell erschienen. Ich hatte das Gefühl, daß sie lächelte, als sie die Zigarette von ihren Lippen nahm, um den Rauch auszuatmen. Ich bin mir dessen nicht ganz sicher, doch wie dem auch sei, schon lagen unsere Münder aufeinander und meine Zunge suchte die ihre. Ohne daß ich unseren Kuß unterbrach, legte ich den linken Arm um sie, während meine Rechte in fiebriger Hast ihren Mantel aufknöpfte und ihre Brüste suchte. Wir standen seltsam ruhig da, und mir schien, daß dieser Kuß bis in alle Ewigkeit hätte dauern können und ebenso die sanften Liebkosungen, mit denen ich abwechselnd ihre Brüste bedachte. Die Straßen lagen verlassen da, aber dessen wurde ich mir erst hinterher bewußt, als wir uns voneinander lösten, um wieder zu Atem zu kommen.
Fröstelnd knöpften wir unsere Mäntel zu und nahmen stumm und dicht aneinandergedrängt unseren Weg wieder auf. Ich war zu erregt, um sprechen zu können, und Thérèse rauchte, ohne ein Wort zu sagen, ihre Zigarette zu Ende. In dem Haus, in dem sie wohnte, gab es keine Concierge. Als die Tür hinter uns ins Schloß gefallen war, drängte ich sie, sich auf den roten Läufer der ersten Stufen zu setzen. Sie leistete nicht den geringsten Widerstand, und als das Licht im Treppenhaus erlosch, begann ich aufs neue, sie zu küssen und ihre Brüste zu liebkosen, diesmal mit solcher Heftigkeit, daß ihre Seufzer Klagelauten glichen. Es fiel mir nicht schwer, unter ihrem Rock die weiße, weiche Innenseite ihrer Schenkel zu finden und von dort aus mit den Fingerspitzen das dünne Nylongewebe ihres Slips zu berühren, das sogleich taufeucht wurde. (Damals hatten die Strumpfhosen noch nicht ihren Sieg über die Dessous errungen.) Schließlich gelang es mir, einen Finger in ihre Scheide gleiten zu lassen. Ich keuchte so heftig, daß ich einen Moment lang befürchtete, die anderen Bewohner des Hauses zu wecken. Vielleicht um meine Erregung zu besänftigen, oder gar um mich für meine Liebkosungen zu belohnen, legte Thérèse ihre Hand auf meinen zum Zerreißen straffen Hosenverschluß, und sogleich verströmte ich mich. Ich ging wieder in die Nacht hinaus, und trotz der eisigen Kälte mochte ich meine Handschuhe nicht anziehen, wie um die Erinnerung an Thérèses Körper nicht zu entweihen. Ich konnte lange nicht einschlafen und fühlte mich doch zerschlagen wie ein Marathonläufer nach dem großen Sieg. Aber auf eine andere Weise war ich kaum noch von dieser Welt …
Am nächsten Morgen wirkte mein Bruder noch ziemlich mitgenommen von den Ausschweifungen des Vorabends. Er trug ein mürrisches Gesicht zur Schau und war ungewöhnlich gereizt. Mehrmals sah er mich scharf an. Offensichtlich zögerte er auszusprechen, was er auf dem Herzen hatte. Schließlich fragte er mich ziemlich grob und gleichzeitig verlegen, ob Thérèse über ihn gesprochen habe. Etwas beklommen erwiderte ich, nein, das habe sie nicht, oder vielmehr habe sie nichts Besonderes über ihn gesagt. Was hätte sie mir im übrigen auch sagen können, das ich nicht schon wußte? Er zuckte bei dieser spitzfindigen Antwort mit den Schultern und bohrte nicht weiter. Mir kam der Gedanke, daß er den übermäßigen Alkoholgenuß nur vorgetäuscht hatte, um Thérèse nicht nach Hause begleiten zu müssen, ohne daß diese Weigerung zugleich als Kränkung aufgefaßt werden konnte. Dieses kühle Verhalten war nicht das erste Zeichen für eine gewisse Spannung zwischen den Verlobten, die ich seit einiger Zeit zu bemerken glaubte. Was ging hier vor?
Thérèses Verhalten mir gegenüber trug zur Erhellung dessen, worum es bei ihren Querelen ging, wesentlich bei. Ich ahnte, was für ein feuriges und zärtliches Temperament Thérèse besaß. Ohne Zweifel hatte sie schon zahlreiche Liebhaber gehabt, und ein Spaziergang von zehn Minuten in einem beliebigen Pariser Viertel hätte ihr sogleich zahlreiche neue Bewerber eingebracht! Doch sie liebte meinen Bruder wirklich, auch wenn Philippe in einer seltsamen Anwandlung von Selbstzucht, die so gar nicht zu seiner abschätzigen Einstellung den bürgerlichen Konventionen gegenüber paßte, zu dem Entschluß gekommen war, sich keinen Vorgriff auf spätere eheliche Rechte zu gestatten. Der Verdacht, der mir flüchtig gekommen war, wurde jetzt langsam zur Gewißheit: Philippe wollte nicht mit Thérèse schlafen, weil er – nicht ganz ohne Grund – fürchtete, sein Studium zu vernachlässigen und seine Zukunft zu gefährden, wenn er erst einmal auf den Geschmack gekommen war. Man kann eine so berechnende Haltung als schäbig bezeichnen, und der Lauf der Ereignisse sollte, sofern das nötig war, beweisen, daß man über Thérèses Liebe nicht nach Lust und Laune verfügen konnte. Ich bin jedoch davon überzeugt, daß sie ihm die ganze Zeit hindurch treu blieb, obwohl nichts für sie einfacher gewesen wäre, als gleichzeitig irgendein heimliches Verhältnis zu haben. Aber es lag ihr nicht, sich zu verstellen, und wenn sie sich Forderungen gegenüber sah, denen schwer auszuweichen war, sorgte sie dafür, daß diejenigen, die sie liebten, bald davon erfuhren und sie akzeptierten, wozu der unwiderstehliche Einfluß, den sie auf andere ausübte, nicht unwesentlich beitrug.
Über eine Woche war seit der denkwürdigen Nacht vergangen, in der ich sie nach Hause gebracht hatte, und außer ihren üblichen Neckereien hatte sich nichts Neues zwischen uns ereignet. Das änderte sich an einem ungewöhnlich ruhigen und friedlichen Abend, der alles in allem eher gedämpft verlief, bis auf die Tatsache, daß Thérèse sehr viel mehr Zigaretten rauchte als sonst. Ich spielte eine Partie Dame mit ihr – ein Spiel, das ich immer tödlich langweilig gefunden habe, aber Thérèse hätte mich noch die Reize eines Gefängnisses entdecken lassen, wenn sie mit mir eingesperrt gewesen wäre! Mein Bruder war gerade ans Telefon gerufen worden, das sich in einem an den Salon grenzenden Raum befand. Thérèse, die bald bemerkt hatte, wie gern ich sie betrachtete, wenn sie rauchte (aber ich betrachtete sie auch gern, wenn sie nicht rauchte!), und die sich manchmal darüber lustig machte, indem sie sich wie eine femme fatale gebärdete, blickte mir tief in die Augen, stieß eine lange Rauchwolke aus und sagte, ohne die Stimme zu senken und als sei es die natürlichste Sache der Welt: «Du bist noch nie in meinem Zimmer gewesen, kleiner Bruder. Möchtest du morgen nachmittag um vier zu mir kommen?»
Ich wäre beinahe erstickt. Ich merkte, wie ich rot wurde, und mir war hundeelend zumute. Thérèse wandte die Augen nicht von mir ab und rauchte weiter, sehr langsam, aber ohne jede Verstellung. Ihr Gesicht, weder traurig noch fröhlich, war einfach nur aufmerksam. Vom Nebenzimmer her hörte man, wie mein Bruder ruhig und gemessen am Telefon sprach. Ich atmete tief ein, in der Hoffnung, meine Verwirrung zu überwinden, und murmelte kaum hörbar: «Ja, Thérèse.»
Da beugte sie sich leicht über das Schachbrett (ihre langen Haare strichen wie in Zeitlupe über die Bauern hin) und drückte mir einen flüchtigen Kuß auf die Lippen.
Man kann sich leicht vorstellen, in welchen Zustand mich diese Einladung versetzte! Die Stunden und selbst die Minuten verrannen nicht mehr, alle Uhren waren stehengeblieben. Ich schlief kaum. In der Schule muß ich ziemlich verstört gewirkt haben, denn mehrere Lehrer zeigten sich, wie mir schien, über meine Gesundheit besorgt. Aber das alles drang wie durch einen Nebel zu mir, der gleichermaßen Geräusche und Lichter dämpfte. Und kaum war die Schule aus, glaubte ich, der Wind trüge mich davon. Es war der Wirbelwind in mir! Ich geriet in Versuchung, bis zu dem Haus, in dem Thérèse wohnte, in wilder Jagd zu rennen. Im nächsten Augenblick gaben meine Beine nach, und ich schleppte Füße aus Blei über Bürgersteige aus Treibsand. Schließlich kam ich doch zwanzig Minuten zu früh vor dem Haus an, und um nicht dadurch aufzufallen, daß ich mir die Beine in den Bauch stand, zwang ich mich dazu, die Schaufenster zu betrachten, sah jedoch nichts. Endlich war es fast vier. Ich stieg die Treppe hinauf, ganz gemächlich, wie ich meinte, doch als ich vor Thérèses Tür anlangte, war ich völlig außer Atem. Dort stand auf einem Kärtchen ihr Name, mit der Hand geschrieben, in einer lebhaften, ausgeglichenen Schrift. Hier also war es. Aber jetzt galt es, an die Tür zu klopfen! Ich klopfte. Nur Stille antwortete mir. Mir wurde kalt ums Herz. Würde ich noch einmal klopfen müssen? Dann öffnete sich die Tür, und Thérèse sagte: «Guten Tag, Francis.»
Es war, glaube ich, das erste Mal, daß sie mich nicht «kleiner Bruder» nannte. (Sehr zu meinem Ärger hatte meine ganze Familie von ihr die Gewohnheit übernommen, mich «kleiner Bruder» zu nennen.) Ich stammelte hilflos: «Guten Tag, Thérèse.»
Sie ließ mich eintreten und schloß die Tür. Lag es daran, daß ich sie sonst nur bei abendlicher Beleuchtung sah? Jedenfalls war ich erstaunt über ihre Blässe, die sicherlich noch dadurch hervorgehoben wurde, daß sie weit weniger geschminkt war, als wenn sie zu uns nach Hause kam, und daß ihre Haare, wie bei Indianerinnen, straff gescheitelt waren und in Strähnen herabfielen, was sie weiß und schwarz erscheinen ließ. Die gleiche Strenge kennzeichnete ihre Kleidung: sie trug eine weiße Bluse, einen weiten schwarzen Pullover und eine schwarze Samthose. Ihr Zimmer war nicht groß, aber sie hatte es verstanden, ihm ihre eigene Note zu verleihen, nicht durch eine Sammlung von Nippes, Fotos und Souvenirs, wie das bei so vielen Jungmädchenzimmern die Regel ist, sondern durch einige bedeutsame Details. Ich erinnere mich vor allem an eine große Reproduktion eines Gemäldes von Kandinsky und an eine Postkarte mit der Ansicht eines erotischen Reliefs an einem Hindutempel.