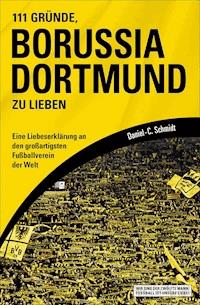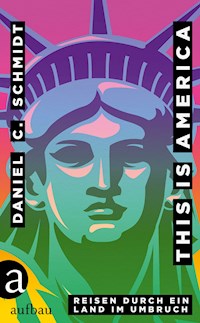
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Roadtrip durch eine Nation im Wandel. Amerika erfindet sich neu, inmitten von Opiumkrise, Geschlechterkampf und Rassendiskriminierung. Temporeich erzählt Daniel C. Schmidt von Schülern, die zu Aktivisten gegen die Waffenlobby wurden, Amerikanerinnen wie der Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez aus der Bronx, die gegen das Establishment kämpfen, und illegalen Einwanderern, die in den USA ein neues Zuhause suchen. Das flirrende Porträt einer polarisierten Gesellschaft. „Schmidt schreibt so eindrücklich, selbst Donald Trump könnte mit diesem Buch die USA begreifen.“ Sophie Passmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Daniel C. Schmidt
Daniel C. Schmidt, Studium in Manchester und London, lebt seit Anfang 2016 in den USA, von wo er als freier Reporter u.a. für FAZ, ZEIT Online, NZZ und SPIEGEL über Politik, Gesellschaft, und Popkultur berichtet hat. Er wohnt in Washington, D.C. und hat bislang 38 US-Bundesstaaten bereist.
Informationen zum Buch
Roadtrip durch eine Nation im Wandel.
Amerika erfindet sich neu, inmitten von Opiumkrise, Geschlechterkampf und Rassendiskriminierung. Temporeich erzählt Daniel C. Schmidt von Schülern, die zu Aktivisten gegen die Waffenlobby wurden, Amerikanerinnen wie der Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez aus der Bronx, die gegen das Establishment kämpfen, und illegalen Einwanderern, die in den USA ein neues Zuhause suchen. Das flirrende Porträt einer polarisierten Gesellschaft.
»Schmidt schreibt so eindrücklich, selbst Donald Trump könnte mit diesem Buch die USA begreifen.« Sophie Passmann
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Daniel C. Schmidt
This is America
Reisen durch ein Land im Umbruch
Inhaltsübersicht
Über Daniel C. Schmidt
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1 – November 2016: Der Trump-Translator
Kapitel 2 – April 2017: Guns N’ Roses
Kapitel 3 – März 2018: Herzensangelegenheit
Kapitel 4 – September 2018: Aller Ehren wert
Kapitel 5 – März 2018: Schuss-Wechsel
Kapitel 6 – Oktober 2018: Showtime
Kapitel 7 – Januar 2019: Seiten-Wechsel
Kapitel 8 – Juli 2019: Ring frei
Kapitel 9 – September 2019: Zwei Mütter
Kapitel 10 – Herbst/Winter 2019: Warum es Warren wird…
Kapitel 11 – Oktober 2019: On The Streets
Nachwort
Stars & Stripes
Thanks
Nachweise
Impressum
Für Caitlin und Clementine
THIS IS AMERICA
Reisen durch ein Land im Umbruch
»I lost track of information.
I was blitzed by opinion.«
Joan Didion, »On the Road« (1977)
Prolog
Im Weißen Haus brennt noch Licht. Die Residenz des Präsidenten liegt still da, umgeben von schwarzer Nacht. Seit vier Jahren weiß Amerika nicht mehr genau, was der nächste Morgen bringt. Die vergangenen Tage und Wochen waren lang und mühsam. Sie fanden in gut ausgeleuchteten Ausschusszimmern, auf langen Fluren, im Kabelfernsehen, in Zeitungsspalten und im Vorstellungsvermögen unzähliger Wähler statt: Die amerikanische Demokratie hat Donald Trump angeklagt.
Das Impeachment-Verfahren gegen den amerikanischen Präsidenten, egal, wie es ausgeht, ist ein erstes Muskelspiel der Demokraten vor dem Showdown im November 2020, wenn die USA einen neuen Präsidenten oder Präsidentin wählen werden. Vielleicht wird der neue aber auch: der alte Präsident.
Noch ist offen, wer gegen ihn antritt. Die Demokraten haben sich in den vergangenen vier Jahren viel mit sich selbst beschäftigt beim Versuch, eine Antwort auf Trump und seine Faktenallergie zu finden. Gibt es einen moderaten Weg zurück in eine Zeit, in der Demokraten und Republikaner gemeinsam für die Sache gekämpft haben, wie Joe Biden ihn propagiert? Oder braucht es jetzt radikale, ikonoklastische Schritte, wie sie das progressive Lager fordert, um Amerika nach dem Chaos der Trump-Präsidentschaft wieder auf einen gewissen Normalzustand hochzufahren?
Und was wäre, wenn alles ganz anders kommt, Trump abermals triumphiert und wiedergewählt wird?
2020 ist noch jung, es kann so viel passieren. Eine ernsthafte Prognose zu diesem Zeitpunkt: eher sinnlos. Aber es gibt ein paar einfache Fragen, die man stellen kann.
Wie geht es den Menschen unter Trump? Was bewegt die Amerikaner wirklich und wie hat sich das Land unter diesem außergewöhnlichsten aller Präsidenten verändert?
Auf das und noch einige andere Anliegen versucht dieses Buch Antworten zu finden. Die Reportagen, Interviews, Begegnungen und Porträts auf den folgenden Seiten konzentrieren sich auf fünf große Themen, die das Selbstverständnis der USA zurzeit herausfordern: Rassismus und Diskriminierung, Migration und die Probleme an der Grenze zu Mexiko, die Auswirkungen der Opiumkrise auf die Gesellschaft, Frauenrechte nach der #metoo-Bewegung sowie Amerikas anhaltende Faszination mit Schusswaffen.
1932 prägte der amerikanische Verfassungsrichter Louis Brandeis den Ausdruck »laboratories of democracy«. In einer abweichenden Urteilsbegründung argumentierte der Jurist am Supreme Court damals, dass eine Absage an das Recht zu experimentieren, erhebliche Konsequenzen für die Nation haben würde. »Es ist eins der erfreulichen Vorkommnisse des föderalen Systems«, schrieb er, »dass ein einziger Bundesstaat, wenn seine Bürger sich dafür entscheiden, als Labor dienen kann, um neue soziale und ökonomische Experimente auszutesten.« Diese Idee hat in den USA noch heute Bestand. Aus diesem Grund kann ein Bundesstaat wie Colorado Cannabis entkriminalisieren, obwohl es auf Bundesebene immer noch illegal ist. Wie sich diese Entscheidung dann auf die sozialen Strukturen, die Gesellschaft, die Lohnentwicklung, den Schwarzmarkt oder den Tourismus auswirkt, kann der Rest des Landes an diesem lokalen Experiment entsprechend studieren.
Genau das war es, was ich in den vergangenen dreieinhalb Jahren auf meinen Reisen durch fast vierzig Bundesstaaten ebenfalls sah: Auswirkungen eines Experiments. Ich traf auf Amerikaner und Zugezogene, die sich wie Amerikaner fühlen, die auf der Suche nach einem Umgang mit der Politik aus Washington und dem Experiment namens Donald Trump sind. Lauter menschliche Labore, wenn man so will, die ihre Probleme, Sorgen und Nöte im Kleinen bewältigen und mir davon erzählten, damit wir im Großen vielleicht daraus ein paar Schlüsse ziehen.
»This is America« behauptet das Buch. Es hätte auch »Made in America«, »Young Americans« oder »This is not America« heißen können; das wären allerdings andere Bücher geworden. Vor meinem Umzug in die USA 2016 sagte mir ein Freund, der Ende der 90er-Jahre als Austauschschüler in Amerika war, ich solle zur Vorbereitung doch mal »This is America, Charlie Brown« anschauen, eine Zeichentrickserie, in der die Charaktere der Peanuts durch die Kulissen der amerikanischen Jahrhunderte stolpern und dem Land beim politischen und kulturellen Großwerden zugucken. Mehrfach hörte ich den Satz während meiner Reisen – »This is America«, das hat diesen inneren Stolz, der uns in Deutschland so fremd ist, und ist Fingerzeig zugleich: guckt mal, wie irre das hier alles ist. Vor nicht allzu langer Zeit nahm Childish Gambino den Satz und machte daraus ein unglaubliches Musikvideo, das in 3:58 Minuten ein amerikanisches Trauma decodierte.
Der Titel des Buches ist deshalb schlicht eine Verneigung vor den Menschen, die ich getroffen und die mir ihr Land erklärt haben.
Menschen, wie die ältere Frau im Vorstadtzug von Chicago, die mir vor ein paar Jahren gegenübersaß und nach meiner kurzen Unterhaltung mit dem Kontrolleur fragte, woher ich denn käme, der Akzent klinge ja ungewöhnlich, ob ich Europäer sei. Als ich aus Deutschland antwortete, sagte sie, ihr Vater sei mal in, na, wie heiße das noch gleich, Geisackslowdern stationiert gewesen. Ich erzählte ihr von meinem Reporter-Leben und der Angst, das Land nie ganz zu verstehen, weil es doch so riesig und von Region zu Region verschieden sei. Keine Sorge, das füge sich schon zusammen, sagte sie.
Am Ende seien wir eh alle wie Ameisen: »We will have seen very little.«
Daniel C.Schmidt
Winter 2019
Kapitel 1 – November 2016Der Trump-Translator
Der Tag der Präsidentschaftswahl. Raleigh, North Carolina
Als der Tag sich in die Nacht verwandelt hatte, fielen mir plötzlich all die Fragen ein, die ich Stunden vorher hätte stellen sollen.
Bekommt man immer den Präsidenten, den man verdient?
Ist nur Bill Clinton noch unterhaltsamer als Donald Trump?
Warum kleiden sich die meisten wohlhabenden Republikanerinnen wie Statistinnen aus der Serie »Dallas«?
Leidet Melania unter dem Stockholm-Syndrom?
Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt Dennis Berwyn längst aus den Augen verloren. Er hätte Antworten gehabt, da war ich mir sicher. Weit nach Mitternacht – Berwyn hielt sich den Abend über mit Wein und Whiskey über Wasser – hatte er mir die Hand geschüttelt und mir einen letzten Satz mitgegeben, bevor er in der Menge der Feiernden untertauchte: »Erzähl deinen Lesern in Deutschland, was du heute hier gesehen hast.«
Ich hatte binnen 48 Stunden Donald Trump, Hillary Clinton und Lady Gaga im Duett mit Jon Bon Jovi gesehen, falsche Prognosen, konservative Migranten und afroamerikanische Trump-Fans. Anderthalb Tage war ich so etwas wie Dennis Berwyns Schatten gewesen. Wir rasten in seinem in die Jahre gekommenen Chevrolet-Van durch Wake County in North Carolinas Hauptstadt Raleigh, stellten Plakate auf, fuhren Wahllokale ab, trafen zufällig den Gouverneur des Bundesstaates, sprachen mit Wählern, Republikanern, Demokraten und Unentschlossenen. Amerika befand sich in Endspurtstimmung, mit der Siegerin Hillary Clinton im Zieleinlauf – bevor sie von rechts noch jemand überholte.
Zwei Tage vor der Wahl, im Anflug auf Raleigh, dachte ich über die Siegerpartys in New York nach. Da müsste man sein. Großstadt, Nabel der Welt. Manhattan, Glamour, Flair. Freudentränen und auch solche der Trauer. Amerika nach Obama. Da sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Clinton… oder Trump. Schulter an Schulter mit den Gewinnern. Ich hatte stattdessen einer deutschen Redaktion angeboten, den Wahlabend in einem sogenannten swing state zu verbringen. Ich kenne da einen, versprach ich, mit dem kann ich den Tag verbringen, der ist überzeugter Konservativer. Ja, hieß es aus Deutschland, mach das, super. Wir hatten es unausgesprochen gelassen, aber im Grunde war klar: Der Konfettiregen in New York ist abgedeckt, mal gucken, wie die Republikaner mit der Niederlage umgehen. So sehr war das Nervensystem des liberalen Amerikas angekratzt, dass Tage vor der Wahl noch die Rede von Unruhen war, sollte Donald Trump das Ergebnis nicht anerkennen bei einer Niederlage – wovon ja alle ausgingen.
Wenn die Straßen dann brennen, scherzte ein Kollegen in Deutschland, bist du mittendrin. Sie hatten mich ins vermeintliche Krisengebiet geschickt. Dabei, und das wurde spätestens am Ende der Wahlnacht allen klar, die weggesehen hatten, stimmte nicht nur dort, sondern im gesamten Land etwas nicht.
Das Wahlbarometer der Umfragespezialisten der New York Times, auf das Millionen von Amerikanern im Wahlkampf wie einen Fixstern geblickt hatten, versprach am Tag vor der Wahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent, dass Hillary Clinton statt Donald Trump gewinnen würde. Frei nach Andy Warhol: »In the future, everyone will be world-famous for 15 percent.« Wenn sie bei dem Vorsprung jetzt nicht als Siegerin über die Ziellinie gehen würde, dachte man, war sie wohl niemals losgerannt.
Gegen 21 Uhr waren Dennis Berwyn und ich auf die offizielle Wahlparty der Republikaner im Marriott gefahren. Vorher, beim Abendessen, als die ersten Ergebnisse aus den anderen Bundesstaaten vermeldet wurden und es nicht wie ein Durchmarsch für Trump aussah, hatte Berwyn noch gesagt: »Maybe it’s just not gonna be his night.«
Vielleicht reicht es für ihn heute Abend einfach nicht. Der Abend war der 8.November 2016, Amerika hatte gewählt und Donald Trump an seinem Ende gewonnen. Ab morgen früh müsste die große amerikanische Erzählung, das fortwährende Spiel aus Gewinnen und Verlieren, das ewige Nachobenschwimmen, um ein Kapitel erweitert werden. Doch noch wusste keiner (dem Vernehmen nach nicht einmal Trump selbst), was da auf uns zukommen würde.
Eins der hässlichsten Gebäude in Cleveland, Ohio, ist die so genannte Rock & Roll Hall of Fame am Ufer des Lake Erie, eine von Stahlträgern gehaltene schwarze Glaspyramide ohne einen Funken Raffinesse, die man so nur bauen kann, wenn man Florenz und Dresden für exotische Vornamen hält. Im Juli 2016 wehte der Duft von Grillfleisch von der angrenzenden Wiese des Rock-Museums herüber. Die Republikaner feierten den Auftakt ihres Parteitages, drei Tage später würden sie Donald Trump zu ihrem Spitzenkandidaten küren. Es war ein heißer Tag, die Delegierten hatten sich zur Begrüßung zu einem BBQ versammelt. Vielleicht war es reiner Zufall, dass die Parteiführung keine Blues- oder Jazz-Stadt ausgewählt hatte. Vielleicht war es Fügung, dass die Krönungszeremonie des windigen Immobilienunternehmers im Schatten dieser boys clubs für alternde, meist weiße Bands stattfinden sollte.
Unter den Delegierten stand ein Mann in Jeans und T-Shirt, an dem sich mein Blick festhielt. Auf seinem Rücken prustete ein wutschnaubender Elefant, das Wappentier der Republikaner. Darunter standen zwei Worte, die man inmitten der aufgekratzten Stimmung im Sommer 2016 allenfalls als nett gemeinte Warnung deuten konnte: Hardcore Conservative. Ich fragte ihn, ob ich davon ein Foto machen könne. »Aber natürlich«, sagte der Mann. Es war Dennis Berwyn.
In Amerika sind es die klassischen Eisbrecher, die einem die Möglichkeit eröffnen, sich in tiefere Gespräche verwickeln zu lassen. Mit einem Satz wie »Hey, how are you?« oder »Where are you from?« kann man zunächst wunderbar an der Oberfläche entlangsegeln. Doch wenn man ein wenig Neugier mitbringt, kann man anfangen, ein bisschen vorzufühlen – mal gucken, ob das Gegenüber gesprächsbereit ist und man selber gewillt, in den Kaninchenbau aus irren, überraschenden, kaputten Geschichten hinabzusteigen, die dieses Land zuhauf produziert.
»Du kommst aus Deutschland?«, sagte Dennis Berwyn zu mir. »Da bin ich aufgewachsen. Servus, Alter!« Ein leichter Akzent schwang in seinem tiefen Bourbonzigarettengegurgel mit. 1960 kam er in Washington, D.C. zur Welt, im Alter von zwei Monaten zog er mit seinen Eltern nach Frankfurt, ging anschließend auf eine Militärschule der Alliierten. Mit 18 kehrte er in die USA zurück, kam zunächst nach Kalifornien (»ich war ein langhaariger Hippie«) und über Umwege nach North Carolina. Im Studium hatte er sich für Gesellschaftsordnung und Staatswesen interessiert, anschließend eine Familie gegründet und ein Haus gekauft. Im Sommer 2016 arbeitete er als Wahlkampfmanager für den republikanischen Lokalabgeordneten Chris Malone in Raleigh.
Irgendwann hatte Hardcore den Hippie ersetzt.
In Cleveland hielt Berwyn ein Bier in der Hand und erklärte, warum Trump, dessen Kandidatur er anfangs nicht unterstützt hatte, der richtige Mann sei, um Amerika nach Barack Obamas historischer Amtszeit zu führen. Der Politikstratege schien da schon ein Gespür dafür zu haben, womit die Presse im Juli 2016 noch haderte und was das linke Amerika sich zu ignorieren erlaubte: Es würde nicht reichen, auf dem großen Schachbrett, das die amerikanische Politik darstellte, bloß den einen nervigen Bauern runterzuschnipsen, weil die Wut der Trump-Supporter weiter zurückreichte als zu dem Moment, in dem dieser seine Kandidatur bekannt gab. Schönwetterpopulist Newt Gingrich, der Mitte der 90er Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre vor sich hergejagt hatte und später die Tea-Party-Bewegung samt ihres Maskottchens Sarah Palin, all das waren Vorboten des Rechtsrucks gewesen.
Der Kulturwandel, die Hinwendung zur Identitätspolitik unter den Konservativen, hatte den Politikwandel angekündigt. Die Republikaner hatten erkannt, dass man sich die klassischen linken Interessensthemen zum Schutz von Minderheiten aneignen konnte, um auf Stimmenfang zu gehen und unter der eigenen Kernwählerschaft eine white angst zu schüren. Selbst ohne die Figur Trump hatte sich auf dem Spielfeld etwas verschoben, das sich nicht einfach zurückdrehen ließ. Trumps Rhetorik war nur der Katalysator, nicht Initiator für Amerikas neue politische Realität. Politik fand nicht mehr in Ortsvereinen statt; der Stammtisch, an dem die Genug-ist-genug-Amerikaner nun einkehrten, hieß Fox News, Breitbart, The Daily Caller oder, bezeichnenderweise, Info Wars. Ein nicht unerheblicher Teil des Landes reagierte lediglich auf Reizwörter, nicht mehr auf Tatsachen. Wer einmal eine Meinung hatte, ließ sich nicht durch Zahlen, Daten oder Fakten davon abbringen. »Was ihr Reporter nicht versteht«, sagte Berwyn mir später in Raleigh, »ist, dass das, was in Washington passiert, für uns egaler nicht sein könnte.«
Was ja Kalkül war: Dort hatten sich die Konservativen den neuen Fokus aus Verlustangst-Themen ausgedacht, dort hatten sie den Sturm gesät, der über das Land hinwegfegen sollte.
Nach den aufgeheizten Sommertagen in Cleveland, an denen die Anti-Trump-Proteste das Stadtbild prägten, hielten Berwyn und ich Kontakt. Alle paar Wochen schrieb ich ihn an, um mir ein eigenes kleines Stimmungsbarometer zu basteln: Hallo Amerika, wie geht’s? Als ich ihn fragte, ob ich ihn am Wahltag begleiten könne, stimmte er sofort zu.
Die zufallende Tür knallte etwas zu laut. Ich streckte meine Beine aus. Dennis Berwyn drehte den Schlüssel um, wir fuhren los. Irgendwo da draußen lag der Anfang von Amerikas nächstem Kapitel.
Hinten auf der Rückbank und im Kofferraum lagen die restlichen Kisten mit Wahlplakaten und Drahtgestänge. Am Vorabend hatte ich Berwyn und ein paar andere Parteimitglieder beim Aufstellen der letzten Plakate vor den Wahllokalen begleitet. Nach dem Abendessen steuerten wir Schulen und Gemeindezentren an, wo es zuging wie auf dem Flohmarkt im Morgengrauen: Scheiße, die Demokraten waren schon da, die haben sich den besten Platz geschnappt, von hier kann man unsere Schilder ja gar nicht erkennen. Auch Trump hatte den Sommer über mit Clinton bei den Wählern um den Preis gefeilscht. Nur hatte sie bereits irgendwann ab 1974 ihre Schilder aufgestellt – Jurastudium in Yale; Rechtsanwältin und Gastprofessur; First Lady des Gouverneurs von Arkansas; First Lady im Weißen Haus, wo sie ihre eigenen Politikinitiativen vorantrieb; danach Senatorin von New York und schließlich Außenministerin unter Barack Obama. Der 8.November 2016 hatte ihr Abend werden sollen.
Er gehe alle zwei Jahre zum Friseur, sagte mir Dennis Berwyn, während er das Fenster auf seiner Seite herunterließ, damit der Dampf seiner Camel Filter abziehen konnte. Sein Wecker hatte um 6:15 Uhr gebimmelt, er hatte »einen Jacobs-Kaffee getrunken«, wie er auf Deutsch sagte, in die Zeitung geguckt, geduscht, ein paar Anrufe getätigt. Gegen 8:30 Uhr hatte er mich eingesammelt. Ich guckte irritiert auf das graue Haar, das unter der blauen Baseballkappe hervorguckte. Alle zwei Jahre zum Friseur, ach ja? Alle zwei Jahre, nickte er, immer wenn der Präsident beziehungsweise der Kongress neu gewählt werde, mache er sich einen Friseurtermin. Dazwischen aber natürlich auch. Hahah, hohoh. Hippie-Humor statt Hippie-Frisur. Konnte ich mit leben.
Auto- und Traktorhändler, Felder, Wälder, amerikanische Leichtbauhäuser zogen am Fenster vorbei. Berwyn steckte sich die nächste Zigarette an. Ich dachte an meinen Anflug auf North Carolina und dass, wenn man auf Reisehöhe aus dem Flugzeugfenster herunterschaut und dabei einen Punkt fixiert, die Welt trotz der enormen Geschwindigkeit wie in Zeitlupe an einem vorbeizieht. Aus der Modelleisenbahn-Perspektive erkennt man natürlich das Gesamtbild viel besser. Man bekommt mehr mit, dafür gehen Details verloren. Seit Januar 2016 war ich dem Wahlkampf hinterhergereist. Jedes Mal hatte ich meine blaue Tasche gepackt, die selbst in den kleinen Propellermaschinen oben ins Ablagefach passte. »Travel light, that’s key«, hatte mir ein amerikanischer Kollege als Rat vor meiner ersten Tour mitgegeben. In den Winterwochen hatte die Tasche Platz für sieben, wenn das Wetter wärmer war für zehn Tage saubere Klamotten. Bei jeder neuen Tour war ich mit der simplen Vorstellung im Gepäck losgefahren, den Vorhang ein bisschen weiter lüften zu können. Während Dennis Berwyn sagte, »election day has its own grammar«, fragte ich mich, ob dieser Blick hinter die Kulissen wirklich so viel brachte. War es interessanter zu erfahren, wie die Wurst gemacht wird oder wie sie den Leuten schmeckt?
Amerika ist Schauspiel, in jeder Hinsicht, immer und überall. Warum jetzt nicht einfach das Theater angucken, bewerten, statt einer Spin-Doctor-Wahrheit hinterherzujagen, die eh für jeden anders aussah? Das, was auf der Bühne stattfand, war schließlich die Kunst, nicht die Arbeit der Bühnenbildner dahinter. Geht man heute, im Jahr 2020, zwei Schritte zurück, um mit etwas Abstand auf die Dinge zu blicken, klingt Amerikas Wirklichkeit nach knapp vier Jahren Trump ja wie eine Geschichte, die sich ein Kind ausdenken würde. Was anfangs wie eine griechische Tragödie anmutete, anschließend in ein unterhaltsames Shakespeare-Drama abdriftete, ist inzwischen nicht mehr viel überraschender als eine gut gemachte Seifenoper. Die einzige Frage, die unbeantwortet bleibt, ist, ob die Regieanweisungen für die Inszenierung von Vladimir Putin kommen.
Berwyn und ich hatten zuerst ein Wahllokal an einer örtlichen Highschool angesteuert. Draußen stand eine seiner freiwilligen Mitarbeiterinnen. »Nicht viel los bislang«, sagte sie, als sie die Flugblätter für Chris Malone, Berwyns Boss, entgegennahm. (Am Wahltag darf man in Amerika Informationsblätter verteilen, um denen, die sich bis dato nicht mit der Wahl oder den Kandidaten beschäftigt haben, einen Denkanstoß zu geben: Gegen Abtreibungen, Steuererhöhungen und Abschaffung der Studiengebühren? Dann hier entlang, das Kreuz da, da und da, bitte, danke …) Wir gingen in Richtung Turnhalle, wo die Wahlkabinen aufgebaut waren. Berwyn hielt einer älteren Dame mit Gehstock die Tür beim Herauskommen auf. Good morning, how are you? It’s a fine day, isn’t it?
Innen: zwei Wähler, zwei Wahlhelfer, 15 Kabinen. Eine Stunde später, in Bedford, standen rund 300 Menschen in der Schlange. »Kein Wunder«, sagte Berwyn, die Menschen gingen gleich morgens oder eben in der Mittagspause wählen. Er schüttelte Hände, sprach mit ihm bekannten Gesichtern und ließ sich Zahlen vom Wahlleiter durchgeben, von denen er seine interne Hochrechnung für Chris Malones Wiederwahlkampagne ableitete. Ich ging die Schlange ab. Raquel Robinson, 42, Fitnesstrainerin aus Raleigh, sagte, sie habe vor, weder für Trump noch für Clinton abzustimmen. »Ich werde Gary Johnson wählen.« Ihre Tochter hätte ihr von der Webseite isidewith.com erzählt, wo man seine Vorlieben ankreuzen konnte, um die mit den Wahlprogrammen der einzelnen Politiker abzugleichen. Der Drittparteikandidat Johnson habe bei ihr an erster Stelle gestanden, dann Clinton, erst an vierter Stelle kam Trump. Die zwei klaren Favoriten hätten aus ihrer Sicht »ein Anstandsproblem«: »Trump ist ehrlich mit dem, was er sagt, obwohl mir die Wortwahl nicht gefällt.« Clinton hingegen habe den Nachteil, schon so lang im Politikbetrieb zu sein. »Sie hat viel mehr Zeit als Trump gehabt, Fehler zu machen.«
Julie Brown, 42, Steuerberaterin aus Raleigh, sagte, Hillary Clinton sei so unbeliebt, dass der Wahlsieg für Trump schon beinah ein »no brainer« sei. Ich hatte gedacht, dass die Wähler und Wählerinnen darüber reden würden, warum Amerika aus seinen 320 Millionen Einwohnern ausgerechnet diese zwei ausgewählt hatte. Taten sie aber nicht. Der Markt, der im Kapitalismus angeblich alles regelt, hatte im wettbewerbsaffinen Amerika ganze Arbeit geleistet: Er hatte die Frau ausgewählt, die für alles steht, was in der amerikanischen Politik falsch läuft – dubiose Geschäfte, Zugang durch Spenden, Vetternwirtschaft. Und den Mann, der für alles steht, was in der amerikanischen Kultur falsch läuft – celebrity culture, Oberflächlichkeit, Ich-Bezogenheit, Sexismus, Rassismus …
»Komm mal her, ich will dir jemanden vorstellen.« Berwyn stand auf einer Rasenfläche am Ende der Wählerschlange. Septina Florimonte streckte mir ihren Arm entgegen und lächelte. »Nice to meet you«, sagte sie. Wie klar es ist, dass man mit einem Brett vorm Kopf rumläuft, merkt man immer, wenn die Frage »Ja gibt’s denn so was?« mit einem »Logo, steht vor dir« beantwortet werden kann. Eine schwarze Wählerin, die Trump unterstützt – wie passt das, dachte ich, wenn der sich doch die ganze Zeit wie ein weißer Herrenmensch aufführt?
Sie sei vor zwanzig Jahren aus Sierra Leone nach Amerika gekommen, erzählte Florimonte. Die Republikaner unterstütze sie seit 2000, fuhr sie fort, Trump seit der Ankündigung seiner Kandidatur. Ob sie irgendwelche Makel bei ihm sehe, wollte ich wissen. Irgendetwas, das ihr nicht zusagt. Er habe so seine Probleme, sich mit gewissen Minderheiten zu arrangieren, sagte sie. Aber jeder, der neu sei im Geschäft der Politik (schließlich sei er eigentlich Immobilienunternehmer), durchlaufe eine gewisse Lernkurve. Es klang wie die einfachste Ausflucht: als ob sich das Geschäftemachen und das Interesse an menschlichen Anliegen gänzlich ausschlossen.
Ich schrieb artig mit, hatte mir abgewöhnt, der Logik solcher Aussagen etwas entgegenzusetzen. Ich war nicht als Missionar nach Amerika gekommen. Sollten sich die Amerikaner doch untereinander streiten, das war hier nicht mein Spielfeld. Notieren: ja, gern. Argumentieren: eher nicht. Man muss den Leuten nicht alles durchgehen lassen, besonders wenn es allzu lächerlich wurde, nur hatte ich meine Streitlust seit einer Tour durch Wisconsin weitestgehend aufgebraucht, nachdem ein älterer Herr in »Air Force Veteran«-Fliegerjacke mich dort im März 2016 angesehen hatte, als hätte ich zwei Köpfe am Halsende – wir hatten uns über Mordlust im Islam gestritten, auf die er bestand. Mein Argument, dass es eine grundlegend friedliche Religion sei, ließ er nicht durchgehen, woraufhin ich ihn fragte, was denn mit den weißen Christen sei, die im Namen des Herren das Schwert geschwungen oder Jahrhunderte später die Halbautomatische gezückt hätten. Noch nie in meinem Leben bin ich so entgeistert angeguckt worden. »Whooo? WHAT?!?«, brachte er noch heraus, bevor ihm die sogenannte Hutschnur platzte. Was mir denn einfiele, ich könnte doch nicht, usw. usf. Mir fiel eine Menge ein. Seit dieser Auseinandersetzung behielt ich es größtenteils für mich.
Dass Trump, wie Septina Florimonte es ausdrückte, ein Problem hatte »sich mit gewissen Minderheiten zu arrangieren«, war natürlich auch ein »no brainer«. Man brauchte nicht viel Gehirnschmalz, um aus seiner Rhetorik ein Spiel mit rassistischen Tendenzen herauszulesen. Florimonte war nicht die einzige Migrantin, die ich traf, die konservativere Ansichten hatte als so manch weißer American Vorstadtdad. James Fallows, einer der großen Chronisten amerikanischen Lebens beim Magazin The Atlantic, hat in einem Interview einmal sinngemäß gesagt, dass, wenn die Zeitachse der Bundesrepublik Deutschland entlang des Faschismus verlaufe, es in den Vereinigten Staaten der Rassismus sei. Es sind diese historischen Abschnitte, die Jahrhunderte der Sklaverei in den USA bzw. die NS-Zeit in Deutschland, wollte er damit sagen, an denen sich die moderne Gesellschaft in beiden Ländern messen lassen muss. Man kann diese Herausforderung mit einem Gespür für geschichtliche Empfindsamkeit annehmen – oder sie wissentlich ignorieren und stattdessen ausländerfeindliche Motive bedienen. Was wusste Trump, der billionaire playboy aus Manhattan, der fast jede Nacht im Wahlkampf mit seinem Privatflugzeug zurück nach New York flog, um nicht in fremden Hotelbetten übernachten zu müssen, denn von dieser amerikanischen Lebenswirklichkeit? Kannte er die Sorgen der Menschen besser als andere Politiker oder bediente er bloß ihre Ängste wirkungsvoller, dass Septina Florimonte über ihn sagte, »er spricht die grundlegenden Probleme im Herzen der Gesellschaft an«?
Am Tag vor der Wahl fegte Trumps Kampagne ein letztes Mal über das Land hinweg. Fünf Reden in fünf Bundesstaaten, von morgens früh bis spät in die Nacht. Ein letztes Rütteln am Zaun. No-brainer tour. Nach dem ersten Auftritt am Vormittag in Florida landete er gegen halb drei in Raleigh. Ich saß im Pressebereich der überfüllten Dorton Arena, noch zwanzig Minuten bis zu Trumps Auftritt. Über die Lautsprecher lief Musik vom Band, eine Endlosschleife aus harmlosem Poprock: »Rocket Man« von Elton John, »Don’t Stop Believing« von Journey, »Hey Jude« von den Beatles und natürlich »You Can’t Always Get What You Want« von den Rolling Stones in der langen Albumversion mit dem engelsgleichen Kinderchor-Intro und Mick Jaggers abschließender Botschaft You get what you need. Natürlich, das war die Frage: Würde Amerika wirklich bekommen, was es verdient hatte? Was wollten diese Menschen hier im Saal, was brauchten sie?
Ich schaute ins Publikum. Gut gelaunte, selbstbewusste Amerikaner, unmissverständliche Trump-Anhänger. Aber kein Meer aus Septina Florimontes. Viele weiße Gesichter, rote MAGA-Kappen. Make America Great Again. Clintons Kampagnenspruch musste ich noch einmal googeln, um sicherzugehen, dass er wirklich so lautete (»Stronger together«), obwohl er wahrscheinlich durch unzählige Agenturhände zur finalen Abnahme gegangen war, während Trumps globaler Ellenbogenausfahrslogan so klang, als hätte er ihn sich auf dem Klo ausgedacht (nebenbei: hat er nicht). Trump, ganz der feinfühlige Brückenbauer, sagte in Raleigh, die afroamerikanischen und lateinamerikanischen Wähler hätten doch nichts zu verlieren, so schlecht sei es ihnen unter Obama ergangen – jetzt könnten sie ja auch einfach für ihn abstimmen.
Manchmal war Trumps Ignoranz im Umgang mit dem rassistischen Erbe der USA schier unfassbar – und dann wiederum komplett erwartbar.
Nach der Rede hallten »U-S-A! U-S-A! U-S-A!«-Sprechchöre durch den Saal in Raleigh. Dieser Patriotismus, den Trump da bediente, kratzte noch einmal sehr laut mit der Nadel durch die Tonspur von Amerikas hässlicher Vergangenheit: Da feierte sich ein Land für Errungenschaften, die lange zurücklagen, ohne sich je auf sinnvolle Weise mit den Ausgebeuteten und Verlierern der amerikanischen Geschichte auseinandergesetzt zu haben.
Es ist nicht schwierig, herauszulesen, wonach sich Trumps Anhängerschaft sehnen sollte: dem Amerika der Reagan-Ära. Die einzige Supermacht auf dem Planeten, wirtschaftlich und militärisch den Klassenfeinden haushoch überlegen, angeführt von einem telegenen, kameraerfahrenen Präsidenten, der über Umwege in die Politik gelangt war; selbst Trumps Slogan war schließlich von Ronald Reagans Wahlkampf 1980 entlehnt (»Let’s Make America Great Again!«). Schaut man sich das amerikanische Kino an, das das politische Selbstverständnis dieser Zeitspanne einfing, ging es auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges auch immer darum, nicht nur den Rivalen zu schlagen, sondern von ihm Respekt gezollt zu bekommen. Maverick und Icemans Rivalität in »Top Gun« ist darauf ausgelegt, genauso wie das Ende von »Rocky IV«, an dem die Sowjet-Apparatschiks Rocky Balboa als großen Kämpfer anerkennen. Und viel anders schien es Trump auch nicht zu gehen: ja, winning war ihm wichtig, aber nicht unwichtiger schien sein Drang, respektiert zu werden – früher als Zögling, der von Queens nach Manhattan geht, um in der glitzernden high society anzukommen; heute als mächtigster Mann der Welt in der Geopolitik.
Nur klangen die USA unter Donald Trump im Herbst 2016 wie eine Nation, die mit Lautstärke statt echter Stärke auf sich aufmerksam machen musste. Der alte Schlager vom American exceptionalism plus Trumps nationalistische Wirtschaftstheorie – das war reine Beschwörung vergangener Souveränität und keine ernsthafte Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen.
Bei Trump war keine tief greifende Vision zu erkennen, und die Wähler mussten erst mal über unzählige Schönheitsfehler hinwegsehen. »Trumps Verhalten Frauen gegenüber ist anstößig«, sagte Septina Florimonte am Wahltag, »aber ich stimme hier doch nicht für den Papst ab.« Niemand sei perfekt, »und wenn schon«, schob die 38-Jährige hinterher, »es steht mir nicht zu, darüber zu richten«.
Wer würde schon, objektiv, über Trump richten können? Für das liberale Amerika war die Nummer durch – Clinton war vielleicht nicht perfekt, aber Trump eben komplett untragbar. Andersherum ja auch: Für Leute wie Dennis Berwyn war Trump lediglich ein erprobtes Kampfmittel gegen acht Jahre Verständnisliberalismus, der sich um Umwelt, Gesundheitswesen, faule Studenten und Transgender-Toilettenschilder gesorgt, aber nicht um die Staublungen der Kohle-Kumpel gekümmert hatte.
Acht Stunden nach Trumps Auftritt, kurz vor Mitternacht, machte Hillary Clinton in Raleigh halt. Was dort in der Sporthalle der North Carolina State University in der Luft lag, lässt sich mit dem Wissen um den Ausgang der Wahl kaum glaubhaft beschreiben. War die Aufregung, das Geklatsche, die überdrehte Betriebsamkeit dem historischen Ereignis des anstehenden Wahlsiegs geschuldet oder doch nur Vorfreude auf die Stargäste Lady Gaga und Jon Bon Jovi, die später zusammen auftraten und »Livin’ on a Prayer« im Duett sangen?
Jedenfalls stand Lady Gaga in einer Art Michael-Jackson-Kostüm (verspiegelte Sonnenbrille, schwarzer Blazer mit glitzernder Phantasiebrosche und roter Armbinde – kein guter Look, heute, vier Jahre und eine Neverland-Dokumentation später) auf der Bühne; alles wartete auf Hillary Clinton, der Minutenzeiger tickte auf null Uhr zu, und wieder sah man die Inszenierungsmaschine rattern: Ein letzter Push in der Nacht vor der Wahl, um für den Frühstückstisch die passenden Bilder zum Start in den Tag zu liefern. Gaga sagte einen Satz, der heute fast noch unglücklicher klingt als die Michael-Jackson-Aufmachung aussah: »Ich hatte es mir nie ausgemalt, dass ich eines Tages erleben würde«, drei Sekunden Kunstpause, »dass eine Frau Präsidentin der Vereinigten Staaten wird.«
Für Lady Gaga wie für Millionen andere Frauen, war Hillary Clinton der Beweis, dass Frauen eben (fast) alles erreichen können. Doch was war diese Inspiration wert, wenn dem Kontrahenten etwas gelang, das Septina Florimonte zwölf Stunden nach Clintons Wahlkampfrede so zusammenfasste: »Trump bringt den amerikanischen Traum zurück.«
Die Idee, dass es jeder in Amerika schaffen kann, wenn er oder sie nur hart genug arbeitet, ist natürlich eine der größten Unwahrheiten, die dieses Land je hervorgebracht hat. Glück, Zufall oder Talent können einen an die Spitze bringen, gewisse Privilegien genießt man in den USA jedoch nur als weißer Mann. Dass also ausgerechnet Donald Trump, der mit Millionen auf dem Familienkonto auf die Welt kam und dem es in seiner Kindheit angeblich an nichts außer väterlicher Liebe fehlte, die Amerikaner dazu inspirieren könnte, Großes zu schaffen, wirkt naturgemäß absurd. Aber so funktioniert der American Dream nun einmal: Trump war zwar allerlei Silberbesteck in die Wiege gelegt worden, aber er lebte das Leben, wie man es leben sollte. Der Clinton-Weg? Yale, Gastprofessur, First Lady in Arkansas, und so weiter und so fort? Don’t be silly!
Nein, Trump flog mit dem Privatjet über den Kontinent. Er hatte ein Model geheiratet, und als die schwanger war, küsste er eine andere auf den Mund und langte ihr werweißwohin. Er dachte, was er sagte. Er sagte, was er wollte. Keine Kompromisse. Und einen langweiligen Boss hatte er in seinem Leben auch nie gehabt. Tellerwäscherromantik schön und gut. Aber es kommt doch darauf an, wie man den Traum mit Leben füllt. Trumps Traum vom Weißen Haus war abenteuerlich – und wahr geworden.
The American Dream ist auch: Teil der Action sein, einmal mit am Tisch sitzen, einmal im Leben zuschauen, ob die Roulette-Kugel auf Schwarz oder Rot landet. Trump war dieser Spieler, »die richtige Mischung aus Gauner und Milliardär«, wie es Dennis Berwyn ausdrückte. Er zeigte Amerika, oder besser: einem Teil von Amerika, wie man es macht. Wem die Tür zu seinem persönlichen Glück verschlossen blieb, den wies Trump indirekt darauf hin: Guck mal, es gibt auch noch die Hintertür. Weshalb ihm seine Wähler auch die Affäre, die Selbstverliebtheit, den Sexismus, den Mangel an Stil durchgehen ließen. Er hat die Steuer und seine dritte Ehefrau beschissen? Good for him.
Die Wahllokale hatten noch eine knappe Stunde geöffnet, als Dennis Berwyn sich fallen ließ. Der Stuhl im Friseursalon klappte zurück, er lag da, erschöpft vom langen Tag. Bis auf seinen Kopf war er unter einem schwarzen Umhang verschwunden. Die Friseurin pinselte seinen Bart ein. »Jetzt müssen Sie einmal kurz schlucken«, sagte sie und fuhr mit einer Rasierklinge vorsichtig über den eingeseiften Kehlkopf. »Immer wieder ein komisches Gefühl«, sagte er, »wenn dir ein Fremder mit so einem scharfen Messer am Hals entlangfährt.« Die Frau breitete in der Luft ein dampfendes Handtuch aus, mit dem sie die Schaumreste abtupfte. »Alles eine Sache des Vertrauens«, sagte sie.
Berwyn sprach mit geschlossenen Augen. Er sprach über seine Jugend in Europa, sein Haus, seine Hypothek, den alten Rennwagen, den er verkaufen wollte, seine Familie, über die Söhne, seine jüngste Tochter, die schwarz ist, und wie sie mit Vorurteilen und Rassismus umgeht. Er sagte auch: »Ich habe nichts gegen Einwanderung. Sie sollte bloß legal erfolgen. Die Leute sollen die richtigen Papiere bekommen, damit sie rechtmäßig hier sind, Steuern zahlen und zur Gesellschaft etwas beitragen können.«
Auf den Autofahrten zwischen den einzelnen Wahllokalen hatte Berwyn aufgekratzt gewirkt. Auf dem Friseurstuhl kam er zur Ruhe. Ganz oben auf dem Wahlzettel in Raleigh hatten Clintons und Trumps Namen gestanden, ein paar Zeilen darunter, hinter den Kandidaten für den Kongress, dann die Lokalabgeordneten, wie Chris Malone, Berwyns Chef. Die Realitäten waren für ihn an diesem Abend einfach skizziert: Würde Malone seinen Sitz verlieren, stünde Berwyn anschließend ohne Job da.
Zwei Jahre später, als der Kongress im November 2018 die midterms abhielt und Berwyn wieder einen Friseurtermin gemacht hatte, kam es genau so: Malone verlor seinen Sitz im Abgeordnetenhaus – und Dennis Berwyn seinen Job. Die Demokraten waren in Scharen zur Wahl gegangen. Denkzettel für Trump lauteten die Überschriften am Morgen danach. Ich fragte Berwyn, ob Trump den Vertrauensvorschuss, den die Wahl im November 2016 für den Politikneuling bedeutet hatte, verspielt hätte. Obwohl die Wahl verloren gegangen war für Team Malone, war Berwyn guter Dinge. »Amerika marschiert weiter, die Wirtschaft brummt. Raleigh geht es gut, die Menschen sind unterwegs, kaufen ein, geben Geld aus. Uns geht es gut, die Menschen bekommen wieder mehr Babys, ich habe zwei neue Enkelkinder. Meiner Familie und mir geht es gut. Selbst der Wert meines Hauses ist gestiegen.«
Und Trump? Der hätte sich einfach nur ein blaues Auge abgeholt. »Einwanderung und nationale Sicherheit, damit gewinnt niemand einen Preis. Schwieriges Thema. Hat seit Reagan niemand angerührt.« Dass Trump Teile der Presse als »enemy of the people« bezeichnete, damit konnte er nichts anfangen, aber wenn er sich etwas wünschen dürfe, dann mehr Journalismus ohne Meinung. »Diese ganzen Adjektive und Superlative treiben vielleicht die Quoten hoch, schöner wäre es aber, wenn sie einfach objektiv darüber berichteten, was passiert ist.«
Die midterms, die Kongresswahlen zwischen zwei Präsidentschaftswahlen, seien brutal gewesen, sagte er. Weniger als 3000 Stimmen hätten Malone zum Sieg gefehlt, obwohl sein Team und er mehr Spenden für die Kampagne eingesammelt hätten als noch zwei Jahre zuvor.
Auf dem Friseurstuhl liegend, hatte Berwyn 2016 noch gesagt: »Für die meisten Amerikaner wird dieser Abend enttäuschen verlaufen: Morgen gehst du wieder zur Arbeit, die Welt dreht sich weiter und das Laub hängt immer noch in der Regenrinne.« Für Trump war die Roulette-Kugel an der richtigen Stelle hängen geblieben. Für den Durchschnittsbürger änderte sich von heute auf morgen erst einmal: gar nichts.
Chris Malone hatte am Abend von Trumps Triumph seine Familie, das gesamte Wahlkampfteam sowie ein paar Freunde in ein Restaurant eingeladen. Um 19:30 Uhr schlossen die Wahllokale. Es dauerte anderthalb Stunden, bis die Männer am Tisch ihre Nervosität ablegten: Malone und Berwyn balancierten einen kleinen Laptop auf dem Schoß, immer mit dem Zeigefinger auf F5, refresh, refresh, refresh, um die aktuellsten Zahlen auf der Webseite der Wahlkommission abzurufen. Am Ende gewann Malone mit 53,1 Prozent der Stimmen gegen den Kandidaten der Demokraten. Wir zogen weiter zur offiziellen Party der Republikaner im Ballsaal des Marriott Hotel.
Ich fand in meinem Notizbuch von der Nacht am Rande einer vollgeschriebenen Seite drei Worte, komplett zusammenhangslos und ohne dass ich es einer Person zuordnen könnte, aufgeschrieben in hastiger Schreibschrift, über die ich heute noch nachdenke: the Trump translator, stand dort. Wer hatte das gesagt? Berwyn? Nicht, dass ich mich daran erinnern konnte. Jemand anderes? Vielleicht. War es mein eigener Gedanke gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Es war ja auch egal, denn: Brauchte man Trump überhaupt noch zu übersetzen? Benutzte er nicht eine Sprache, die simpler und somit nicht weniger interpretationsbedürftig hätte sein können?
Oder war es anders gemeint gewesen? Als Frage danach, wie sich Trump auf das Land übersetzen lassen würde?
Monate später saß ich in Washington vorm Fernseher und schaute einen Film, aus dem man alles und nichts lesen kann. Die Truman Show mit Jim Carrey griff bereits 1998 auf, wohin sich unsere Sehgewohnheiten erst Jahre später entwickelten. Als Truman, dessen Leben als Teil einer Fernsehsendung auf Schritt und Tritt von Kameras eingefangen wird, gegen Ende des Films hinter der Kulisse seines Fernsehlebens verschwindet, ohne weitergefilmt zu werden, und die Zuschauer vor den Apparaten daheim jubeln, musste ich an Dennis Berwyn denken, wie er mir zum Abschied die Hand schüttelt und sich in der Menge verliert. Erzähl deinen Lesern, was du heute hier gesehen hast.
In der allerletzten Einstellung des Films sitzen zwei Parkhauswächter in ihrem Kabuff vorm Fernseher, die Truman Show ist vorbei, die Permanentaufzeichnung seines Alltags für immer beendet, für den Helden beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Die Bildschirme im Film schalten auf Schneegestöber, Ende der Übertragung. Fragt der eine Wächter den anderen, kurz bevor die schwarze Blende mit dem Abspann erscheint: »Und, was kommt als Nächstes?«
Höchste Zeit, genau das aufzuschreiben.
Kapitel 2 – April 2017Guns N’ Roses
Besuch in einer alten Kohle-Stadt. Rock Springs, Wyoming
Hinter der Grenze zu Nebraska, wo das Land, das sie die great plains nennen, flach ist, baute sich nach ein paar Autostunden plötzlich Wyoming in seiner dramatischen Schönheit auf.
Da war zu allerersteinmal die unendliche Weite am Horizont. Meilenweit kein Haus, kein Städtchen, nur Natur, durch die jemand eine Landstraße gezogen hatte. Die Wolken schoben sich vor die Sonne, nur kurz, bis der Wind sie wegblies. Das Licht, das auf die schneebedeckten Bergkuppen fiel, ließ den Himmel türkisfarben leuchten. Im 18.Jahrhundert war hier Wilder Westen; die Cheyenne, Shoshonen, Sioux und andere Stämme bewohnten das Land, bis die europäischen Einwanderer kamen und den Kontinent unter sich aufteilten.
Hier, am Fuße des Yellowstone National Park, war die Natur so weit, atemberaubend und scheinbar unberührt, dass man es sich als Außenstehender kaum vorstellen konnte, warum sich in Wyoming statistisch gesehen alle 2,5 Tage jemand umbringt.
Was, bitte schön, sollte das mit der Natur zu tun haben? Nichts, natürlich. Aber, und das stellte sich erst später raus, ganz unschuldig war sie nicht. Diese elende Statistik (in den Jahren 2014 bis 2016 hatten Alaska, Montana und Wyoming abwechselnd den ersten Platz mit den meisten Suiziden pro 100000 Einwohner unter sich ausgemacht)1 war ein Detail, über das ich zufällig gestolpert war vor meiner Reise nach Rock Springs in Sweetwater County. Ich hatte einen Termin in Colorado und war einen kleinen Umweg nach Wyoming gefahren, in eine alte Kohle-Stadt, in der Bergbau und Ölförderung den Pulsschlag der Gemeinde bestimmten, um kurz vor Trumps erstem kleinem Amtsjubiläum (100 Tage im Weißen Haus) zu hören, ob die, denen er versprochen hatte, »beautiful, clean coal«2 zurückzubringen, schon desillusioniert waren oder immer noch nicht genug vom neuen Präsidenten bekommen konnten.
Ist es naiv, an solch einem Ort nach Antworten zu suchen? Im Kern vermessen ist natürlich die Idee, zu denken, das Rüstzeug des Reporters führe automatisch zu einer höheren Erkenntnis: Stift und Block in der Tasche – die Geschichten liegen auf der Straße und die Wahrheit auch, bitte aufsammeln. Reichen Kugelschreiber, Notizbuch und ein paar Fragen, um der Realität zu begegnen und ihr Storys abzuluchsen, die etwas aussagten?