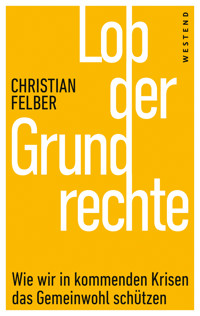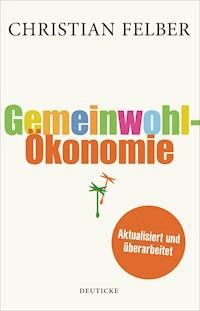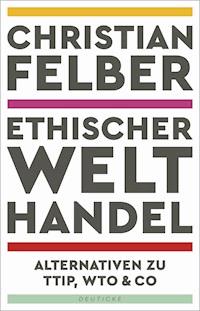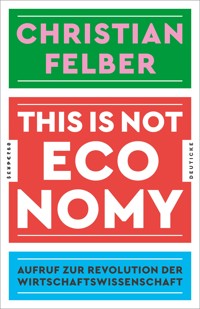
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zündstoff für ÖkonomInnen: In seinem neuen Buch nimmt Christian Felber, der Initator der "Gemeinwohl-Ökonomie", die Wirtschaftswissenschaft ins Visier. "Why did nobody notice it?", nicht nur Queen Elizabeth fragte sich 2008, warum die Finanzkrise auch ÖkonomInnen zu überraschen schien. An den Wirtschaftsfakultäten brodelt es: Weltweit setzen sich Studierende für eine plurale Wirtschaftswissenschaft ein. Sie wollen implizite Annahmen, versteckte Werturteile und blinde Flecken offenlegen und die Ökonomie wieder in breitere Kontexte einbetten. Nach einem Überblick über die Bandbreite der Kritik stellt der Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie Grundsatzfragen nach den Wurzeln der Disziplin und den Gründen der fatalen Verirrungen. Und er macht einen konkreten Vorschlag für eine ganzheitliche Wirtschaftswissenschaft. Zündstoff für die Wirtschaftswelt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
»Why did nobody notice it?« Nicht nur Queen Elizabeth fragte sich 2008, warum die Finanzkrise auch Ökonom*innen überraschte. An den Wirtschaftsfakultäten brodelt es: Weltweit setzen sich Studierende für eine plurale Wirtschaftswissenschaft ein. Sie wollen implizite Annahmen, versteckte Werturteile und blinde Flecken offenlegen und die Ökonomie wieder in breitere Kontexte einbetten.
Nach einem Überblick über die Bandbreite der Kritik stellt Felber Grundsatzfragen nach den Wurzeln der Disziplin und den Gründen der fundamentalen Verirrungen. Und er macht einen konkreten und konsistenten Vorschlag für eine ganzheitliche Wirtschaftswissenschaft.
Christian Felber
THISISNOTECONOMY
Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft
Deuticke
Inhalt
Einleitung
Teil I – Panoptikum der Kritik
1. Geschichts- und Kontextlosigkeit
2. Mathematisierung
3. Physikneid – die eingebildete Naturwissenschaft
4. Fetisch Modell
5. Gleichgewichtsmärchen
6. Positivismus
7. Wertfreiheit versus Normativität
8. Theoretischer Monismus
9. Interdisziplinaritätsresistenz
10. Lehrbücher oder Parteiprogramme?
11. Bildung von Egoisten
12. Hierarchisierung-Machtbildung
13. Königsdisziplin
Teil II– Radikale Amnesie
Vergessen und verdrängt I – die Herkunft
Vergessen und verdrängt II – der Name
Vergessen und verdrängt III – das Ziel
Teil III– Politische Ökonomie
1. Wirtschaftsnobelpreis?
2. Econocracy – die Herrschaft der Ökonomen
3. Lehrbuchposse
4. Ideologisches Glaubenssystem
Teil IV – Zentrale Glaubensinhalte
1. Wachstum
2. Menschenbild
3. Wettbewerb statt Kooperation – der zentrale Theorie- und Empirie-Fehler
4. Staat & Markt: das beste Ehepaar der Welt
5. Eigentum
Teil V – Alternativen
1. »Plural«: die Ökumene der Ökonomik
2. Heilige Wirtschaftswissenschaft
Dank
Anmerkungen
Literatur
Interviews
Einleitung
Moderne Makroökonomie ist bestenfalls spektakulär nutzlos und schlimmstenfalls klar schädlich.
PAUL KRUGMAN (2009)1
Als ich die Gemeinwohl-Ökonomie, angespornt von einer Gruppe Unternehmer*innen und in Zusammenarbeit mit ihnen, entwickelte, wollte ich nicht primär eine wissenschaftliche Theorie vorlegen, sondern eine konkrete Alternative, die Menschen ohne abgeschlossenes Studium verstehen und Unternehmer*innen, Bürgermeister*innen und Schulen praktisch anwenden und weiterentwickeln können. Wir hatten selbstverständlich nicht nur mit Zustimmung gerechnet. Jede gesellschaftliche Veränderung löst Kritik, Befürchtungen und Widerstand aus. Nicht alle Menschen sind gleich offen für Innovation und Weiterentwicklung. Vor allem war uns klar, dass einige der Eckpunkte wie die Infragestellung grenzenloser Ungleichheit bei einem Teil der Besitzenden Abwehrreflexe hervorrufen würden – einschließlich eher unbeholfener Versuche, die GWÖ in verschiedene Ecken zu stellen: Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, Populismus, Greenwashing, Esoterik … Fast alles war dabei. Einen konstruktiven Diskurs kann das verzögern, aber nicht verhindern. Umso erstaunter waren wir, dass ein vergleichsweise schroffer Gegenwind aus akademischen Kreisen pfiff. Mainstream-Ökonomen fühlten sich offenbar in ihrer Domäne gestört und in ihrer Deutungshoheit infrage gestellt, was Wirtschaft ist oder wie sie anders verstanden, praktiziert und politisch gestaltet werden könnte.
Sonderbare Argumente
Stutzig wurde ich durch die Argumente: Ich hätte »grundlegende Prinzipien der VWL« und »die Märkte nicht verstanden«, die GWÖ sei »keine Theorie«, »nicht wissenschaftlich«, ich sei ein »politischer Aktivist«, und schließlich, der Hauptvorwurf, dass die GWÖ ein »normativer« Ansatz sei – ja was denn sonst? Die GWÖ sagt ja prominent und transparent von sich, dass sie auf Beziehungs- und Verfassungswerten aufbaut, dass sie primär ein Wertesystem ist. Das gilt aber für jede Theorie über die Wirtschaft, egal ob Kapitalismus, Kommunismus, soziale Marktwirtschaft, Postwachstums- oder Care-Ökonomie. Und hier tat sich der Kernwiderspruch auf: Der Mainstream der Wissenschaft glaubt tatsächlich, dass die neoklassische Ökonomik eine wertfreie Wissenschaft sei. Das ist nicht nur eine mächtige Selbst- und Publikumstäuschung; wenn das eigene Wertesystem nicht transparent gemacht wird, handelt es sich um Ideologie. Umso mehr, wenn damit die bestehende Ordnung legitimiert wird, anstatt dringend benötigte Alternativen zu entwickeln.
Ideologie
Bei der neugierigen Nachschau, was sich unter der Oberfläche der merkwürdigen Abwehr von Alternativen verbirgt, stieß ich auf ein unübersehbares Ausmaß an vernichtender Kritik an der Mainstream-Ökonomik – von Ökonom*innen selbst! Die Kritik betrifft alle Ebenen der Wirtschaftswissenschaft – ihr wissenschaftstheoretisches Selbstverständnis, ihre Geschichtsvergessenheit und Undefiniertheit, die Theorie- und Methoden-Einfalt, die haarsträubenden Annahmen und die Realitätsferne, die Mathematisierung und Modellversponnenheit, die Resistenz gegen Kritik und Interdisziplinarität, die Arroganz und die Machthierarchien, die Dominanz der Männer. Die Breitband-Kritik existiert seit vielen Jahren und in vielen Punkten sogar seit Jahrzehnten – doch sie prallt am orthodoxen Theoriegebäude und am Wissenschaftsbetrieb wie an der Chinesischen Mauer ab. »Neoklassische Ökonomen bewältigen Kritik, indem sie sie ignorieren«, schreibt der Renegat-Ökonom Steve Keen.2 Eine weitere Schwierigkeit: Durch das Undefiniertlassen mancher Kernkonzepte – allen voran des »freien Marktes« – entwindet sie sich der Möglichkeit einer konkreten Dekonstruktion.3 Kritikresistenz und -immunisierung sind weitere Erkennungsmerkmale von Ideologien.
Vertrauen im Abgrund
Kritikoffenheit, Selbstreflexion und Demut stünden der Wirtschaftswissenschaft jetzt gut zu Gesicht. Der neoklassische Mainstream war nicht nur unfähig, die Finanzkrise vorherzusehen, er hat sich grundlegend verrannt: Der Fokus auf Finanzkennzahlen, der Wachstumsfetischismus, die Mathematisierung und das absurde Menschenbild tragen zum sinkenden Ansehen der Zunft in der Bevölkerung bei. Eine FORSA-Umfrage in Deutschland ergab 2015, dass Wirtschaftsexperten nur bei einem Viertel der unter 34-Jährigen »alles in allem einen vertrauenswürdigen Eindruck machen«.4 Eine YouGov-Umfrage 2017 unter zweitausend Brit*innen ergab, dass die Menschen den Wissenschaftler*innen im Schnitt zu sechzig Prozent vertrauen, hingegen liegt der Wert für Ökonom*innen bei minus zwanzig Prozent!5 Ein Schelm, wer darin eine Mitursache für den Brexit sieht. Die Bevölkerung erwartet von den Wissenschaftler*innen Antworten auf die brennenden Probleme der Gegenwart: Arbeitslosigkeit, Ungleichheit, Machtkonzentration, Klimawandel, Artensterben, Demokratieerosion, Sinnverlust … Ich zähle die neoklassische Mainstream-Wirtschaftswissenschaft nicht nur zu ihren Hauptverursachern, ich gehe mit Steve Keen konform, dass die »neoklassische Wirtschaftswissenschaft (…) gegenwärtig das größte Hindernis beim Verständnis dafür ist, wie die Wirtschaft tatsächlich funktioniert«.6
Von daher prognostiziere ich, dass die Mainstream-Ökonomie genauso wenig, wie sie in der Lage war, die Finanzkrise – auf ihrem Kerngebiet – vorherzusagen, in der Lage sein wird, kommende Krisen – Klima, Verteilung, Konzernmacht, Demokratie – vorherzusehen. Inklusive soziale Unruhen und Verteilungskrisen. Sie sah auch weder Pegida noch Trump, noch die Gelbwesten kommen. Und auch nicht den Terror. Dieser ist ja die radikalste Kontraindikation zur Erzählung mancher Ökonomen, dass der Gesamtzustand der Welt so gut wie nie zuvor sei, weil Kapitalismus und Freihandel weltweit Wohlstand schafften. Wie ist es zu erklären, dass der Terror ausgerechnet dann beginnt, wenn die Armutszahlen rückläufig und Demokratien weltweit auf dem Vormarsch sind?
Studierendenproteste
Ein zweiter Verstörungsmoment war, dass ich bei Vorträgen allerorts tief frustrierte und existenziell verstörte Studierende antraf, weil sie mit ihren brennenden Fragen zum Zustand der Welt kein Gehör und sich stattdessen in einem sterilen Modell-Labor ohne Realitätsbezug wiederfanden. Ihre Fragen werden nicht nur gar nicht behandelt, sie werden häufig auf andere Studien verwiesen – Ökologie, Philosophie – oder sogar persönlich brüskiert, dass sie mit solchen »Gutmenschen«-Fragen daherkämen. Ständig werde ich und wird die Gemeinwohl-Ökonomie nach alternativen Wirtschaftsstudien gefragt.
Aktuell studieren Millionen junger Menschen an Tausenden von Business Schools und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten Ökonomik oder haben einführende Vorlesungen in ihren Curricula. Dabei werden sie nicht umfassend, universell, plural und selbstreflexiv geschult, sondern monistisch, mathematisch, unkritisch, unpolitisch und verdeckt ideologisch. Die führenden Lehrbücher – Samuelson, Mankiw, Varian, Blanchard, Pindyck/Rubinfeld … – haben eine anti-aufklärerische Wirkung, sie richten laufend weiteren und großen Schaden an.
Der Protest entzündete sich deshalb auch innerhalb der Disziplin. In Frankreich gründete sich 2000 ein Netzwerk für »postautistische Ökonomik«, in Großbritannien ging »Rethinking Economics« an den Start, in Deutschland und Österreich entstanden die Netzwerke für Plurale Ökonomik, die sich 2014 international mit anderen Initiativen zur International Student Initiative for Plural Economics (ISIPE) zusammenschlossen. In einem öffentlichen Brief schreiben die Nachwuchs-Ökonom*innen: »Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Krise. In der Krise steckt aber auch die Art, wie Ökonomie an den Hochschulen gelehrt wird (…) Wir beobachten eine besorgniserregende Einseitigkeit der Lehre, die sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verschärft hat.« Das Netzwerk fordert, »die Ökonomie wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen«.7
Diesem Ziel ist auch das vorliegende Buch gewidmet. Zunächst geht es darum, die Kritik am neoklassischen Mainstream, dem Unterricht und den Lehrbüchern, die auch zu den studentischen Protesten und Alternativbewegungen geführt hat, in eine verständliche Übersicht zu bringen – für alle Interessierten, nicht nur für Ökonom*innen. Ich verstehe mich bei dieser Übung als Wissenschaftsjournalist. Die panoptische Zusammenschau der Kritik ermöglicht ein Gesamtbild, das wiederum der Ausgangspunkt für einen Neuanfang sein kann, für eine ganzheitliche Ökonomik.
Insbesondere richtet sich das Buch an Studierende der Wirtschaftswissenschaft sowie Studierende der Politologie, Soziologie oder Jus, die durch einführende Lehrveranstaltungen in Mikro-/Makroökonomie durchmüssen und dabei den schlechtesten Teil des Lehrangebots abbekommen. Es möchte ihnen alternative Vorstellungen von Wirtschaft und Wissenschaft anbieten und Werkzeuge in die Hand geben, das, was sie im Studium kennengelernt haben, zu hinterfragen, zu reflektieren und zu dekonstruieren. Es gibt nicht eine ökonomische »Denkweise« (Mankiw), es gibt viele. Es gibt eine Pluralität von Theorien, Methoden und Erkenntnisweisen und Wirtschaftspraktiken. Der Markt ist nur eine davon, und er muss sich genauso den demokratischen Spielregeln unterordnen wie alle anderen. Wir brauchen weder eine »marktkonforme Demokratie« (Angela Merkel) noch eine systemkonforme Wissenschaft.
Wichtig sind mir zwei Differenzierungen. Der nachfolgende Text kritisiert den Mainstream der Wirtschaftswissenschaft, der sich zum Großteil, wenn nicht zur Gänze, mit der Neoklassik deckt. Zum Glück gibt es eine reichhaltige Pluralität heterodoxer und anderer alternativer Ansätze – ihnen ist dieses Buch mit gewidmet. Der »Mainstream« zeigt sich nirgendwo deutlicher als in der Lehre und den Massen-Lehrbüchern. Diese sind die Achillesferse der Disziplin. In der Forschung ist das Feld viel heterogener, und viele Forscher*innen haben Kritikpunkte ernst genommen und selbst zu ihrer Schärfung beigetragen. Diesem Umstand trage ich Rechnung, indem ich eine große Anzahl etablierter Ökonom*innen zu Wort kommen lasse.
Mein persönlicher Beitrag – auch als Linguist – ist die Wiederaneignung des entführten Begriffs »Ökonomie«. An dessen ursprüngliche Bedeutung möchte ich erinnern, und auf Basis einer sauberen Definition eine echte »Ökonomik« neu begründen, die diesen Namen verdient. Eine integrale Wirtschaftswissenschaft, die auf einer reflektierten wissenschaftstheoretischen Grundlage arbeitet, ihre Annahmen und Werte offenlegt, die dem Leben und dem Gemeinwohl dient. Jede Vorstellung und Wissenschaft von Wirtschaft ist gleichzeitig ein Wertesystem. Wenn diese Werte transparent gemacht werden, dann haben Ideologien keine Chance, und Lehrbücher verkommen nicht zu Gebetsbüchern oder Parteiprogrammen.
Teil I – Panoptikum der Kritik
1. Geschichts- und Kontextlosigkeit
Der Meister-Ökonom muss eine seltene Kombination von Talenten vereinen (…) Er muss Mathematiker, Historiker, Staatsmann, Philosoph sein (…) Er muss Symbole verstehen und in Worten sprechen (…) Kein Teil der Menschennatur oder seiner Intuitionen darf vollständig außerhalb seiner Berücksichtigung liegen.
JOHN MAYNARD KEYNES (1924)1
Für Studenten, die sich damit beschäftigten, wie die Welt funktioniert, stellt die Mikroökonomie wahrscheinlich das relevanteste, interessanteste und wichtigste Fach dar, das sie studieren können (wobei die Makroökonomie das zweitwichtigste Fach ist).
ROBERT PINDYCK, DANIEL RUBINFELD (2015)2
Wenn Studierende mit dem Gegenstand des Studiums bekannt gemacht werden, ist eine transparente Definition des Gegenstands, die Zielsetzung der Disziplin, ihre bisherige Geschichte, ihr Wissenschaftsverständnis sowie ihre Einbettung in gesellschaftliche Kontexte erwartbar: Was bedeutet »Wirtschaft« eigentlich, welche Definitionen liegen vor? Worin ist sie eingebettet, und in welcher – hierarchischen, systemischen oder anderen – Beziehung steht sie zu ihren (weiteren) Kontexten? Um am Ende daraus abzuleiten: Was ist das übergeordnete Ziel, der Sinn und Zweck von Wirtschaft? Hat sich die Sichtweise darüber im Lauf der Geschichte geändert? Welche theoretischen Schulen gibt es, und woraus ist die Wirtschaftswissenschaft hervorgegangen? Wenn schon Lehrbücher im Schnitt achthundert bis tausend Seiten zu »verteilen« haben, müssten doch die wesentlichen Dinge auf diesem Raum Platz finden – zumal Ökonom*innen sich als Expert*innen im Management knapper Ressourcen verstehen.
Doch dem ist leider nicht so. Eine Studie der Universität Kassel zur Situation in Deutschland kommt zum Schluss: »Lehrveranstaltungen mit erweiternder Perspektive, etwa die Geschichte des ökonomischen Denkens, Wirtschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie und Ethik, sind nicht genuin Teil der Lehre, sondern werden – wenn überhaupt – nur an einzelnen Universitäten angeboten.«3 Eine Untersuchung des Netzwerks Plurale Ökonomik an 57 deutschen VWL-Bachelor-Studiengängen ergab, dass reflexive Fächer wie Geschichte des ökonomischen Denkens und Wirtschaftsethik nur 1,3 Prozent der Curricula an deutschen Universitäten ausmachen.4 Die Untersuchung von 174 Ökonomik-Modulen an britischen Universitäten hat ergeben: »Kritisches und unabhängiges Denken wird in den Ökonomik-Kursen nicht gefördert, und Geschichte, Ethik oder Politik kommen kaum oder gar nicht vor.«5 Walter Ötsch schreibt: »Traditionelle Ökonomen wissen wenig über Geschichte, sei es die Geschichte ihres Faches (z. B. über die Entstehung ihres Welt-Bildes) oder der Wirtschaft selbst (…) Sie sind nicht trainiert, über die methodischen Grundlagen zu reflektieren oder über die gesellschaftlichen Wirkungen ihrer Theorien nachzudenken.«6
Das 882 Seiten starke führende Lehrbuch des Google-Chefökonomen Hal Varian Grundzüge der Mikroökonomik beginnt auf Seite eins mit »Der Markt«.7 Paul Samuelson beginnt das erfolgreichste Lehrbuch aller Zeiten Volkswirtschaftslehre mit dem Flussdiagramm zwischen Haushalten und Unternehmen. Die Wirtschaftswissenschaft emergiert aus dem Nichts: »scientia ex nihilo«.
Die wesentlichen Umfelder und Grundlagen des Wirtschaftens – Ökologie, Ethik, Demokratie- und Gender-Theorien … – sind bestenfalls Marginalia, sie kommen weder in der Mainstream-Lehre noch in den Standardmodellen vor. Viele Studierende beklagen, dass sie im Studium überhaupt nicht auf die verantwortungsvolle Rolle vorbereitet würden, wirtschaftspolitische Empfehlungen abzugeben, die massive Konsequenzen für Millionen von Menschen hätten. »Als Studierende der Wirtschaftswissenschaft sind wir irgendwie zur Ehre einer merkwürdigen Autorität gelangt, die Qualität politischer Argumente zu beurteilen«, schreiben die »Cambridge-Rebellen« Joe Earle, Cahal Moran und Zach Ward-Perkins.8
Welche wären die Mindeststandards an Begriffsklärung, Zieldefinition, Kontextualisierung, Realitätsbezug und epistemischer Selbstreflexion? Hier ein Versuch für Curricula und Lehrbücher.
Wirtschaftsgeschichte
Natürlich ließen sich mit Wirtschaftsgeschichte endlos Seiten füllen, die Frage ist: Was sollte keinesfalls fehlen? Ein Mindeststandard wäre eine Übersicht, welche Typen von Wirtschaft es schon gab oder noch gibt. Märkte sind aktuell eine Form, gibt es andere Formen? Selbstversorgung, Geschenkkultur, Gemeingüter, öffentliche Dienstleistungen, Planwirtschaft? Müsste nicht am Beginn eine dem aktuellen Stand des Wissens entsprechende Übersicht erfolgen, welche Arten des Wirtschaftens es schon gab oder noch gibt – um den Horizont am Beginn möglichst weit aufzuspannen? Bevor die einzelnen Formen en détail abgehandelt werden oder auf eine einzige Form – Märkte – fokussiert wird? Wie seriös wäre ein Lehrbuch über Mobilität, das ausschließlich von Autos mit Benzinmotoren handelt? Oder ein Lehrbuch über Ernährung, das allein über die Zubereitung von Fleischmahlzeiten instruiert?
Ein zweiter Grundbaustein wären die wichtigsten Entwicklungsstationen von Handel, Geld, Steuern, Eigentum, Unternehmensrechtsformen sowie diverser Institutionen, die Märkte nicht nur steuern, sondern wesentlich mitkonstituieren. Das sind nicht nur Behörden wie die Zentralbank, das Finanzamt oder das Arbeitsinspektorat, sondern auch rechtliche Institutionen wie Geld, Privateigentum oder juristische Personen – ohne sie würde eine komplexe Marktwirtschaft nicht funktionieren. Wirtschaftsstudierende könnten erfahren, dass nicht erst Geld entstand und Schulden nachfolgten, sondern dass es umgekehrt war.9 Oder dass in der Geschichte der heutigen Industrieländer »Freihandel die Ausnahme und Protektionismus die Regel« war.10 In den Lehrbüchern kommen so gut wie ausschließlich Argumente für Freihandel vor, weder historische Fakten noch Kritik an der Freihandelstheorie.
Interessant zu erfahren wäre auch – einfach nur zum Vergleich –, dass der Spitzensteuersatz der Erbschaftssteuer in Großbritannien bei achtzig Prozent lag, nachdem zuvor Winston Churchill vor der Entstehung einer »Klasse fauler Reicher« gewarnt hatte.11 Auch die bayerische Verfassung könnte exemplarisch angeführt werden: »Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen weniger zu verhindern.« (Art. 157) Eine Diskussion, wo so eine Grenze angesetzt werden könnte, würde das eigenständige Denken anregen. Brandaktuell wäre die Nachzeichnung der schrittweisen Ermächtigung juristischer Personen seit dem 19. Jahrhundert und ihre dadurch heute möglich gewordene Machtfülle. Schließlich wäre noch Bestandteil einer Mindestallgemeinbildung der Zusammenhang zwischen dem Verbrauch fossiler Ressourcen und dem BIP-Wachstum.
Vielleicht reichen zwanzig bis dreißig Seiten Wirtschaftsgeschichte in den Lehrbüchern (zwei bis drei Prozent), aber ganz ohne sollte es nicht abgehen. An den deutschen Universitäten kamen 2016 gerade einmal 0,5 Prozent Wirtschaftsgeschichte in den Curricula vor.12
Geschichte der Disziplin
Gerade für eine Einführung in eine Wissenschaft ist es passend, einen kurzen Gang durch die Theoriegeschichte vorzunehmen, um das Fundament kennenzulernen, auf dem die aktuellen Ideen aufbauen: die Riesen, auf deren Schultern das heutige Weltverständnis steht. Thomas Dürmeier schreibt, dass es heute allgemein üblich ist, Ökonomin zu werden, ohne ein einziges Mal Smith, Marx, Keynes oder Hayek gelesen zu haben.13 Interessant zu erfahren wäre auch, wann die Disziplin der Wirtschaftswissenschaft entstand und wo der erste Lehrstuhl eingerichtet wurde. Und natürlich, woher der Begriff kommt und was er ursprünglich bedeutete. Beginnen könnte ein solcher historischer Rundgang mit der Entstehung des Begriffes »Ökonomie« bei den alten Griechen. Apropos: Was passierte eigentlich zwischen Aristoteles und Adam Smith, wer beschäftigte sich mit Ökonomie, wenn es bis ins 20. Jahrhundert weder an der Universität Cambridge in Großbritannien noch an der University of California ein Studium der Ökonomik gab – und auch kein Department of Economics?14 Wer dachte über die Wirtschaft nach, wenn es keine Wirtschaftswissenschaftler*innen gab? Zwei Diagramme wären vor jedem Blick auf Märkte oder das Flussdiagramm von Interesse: 1. die Entwicklung der Disziplin Ökonomik im Konzert der Wissenschaften und 2. eine Übersicht über die wichtigsten ökonomischen Theorieschulen: von der Neoklassik bis zum Postkeynesianismus, von der Institutionenökonomik bis zur Ökologischen Ökonomik, von der Care-Ökonomie bis zur Commons-Theorie. Das hätte zwangsläufig zur Folge, dass nicht nur »Märkte« betrachtet, analysiert und verstanden werden, sondern auch andere Formen des Wirtschaftens. Und die Studierenden würden (sich) zu fragen beginnen, welche Positionen die einzelnen Schulen zu ökonomischen Kernthemen wie Eigentum, Markt, Macht, Care-Arbeit, Ökologie, externe Effekte, öffentliche Güter, Gemeingüter, Verteilung, Ungleichheit oder Arbeit entwickelt haben – das wäre hochinteressant und aufschlussreicher als nur eine einzige Perspektive!
Definition und Ziel der Ökonomik
Es fällt weiters auf, dass es keine klare und einheitliche Definition der Wirtschaftswissenschaft gibt. Das ist ein massives Problem, denn ohne diese Klärung ergibt eine Wissenschaft keinen Sinn. Dann forschen die einen in eine (z. B. effizienter Einsatz finanzieller Ressourcen) und die anderen in eine andere Richtung (z. B. das gute Leben für alle oder das Gemeinwohl). Durch die unklare Definition bleibt offen: Ist nun Effizienz wichtiger als das Gemeinwohl oder umgekehrt? Falls es primär um Effizienz des Mitteleinsatzes geht, welche Mittel sind gemeint? Die Wirtschaftswissenschaft ist nicht hinreichend definiert, damit entbehrt sie eigentlich einer wissenschaftlichen Grundlage.
Angenommen, es ginge in der Wirtschaft(swissenschaft) um die Befriedigung menschlicher (Grund-)Bedürfnisse, dann müsste der Mutterliebe und der Muttermilch, den Freundschaften, Beziehungen, Partnerschaften und dem sozialen Zusammenhalt von der Nachbarschaft bis zur Demokratie (die allesamt weder materiell sind noch einen Marktpreis haben) zumindest gleich viel Aufmerksamkeit geschenkt werden wie marktförmigen Gütern und Dienstleistungen (die einen Preis haben). Sonst ist das Bild von Beginn an radikal unvollständig. Wer möchte in einer Welt leben, in der es zwar alle Güter gibt, in der mensch vielleicht drei Fernseher und vier Autos haben kann, aber es gibt keine Freundschaften, kein Vertrauen, keine Zärtlichkeit, keine Mütter und keine Demokratie?
Warum aber fokussiert dann die Wirtschaftswissenschaft ausschließlich auf Angebot und Nachfrage von Gütern, die einen Preis haben? Wie lautet die Definition für so eine Wissenschaft, und wodurch ist sie legitimiert?
Sinn ergeben würde eine ganzheitliche Betrachtung menschlicher Grundbedürfnisse, deren vollständige (und nicht teilweise) Befriedigung verantwortlich ist für das Gedeihen und Glück von menschlichen Individuen und Gemeinschaften – unabhängig davon, ob ihre Befriedigung über Haushalte, solidarische Netzwerke, Gemeingüter, Märkte oder Planung erfolgt. Erst vor dem vollständigen Spektrum der Möglichkeiten können die jeweils effektivsten Wege zur Erreichung des Ziels ermittelt werden. Ein solch pluraler Ansatz passt besser zu einer Wissenschaft als eine Uniform.
Wissenschaftstheorie
Damit die Studierenden die »Denkweise« einer Disziplin bewusst verstehen und kritisch hinterfragen können, muss diese etwas ausführlicher offengelegt werden: Welchem Wissenschafts- und welchem Theorieverständnis folgt die Ökonomik? Wie lautet ihr Erkenntnisideal? Tendiert sie zu Positivismus, Rationalismus, Konstruktivismus, Realismus oder Pragmatismus? Wofür hat sich die Ökonomik entschieden und warum? Zwar liefern die Lehrbücher einige »Sprengsel« wie Aussagen, dass sie nach Objektivität streben, sich als wertfrei erachten und positive von normativen Aussagen unterscheiden. Doch findet man üblicherweise wenig oder gar keine Erklärung und Begründung dieser Präferenzen, geschweige denn eine Bezugnahme auf den aktuellen wissenschaftstheoretischen Diskurs. Zumindest einige Zeilen sollten darüber verloren werden, ob die Ökonomik eine Natur- oder eine Sozialwissenschaft ist und was die beiden voneinander unterscheidet. Wer eine wissenschaftliche Disziplin studiert, sollte auch eine – verdaubare – Mindestdosis an Wissenschaftstheorie genießen.
Kontexte
Die heute vorherrschende neoklassische Wirtschaftswissenschaft hat seit ihrer Entstehung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die wesentlichen Umfelder – Politik, Ethik, Ökologie, Gender- und Machtthemen – ebenso konsequent ausgeblendet wie Erkenntnisse zu ihren Kernthemen aus anderen Disziplinen. Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft ergeben aber nur in einer systemischen und interrelationalen Gesamtbetrachtung Sinn, sonst wären sie ein geschlossenes System, das außer einer reinen Gedankenspielerei keinen wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Wert erbrächte. Welche sind die wichtigsten Kontexte wirtschaftlicher Vorgänge?
Abbildung 1: Einbettung der Wirtschaft in ihre Kontexte
Gender
Nicht ein »Kontext«, sondern vielmehr der Kern der oikonomia, die ja vom oikos, dem Haushalt, abstammt, ist die Produktion von Leben in diesen Haushalten.15 Das machen vor allem die Mütter, sie sind die genuinen Ökonominnen. Das Austragen, Gebären, Stillen und Großziehen von neuen Menschen ist die Grundfunktion menschlicher Haushalte und das Fundament aller Wirtschaftsformen. Werden diese Leistungen jedoch nicht kommerzialisiert und bezahlt, werden sie von der Neoklassik nicht wahrgenommen. Diese Ausblendung ist eine gewaltförmige Spaltung der Gesellschaft in wertvolle Erwerbs- und wertlose Haus- und Care-Arbeit. Eine Umfrage unter 150 000 Müttern in den USA hat errechnet, dass, wenn Frauen für jede ihrer Rollen den üblichen Stundenlohn erhielten – Haushälterin, Tagesbetreuerin, Taxifahrerin, Wäschereinigung –, zu Hause arbeitende Mütter jährlich rund 120 000 US-Dollar verdienen würden.16 Es gibt keinen vernünftigen Grund, diese Basisökonomie aus der Wissenschaft auszuklammern. Neben der Fürsorge-Arbeit für Kinder, Ehemänner, Kranke, Alte und Sterbende werden auch andere für das Funktionieren und den Zusammenhalt menschlicher Gesellschaften essenzielle Leistungen von der Standard-Ökonomik ignoriert: Wer hilft Spitzenverdienern, wenn sie einen Unfall erleiden? Wer spendet ihnen Blut? Wer löscht ihr Haus, wenn es brennt? Alles, wofür kein Preis bezahlt wird, existiert in der Standard-Wirtschaftswissenschaft nicht, egal, wie wertvoll es ist.
Umwelt
Der wichtigste und essenzielle Kontext allen menschlichen Wirtschaftens sind der Planet Erde und seine Ökosysteme. Die Trennung von Ökonomie und Ökologie ist einer der gröbsten Sündenfälle der Wirtschaftswissenschaft. Denn alle in Geld messbaren »ökonomischen« Werte stammen letztlich aus der Natur. Wird dies übersehen oder negiert, kann es passieren, dass die unvollständig verstandene »Wirtschaft«, die eigentlich – ganzheitliche – Werte schaffen sollte, die ökologischen Lebensgrundlagen zerstört. Hazel Hendersen formulierte es bereits 1978 prägnant: »Sie erzählen uns von blitzsauberem Geschirr und Tischtüchern, vergessen jedoch den Verlust der blitzsauberen Flüsse und Seen zu erwähnen.«17 Das größte globale Umweltproblem der Gegenwart ist, noch vor dem Klimawandel, der Verlust von Artenvielfalt.18 Ich spazierte vor kurzem in Costa Rica mit dem Rektor der Universität für Internationale Zusammenarbeit durch den Regenwald. Er berichtete von einem Besuch am selben Ort mit seinem Sohn, dem er mitteilen musste, dass die Artenvielfalt doppelt so groß war, als er in seinem Alter war: ein Verlust von fünfzig Prozent in einer Generation! Während die Ökonomen mit ihren Standardmodellen uns vorrechnen, dass wir reicher werden, verarmen wir in den wesentlichsten aller Aspekte von Reichtum: in der biologischen und genetischen Vielfalt. Bei der ersten Postgrowth Conference im EU-Parlament im September 2018 stellte der Ökonom Björn Döhring die Standardmodelle der EU-Kommission, sogenannte Dynamik Stochastic General Equilibrium Models (DSGE Models), vor. Mit ihrer Hilfe analysiert die Kommission die Wirtschaft und spricht Empfehlungen für die Politik aus. Ich fragte ihn, welche Rolle die Artenvielfalt in diesen Modellen spiele. Seine Antwort: »Ob es sinnvoll wäre, die Artenvielfalt in DSGE-Modelle zu integrieren? Das würde ich sehr bezweifeln. Der Punkt ist, dass es kein Modell gibt, das man für alles verwenden kann.«19
Ethik
Auch kein Kontext, sondern ein weiteres Fundament des Wirtschaftens, sind die Grundwerte jeder Gesellschaft und Kultur. Wirtschaften basiert immer und überall auf Werten, der Versuch, die Zahlen von den Werten zu trennen, führt zur totalitären Herrschaft der Zahlen. Die behauptete Wertfreiheit ist eine grundlegende Illusion. Alles Denken, Schreiben, Rechnen und Handeln beruht auf Wertentscheidungen, von daher ist der Versuch, Wirtschaft und Ethik zu trennen, vielleicht das Absurdeste, was je in der Wissenschaftsgeschichte unternommen wurde. Das neoklassische Standardmodell strotzt vor Werten: Effizienz, Wachstum, Wettbewerb, Nutzenmaximierung, Rationalität: alles Werte! Gipfel der Wertunfreiheit der neoklassischen Ökonomik ist der Homo oeconomicus – ein mechanischer, gefühlloser, gieriger Psychopath. Da es keine wertfreie Theorie gibt, baut eine weise Wirtschaftswissenschaft ihre Ideen und Modelle auf den breit geteilten Beziehungs- und Verfassungswerten auf. Viele Ökonomik-Kurse verweisen jedoch bei ethischen Fragestellungen auf das Philosophie-Studium!
Demokratische Institutionen
Das juristische »Skelett« von Märkten sind Institutionen. Als zentrale Gestaltungs- und Steuerungselemente sind sie für die sozialen, kulturellen und ökologischen Wirkungen von Märkten verantwortlich. Dabei geht es um so unterschiedliche Einrichtungen wie Handelsregister, Grundbuch, Finanzamt, Umweltbehörden, Emissionszertifikate-Ausgabestelle, Arbeitsinspektorat, Finanzaufsicht, Zentralbank, Staatsanwaltschaften oder Gerichtshöfe (eines Tages für die Menschenrechte). Von diesen Institutionen hängt ab, wer wie wo wirtschaften darf, wie weitreichend oder eingeschränkt die Wirtschaftsfreiheiten sind, ob z. B. Umweltschäden externalisiert werden können, ob der Zugriff auf Kinderarbeit geahndet wird, ob Unternehmen unendlich groß und mächtig werden dürfen, ob sie nur eine Finanz- oder auch eine Gemeinwohl-Bilanz erstellen müssen, wie frei sie handeln dürfen. All diese Aspekte der Marktwirtschaft werden über demokratische Institutionen reguliert und gesteuert. In den ökonomischen Standardmodellen kommen sie jedoch nicht vor.
Geld und Finanzsystem
So unglaublich es klingen mag, auch Geld und das Finanzsystem kamen die längste Zeit in den ökonomischen Standardmodellen nicht vor. »Wir haben sehr ausdifferenzierte makroökonomische Modelle«, meint das damalige Mitglied des Sachverständigenrates Peter Bofinger, »sie haben nur einen Nachteil: Es gibt keinen Finanzsektor. Das finde ich bemerkenswert, insbesondere in der Europäischen Zentralbank: Auch deren sehr kompliziertes Modell kennt keinen Finanzsektor. Man nimmt an: Jeder Mensch hat alle Informationen, die er braucht, es gibt keine Unsicherheit. Dann ist Geld irrelevant, und den Finanzsektor kann man wegignorieren, weil er perfekt rational arbeitet.«20 Selbst Geld spielte in den ökonomischen Modellen keine Rolle. »Es scheint, Geld ist für Ökonomen ungefähr so, wie das Wasser für Fische – es ist einfach da.«21 In den meisten klassischen Lehrbüchern wird bis heute zudem der Vorgang der Geldschöpfung nicht richtig erklärt.
Macht
Dazu passend blendet die Neoklassik die Machtverhältnisse und -gefälle aus. In den Standardmodellen wird nicht zwischen der Alleinerzieherin und BlackRock unterschieden, nicht zwischen Bayer und Biobauer. Alle natürlichen (Menschen) und juristischen Personen (Unternehmen) sind gleich mächtig und gehen sämtliche Transaktionen vollkommen freiwillig ein. Weder gibt es unterschiedliche Grade von Freiwilligkeit noch Abhängigkeiten, die zu Positionen der Stärke und Schwäche und deren Ausnutzung führen. In der realen Marktwirtschaft sind jedoch Machtgefälle in Kredit-, Kauf-, Miet-, Zuliefer- oder Arbeitsverträgen die Regel. Und hier bräuchte es einerseits eine andere Ethik als die der Nutzenmaximierung und andererseits andere Regeln und Institutionen, die das skrupellose Zuschlagen des Homo oeconomicus raptus verhindern. Da die Standard-Wirtschaftswissenschaft glaubt, dass auf den Märkten alles mit freien Dingen zugehe, kommt es in der Realität zu exzessiver Reichtums- und Machtkonzentration. Doch wenn acht Menschen heute so viel besitzen wie die halbe Menschheit, liegt das nicht daran, dass sie gleich viel leisten wie vier Milliarden andere, sondern, dass sie von einer langen Kette an Machtgefällen profitieren, die sie unverdient in diese Position gebracht haben. Ökonomische Standard-Lehrbücher präsentieren Märkte dessen ungeachtet »in Bezug auf die Verteilung neutral«.22
Wirtschaftswissenschaft ohne die Kernthemen Natur, Werte, Macht, Gender oder demokratische Institutionen – ergibt schlicht keinen Sinn, ist sinnlos! Die Wirtschaftswissenschaft muss sich öffnen und rückbetten in größere Zusammenhänge. Sonst verkommt sie zu einer abgehobenen Gedankenspielerei mit fatalen Rückwirkungen auf die vergessene Realität.
2. Mathematisierung
Wir haben zu viel Weisheit gegen Exaktheit getauscht, zu viel Menschlichkeit gegen Mathematisierung.
TOMÁŠ SEDLÁČEK23
NEUFAUST
Habe nun, ach o weh, fünf Jahre lang
Mathematik, Statistik und Wirtschaft studiert
habe dabei Herz und Seele riskiert
habe selbst meinen Geist brüskiert
bin zwar in Ziffern und Zahlen belesen
doch fremd blieb mir der Materie Wesen
Das hat zu dem knappen Ergebnis geführt:
ich bin als Spezialist arriviert
bin also nach strengster Regel Gebot
ein ausgebildeter Fachidiot.24
Die vielleicht markanteste Kritik am Mainstream der – neoklassischen – Wirtschaftswissenschaft ist die intensive Anwendung von Mathematik. Die Lehrbücher sind voll von Gleichungen und Diagrammen.25 In vielen Trainingsbüchern wird nur noch gerechnet und gezeichnet.26 Das »Herz« der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft ist ein Formelfriedhof. Die Postautistischen Ökonom*innen kritisieren, dass die Mathematik vom »Instrument« zum »Selbstzweck« geworden sei.27 Studierende meinen ironisch: »Wir lernen mit Buchstaben rechnen.«28 Eine Studie der American Association of Economics kam zum Ergebnis, dass die Mathematisierung »absurd übers Ziel geschossen« sei.29
Führende Lehrbuch-Autoren verteidigen hingegen den mathematischen Schwerpunkt. Hal Varian klagt in seinem Buch Grundzüge der Mikroökonomik, Studierende »sollten die Differenzialrechnung beherrschen, aber sie können sie nicht«.30 Mit Mathematik seien Gedankengänge »viel einfacher darstellbar, und alle Studenten der Volkwirtschaft sollten das erkennen«. Mehr noch: »Alle Studierenden der Volkswirtschaftslehre sollten fähig sein, eine ökonomische Geschichte in eine Gleichung oder in ein Zahlenbeispiel zu übersetzen; allzu oft wird jedoch die Entwicklung dieser Fähigkeiten vernachlässigt.«31 David Colander und Arjo Klamer befragten höhere Ökonomie-Studierende, ob sie glaubten, dass Kenntnisse der realen Ökonomie wichtig für akademischen Erfolg in Wirtschaftswissenschaft seien. 3,4 Prozent glaubten das. Hingegen glaubten sechzig Prozent, dass Mathematik und Theorie wichtig seien.32
In Deutschland rangierten bei der Ökonom*innen-Umfrage 2015 »mathematisch-analytische Fähigkeiten« bei der Bewertung, was eine gute Ökonom*in ausmacht, vor »breites Wissen der wissenschaftlichen Literatur«, »Kenntnisse der aktuellen Wirtschaftslage« oder »Vermittlung der Erkenntnisse in der Öffentlichkeit«.33 Warum und woher dieser Stellenwert der abstrakten Mathematik?
Historische Erklärung
Die wichtigste Antwort ist: Mathematik gilt als exakte Wissenschaft, und wenn etwas mathematisch ausgedrückt wird, erhält es allein deshalb schon den Anschein, wissenschaftlich zu sein. Der ehemalige St. Gallener VWL-Professor Gebhard Kirchgässner erklärte: »Wenn Sie etwas wirklich exakt erfassen wollen, brauchen Sie eine exakte Sprache, und die Mathematik ist eine exakte Sprache, und diese exakte Sprache erlaubt Ihnen, aus Ihren Annahmen Konsequenzen abzuleiten, die Sie sonst nicht gesehen hätten.«34 Claus Peter Ortlieb bestätigt: »Die bloße Verwendung von Mathematik wird als ein Garant für Wissenschaftlichkeit und ›Ideologiefreiheit‹ genommen.«35 Thomas Dürmeier schreibt: »Mit der Entstehung des modernen Denkens in der Aufklärung lösten Mathematik und Physik Theologie und Philosophie als zentrale Wissenschaften ab. Mathematisches und mechanisches Denken wurde zum wissenschaftlichen Ideal.«36 Das war nicht immer so: Die Klassiker kamen noch mit wenig oder gar keiner Mathematik aus – was ihrem Ruhm nicht im Weg steht, man bedenke nur die »Nachhaltigkeit« von Smith, Ricardo, Mill oder Marx.
Den ersten Mathematisierungsschub leitete Léon Walras (1834 – 1910) ein. Ziel des Begründers der Neoklassik und der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie war es, die Politische Ökonomie (so hieß die Wirtschaftswissenschaft damals noch) nach dem Vorbild der reinen Naturwissenschaft und Mathematik umzugestalten. »Reine Mechanik muss sicherlich der angewandten Mechanik vorausgehen. Ähnlich muss die reine ökonomische Theorie der angewandten Wirtschaftswissenschaft vorangehen; und diese reine ökonomische Theorie ist eine Wissenschaft, die den physico-mathematischen Wissenschaften in jedem Aspekt ähnlich ist.«37 Dass der gewählte mathematische Zugang neu war, ist an Walras’ Zeitgenossen Alfred Marshall abzulesen, der den ersten Wirtschaftsstudiengang 1903 an der Universität Cambridge einrichtete und dessen Lehrbuch lange Zeit in England führend war. In diesem verbannte er mathematische Gleichungen konsequent in Fußnoten und Anhänge.38 Über ihn wird geschrieben: »Würde er heute an der Universität Cambridge oder an irgendeiner führenden ökonomischen Fakultät auf der Welt eine Stelle bekommen? Wahrscheinlich nicht, denn seine Werke weisen zum einen sehr wenig Mathematik auf, zum anderen hielt er Mathematik für nichts anderes als ein Zusatzwerkzeug.«39
Walras könnte auch daran gelegen haben, seinen Vater zu rächen: »Der alte Walras betrachtete sein Fach als eine mathematische Wissenschaft – und galt deshalb als Spinner (…) Ökonomie galt als Geisteswissenschaft, sie war nichts für Erbsenzähler wie Walras. Man habe seinen Vater totgeschwiegen, schrieb Léon Walras später bitter, er wolle dafür sorgen, daß ›die Ignoranten so unmöglich und lächerlich dastehen wie jene, die Kopernikus verfolgten und Galilei quälten‹.«40
Capra vermutet einen anderen Grund: »Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich die klassische Nationalökonomie in zwei breite Strömungen gespalten. Auf der einen Seite standen die Reformer: die Utopisten, Marxisten und die Minderheit klassischer Wirtschaftswissenschaftler, die John Stuart Mill folgten. Auf der anderen Seite befanden sich die neoklassischen Wirtschaftswissenschaftler, die sich auf den wirtschaftlichen Kernprozess konzentrierten und dabei die Schule der mathematischen Wirtschaftswissenschaft entwickelten. Einige von ihnen versuchten, objektive Formeln für die Maximierung der Wohlfahrt zu entwickeln, andere flüchteten sich in immer abstrusere Mathematik, um der vernichtenden Kritik der Utopisten und Marxisten zu entgehen.«41 Ein Richtungsstreit tobte: Walras’ Zeitgenosse Stanley Jevons meinte über die Politische Ökonomie: »Wenn sie überhaupt eine Wissenschaft ist, muss sie eine mathematische sein, weil sie mit Quantitäten von Waren handelt.« Der Italiener Vilfredo Pareto war der Ansicht, dass sich die ökonomische Theorie durch den intensiven Gebrauch mathematischer Formeln »die Strenge rationaler Mechanik aneignen könne«.42 Auf dieser Basis entwickelten die Neoklassiker die Allgemeine Gleichgewichtstheorie, die bis heute den theoretischen Kern der Mainstream-Ökonomik ausmacht.
Einen zweiten Schub an Mathematisierung datiert Deirdre McCloskey auf 1947: »Es begann mit der Harvard-Dissertation von Paul Samuelson ›The Foundations of Economic Analysis‹ – dieser Text wurde in Lehrbücher übersetzt und hat viele andere, weniger mathematische Strömungen, ersetzt.«43 Seither spinnt sich der Faden der Mathematisierung immer weiter fort. Marion Fourcade et al. schreiben: »Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Anspannen der mathematischen und statistischen Muskeln und die Zuspitzung des Arguments auf einen formalen und knappen Satz von Gleichungen der Königsweg zu wissenschaftlicher Reinheit in der Ökonomik.«44 Der Londoner Management-Professor Geoffrey Hodgson schreibt: »In der Tat wird Formalisierung zum Selbstläufer. Sie erzeugt einen Teufelskreis gegenseitiger positiver Verstärkungsprozesse, nach dem nur das zählt, was in mathematischer Form ausgedrückt werden kann.«45 Eine dritte »positive Rückkoppelung« erfuhren die mathematischen und ökonometrischen Rechner durch die Einrichtung eines Schein-Nobelpreises für die Ökonomik, dessen Ziel es war, den Neoklassikern unter den Ökonomen Rückenwind zu liefern, was in Kapitel III.1 genauer behandelt wird.46 Reichsbankpreisträger (RPT) Paul Samuelson referenzierte in seiner Preisrede dreimal auf den Erfinder der Differenzialgleichung Sir Isaac Newton, während er Adam Smith und John Maynard Keynes nur je einmal würdigte.47
Prinzipielle Kritik
Das erkenntnistheoretische Ideal der Mathematik ist die Objektivität. Mankiw schreibt: »Volkswirte bemühen sich, ihr Gebiet mit wissenschaftlicher Objektivität zu behandeln. Sie betreiben die Erforschung der Ökonomie auf eine ähnliche Weise, wie ein Physiker die Materie und ein Biologe das Leben untersucht: Sie entwerfen Theorien, sammeln Daten und versuchen dann aufgrund der Daten, ihre Theorie zu bestätigen oder zu verwerfen.«48 Am Anfang ist also die Theorie. Wissenschaftstheoretiker*innen zufolge geht es in der wissenschaftlichen Objektivität nicht darum, die Dinge zu sehen, wie sie (wirklich) sind, sondern um ein Erkennen logischer Zusammenhänge jenseits von subjektiver Wahrnehmung und Erfahrung.49 Diese Definition ist wichtig, weil wissenschaftliche Objektivität in einem grundlegenden Gegensatz zu Empirie und Realität steht. Das mag bei vielen auf Unverständnis stoßen, doch wie Silja Graupe schön herausgearbeitet hat, ist »im Erkennen eine größtmögliche Distanz zu jeglicher Form der menschlichen Erfahrung aufzubauen« ausdrückliches Ziel objektiver Wissenschaft und somit eine »epistemische Tugend«.50 Die vielkritisierte Realitätsferne der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft – Befreiung von aller Subjektivität – hat Methode, Weltentrücktheit ist vorsätzliches Programm! Graupe schreibt weiter: »Die Theorie schafft bewusst kein Abbild der Realität, sondern sucht ein neues, eigenes Reich des Denkens zu begründen, in dem sich der logische Verstand frei von jedem Bezug zur Realität neue Welten schaffen und in diesen bewegen soll.« Es geht Carl Boyer zufolge »weder um approximative noch absolute Wahrheit, sondern rein hypothetische Wahrheit«.51 Empirie ist unerwünscht, weil die Erfahrung immer subjektiv ist. Walras selbst führt es so aus: »Auf Basis dieser [objektiven] Definitionen bauen Ökonomen a priori den gesamten Rahmen ihrer Theoreme und Beweise. Danach gehen sie zurück zur Erfahrung, nicht um ihre Schlussfolgerungen zu erhärten, sondern um sie anzuwenden.«52
Dieses Wissenschafts- und Erkenntnisideal hat zwei Haken: Zum einen hat die moderne Kognitionsforschung herausgefunden, dass die Entkoppelung von abstraktem Denken (»reiner Theorie-Bildung«) und menschlicher Erfahrung nicht möglich ist – weil menschliches Denken nicht so funktioniert (was die neoklassischen Ökonomen infolge ihrer geringen Beschäftigung mit Erkenntnistheorie nicht wissen oder ignorieren). Zwar können Buchstaben und Zahlen in einer in sich logischen Form aufeinander bezogen werden, aber damit haben sie mit der Realität erst einmal noch gar nichts zu tun (weshalb eine so verstandene und betriebene Wissenschaft keinerlei praktischen Nutzen für das Verständnis realer Märkte oder für die Wirtschaftspolitik hätte). In dem Augenblick aber, in dem sie mit ökonomischen Begriffen wie »Markt«, »Nachfrage« oder »Transaktion« in Beziehung gebracht werden, setzen, gemäß den Erkenntnissen der zeitgenössischen Kognitionsforschung, Assoziationen zu (unbewusster) subjektiver Erfahrung ein, weil der Verstand sonst solche Begriffe gar nicht kognitiv verarbeiten könnte, er muss sie mit Erfahrungen assoziieren. Das bedeutet, dass in dem Moment, in dem ökonomische Begriffe ins Spiel kommen, diese automatisch – unwillkürlich oder unbewusst – mit subjektiver Erfahrung verknüpft werden, was das Ende wissenschaftlicher Objektivität in der Ökonomik ist. Entweder objektiv (und realitätsfrei!) oder realtiätsbezogen (dann nicht mehr objektiv): ein epistemisches Dilemma, aus dem es kein Entrinnen gibt. Solcherart Reflexionen werden in wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern nicht angestellt, die »Denkweise« wird zwar angesprochen, aber dann nicht genauer ausgeführt. Die Behandlung oder Auflösung des Dilemmas wäre die Voraussetzung, dass die Wirtschaftswissenschaft auf einer sauberen epistemischen Grundlage betrieben werden kann.
Damit ist auch schon der zweite Haken freigelegt: Die gewählte Methode der Mathematik ist nicht wissenschaftlicher als eine lyrisch-elegant formulierte prosaische Zeile, in der die Persönlichkeit der Autor*in neben dem Argument unverkennbar zum Ausdruck kommt. Beide sind gleich spekulativ – oder »hypothetisch«. Mathematische Gleichungen und Modelle über die Wirtschaft sind scheinobjektiv, weil sie erst Sinn ergeben, wenn sie mit ökonomischen Begriffen gekoppelt werden, welche die Brücke zur Realität herstellen. Ökonomische Begriffe können aber genauso gut in prosaischen Texten als Brücke zur – subjektiv erlebten – Realität fungieren. Der allgemeinverständliche Satz »Mindestlöhne erhöhen die Arbeitslosigkeit« kann genauso gut verbal ausgeschrieben werden, wie sein Inhalt in eine komplexe Gleichung eingebaut werden kann. Beide Formen sind gleich irrtumsanfällig (hypothetisch) und somit gleich (un)wissenschaftlich. Wenn Mindestlöhne in einem Land und einer bestimmten Höhe die Arbeitslosigkeit erhöhen, in einem zweiten Land die Arbeitslosigkeit senken und in einem dritten Land keine Auswirkung auf die Beschäftigung haben, sind beide Formen – Text und Gleichung – von der Realität äquidistant. Der Unterschied ist, dass Mathematik im Mainstream der Scientific Community seriöser wirkt als ein geschriebener Text.
Schein und Entschwinden
Anders gesprochen: Der Kaiser unter dem mathematischen Umhang, pardon: der Ökonom unter dem mathematischen Talar, ist nackt. Auch in der hohen Wissenschaft kann mit Schein gearbeitet werden. Sogar recht effizient, weil grundsätzlich alles mathematisch »darstellbar« ist, man muss nur Phänomenen oder Werten einen Buchstaben zuordnen und diesen in komplexe Gleichungen integrieren und einen logischen Zusammenhang zwischen dem »Buchstabierten« herstellen. Das muss noch lange nicht für andere intersubjektiv nachvollziehbar sein. Nicht nur, weil es prinzipiell keine objektiven Aussagen über das reale Wirtschaftsgeschehen gibt. Sondern, weil es hochspekulativ ist, komplexe soziale Sachverhalte auf Buchstabenketten zu verkürzen, und es ist optimistisch zu erwarten, dass andere diesen Gedankengängen folgen. So gesehen gibt es keine Objektivität, sondern nur einen Objektivitätsanspruch der Buchstabenverketter oder, im schlechteren Fall, den Missbrauch des Objektivitätsscheins, um die eigene Weltanschauung als wissenschaftlich darzustellen und andere Meinungen als unwissenschaftlich abzutun.
Der Wechsel in eine von nur wenigen verstandene und nachvollziehbare »Fremdsprache« schottet ab und verhindert Diskurs, Kritik und gesellschaftliche Kontrolle: »Der mathematische Apparat wirkt einschüchternd, verhindert grundsätzliche Fragestellungen und suggeriert eine feste wissenschaftliche Basis«, schreibt Walter Ötsch.53 Wie kann sich eine Sozialwissenschaft der öffentlichen Kontrolle stellen, wenn sie sich nicht verständlich ausdrückt? Auch innerhalb von mathematisch versierten Ökonom*innen gibt es eine steile Hierarchie zwischen den fortgeschrittenen und den dieser Sprache weniger mächtigen. Ulrich van Suntum schreibt: »Selbst studierte Ökonomen sind heute oft nicht mehr in der Lage, die hochmathematischen Abhandlungen in den einschlägigen Fachzeitschriften nachzuvollziehen.«54 Das wäre anders, wenn ihr Inhalt, in verständlicherer Sprache dargelegt, von anderen nachvollzogen und kritisch reflektiert werden könnte. Schließlich liegt es nicht nur am Intelligenzquotienten, dass viele kluge Menschen dieser Sprache nicht folgen können, es liegt am intuitiven oder prinzipiellen Widerwillen, so eine – reduktionistische, irreale, formale – Denkweise anzunehmen, sie halten die vermeintliche epistemische Tugend für eine methodische Verirrung. Letztlich ist die mathematische Formalisierung der ökonomischen Theorie eine mechanistische Denke, die auf ein nichtmechanisches Erkenntnisfeld angewandt wird und die genau zu dem Zeitpunkt Einzug in die Ökonomik hält, nämlich im Lauf des 20. Jahrhunderts, wo sie aus allen anderen Wissenschaften – voran der »Königswissenshaft« Physik – schon wieder ausgezogen ist. Das objektive Erkenntnisideal der Neoklassik ist heute obsolet.
Methodische Kritik
Der »wahre Wert« der Mathematik für die ökonomische Wissenschaft wird breit angezweifelt. Ein siebenköpfiges Autorenteam rund um den Mainstream-Kritiker David Colander schreibt: »Die Analyse der vernachlässigten Aspekte und Themen würde eine andere Art von Mathematik erfordern als die in üblicher Weise in den prominenten Ökonomie-Modellen verwendete.«55 Der Mathematiker Tony Lawson kritisiert: »Es ist wie der Versuch, den Rasen mit einem Hammer zu mähen oder mit einem Blatt Papier. Beide Instrumente haben ihren Zweck, aber es ist nicht Rasenmähen. Die Methoden der angewandten Mathematik haben ihren berechtigten Gebrauch, aber soziale Realitäten zu erhellen zählt nicht dazu, oder allenfalls nur unter sehr außergewöhnlichen Bedingungen.«56 Anders gesagt: Während der Nutzen von »zwei mal zwei ist vier« objektiv (logisch schlüssig und intersubjektiv auch ohne Erfahrung) nachvollziehbar ist, sind zwischenmenschliche Beziehungen und Märkte als soziale Phänomene nicht in einer solchen objektiven Sprache darstellbar, das wäre eine unangemessene methodische Annäherung an soziale Phänomene. Komlos schreibt: »Menschen sind keine leblosen Objekte, deren Lebenslauf durch eine mathematische Funktion von einigen Variablen genau beschrieben werden kann. Im Gegensatz zu Planeten können sie ihre Richtung und Meinung ändern.«57 Walras selbst meinte: »Mathematik ignoriert Friktionen, die in den Sozialwissenschaften alles sind.« Und: »Menschliche Freiheit lässt sich niemals in Gleichungen gießen.«58 Voilà: Das erkenntnistheoretische Ideal der Objektivität ist in der Wirtschaftswissenschaft fehl am Platz, und deshalb ist auch Mathematik als bevorzugte Methode in dieser Disziplin prinzipiell deplatziert.
Finale
Heute verdrängt die Mathematik die Weisheit vom Platz: »Viele wichtige Erkenntnisse, die früher zum Allgemeingut jedes Volkswirtes gehörten, sind dadurch [durch den Fokus auf Mathematik] sogar in Vergessenheit geraten«, schreibt van Suntum.59 RPT Paul Krugman schreibt in der New York Times: »Die ökonomische Disziplin hat sich verrannt, da Ökonomen im Kollektiv die Schönheit und die Präzision eindrucksvoller Mathematik mit der Wahrheit verwechselt haben.«60 Auch Thomas Straubhaar zeigt sich einsichtig: »Durch die Mathematisierung haben wir aus der Ökonomie immer stärker eine Naturwissenschaft machen wollen und dabei wohl unsere Möglichkeiten überschätzt.«61 McKloskey resümiert: »Statt Ökonom*innen von historischer Größe zu produzieren, produzieren die ökonomischen Ausbildungsstätten wissenschaftliche Analphabeten.«62
Ich halte es mit Bernard Guerrien von der Universität Paris I: »Die Hauptannahmen und -elemente der neoklassischen Theorie (…) sollten mit wenig oder gar ganz ohne Mathematik vermittelt werden. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass es für Studierende wesentlich ist, die ökonomische Bedeutung von mathematisch ausgedrückten Annahmen zu erkennen. Da sie Ökonomik und nicht Mathematik studieren, sollten sie in der Lage sein, Annahmen nach ihrer Relevanz und Bedeutung zu beurteilen. Annahmen sollten deswegen mit klaren sprachlichen Mitteln und nicht in abstrusen Formeln ausgedrückt werden.«63 Ich finde, dass die Texte von Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes oder Friedrich A. von Hayek ebenso wie diejenigen scharfer zeitgenössischer Denker*innen wie Galbraith, Daly oder Sen, die gut ohne Mathematik auskommen, deutlich mehr Weisheit enthalten als endlose Buchstabenketten.
3. Physikneid – die eingebildete Naturwissenschaft
Wenn ich mit einem Ökonomen spreche – und das ist für einen Physiker die Höchststrafe.
HANS JOACHIM SCHELLNHUBER64
Der vielleicht wichtigste Kritikpunkt an der neoklassischen Mainstream-Wirtschaftswissenschaft ist eng mit der Mathematisierung verknüpft: das Selbstverständnis und die Selbstdarstellung als (Quasi-)Naturwissenschaft. Dieses Selbstverständnis findet sich bis heute in den am weitesten verbreiteten Lehrbüchern. Mankiw und Taylor schreiben in der Einleitung zu den Grundzügen der Volkswirtschaftslehre: »Die VWL geht leidenschaftslos wie eine Naturwissenschaft zu Werke. Durch die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden auf politische Fragen sucht die VWL bei den grundlegenden Fragen voranzukommen.«65
Da muss eine Soziolog*in ein zweites Mal hinschauen, ob sie richtig gelesen hat: Weder gibt es nach aktuellem Stand der Wissenschaftstheorie »leidenschaftslose« Menschen, auch Wissenschaftler sind voller Leidenschaft, bewusst oder unbewusst, und diese Leidenschaften verschwinden nicht durch die Anwendung von Mathematik in der Ökonomik. Noch ist die Wirtschafts- eine Naturwissenschaft oder wie eine Naturwissenschaft. Sie ist eine Sozialwissenschaft, das sollte eigentlich unumstritten sein. Wieso also diese bewusste Verwirrung der Studierenden gleich zu Beginn? Wieso stellen führende wirtschaftswissenschaftliche Lehrbücher nicht außer Streit, dass es sich bei der Wirtschafts- um eine Sozialwissenschaft handelt? Und wieso werden nicht sozialwissenschaftliche Methoden im Unterschied zu Methoden der Naturwissenschaft vorgestellt und ihre Angemessenheit und Stärken argumentiert?