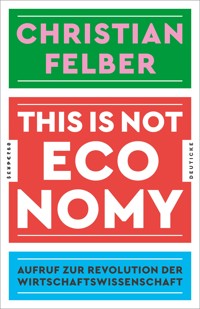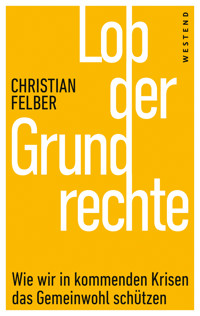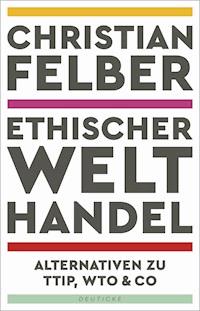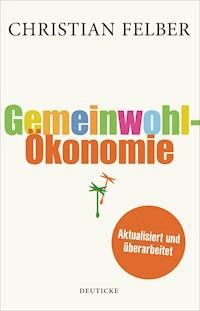
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Gemeinwohl-Ökonomie beruht – wie eine Marktwirtschaft – auf privaten Unternehmen und individueller Initiative, jedoch streben die Betriebe nicht in Konkurrenz zueinander nach Finanzgewinn, sondern sie kooperieren mit dem Ziel des größtmöglichen Gemeinwohls. Nach sieben Jahren sind es bereits 2300 Unternehmen und weitere 200 Organisationen, die das Modell unterstützen, immer mehr Schulen, Universitäten, Gemeinden und Regionen beteiligen sich. Die Bewegung reicht inzwischen von Schweden bis Chile und Ghana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Gemeinwohl-Ökonomie beruht – wie eine Marktwirtschaft – auf privaten Unternehmen und individueller Initiative, jedoch streben die Betriebe nicht in Konkurrenz zueinander nach Finanzgewinn, sondern sie kooperieren mit dem Ziel des größtmöglichen Gemeinwohls. Nach sieben Jahren sind es bereits 2300 Unternehmen und weitere 200 Organisationen, die das Modell unterstützen, immer mehr Schulen, Universitäten, Gemeinden und Regionen beteiligen sich. Die Bewegung reicht inzwischen von Schweden bis Chile und Ghana.
Deuticke E-Book
Christian Felber
Die Gemeinwohl-Ökonomie
Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft
Deuticke
Inhalt
Vorwort
1. Kurzanalyse
2. Die Gemeinwohl-Ökonomie – der Kern
3. Geld als öffentliches Gut
4. Eigentum
5. Motivation und Sinn
6. Weiterentwicklung der Demokratie
7. Beispiele, Verwandte und Vorbilder
8. Umsetzungsstrategie
9. Häufig gestellte Fragen
Anhang 1: Zahlen & Fakten
Anhang 2: Mögliche Fragen an den demokratischen Wirtschaftskonvent
Anmerkungen
Literatur
Dank
Zum Gemeinwohl!
Neuer Trinkspruch
Vorwort
Es gibt immer eine Alternative.
There is always an alternative.
Für Margaret Thatcher und Angela Merkel
Bei der Redaktion dieser Ausgabe ist es ziemlich genau sieben Jahre her, dass die Vorbereitungsgruppe der Gemeinwohl-Ökonomie erstmals an die Öffentlichkeit ging, um auszuloten, ob es eine Resonanz auf die junge Idee geben würde. Sie zündete. Sieben Jahre später sind dreißig Fördervereine von Schweden bis Chile am Start, mehr als 2300 Unternehmen unterstützen die Bewegung offiziell, und immer mehr Gemeinden machen sich auf den Weg zur Umsetzung. Einige Nachrichten dieser Tage: Die Stadt Stuttgart hat vier Kommunalbetriebe gemeinwohlbilanziert und sich damit als »deutschlandweite Vorreiterin« platziert.1 Greenpeace Deutschland stellte seine erste Gemeinwohl-Bilanz vor, als ungefähr 500. Organisation weltweit. Im März 2017 erhielt die Gemeinwohl-Ökonomie den ZEIT-WISSEN-Preis »Mut zur Nachhaltigkeit« in der Kategorie Wissen. Im Juni startete der erste Lehrstuhl Gemeinwohl-Ökonomie an der Universität Valencia. Zuvor hatte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss eine Initiativstellungnahme zur Gemeinwohl-Ökonomie mit 86 Prozent der Stimmen angenommen.2 Kein Wunder: 88 Prozent der Deutschen und neunzig Prozent der ÖsterreicherInnen wünschen sich laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung eine »neue Wirtschaftsordnung«.3 Neun von zehn Menschen sind reif für den Wandel. Sie erkennen mehr und mehr, dass die Finanzkrise, die Klimakrise, die Verteilungskrise, die Sinnkrise, die Demokratiekrise und die Wertekrise Symptome einer »ganzheitlichen« Systemkrise sind. Reformen genügen nun nicht mehr, es braucht eine neue Vision.
Offen ist, wohin die Reise gehen soll: in Richtung Solidarische Ökonomie mit nur noch Genossenschaften? In Richtung Commons oder Allmenden, den Gemeinschaftsgütern, die ganz ohne Marktlogik auskommen? In Richtung Postwachstumsökonomie, die, radikaler als die ökosoziale Marktwirtschaft, Schrumpfungsziele vorgibt? Oder in Richtung Wirtschaftsdemokratie, um die Superkonzentration von Eigentum und Macht, den »Superkapitalismus« und die »Supergrundrechte« für juristische Personen – vulgo Großkonzerne – zu stoppen?
Die Gemeinwohl-Ökonomie sagt: Es braucht von all diesen Ansätzen mehr als heute: Die Wirtschaft muss menschlicher, sozialer, verteilungsgerechter, nachhaltiger, demokratischer – rundum ethischer werden: gemeinwohlorientierter. Einige der Erstreaktionen waren: »Gemeinwohl-Ökonomie, das ist doch ein Widerspruch in sich!« Heute sehen wir das anders. Im Lauf der sieben Jahre sind viele weitere Quellen aufgetaucht, die das GWÖ-Modell zu einem kohärenten Mosaik zusammengefügt haben: Die Überzeugung, dass die Wirtschaft nur ein Mittel ist, das höheren Werten verpflichtet ist, hat es praktisch immer gegeben, zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Die merkwürdige Tatsache, dass die Wirtschaft heute ganz anders funktioniert und auch anders gelehrt wird, deutet auf ein weiteres Kernproblem hin: die akademische Wirtschaftswissenschaft oder »economics«. Sie hat sich mathematisiert und verirrt, auf einen trügerischen Fluchtpunkt hin: finanzielle Kennzahlen und Geldwerte. Doch Geld ist nur das Mittel, das dem Gemeinwohl dienen soll, so wie Unternehmen, Investitionen, Kredite und die ganze Wirtschaft. Die »ökonomische Wissenschaft« hat es zuwege gebracht, Ziel und Mittel zu verwechseln. Und sich dabei in eine nichtökonomische Wissenschaft zu »pervertieren«. Das sind die Worte von Aristoteles. Er hat messerscharf zwischen zwei Formen, Wirtschaft zu denken und zu praktizieren, unterschieden: Während die »oikonomia« das gute Leben für alle zum Ziel hat (in einem menschlichen oder volkswirtschaftlichen Haushalt) und das Geld dabei ausdrücklich nur als Mittel verwendet, bezeichnet er eine Wirtschaftsform, in der Gelderwerb und Geldvermehrung zum Selbstzweck werden, als »chrematistike« und kritisiert sie als »widernatürlich«.4 Die Wirtschaftswissenschaft hat sich, in dem Maße, in dem sie sich für Renditen, Profite und das BIP interessiert und »Effizienz« mit einer effizienteren Kapitalverwertung oder -vermehrung gleichsetzt, in eine Chrematistik verwandelt – und ist gar keine Ökonomie mehr. Zumindest nicht im Sinne von Aristoteles.
»Oikonomia« könnte trefflich mit Gemeinwohl-Ökonomie übersetzt werden, das Gemeinwohl ist inhärent im Begriff enthalten; die vielfältigen Versuche, die Attribute »sozial«, »ökologisch«, »nachhaltig«, »human«, »fair«, »gerecht«, »demokratisch« oder »ethisch« zu ergänzen, sind nur Zeugnis davon, dass es den Chrematisten gelungen ist, den Begriff »Ökonomie« seines ursprünglichen Sinns zu berauben und mit »widernatürlichen« Inhalten anzufüllen.
Zum Glück sind einigen ÖkonomInnen diese Unterscheidungen und Pervertierungen bekannt, und sie haben sich starkgemacht für eine »Gleichgewichtsökonomie« (Herman Daly), »Ökologische Ökonomie« (Joan Martínez-Alier), »Postwachstumsökonomik« (Niko Paech), »doughnut economics« (Kate Raworth), Gemeingüter-Ökonomie (Elinor Ostrom), Geschenk-Ökonomie (Genevieve Vaughan) oder Care-Ökonomie (Mascha Madörin). Aus studentischen Kreisen sind zunächst in Frankreich die »postautistische Ökonomie« entstanden und später weltweit die Gesellschaft für plurale Ökonomik. Das sind viele Lichtschimmer am Horizont, doch der Mainstream ist immer noch fest im Griff der Chrematisten.
Bezeichnend für den Irrweg der Wissenschaft ist der »Wirtschaftsnobelpreis« – den es gar nicht gibt. Alfred Nobel hatte den von ihm gestifteten Preis ausdrücklich für naturwissenschaftliche Disziplinen ausgelobt – und sich ebenso klar gegen einen Preis für »economics«, einer Sozialwissenschaft, ausgesprochen. Der Anerkennungspreis der schwedischen Reichsbank kam erst 1968 hinzu, gegen den Willen der Erben von Alfred Nobel, es handelt sich um eine Mischung aus Usurpation und Etikettenschwindel – um einen doppelten: Neun von zehn ausgezeichneten WissenschaftlerInnen sind viel eher der Kaste der Chrematisten zuzurechnen als jener der Ökonomie: weder Nobelpreis noch Ökonomie also. Hinter diesem »genialen PR-Coup« (Ulrike Herrmann5) verstecken sich mächtige Ideologien und ein Ringen um die gesellschaftlichen Machtverhältnisse.
Die Gemeinwohl-Ökonomie möchte eine neue Wirtschaftstheorie begründen, sie will die Praxis des Wirtschaftens ändern, und sie möchte den passenden Rechtsrahmen schaffen, damit ethische und umfassend verantwortungsvolle Wirtschaftsakteure und -tätigkeiten nachhaltig reüssieren können.
Als ganzheitliche Alternative ist die GWÖ a) ein konsistenter Theorieansatz: ein in sich schlüssiges Modell, b) ein breiter Beteiligungsprozess, der allen kreativen und kooperativen Reformwilligen offensteht, und c) ein demokratischer Umsetzungsvorschlag. Dafür hat die GWÖ ein Demokratie-Verständnis entwickelt, das den Menschen mehr zutraut, als alle vier oder fünf Jahre ein Kreuzlein für eine Partei abzugeben. Die Idee einer »Souveränen Demokratie« ist die Zwillingsschwester der Gemeinwohl-Ökonomie. Sie könnte zu ihrer entscheidenden Geburtshelferin werden, nachdem viele tausend Menschen, Unternehmen, Gemeinden und wissenschaftliche Einrichtungen den Boden aufbereitet haben für einen tiefreichenden und wertgeleiteten Wandel in Wirtschaft und Politik.
Seit Erscheinen der Erstausgabe im August 2010 ist »Die Gemeinwohl-Ökonomie« in insgesamt zwölf Sprachen erschienen, darunter Französisch, Spanisch, Englisch, Polnisch und Finnisch. Die Umsetzungsbewegung erstreckt sich von Skandinavien nach Südamerika. Mehrere tausend Menschen sind weltweit aktiv geworden – in Regionalgruppen, Arbeitskreisen und Fördervereinen. Und es scheint erst der Anfang zu sein. Das Modell ist äußerst lebendig, es wird sowohl in der Praxis weiterentwickelt als auch durch geistige Befruchtung aus allen Richtungen. Die Bewegung, welche die Idee »kokreativ« weiterentwickelt, ist so vielgesichtig und facettenreich, wie eine soziale Bewegung nur sein kann.
Beim historischen »Zoomen«, ob die Ausbreitung der Gemeinwohl-Ökonomie mit anderen Ideen oder Initiativen vergleichbar ist, kam die Erinnerung an die Raiffeisen-Idee. In Zeiten des Hungers unter den Bauern entstand der erste Brotverein im Westerwald. Daraus wurde zunächst ein landesweites Netz aus Hilfsvereinen, dann folgten die Darlehenskassen. Heute gibt es genossenschaftliche Raiffeisen-Banken in 180 Staaten der Erde.
Die GWÖ entsteht nicht in einer Zeit des Brothungers, aber des Sinnhungers. Manche sprechen bereits von einer sich auswachsenden Sinnhungerepidemie. Täglich steigen Erfolgsmenschen aus Top-Positionen des »alten Systems« aus, weil sie keinen Sinn und sich nicht als Menschen erfahren. Die GWÖ bietet Sinn, Menschlichkeit und echte Nutzwerte an. Wie es in einer richtigen »oikonomia« sein soll! Machen auch Sie mit! Werden Sie Teil der Veränderung, die Sie in der Welt sehen wollen!
1. Kurzanalyse
»Zu kooperieren, anderen zu helfen und Gerechtigkeit walten zu lassen ist eine global anzutreffende, biologisch verankerte menschliche Grundmotivation. Dieses Muster zeigt sich über alle Kulturen hinweg.«6
Joachim Bauer
Menschliche Werte – Werte der Wirtschaft
Merkwürdig: Obwohl Werte die Grundorientierung, die »Leitsterne« unseres Lebens sein sollten, gelten heute in der Wirtschaft ganz andere Werte als in unseren alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. In unseren Freundschafts- und Alltagsbeziehungen geht es uns gut, wenn wir menschliche Werte leben: Vertrauensbildung, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Respekt, Zuhören, Empathie, Kooperation, gegenseitige Hilfe und Teilen. Die »freie« Marktwirtschaft beruht auf den Systemspielregeln Gewinnstreben und Konkurrenz. Diese Anreizkoordinaten befördern Egoismus, Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Dieser Widerspruch ist nicht nur ein Schönheitsfehler in einer komplexen oder multivalenten Welt, sondern ein kultureller Keil; er spaltet uns im Innersten – sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft.
Werte sind Leitsterne
Der Widerspruch ist deshalb fatal, weil Werte das Fundament des Zusammenlebens sind. Nach ihnen setzen wir uns Lebensziele, an ihnen orientieren wir unser Handeln und verleihen diesem Sinn. Die Werte sind wie ein Leitstern, der unserem Lebensweg eine Richtung vorgibt. Aber wenn unser Leitstern des Alltags in eine ethische Richtung weist – Vertrauensbildung, Kooperation, Teilen – und plötzlich in einem Teilbereich des Lebens, der Marktwirtschaft, ein zweiter »Leitstern« in die exakt entgegengesetzte Richtung – Egoismus, Konkurrenz, Gier – zeigt, dann bricht in uns ein heilloser Widerspruch auf: Sollen wir uns solidarisch und kooperativ verhalten, einander helfen und stets auf das Wohl aller achten? Oder zuerst den eigenen Vorteil im Auge haben und die anderen als RivalInnen und KonkurrentInnen kurzhalten? Das Abgründige des Zwiespalts ist: Der Gesetzgeber bevorzugt den falschen Leitstern. Er setzt ihn in Recht – und fördert damit Werte, unter denen wir alle leiden. Das ist nicht unbedingt sofort ersichtlich, weil in keinem Gesetz steht: Du sollst egoistisch, gierig, geizig, rücksichts- und verantwortungslos sein. Aber im Gesetz steht, dass wir in der Wirtschaft nach Finanzgewinn streben und einander konkurrenzieren sollen. Das steht in zahlreichen Gesetzen, Regulierungen und Abkommen der Nationalstaaten, der EU und der Welthandelsorganisation WTO. Die Folge ist das epidemische Auftreten asozialer Verhaltensweisen in der Wirtschaft. Nicht weil der Mensch von Natur aus schlecht ist, sondern weil die Spielregeln unsere Schwächen fördern anstatt unsere Tugenden.
Aus Egoismen wird Gemeinwohl
Der »Imperativ«, dass wir in der Wirtschaft einander konkurrenzieren und nach größtmöglichem persönlichen Finanzgewinn streben (= uns egoistisch verhalten) sollen, rührt aus der – eigentlich zutiefst paradoxen – Hoffnung, dass sich das Wohl aller aus dem egoistischen Verhalten der Einzelnen ergäbe. Diese Ideologie wurde vor 250 Jahren in der Bienenfabel von Bernard Mandeville begründet, die den bezeichnenden Untertitel »Private Laster, öffentliche Vorteile« trägt.7 Auch bei Adam Smith, dem ersten großen Nationalökonomen, finden wir diese Hoffnung: »Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Bäckers, Brauers erwarten wir unsere tägliche Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.«8
Es geht mir nicht um die Anklage von Smith, der auch ein Hohelied auf das Mitgefühl (»sympathy«) gesungen und ein dickes Buch über »ethische Gefühle« verfasst hat.9 Zum damaligen Zeitpunkt ist ein solcher Satz verständlich: Das Verfolgen des Eigeninteresses der »Individuen« war neu, die »Unternehmen« überwiegend winzig und machtlos, außerdem lokal eingebunden und persönlich verantwortlich: Unternehmensgründer, Eigentümer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer bildeten in vielen Fällen noch eine Personalunion. Es gab keine anonymen, globalen Aktiengesellschaften, keinen freien Kapitalverkehr und keine milliardenschweren Investmentfonds.
Adam Smith hoffte, dass eine »unsichtbare Hand« die Egoismen der Einzelakteure zum größtmöglichen Wohl aller lenken würde. Aus metaphysischer Sicht – Smith war Moralphilosoph – mag er die Hand Gottes gemeint haben.10 Oder es war einfach eine Hoffnung. Nichts gegen die Hoffnung, doch sie ist weder eine wissenschaftliche Methode geschweige denn eine wirksame Politikmaßnahme. Dazu bräuchte es eine sichtbare Hand, welche die Unternehmen dazu anreizt, sich so zu verhalten, wie es die Gesellschaft wünscht. Manche Ökonomen glauben, dass es sich um die Konkurrenz handle. Denn welchem Mechanismus, wenn nicht der Konkurrenz, verdanken wir, dass kein Unternehmen seinen Egoismus zu sehr auf Kosten anderer steigern kann? Sobald es zu hohe Preise verlangen oder zu niedrige Qualität bieten würde, würde es von anderen verdrängt: Wettbewerb. Bis heute bildet die Annahme, dass die Egoismen der Einzelakteure durch Konkurrenz zum größtmöglichen Wohl aller gelenkt würden, den Legitimationskern der kapitalistischen Marktwirtschaft. Aus meiner Sicht ist diese Annahme jedoch ein Mythos und grundlegend falsch; Konkurrenz spornt zweifellos auf ihre Weise zu Leistung an (dazu später), aber sie richtet einen ungemein größeren Schaden an der Gesellschaft und an den Beziehungen zwischen den Menschen an.11 Wenn Menschen als oberstes Ziel ihren eigenen Vorteil anstreben und gegeneinander agieren, lernen sie, andere zu übervorteilen und dies als richtig und normal zu betrachten. Wenn wir jedoch andere übervorteilen, dann behandeln wir sie nicht als gleichwertige Menschen: Wir verletzen ihre Würde.
Würde ist der höchste Wert
Wenn ich die Studierenden in meiner Vorlesung an der Wirtschaftsuniversität frage, was sie unter »Menschenwürde« verstehen, ernte ich regelmäßig geschlossenes und betretenes Schweigen. Sie haben im bisherigen Verlauf ihres Studiums nichts darüber gehört oder gelernt. Das ist umso erschreckender, als die Würde der höchste aller Werte ist: Sie ist der erstgenannte Wert im Grundgesetz und bildet die Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Würde heißt Wert und meint den gleichen, bedingungslosen, unveräußerlichen Wert aller Menschen. Würde bedarf keiner »Leistung« außer der nackten menschlichen Existenz. Aus dem gleichen Wert aller Menschen erwächst unsere Gleichheit in dem Sinne, dass in einer Demokratie alle Menschen die gleichen Freiheiten, Rechte und Chancen genießen sollen. Und nur wenn tatsächlich alle die gleichen Freiheiten genießen, ist die Bedingung gegeben, dass alle auch wirklich frei sein können: Menschenwürde ist die Begründung und Voraussetzung für Freiheit. Immanuel Kant sagte: Die Würde kann im alltäglichen Umgang zwischen den Menschen nur dann gewahrt werden, wenn wir uns stets als gleichwertige Personen betrachten und behandeln: Wir sollen unser menschliches Gegenüber und seine/ihre Bedürfnisse, Gefühle und Meinungen gleich ernst nehmen wie die eigenen – als Ausdruck des gleichen Wertes. Wir dürfen die andere Person nie nur instrumentalisieren und primär als Mittel für den eigenen Zweck verwenden. Dann wäre es mit der Würde vorbei.12 Als Nebeneffekt dürfen uns aus der würdevollen Begegnung sehr wohl Vorteile erwachsen, das passiert nach Kant und Hausverstand ganz automatisch, wenn alle das Beste füreinander wollen, eine Vertrauensbasis aufbauen, sich ernst nehmen, einander zuhören und wertschätzen. Aber Vorteilnahme darf nicht das Ziel der Begegnung sein.
Auf dem freien Markt ist es hingegen legal und üblich, dass wir unsere Nächsten instrumentalisieren und dabei ihre Würde verletzen, weil es nicht unser Ziel ist, diese zu wahren. Die Würde wird weder gemessen noch bilanziert. Unser Ziel ist das Erringen eines persönlichen Vorteils, und dieser lässt sich in vielen Fällen leichter erringen, wenn ich meinen Nächsten übervorteile und dabei seine Würde verletze. Entscheidend sind meine Einstellung und meine Priorität: Geht es mir um das größtmögliche Wohl und die Wahrung der Würde aller, wovon ich selbst automatisch auch betroffen bin und profitiere, oder geht es mir vorrangig um mein eigenes Wohl und den eigenen Vorteil, aus dem auch andere Vorteile ziehen können, aber eben nicht müssen?
Wenn wir unseren eigenen Vorteil als oberstes Ziel verfolgen, wird es gängige Praxis, dass wir andere als Mittel für unsere Zwecke benutzen und diese übervorteilen. Deshalb führt die Smith’sche Verdrehung von Ziel und Nebeneffekt zur weitverbreiteten Verletzung der Menschenwürde und zur systematischen Einschränkung der Freiheit vieler Menschen: So wie es das »Wohlwollen« des Lehrers, des Arztes und des Kochs braucht, damit es den SchülerInnen, PatientInnen und Hungrigen gut geht, braucht es genauso das Wohlwollen des Bäckers, Metzgers, Brauers, damit alle ihr »tägliches Brot« erhalten – und nicht nur sie. Adam Fergusson, Landsmann von Smith, sah das genauso: »Wer um das Wohl der anderen bemüht ist, bemerkt, dass das Glück der anderen zur reichhaltigsten Quelle fürs eigene Glück wird.«13
»Freier« Markt?
Der »freie Markt« wäre dann ein freier Markt, wenn alle TeilnehmerInnen dieses Treibens von jedem Tauschgeschäft völlig schadlos zurücktreten könnten. Doch genau das trifft nur auf einen Teil der Transaktionen am Markt zu. Bei einem beträchtlichen Teil hat es eine Partei nicht so leicht, auf das Tauschgeschäft zu verzichten wie die andere Partei, weil sie in stärkerem Maße davon abhängig ist.14 Viele Menschen können sich nicht aussuchen, ob sie heute Nahrungsmittel einkaufen oder nicht; ob sie eine Wohnung anmieten oder nicht; viele Unternehmen können es sich nicht aussuchen, ob sie heute einen Kredit aufnehmen oder nicht; tun sie es nicht, können sie morgen schon insolvent sein; zahllose Bauern und Bäuerinnen können nicht frei entscheiden, wem sie zuliefern wollen; sie haben oft nur einen einzigen oder eine Handvoll Abnehmer zur »Auswahl«, von denen sie gleich (schlecht) behandelt werden. Für typische Tauschgeschäfte gilt:
Die durchschnittliche ArbeitgeberIn kann leichter vom Arbeitsvertrag zurücktreten und damit die Bedingungen des Arbeitsvertrages eher bestimmen als die durchschnittliche ArbeitnehmerIn.
Die durchschnittliche KreditgeberIn kann eher vom Kreditvertrag zurücktreten und damit die Bedingungen des Kreditvertrages eher bestimmen als die durchschnittliche KreditnehmerIn.
Die durchschnittliche Immobilienverwaltung kann eher von der Unterzeichnung des Mietvertrages Abstand nehmen und damit die Bedingungen des Mietvertrages eher bestimmen als die durchschnittliche MieterIn.
Der durchschnittliche Weltkonzern kann eher auf einen seiner tausend Zulieferbetriebe verzichten und damit die Bedingungen des Liefervertrages eher bestimmen als der durchschnittliche Zulieferbetrieb.
Ein Machtgefälle in privaten Tauschbeziehungen wäre nicht das geringste Problem, wenn alle einander mit Achtung und dem Vorsatz der Wahrung der Würde begegnen würden. Denn dann würde die mächtigere Person der weniger mächtigen Person auf Augenhöhe entgegentreten, sie sehen und ihre Bedürfnisse und Gefühle genauso ernst nehmen wie die eigenen; und erst mit dem Ergebnis zufrieden sein, wenn beide damit gut leben können. Doch in der kapitalistischen Marktwirtschaft werden die Mächtigeren geradewegs dazu ermutigt, ihren Vorsprung, das Machtgefälle, auszunutzen, denn daraus – aus dem Streben nach dem eigenen Vorteil und der daraus resultierenden Konkurrenz – ergibt sich erst die ganz spezielle »Effizienz« des freien Marktes.
Wenn in einem menschlichen Gemeinwesen die Würde der Einzelnen nicht systemisch gewahrt wird, wird auch die Freiheit nicht gewahrt; denn die Wahrung der Würde – das Begegnen der Menschen als Gleich(wertig)e – ist die Voraussetzung für die Freiheit in diesem Gemeinwesen. Wenn alle den eigenen Vorteil im Auge haben, behandeln sie die anderen nicht mehr als Gleiche, sondern als »Instrumente« und gefährden dadurch die Freiheit aller. Deshalb kann eine Marktwirtschaft, die auf Gewinnstreben und Konkurrenz beruht, nicht als »freie« Wirtschaft bezeichnet werden: Das wäre ein Widerspruch in sich. Ehrlicherweise sollte deshalb eine Marktwirtschaft, die auf Gewinnstreben und Konkurrenz beruht, in rücksichtslose, inhumane und letztlich illiberale, weil die Freiheit zerstörende Marktwirtschaft umbenannt werden. Und wir sollten uns auf den Weg machen, eine humane und durch und durch ethische (Markt-)Wirtschaft zu entwickeln.
Vertrauen wichtiger als Effizienz
Eines noch: Wenn wir auf dem Markt ständig befürchten müssen, von unseren Nächsten übervorteilt zu werden, sobald sie dazu in der Lage sind, wird noch etwas ganz Wesentliches systemisch zerstört: das Vertrauen. Manche Ökonomen schenken dieser Tatsache wenig Beachtung, denn in der Wirtschaft geht es in ihren Augen vor allem um Effizienz. Doch das ist eine Perversion (lat. Verkehrung) der Dinge, denn das Vertrauen ist das höchste soziale und kulturelle Gut, das wir kennen. Vertrauen ist das, was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält – nicht die Effizienz! Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der Sie jedem Menschen vollkommen vertrauen können: Wäre das nicht die Gesellschaft mit der höchsten Lebensqualität? Und umgekehrt: eine Gesellschaft, in der Sie jedem Menschen misstrauen müssen – wäre das nicht die Gesellschaft mit der geringsten Lebensqualität?
Die Zwischenbilanz ist eine radikale: Solange Marktwirtschaft auf Gewinnstreben und Konkurrenz und der sich daraus ergebenden wechselseitigen Übervorteilung beruht, ist diese weder mit der Menschenwürde noch mit Freiheit vereinbar. Sie zerstört systematisch das gesellschaftliche Vertrauen in der Hoffnung, dass dadurch die Effizienz höher sei als in einer anderen Form des Wirtschaftens.
Auf diese Sachverhalte angesprochen, zeigen Mainstream-Ökonomen häufig drei vertraute Reaktionsmuster:
1. Es gibt keine Alternative zur Marktwirtschaft, das ist bekannt, und deshalb erübrigt sich die Diskussion.
2. Wer das nicht zur Kenntnis nimmt, will die Gesellschaft in die Armut und ins 19. Jahrhundert zurückkatapultieren oder gleich in den Kommunismus.
3. Die Marktwirtschaft ist die produktivste Wirtschaftsform, die es gibt, das hat die Geschichte entschieden. Der Wettbewerb spornt die Menschen zu unvergleichlicher Leistung an, abgesehen davon, dass er in der Natur des Menschen angelegt und deshalb unvermeidbar ist.
Diesen letzten Grundmythos der Marktwirtschaft wollen wir uns noch näher ansehen: »Wettbewerb stellt in den meisten Fällen die effizienteste Methode dar, die wir kennen«, schreibt der Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek.15 Wenn ein »Nobelpreisträger« das sagt, dann muss es auch stimmen – auch wenn es den Wirtschafsnobelpreis gar nicht gibt.16 Ich habe versucht, die empirische Studie zu finden, durch die Hayek zu dieser Erkenntnis kam. Doch ich fand sie nicht. Ich suchte auch bei anderen Ökonomen, denn in der Wissenschaftsgemeinde ist es üblich, dass KollegInnen einander zitieren. Doch auch dort wurde ich nicht fündig. Keiner der nobelpreisgekrönten Ökonomen hat jemals mit einer Studie bewiesen, dass »Wettbewerb die effizienteste Methode ist, die wir kennen«. Ein ideologischer Fundamentalbaustein der ökonomischen Wissenschaft ist eine pure Behauptung, die von der großen Mehrheit der Ökonomen geglaubt wird. Und auf diesem Glauben beruhen Kapitalismus und Konkurrenz-Marktwirtschaft, die seit 200 Jahren das weltweit dominante Wirtschaftsmodell sind.
Zur konkreten Fragestellung »Motiviert Wettbewerb stärker als jede andere Methode?« gibt es eine Fülle von Studien, in zahlreichen Disziplinen: Sozialpsychologie, Pädagogik, Spieltheorie, Neurobiologie. 369 davon wurden in einer Metastudie ausgewertet. Und von denjenigen mit einem klaren Ergebnis kommt eine erstaunliche Mehrheit von 87 Prozent zu dem Befund, dass Konkurrenz nicht die effizienteste Methode ist, die wir kennen.17 Sondern: Kooperation. Der Grund liegt darin, dass die Kooperation anders motiviert als die Konkurrenz. Dass Konkurrenz motiviert, bestreitet niemand, das hat die kapitalistische Marktwirtschaft auch bewiesen; nur motiviert sie schwächer, weil anders: Kooperation motiviert über gelingende Beziehung, Anerkennung, Wertschätzung, gemeinsame Zielsetzung und -erreichung. Das ist die Definition von Kooperation. Die Definition von Konkurrenz hingegen ist »einander ausschließende Zielerreichung«. Ich kann nur erfolgreich sein, wenn jemand anderer erfolglos bleibt. Konkurrenz »motiviert« primär über Angst. Deshalb ist die Angst auch ein sehr weitverbreitetes Phänomen in kapitalistischen Marktwirtschaften: weil viele fürchten, den Job zu verlieren, Einkommen, Status, gesellschaftliche Anerkennung und Zugehörigkeit. In einem Wettbewerb um knappe Güter gibt es nun mal viele Verlierer, und die meisten haben Angst, selbst betroffen zu sein. Es gibt noch eine weitere Motivationskomponente der Konkurrenz. Während die Angst von hinten schiebt, zieht vorne eine Art Lust. Doch welche Lust? Es handelt sich um Siegeslust: um den Wunsch, besser zu sein als jemand anderer. Und das ist, mit psychologischer Brille betrachtet, ein sehr problematisches Motiv. Denn das Ziel unseres Tuns sollte nicht sein, dass wir besser sind als andere, sondern dass wir unsere Sache gut machen, weil wir sie für sinnvoll halten, gerne machen und gut. Daraus sollten wir unseren Selbstwert beziehen. Wer seinen Selbstwert daraus bezieht, besser zu sein als andere, ist davon abhängig, dass andere schlechter sind. Psychologisch gesehen handelt es sich hier um pathologischen Narzissmus: Sich besser zu fühlen, weil andere schlechter sind, ist krank. Gesund ist, dass wir unser Selbstwertgefühl aus Tätigkeiten nähren, die wir gerne machen, weil wir sie aus freien Stücken gewählt haben und darin Sinn erfahren. Wenn wir uns auf das Wir-selbst-Sein konzentrieren anstatt auf das Bessersein, nimmt niemand Schaden, und es braucht keine VerliererInnen.
Es geht um die Zielsetzung. Wenn ich als Nebeneffekt in einer Tätigkeit besser bin als jemand anderer, ohne dass es mein Ziel war, dann gibt es kein Problem. Ich werde dem Bessersein keine Beachtung schenken und dieses nicht als »Sieg« bewerten – und der anderen Person helfen. Das Problem entsteht, wenn es mein Ziel ist, besser zu sein als jemand anderer, ich also eine »Win-lose-Situation« anstrebe – was die hier verwendete Definition von Wettbewerb ist. Wenn es mein Ziel ist, meine Sache gut zu machen, und mir egal ist, wie andere ihre Sache machen, dann brauche ich den Wettbewerb gar nicht – genau das ist aber der Kern des Mythos: Ohne Wettbewerb würden Menschen keinen Leistungsanreiz verspüren, keine Motivation, ihre Sache gut zu machen. Dabei verhält es sich psychologischen Erkenntnissen zufolge genau umgekehrt: Motivation wirkt stärker, wenn sie von innen kommt (»intrinsische Motivation«) als von außen (»extrinsische Motivation«) wie zum Beispiel der Wettbewerb. Die besten Leistungen kommen nicht zustande, weil es eine KonkurrentIn gibt, sondern weil Menschen von einer Sache fasziniert, energetisiert und erfüllt sind, sich ihr hingeben und ganz in ihr aufgehen. Den Wettbewerb braucht es nicht.
Wollten redliche ÖkonomInnen die Marktwirtschaft tatsächlich auf der effizientesten Methode aufbauen, die wir kennen, dann müssten sie sie auf struktureller Kooperation und intrinsischer Motivation aufbauen – zumindest, wenn sie den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung zur Kenntnis nehmen würden. Der Umstand, dass sie das nicht tun, ist ein Hinweis darauf, dass es den WettbewerbsapologetInnen gar nicht um Wissenschaft und Erkenntnis geht, sondern um Anerkennung im ideologischen Mainstream oder um Absicherung bestehender Herrschaftsstrukturen. Den Mächtigen dient die Konkurrenz jedenfalls bravourös: Wenn wir Menschen nicht lernen, zu kooperieren und uns zu solidarisieren, werden wir die Machtverhältnisse nicht in Frage stellen und mit vereinter Kraft verändern, sondern lieber versuchen, uns selbst mit Ellbogentechnik in den Bereich der Macht und in die gesellschaftlichen Eliten vorzukämpfen. Dabei bleibt allerdings die große Mehrheit von uns auf der Strecke. Und das gesellschaftliche Klima wird fortschreitend vergiftet, weil wir in unserem Streben nach dem eigenen Vorteil einander permanent übervorteilen, ausnutzen und entwürdigen und dabei das gesellschaftliche Vertrauen und den Selbstwert der meisten Menschen schwächen oder zerstören.
Die Folgen von Gewinnstreben und Konkurrenz: die zehn Krisen des Kapitalismus
Das Verfolgen des »eigenen Interesses« (Smith) als oberstes Ziel in Konkurrenz zueinander führt, entgegen den Prognosen und Versprechungen der marktwirtschaftlichen Theorie, zu:
1. Konzentration und Missbrauch von Macht. Aufgrund des systemimmanenten Wachstumszwangs – größer, mächtiger und schließlich »Global Player« zu sein, ist das Ziel – kommt es zur Herausbildung von Riesenkonzernen, die Marktmacht missbrauchen, Märkte abschotten, Innovation blockieren, Konkurrenten fressen oder aus dem Markt schlagen. »Eroberung von Marktanteilen«, randvolle »Kriegskassen«, »feindliche« Übernahmen: Die Wirtschaftssprache entlarvt, worum es im Streben nach dem eigenen Vorteil schlussendlich geht.
2. Ausschaltung des Wettbewerbs und Kartellbildung. Wenn nur noch ganz wenige übrig bleiben, kann das feindliche Gegeneinander blitzartig in – taktische, nicht prinzipielle – Kooperation umschlagen. Denn das Ziel bleibt das gleiche: maximaler Profit. Wenn es die Macht erlaubt, Kartelle und Oligopole zu bilden, dann wird dieser Weg sogar bevorzugt, weil er noch effektiver ist als die Konkurrenz. Bei der Konkurrenz gibt es Verlierer, bei der Kooperation gewinnen alle. Deshalb kooperieren Branchenunternehmen, sobald dies möglich ist. (Was ein unfreiwilliger und unschöner Beweis für die Überlegenheit der Kooperation ist. Unschön, weil Kooperation hier kein universales Ziel ist, sondern ein Mittel zum falschen Zweck: andere zu übervorteilen.) Bei der gegenwärtigen Bankenrettung zeigt sich, dass es gar nicht um Wettbewerb und Marktwirtschaft geht, sondern um die (staatliche) Absicherung von Gewinnen und Macht: Zu diesem Zweck kooperieren die wirtschaftlichen und politischen Eliten und schalten den Wettbewerb aus – der offenbar gar nicht das Ziel ist, sonst hätte keine »systemrelevante« Bank je entstehen dürfen.
3. Standortkonkurrenz. Staaten versuchen Unternehmen anzulocken und die Bedingungen für das Gewinnstreben systematisch zu verbessern: Es kommt zu Lohn-, Sozial-, Steuer- und Umweltdumping, zur Besserbehandlung von Weltkonzernen gegenüber lokalen Kleinbetrieben und zu verlockenden Sonderangeboten wie dem Bankgeheimnis oder gar dem Verzicht auf Bankenaufsicht und Regulierung, weil diese als »Standortvorteile« angesehen werden. Wenn der Wettbewerb von den Unternehmen auf die Staaten übergreift, dann blüht der Nationalismus inmitten der angeblichen »Globalisierung«. Zum Schaden fast aller demokratischen und sozialen Errungenschaften, die in der globalen Standortkonkurrenz zu »Wettbewerbshindernissen« herabgewürdigt werden.
4. Ineffiziente Preisbildung. Preise sind sehr oft nicht das vernünftige Ergebnis rationaler Marktakteure, sondern Ausdruck von Machtverhältnissen. Angebots- und Nachfragemacht sind sehr ungleich verteilt, weshalb Preise die Interessen der Mächtigen widerspiegeln und nicht so sehr tatsächliche Kosten oder Nutzen. Zum Beispiel erzielt die wertvolle Betreuung von Kindern, Kranken, Älteren oder Gärten oft gar keinen Preis, während die Betreuung von Hedgefonds astronomische Preise erzielt, obwohl ihr gesellschaftlicher Nutzen negativ ist. Da öffentliche und Gemeinschaftsgüter wie saubere Luft, Artenvielfalt, Sicherheit, Vertrauen, Zusammenhalt oder Gerechtigkeit keinen Preis haben, können sie kostenlos zerstört und die entstehenden Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet werden (vom Verlust an Lebensqualität bis zu den Reparaturkosten). Wer einen größeren Schaden anrichtet als andere, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil!
5. Soziale Polarisierung und Angst. Die Marktwirtschaft ist eine Machtwirtschaft. Je größer – globaler – der »freie Wettbewerb«, desto größer werden die Machtgefälle zwischen den AkteurInnen und damit die Ungleichheiten und die Kluft zwischen Reich und Arm. Laut Oxfam besitzen nur acht Multimilliardäre gleich viel wie die halbe Menschheit.18 In den USA verdient heute der bestbezahlte Manager das 350.000-Fache des gesetzlichen Mindestlohnes.19 Das hat weder mit »rationaler Preisbildung« noch mit Effizienz oder Gerechtigkeit zu tun, sondern ausschließlich mit Macht. In der Folge nimmt das Vertrauen in der Gesellschaft ab, und die Angst steigt. In den USA ist das Vertrauen zwischen den Menschen von sechzig Prozent 1980 auf vierzig Prozent 2004 gesunken.20 Gegengleich ist der Angst-Index in Westdeutschland von 24 Prozent 1991 auf 45 Prozent in den letzten Jahren gestiegen.21
6. Nichtbefriedigung von Grundbedürfnissen und Hunger. Wie wenig die globalisierte kapitalistische Marktwirtschaft in der Lage ist, auch nur die Grundbedürfnisse zu befriedigen und damit die Menschenrechte zu wahren, zeigt die Explosion der Hungerzahlen. Hungerten Anfang der 1990er Jahre noch knapp 800 Millionen Menschen, so waren es 2009 laut Welternährungsorganisation FAO 1,023 Milliarden, danach sank die Zahl wieder auf 843 Millionen 2011–2013.22 Die Befriedigung von Grundbedürfnissen ist nicht das Ziel des Kapitalismus, sondern die Vermehrung von Kapital. Das führt in vielen Fällen dazu, dass Grundbedürfnisse, die mit keiner Kaufkraft ausgestattet sind, nicht gestillt werden (nach Nahrung, medizinischer Versorgung, Wohnung oder Bildung); und für Kaufkraft, hinter der keine Bedürfnisse mehr stehen, neue Bedürfnisse »erfunden« werden (zum Beispiel süchtig machende Nahrung, Gameboys, Schönheitschirurgie oder Stadt-Geländeautos). Kreativität und Investitionen werden im Kapitalismus systemisch fehlgelenkt.
7. Ökologische Zerstörung. Da der Kapitalismus die Vermehrung des Finanzkapitals zum obersten Ziel hat (und nicht das Gemeinwohl), rutschen alle anderen Ziele, wie zum Beispiel Umweltschutz, auf der Prioritätenliste nach unten. Die UNO hat im Millennium Synthesis Report festgestellt, dass sich zwischen 1950 und 2000 der Gesundheitszustand fast aller planetaren Ökosysteme (Meere, Weiden, Flüsse, Gebirge, Wälder) verschlechtert hat.23 Sie nähern sich ihrer Belastungsgrenze und werden früher oder später kippen. Dann sind die lebenswichtigen »Leistungen« dieser Ökosysteme für die Menschen in Gefahr: Klimastabilität, Feuchtigkeits- und Temperaturregulierung, Kontrolle von Krankheiten und Schädlingen, Bodenfruchtbarkeit, Absorptionsfähigkeit. Der Kapitalismus zerstört, da er blind die Vermehrung des Finanzkapitals und nicht das Wohl aller anstrebt, die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen und der Wirtschaft.
8. Sinnverlust. Da die Anhäufung materieller Werte das Ziel des Kapitalismus ist, schießt dieser bald über den sinnvollen Nebeneffekt, die materiellen Grundbedürfnisse zu befriedigen, hinaus und unterwirft alle anderen Werte: Beziehungs- und Umweltqualität, Zeitwohlstand, Kreativität, Autonomie. Die Erwerbsarbeitszeit nahm in der EU zwischen 1995 und 2005 wieder um acht Prozent zu (!)24, der Konsumzwang wird zur Kaufsucht, immer mehr Menschen können in anderen Tätigkeiten als dem Geldverdienen keinen Sinn mehr erkennen, weil sie von ihren wahren Wünschen und Idealen immer mehr entfremdet sind.
9. Werteverfall. In der Wirtschaft kommen heute die asozialsten Personen besonders leicht nach oben, weil es um die Optimierung von Zahlenzielen geht und Menschen, die »fähiger« sind, alle anderen – menschlichen, sozialen, ökologischen – Ziele auszublenden, kulturell »selektiert« werden. Egoisten können heute besonders »erfolgreich« sein. Wenn in der Wirtschaft systematisch Egoismus und Konkurrenzverhalten belohnt werden und Menschen als erfolgreich angesehen werden, wenn sie sich in dieser Anreizdynamik emporarbeiten, dann färben diese Werte auf alle Bereiche der Gesellschaft ab, zunächst auf Politik und Medien und am Ende auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. »Der kapitalistische Charakter formt den Gesellschaftscharakter«, formulierte bereits Erich Fromm.25
10. Ausschaltung der Demokratie. Wenn Gewinnstreben und das Verfolgen des eigenen Interesses das höchste Ziel sind, dann setzen die Wirtschaftsakteure alle Hebel in Bewegung, um dieses Ziel auch konsequent zu erreichen. Nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen, persönliche Talente oder natürliche Ressourcen werden als Mittel benutzt, sondern ebenso selbstverständlich die Demokratie. Denn in der Ethik des »eigenen Interesses« steht dieses seit Mandeville über dem Gemeinwohl; das Gemeinwohl ergibt sich – so die Hoffnung – als Nebeneffekt. Die Realität sieht jedoch anders aus. Globale Unternehmen, Banken und Investmentfonds werden so mächtig, dass sie über Lobbying, Medienbesitz, Public Private Partnerships und Parteienfinanzierung Parlamente und Regierungen erfolgreich dazu bringen, ihren Partikularinteressen und nicht dem Gemeinwohl zu dienen. Die Demokratie wird so zum letzten und prominentesten Opfer der »freien Marktwirtschaft«.
Eine ausführlichere Analyse habe ich an anderer Stelle publiziert26, deshalb sei hier ein Schlussstrich gezogen, um die Bühne frei zu machen für das Neue.
2. Die Gemeinwohl-Ökonomie – der Kern
»Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.«
Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 151
Ziel des Wirtschaftens
Wenn ich an wirtschaftsbildenden Schulen oder wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten die SchülerInnen und Studierenden nach dem Ziel des Wirtschaftens frage, erhalte ich fast immer die Antworten: »Geld«, »Gewinn«, »Profit«. Ich frage zurück: Wer sagt das? »So lernen wir es«, erfahre ich. »Und auf welche Quellen berufen sich eure Lehrer und Lehrerinnen?« Schweigen. »Was ist die Begründung dafür, dass Gewinn oder die Vermehrung von Geld das Ziel des Wirtschaftens sein soll?« Schweigen.
Ich suchte Rat – bei den Verfassungen demokratischer Staaten. Als Erstes schaute ich in die Bayerische Verfassung: »Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl«, steht da wortwörtlich.27 Zuerst dachte ich, das müsse ein Irrtum sein. Doch auch andere Verfassungen besagen dasselbe: »Eigentum verpflichtet«, steht im deutschen Grundgesetz, »sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.«28 Gemäß der italienischen Verfassung soll »die öffentliche und private Wirtschaftstätigkeit nach dem Allgemeinwohl ausgerichtet werden«.29 Die kolumbianische Verfassung sagt: »Die wirtschaftliche Aktivität und die Privatinitiative sind frei, innerhalb der Grenzen des Gemeinwohls.«30 Und selbst die US-Verfassung beendet ihre Präambel mit »der Förderung des Gemeinwohls«. In den Verfassungen herrscht Konsens, was das Ziel des Wirtschaftens ist: die Förderung des Gemeinwohls. Mir ist keine Ausnahme bekannt. Jedenfalls gibt es keine Verfassung, die besagte, dass der Zweck des Wirtschaftens die Mehrung des Kapitals oder der Geldgewinn sei. Damit hat sich eine von zwei fundamental unterschiedlichen Weisen, Wirtschaft zu denken und zu praktizieren, klar durchgesetzt: Aristoteles unterschied die »oikonomia«, in der Geld/Kapital nur Mittel zum Zweck des Wirtschaftens ist, von der »chrematistike«, in der das Mittel zum Zweck und der Gelderwerb das eigentliche Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten wird, wörtlich »die Kunst des Gelderwerbs und Sich-Bereicherns«.31 Im Abendland gibt es seit über 2000 Jahren Konsens, was das Ziel des Wirtschaftens ist. Der Direktor des Weltethos-Instituts Claus Dierksmeier kommt zum Schluss: »Von Aristoteles über Thomas von Aquin bis zu einschließlich Adam Smith bestand Konsens darüber, dass die ökonomische Theorie und Praxis sowohl legitimiert als auch begrenzt werden müssten durch ein übergeordnetes Ziel (griech. telos) wie etwa das ›Gemeinwohl‹.«32 Den Gemeinwohl-Wert kennen alle Kulturen: In Lateinamerika wird vom »buen vivir« gesprochen, in Afrika ist »Ubuntu« gebräuchlich, in Bhutan wird das landesweite Glück erhoben. In Italien wurde bereits im 18. Jahrhundert der Begriff »öffentliches Glück« gebräuchlich.33 Der St. Gallener Wirtschaftsethiker Timo Meynhardt schreibt: »Offenkundig besitzt jede Sprache rund um den Globus ein Wort für Gemeinwohl (…) Eine Gesellschaftstheorie, die ohne Gemeinwohlbezug auskommt«, gebe es »schlicht nicht«!34
Die Gemeinwohl-Ökonomie schlägt nichts anderes vor, als dass das verfassungsmäßige Ziel auch in der realen Wirtschaftsordnung umgesetzt werden soll.
Umstellung der Systemweichen
Dafür müssten die gegenwärtigen Systemweichen der Marktwirtschaft von Gewinnstreben und Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umgestellt werden. Der rechtliche Anreizrahmen müsste dem falschen Leitstern »Eigennutzmaximierung« abgeschnallt und dem Leitstern »Gemeinwohlorientierung« umgeschnallt werden. Ziel aller Unternehmen ist es, einen größtmöglichen Beitrag zum allgemeinen Wohl zu leisten. Das ist nicht neu: Das Ziel der einzelwirtschaftlichen Akteure wird lediglich in Übereinstimmung mit den Verfassungszielen gebracht. Das ist Schritt eins bei der ethischen Umsteuerung freier Märkte.
Wirtschaftlichen Erfolg neu definieren
Schritt zwei: Wenn Gemeinwohl das demokratisch definierte Ziel des Wirtschaftens ist, dann müsste logischerweise bei der ökonomischen Erfolgsmessung die Zielerreichung gemessen werden. Auf allen Ebenen: auf der Ebene der Volkswirtschaft (Makroebene), auf der Ebene des einzelnen Unternehmens (Mesoebene) und bei jeder Investition (Mikroebene).
Heute wird wirtschaftlicher Erfolg auf allen drei Ebenen mit monetären Indikatoren gemessen: auf der Makroebene mit dem Bruttoinlandsprodukt, auf Unternehmensebene mit dem Finanzgewinn und auf der Ebene der einzelnen Investition mit dem »Return on Investment«. Alle drei Standard-Erfolgsindikatoren haben gemeinsam, dass es sich um »monetäre« Indikatoren handelt: Geld ist jedoch nicht das Ziel des Wirtschaftens, sondern nur das Mittel.
Jetzt kommt die Gretchenfrage: Ist es sinnvoller und methodisch korrekt, den Erfolg eines Projektes, ganz gleich, um welches es sich handelt, primär an den Mitteln und ihrer Akkumulation zu messen oder primär an den Zielen und ihrer Erreichung? Möglicherweise ist das der zentrale Systemfehler der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung: Bei der Erfolgsmessung werden Ziel und Mittel verwechselt. Im Kapitalismus – nach Aristoteles »chrematistike« – ist zweifellos die Mehrung des Kapitals das höchste Ziel; die Generierung von Gemeinwohl kann dafür Mittel sein oder Nebeneffekt – muss aber nicht. In der Gemeinwohl-Ökonomie ist die Mehrung des Gemeinwohls das höchste Ziel. Kapital ist ein (wertvolles) Mittel dafür. In manchen Fällen kann es eingesetzt werden, um das Ziel zu erreichen; in anderen braucht es gar keins, wenn es bessere Mittel und Wege zur Zielerreichung gibt. Es gibt weder einen Zwang zum Einsatz von Kapital noch zu dessen Vermehrung – denn der Erfolg von Unternehmen, Investitionen und Volkswirtschaften wird nicht anhand der Mehrung des Kapitals gemessen, sondern direkt an der Zielerreichung.