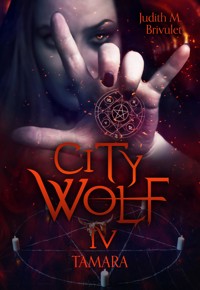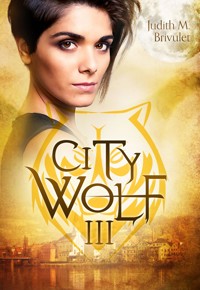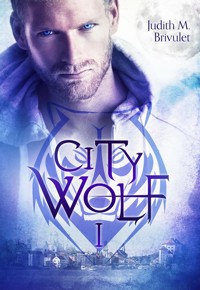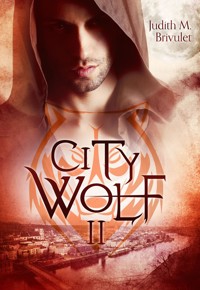3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Band II der epischen High Fantasy Saga Nachdem Esmanté und Loglard mit ihren Verbündeten die grausamen Arsuri erfolgreich von der Silbernen Burg, dem Herrschersitz der Graselfen, vertrieben haben, kehrt zunächst Ruhe ein in Tiranorg. Doch es ist eine trügerische Ruhe. Die Scheibe der Ewigkeit, das mächtigste Artefakt des Landes, bleibt verschollen. Unheilvolle Dinge geschehen. Irrwische und Krähengeister zeigen sich. Statuen der Schlangengöttin Creydillad schießen überall aus dem Boden. Die Meerelfen stehen vor einer schicksalhaften Entscheidung. Schließlich bieten die scheuen Dryaden an, Noreia, die Tochter von Esmanté und Loglard, in ihrer besonderen Magie zu unterweisen, denn das Gleichgewicht der Kräfte ist bedroht. Nur gut, dass Esmanté und Loglard treue Kameraden zur Seite stehen. Zumal eines immer deutlicher wird: Der Krieg um die Herrschaft über Tiranorg hat begonnen. Der Schlüssel zur Macht ist die Scheibe der Ewigkeit. »Schwertmagie« ist der zweite Band der abgeschlossenen vierteiligen High Fantasy Saga um die Zukunft der Elfenvölker in Tiranorg. Band I Tiranorg, Schwertliebe, Band II Tiranorg, Schwertmagie, Band III Tiranorg, Schwertverrat, Band IV Tiranorg, Schwertmacht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tiranorg
Schwertmagie
Ein Roman von Judith M. Brivulet
Für Scathach
und
die Freiheit Tiranorgs!
© 2018 Judith M. Brivulet
www.brivulet.com
2. Auflage
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme, des Nachdrucks in Zeitungen und Zeitschriften, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung und Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Alle in diesem Roman vorkommenden Personen, Schauplätze, Ereignisse und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder realen Ereignissen sind rein zufällig.
Lektorat: Carolin Olivares
www.olivares-canas.com
Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss, www.juliane-schneeweiss.com
Bilder © Depositphotos.com/ fxquadro, vukkostic91, mikeaubry
Impressum:
Impressumssservice:
Fa. bachinger software
Am Wimhof 20
94034 Passau
www.bachinger-software.de
Inhaltsverzeichnis
1. Nisz, die Strahlende
2. Eine Schnapsidee
3. Revanche
4. Ewige Jugend
5. Île de Loar
6. In Béara
7. Raupen
8. Über den Dächern
9. Eine freundliche Einladung
10. Wasserteufel und Schattenkrieger
11. Das Große Zerwürfnis
12. Frischer Wind
13. Im Wald von Brocéliande
14. Eine Flasche Wein
15. Richtige Ladys
16. Dryaden und Irrwische
17. Wie ein trotziges Kind
18. Ein Schwarm Wespen
19. Eine Quelle fremder Magie
20. Dun Aengor
21. Das Opferfest
22. Der Schleier des Glücks
23. Die Leichenholerin
24. Eine Machtdemonstration
25. Tageslicht
26. Krähenzauber
27. Der Preis
28. Die Macht der Dämonen
29. Ein elender Kobold
30. Tyr Abath
31. Sonnenaufgang
32. Eine kurzweilige Wanderung
33. Neuigkeiten
34. Begleitschutz
35. Der Erstgeborene
36. Die Wahl der Gefährten
37. Brutkammern
38. Das Leben im Meer
39. Ein eisernes Regiment
40. Fünf Arten von Feuer
41. Die Jagd
42. Geradewegs in die Anderswelt
43. In den Kelpwäldern
44. Aus purem Fels
45. Gwyn Nogkt
46. Eine elend kalte Höhle
47. Ein weiches Herz
48. Seite an Seite
49. Epilog
50. Personenverzeichnis
51. Zum Schluss
Für Christoph, die Liebe meines Lebens,
ohne ihn wäre die Geschichte nie entstanden.
Für meine drei Töchter,
die immer an mich glaubten.
Für meine Eltern,
die mich lehrten nie aufzugeben.
1. Nisz, die Strahlende
Kyla, stellvertretende Hochmagierin der Morinji, überprüfte ihren Zauber zum hundertsten Mal. Sie durfte nichts dem Zufall überlassen. Es war zu wichtig, dass sie unentdeckt die Hafenstadt Hathabor verließ. In Gedanken verfluchte sie Dagda, den Gott des Wetters, der sie sage und schreibe drei Monate lang in Hathabor festgehalten hatte. Mitsamt der wichtigsten Fracht, die sie jemals transportiert hatte.
Dabei durfte sie sich glücklich schätzen, dass sie im Schneesturm die rettenden Tore von Hathabor erreicht hatte. In der Taverne, in der sie Unterschlupf gefunden hatte, erzählte man sich schauerliche Geschichten von einer Händlergruppe, die in den letzten Ausläufern der Trollspitzen erfroren war. Der Winter hatte schrecklich gewütet, das Nordmeer getobt, als wollte es sich ganz Tiranorg holen. Also hatte sie sich als Schankmagd verdingt, um über die Runden zu kommen.
Jetzt trat sie auf das Stadttor zu. Wie jeden Tag wurde es sorgfältig bewacht. Die Soldaten musterten sie misstrauisch, weil sie Hathabor am frühen Nachmittag verlassen wollte.
»Wisst Ihr nicht, dass im Umkreis vieler Meilen um unsere Stadt rein gar nichts ist?«, schnauzte einer der beiden, ein besonders kräftiger Elf, dessen derbe Hosen in ebenso robusten Fellstiefeln steckten. Ein grober Überwurf mit Pelzbesatz wurde von einem breiten Gürtel zusammengehalten. »Es heißt nicht umsonst Graue Ödnis.«
»Natürlich weiß ich das.« Kyla lächelte den Mann an. »Ich will mein Glück am Strand versuchen. Ein paar Muscheln, von der Flut an Land gespült, etwas Seetang. Meine Kinder und ich haben Hunger.«
»Von mir aus«, murrte der andere, der nicht minder warm gekleidet war. »Seid nur rechtzeitig zurück. Wenn die Tore geschlossen sind, öffnen wir für niemanden mehr, auch nicht für hübsche Elfenfrauen.« Zusammengekniffene eisgraue Augen wanderten über ihren Körper. »Könntest dir das Essen auch auf andere Art verdienen«, setzte er noch nach.
Doch da war sie schon durch das halb geöffnete Tor geschlüpft. Unter dem rauen Gelächter der Männer rannte sie davon. Diese widerlichen Typen! Zu viele von ihnen hatte sie im Laufe des Winters in der Taverne kennengelernt. Sie schickte ein schnelles Gebet an die Große Mutter zum Dank dafür, dass sie nie ernsthaft angegriffen worden war. Da sie nicht kämpfen konnte, hätte sie auf ihre Magie zurückgreifen müssen und dabei ihre Tarnung nicht aufrechterhalten können. Wie hätte sie erklären sollen, dass sie gar keine hüftlangen goldblonden Haare besaß wie alle Frauen in Hathabor?
Und erst ihr Gepäck! Sie hielt an, um wieder zu Atem zu kommen. Eins ums andere Mal strich ihre Hand über den Gürtel, der doch so viel mehr war. Über eine Stunde wanderte sie am Strand entlang, sah sich immer wieder um, versicherte sich, dass ihr niemand folgte.
Nein, sie war allein, denn in einem hatte die Wache recht: Es gab hier nichts, außer kalten, harten Sand und das Donnern der Wellen, die sich an den Felsen brachen, mit tausend gierigen Fingern nach ihnen griffen.
Schließlich blieb sie stehen, atmete tief die salzgesättigte, kühle Luft ein. Ein letzter Blick, um sicherzustellen, dass niemand sie beobachtete. Dann verwandelte sie sich. Die goldene Haarpracht verschwand, zurück blieben raspelkurze Haare. Statt eisblauer Augen schwammen nun pechschwarze Pupillen in der gold-rot getupften Iris. Für Kyla färbte sich das aufgewühlte Meer rosa. Sie musste sich keine Sorgen machen. Außer dem Krächzen der Möwen und dem Rauschen des Windes war nichts zu hören.
Also machte sie sich erneut auf den Weg, leichter nun, da sie die fremde Gestalt aufgegeben hatte. Der Strand wurde felsiger und schmaler.
Kyla kramte in ihrem Bündel, holte eine dünne Decke heraus, breitete sie aus und rezitierte ein paar Worte. Seufzend setzte sie sich im Windschatten eines Findlings darauf. Angenehme Wärme schlug ihr entgegen. Sie verzehrte die wenige Nahrung, die ihr geblieben war: Trockenfisch, dazu ein paar Schlucke verwässerten Wein. Dann starrte sie auf das Meer hinaus. Noch war es zu früh. Ihre Gedanken wanderten zurück zu den Ereignissen im letzten Frühling.
Immer wieder sah sie sich selbst in der Bibliothek der Silbernen Burg neben Lord Loglard sitzen. Gemeinsam hatten sie die Bücher über die Scheibe der Ewigkeit studiert. Als sie begriffen hatte, wie wertvoll die Bände waren, hatte sie eine Entscheidung getroffen. Ehrlos, gewiss, aber angesichts der Umstände doch gerechtfertigt oder etwa nicht? Diese Frage hatte sie sich nicht nur mit jeder Meile gestellt, die sie zwischen sich und die Burg gebracht hatte, während sie, so schnell wie möglich, nach Norden wanderte. Nein, auch den ganzen harten Winter war sie mit dieser Frage eingeschlafen und aufgewacht. Fast alles hätte sie für ein Gespräch mit ihrem Mentor Uisdèan gegeben. Jetzt endlich hatte sich das Wetter soweit gebessert, dass sie die letzte Etappe ihrer Reise wagte.
Kalter Wind zerrte an ihrem Umhang. Ein scharfer Schnabel pickte nach den Gräten des Fisches und riss Kyla aus ihren Gedanken. Mit durchdringendem Geschrei flogen zwei Möwen hoch, balgten sich in der Luft um die leicht verdiente Beute. Erschrocken sah sie sich um. Dann stand sie auf, schlüpfte aus ihren Sachen, stopfte sie in den ölgetränkten Sack. Nur den Gürtel behielt sie um, versicherte sich, dass er gut saß über dem durchscheinenden Untergewand. Niemand weit und breit. Sandwüste, wohin das Auge blickte. Nur ab und zu trotzte ein stacheliges Grasbüschel dem scharfen Wind. Glutrot färbte die untergehende Sonne die rasch dahinziehenden Wolken.
Tief atmete Kyla ein und aus. Was nun folgte, war nicht angenehm. Doch der Gedanke an ihre Heimatstadt gab ihr Kraft. Schon morgen Früh würde sie endlich mit Uisdèan bei einer würzigen Tasse Tee sitzen. Zu besprechen gab es jede Menge.
Sie straffte sich und betrat die Steinbuhne. Nach wenigen Schritten leckten die ersten Wellen an ihren bloßen Füßen. Ein Schauder durchfuhr sie, als ein besonders heftiger Windstoß am Untergewand zerrte. Trotzig reckte sie das Kinn vor, solche Kleinigkeiten würden sie nun nicht mehr aufhalten. Vorsichtig ging sie weiter, ignorierte die scharfen Steine unter ihren Sohlen, wich Muschelteppichen und allzu frechen Wellen aus. Kyla hätte das Wasser im Zaum halten können, doch sie würde ihre Kraft noch für die Reise brauchen.
Als ihr das Meer bis zu den Knien reichte, hängte sie sich den Sack um, breitete die Arme aus und spürte nach der Magie in ihr, um einen komplizierten Spruch zu weben. Mit einer weit ausholenden Geste warf sie den magischen Ruf den Wellen entgegen. Kreischend flogen die Möwen auf.
»He, du! Nein, tu das nicht!«
Überrascht blickte Kyla nach hinten. Das durfte doch nicht wahr sein! Ein Muschelsammler rannte den Strand entlang. Er dachte wohl, sie wollte sich ertränken. Ihr Herz klopfte wild. Trotzdem bemühte sie sich, langsam weiterzugehen, Schritt für Schritt, tiefer hinein in die aufgewühlte See. Beinahe fühlte sie ihre Beine nicht mehr, so kalt war das Wasser.
»Tu’s nicht!«, hörte sie die Stimme nun schon sehr nah.
Sie rutschte aus, fing sich erst im letzten Augenblick. Wo blieb der versprochene Bote? Sie konnte nicht mehr umkehren. Der Elf, der sie aufhalten wollte, betrat gerade die Steinbuhne. In diesem Augenblick regte sich etwas unter Wasser. Bläschen stiegen auf, bildeten Wirbel, die um ihre Beine strichen. Eine Flosse teilte die Oberfläche. Sie atmete auf und spürte, wie ein Lächeln ihre verkniffenen Gesichtszüge lockerte.
»Brenk koara~n!«, flüsterte sie. Sofort bildeten sich links und rechts an ihrem Hals Kiemen.
»Nein, halt!«
Ohne sich umzusehen, glitt sie ins Meer. Wellen umfingen sie – und schneidende Kälte. Während sie immer tiefer sank, wob sie einen leichten Schutzzauber, um die Kälte abzuwehren, und doch nicht zu stark, um ihren Boten nicht zu verschrecken. Dunkelheit umfing sie, kleine Fische schwammen neugierig näher, Algenbüschel blieben an ihr hängen. Sollte sie sich getäuscht haben? War der Bote noch nicht da? Schlimmer noch: Kam sie zu spät? War Nisz während ihrer Abwesenheit untergegangen?
Mitten in diesen Überlegungen schälte sich ein kolossaler Mondfisch neben ihr aus der Dunkelheit. Sie legte die Hand leicht auf seinen Kopf. Dann wartete sie. Erst als er sich etwas zur Seite neigte und damit sein Einverständnis signalisierte, kletterte sie auf seinen Rücken. Mit ruhigen Schwimmbewegungen steuerte der Mondfisch die Tiefe an. Kyla atmete auf. Der schwierigste Teil ihrer Reise war geschafft.
Einige Stunden später grüßten die ersten Lichter von Nisz. Kurz vor dem Jadebogen bedankte Kyla sich bei ihrem Reisegefährten und entließ ihn. Sie schwamm zur Schleuse, jubelte innerlich, als sich die schwere, runde Tür öffnete. Die Wachen nickten ihr zu, sie betrat die Durchgangskammer. Auf dem gefliesten Boden zeugten Wasserpfützen vom regen Gebrauch.
»Herrin!« Eine Elfe in einfacher Kleidung verbeugte sich und reichte ihr ein weiches, angewärmtes Handtuch. »Meister Uisdèan lässt ausrichten, dass er Euch erwartet. Eure Kleider liegen bereit.«
Wenig später verließ Kyla die Schleuse durch einen Nebenausgang und folgte demSchleusenweg. Von Zeit zu Zeit blickte sie zum Jadebogen hinauf. Er schien in Ordnung. Wie viele Dschinn mochte ihr früherer Meister dieses Mal beschworen haben, um neue Lecks abzudichten? Nach einer Biegung blieb sie stehen. Obwohl sie so schnell wie möglich zu Uisdèan wollte, gönnte sie sich einen Moment, um den Anblick zu genießen. Wie sehr liebte sie diese Stadt!
Im Schein der künstlichen Sonne glitzerten und funkelten die Gebäude, die zumeist aus Glas gebaut waren, in den verschiedensten Farben. Ihnen verdankte die Stadt den Beinamen: die Strahlende. Viele Stockwerke hoch schmiegten sich die Bauten links und rechts an die türkis leuchtenden Grabenwände. Durchsichtige, in Pastelltönen schimmernde Brücken verbanden sie. Eine dieser Überführungen betrat Kyla nun, um hangaufwärts zum Zaubererviertel zu gelangen. Sie reckte sich, sog die Luft ein. Rasenflächen behaupteten ihren Platz zwischen den Gehwegen, bunte Blumen verströmten einen lieblichen Duft. Vor ihr bot eine Bäckerin herrlich duftendes Brot an. Daneben bewachte ein Mädchen den Stand mit frischem Gemüse. Trotz der frühen Stunde waren viele Morinji unterwegs. Und doch kam Kyla zügig voran, denn jeder kannte die nach Uisdèan zweitmächtigste Magierin von Nisz. Alle machten ihr ehrerbietig Platz. Schon bald erreichte sie ein etwas zurückgesetztes Haus; eindrucksvolle Glyphen zogen sich um den Fries. Den Kettenturm bewohnten traditionell die mächtigsten Magier von Nisz.
Gerade wollte sie klopfen, da wurde die Tür aufgerissen und sie versank in einer kräftigen Umarmung.
»Den Göttern sei Dank, du bist wohlbehalten zurück.« Uisdèan schämte sich seiner Tränen nicht.
Kyla erschrak, weil der Meister so müde aussah.
»Komm erst einmal herein«, fügte er hinzu.
Auf einem Tischchen standen eine Teekanne, zwei Becher aus hauchdünnem Porzellan und ein Korb mit Brötchen. In einer azurblauen Schale lag ein Stück Butter, in einer zweiten schimmerte Marmelade. Kyla nahm den Becher mit Tee entgegen, lehnte jedoch das Brötchen ab. Sie setzte sich und erzählte in groben Zügen, wie es ihr ergangen war. Schließlich überreichte sie ihrem Mentor den Gürtel.
Uisdèan runzelte die Stirn, legte ihn auf den Tisch und sprach: »Echu~in.«
Nur einen Wimpernschlag später riss der Leibgurt, beginnend an der Dornenschnalle, in der ganzen Länge auf. Brauner Nebel bildete sich und waberte um den Gurt. Dieser verlor mehr und mehr an Konsistenz, während sich der Dunst nach und nach verfestigte. In nur wenigen Augenblicken lagen zwei schwere Folianten vor ihnen. Der Gürtel war verschwunden.
»Sind das die Bände aus der Bibliothek?« Uisdèan starrte sie an. »Wie ist das möglich? Ihr habt sie doch nicht …?«
Unter seinem Blick wand sie sich. »Um Nisz steht es schlimm, nicht wahr?«, fragte sie eilig.
Schwerfällig setzte sich Uisdèan. War er schon seit Längerem immer mit dem Gehstock unterwegs gewesen, so stützte er sich nun bei jedem Schritt darauf. Die Falten in dem ohnehin runzeligen Gesicht teilten es wie tiefe Gräben.
»Ah, Nisz!« Sein Gesicht hellte sich auf. »Die Stadt ist genauso stark wie die Frauen aus dem Geschlecht d‘Elestre.« Er nahm einen Schluck.
Auch Kyla genoss den heißen Tee. Seit die Dschinn sie verwundet hatte, fühlte sie trotz der Heilung durch den Hohen Lord eine gewisse Schwäche in sich, eine Art von eisigem Fieber, das sie sich nicht erklären konnte.
Am liebsten hätte sie sich ein paar freie Tage gegönnt, wäre durch den Regenbogenpark spaziert, um sich die neuesten Glaskunstwerke anzusehen. Hätte in einem der kleinen Teehäuser am Westhang Algenkekse geknabbert und sich die neue Teeernte schmecken lassen. Sie seufzte auf, all das würde warten müssen.
»Wir werden den Jadebogen nicht mehr lange aufrechterhalten können.«
Fassungslos starrte sie ihren Mentor an. »Seid Ihr sicher?«, hauchte sie.
Freundlos lachte er auf. »In deinem Alter dachte ich auch, dass nichts mich aufhalten könnte. Aber jetzt …« Er hob die Arme, ließ sie gleich darauf kraftlos sinken.
»Dann ist es Zeit für meinen Plan.« Kyla straffte sich. Während der langen Wintermonate in Hathabor hatte sie genug Zeit gehabt, nachzudenken. Daraus war ein Vorhaben entstanden, das sie dem Meister nun erklärte. Als sie geendet hatte, schwieg Uisdèan. Nur das leise Geräusch, als er mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand den langen, weißen Bart zwirbelte, untermalte die Stille.
»Bist du sicher, dass du dich derart in Gefahr begeben willst?« Alte braune Augen wurden weich.
»Wie Ihr schon sagtet, Nisz und die Morinji sind jedes Risiko wert.« Sie stand auf. »Ich hoffe, dass Ihr mich in die Lichte Halle begleiten werdet.«
»Das ist das Mindeste, was ich tun kann«, versetzte er.
Sie erhoben sich. Er hakte sich bei seiner ehemaligen Schülerin unter, als sie den Turm verließen. Kyla trug wieder den kostbaren Gürtel.
Bewusst mied Kyla den Blick nach Westen. Eine hässliche Mauer verdeckte ein weiteres, nur dürftig verschlossenes Leck im Jadebogen. Sie presste die Lippen aufeinander und schwor sich, dem Ganzen ein Ende zu bereiten.
An der Lichten Halle angekommen, wurden sie ohne Verzögerung zum Herrscherpaar vorgelassen. Als sie eintraten, tagte gerade der Ministerrat. Königin Namira und König Rhodin saßen am Kopfende des langen Tisches.
»Seid gegrüßt, Meister Uisdèan und Magierin Kyla.« Rhodin nickte freundlich.
»Es freut uns außerordentlich, dass Ihr wohlbehalten zurückgekehrt seid, liebe Kyla«, fügte Namira hinzu. »Bitte, berichtet uns.«
Uisdèan nahm auf einem leeren Stuhl Platz, Kyla stellte sich neben ihn und sprach in die Runde: »Mylady, Mylord, werte Ratsmitglieder. Wie Ihr sicher schon von Balor erfahren habt, traf ich die Verwandte unserer Königin. Esmanté d‘Elestre ist eine tapfere Schwertmeisterin, verheiratet mit Lord Loglard de Gralon, dem Hohen Lord von Gwyneddion. Zusammen mit ihm fand ich in der Bibliothek der Silbernen Burg zwei sehr interessante Bücher, die sich mit der Scheibe der Ewigkeit befassen. Ich habe sie hier.«
Alle sahen erstaunt auf den Gürtel, den Kyla jetzt abnahm und auf den Tisch legte, wo er sich in zwei schwere Folianten verwandelte.
»Der König von Cérnowia hat Euch die Bücher überlassen?«, fragte Rhodin zweifelnd.
Kyla atmete durch, warf ihrem Meister einen Blick zu und antwortete: »Nein. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, habe ich sie gestohlen.«
Stille trat ein. Das Entsetzen stand jedem Anwesenden ins Gesicht geschrieben.
»Ihr mögt mich verurteilen, aber ich sage Euch: Diese Bücher sind wertvoll für uns, viel wertvoller, als sie es für die Cérn je sein könnten. Wir brauchen sie, um zu überleben.«
Ihr Blick schwenkte über das Königspaar und den General zu den übrigen Ratsmitgliedern. Niemand schien sie zu verstehen. Sicher, ihre Idee kam ihr selbst ungeheuerlich vor, aber sie sah keine andere Möglichkeit. Auch sie wurde von Skrupeln geplagt. Viele Nächte hatte sie mit Zweifeln und in großer Sorge verbracht. Nie in ihrem Leben hatte sie sich einsamer gefühlt. Fast hatte sie sich selbst als Verräterin an ihrem Volk gesehen, da sie die Morinji in Gefahr brachte. Fast hätte sie ihren Plan aufgegeben. Aber angesichts Uisdèans Schwäche und des neuerlichen Lecks im Jadebogen überwog nun die Gewissheit, dass sie handeln mussten – und zwar jetzt.
»Was wir brauchen, sind mächtige Magier«, sagte sie mit fester Stimme. »Wie ich am eigenen Leib erfahren habe, erstarkt der Orden der Creydillad unaufhaltsam. Mein Plan ist es, den Arsuri die Bücher anzubieten. Im Gegenzug verlange ich ihre Unterstützung bei der Stärkung des Jadebogens, so lange, bis wir die Scheibe gefunden haben.« Eisiges Schweigen folgte.
»Wir können doch nicht mit dem Orden zusammenarbeiten. Denkt an Magier Tavish!« Königin Namira hielt beim Sprechen die Hand mit den langen, schlanken Fingern vor den Mund, wohl um das Zittern der Lippen zu verbergen.
Dann sprang sie auf, stand nun mit dem Rücken zur Runde des Ministerrates, ihre Schultern bebten. Kyla waren die dunklen Augenringe der Herrscherin nicht entgangen. Nicht nur ihr Mentor war am Ende seiner Kräfte.
»Bei allem gebotenen Respekt, Mylady.« Uisdèan verbeugte sich ansatzweise im Sitzen. »Meine Kräfte reichen nicht ewig. Sicher, ich kann noch ein oder zwei Dschinn beschwören und beaufsichtigen, damit sie die Lecks stopfen. Aber dann …« Seine Arme klatschten gegen die blütenweiße Tunika. »Wir sollten unser Volk darauf vorbereiten, Nisz zu verlassen und auf die Insel der Springenden Lachse zu ziehen.«
Die letzten Worte lagen wie eine Drohung in der Luft.
»Oder aber Ihr gebt mir die Erlaubnis, nach Tyr Abath zu reisen.« Kyla forschte in dem bleichen Gesicht der Königin nach Zustimmung. »Den Berichten nach haben die Gward die Arsuri in diese Stadt in den Sümpfen zurückgedrängt. Ich bin sicher, dass ich den Orden dort finden werde.«
»Es ist riskant«, wandte König Rhodin ein. »Ihr kennt die Geschichten. Die Arsuri haben nur ein Ziel: die Herrschaft über Tiranorg. Das schließt natürlich das Nordmeer mit ein.« Er schüttelte sachte den Kopf. Dann suchte er ihren Blick und fragte: »Was steht in den Büchern, Magierin Kyla?«
Sie wechselte einen Blick mit Uisdèan, der unmerklich nickte.
»Nicht allzu viel von Bedeutung. Die Zwerge waren schon immer verschlossen. Die Bände hat ein Cérn verfasst, ein Historiker, Jahrzehnte nach dem Großen Zerwürfnis. Beschrieben wird, wie die Scheibe aussieht, was sie vermag, aber nur ein vager Hinweis darauf, warum sie derart machtvoll ist.« Absichtlich ließ sie den letzten Satz ausklingen.
»Warum sollten uns die Arsuri helfen, wenn die Bücher nichts enthalten, was für sie interessant sein könnte?«, wandte General Kelbot ein.
»Wir wissen eben nicht, worum es ihnen geht.« Kyla hob betont unschuldig die Schultern. »Tatsache ist, dass in diesen Folianten …« Sie klopfte auf die Einbände, es staubte ein wenig »... die Scheibe der Ewigkeit beschrieben ist. Für diese Information fordere ich den Schutz des Ordens. Ein fairer Handel, wie ich finde, denn meines Wissens gibt es keine anderen Schriften dieser Art.« Kyla nickte nachdrücklich und sah in die Runde.
»Wer sollte auf diese gefährliche Mission gehen?«, fragte der General.
»Das ist meine Aufgabe. Ich habe sie gestohlen, ich werde auch der Hehler sein«, bestimmte Kyla. »Der Dämon, den Kinnon beschworen hat, wird mich leiten.«
Eine stürmische Auseinandersetzung folgte, bis der König schließlich Ruhe befahl.
»Aber auf diese Weise erfahren sie von dem Geheimnis, das der Scheibe innewohnt, nicht wahr?«, wandte Namira ein.
»Das Geheimnis! Bei allem gebotenen Respekt, Mylady, Eure Vorfahrin wusste nur davon, weil es ihr der Zwerg in seiner Verliebtheit offenbarte. Wir werden es nicht für immer verheimlichen können.«
»Wenn es stimmt, dass der Orden bereits so mächtig ist, wäre es besser, ihn auf unserer Seite zu wissen. Niemand will ernsthaft die Arsuri zum Feind haben«, gab Rhodin zu bedenken.
»Das ist nicht Euer Ernst, Mylord«, polterte General Kelbot los. Sein Adjutant neben ihm nickte heftig.
Ein strenger Blick des Herrschers ließ ihn schweigen. »Wie groß ist unsere militärische Stärke?«, wollte er wissen.
»Nun ja …«, stotterte der General und schickte Uisdèan, der lächelte, einen bösen Blick. »Die jungen Leute wollen einfach nicht mehr lernen, wie man kämpft. Alle zaubern und glauben, nur weil sie Wasserblasen voller Fische schweben lassen können, gehört ihnen die Welt. Ha! Zu meiner Zeit …«
»Das genügt«, wies Rhodin ihn ungewohnt schroff in die Schranken. »Unsere Magier müssen den Jadebogen aufrechterhalten und wären deshalb keine Hilfe bei einem Angriff der Kampfmagier der Arsuri. Der wird aber mit Sicherheit sofort stattfinden, wenn sie erfahren, dass Kyla die beiden Bände gestohlen hat, die über die Scheibe Auskunft geben. Die Arsuri werden schnell begreifen, wo unser Schwachpunkt liegt.«
Kelbot sank auf seinem Platz zusammen.
»Es gefällt mir ebenso wenig wie Euch«, wandte sich Uisdèan ernst an den General. »Kyla ist meine Stellvertreterin, sie war auch immer meine Lieblingsschülerin; das ist kein Geheimnis. Ich vertraue ihr. « Er schenkte Kyla ein warmes Lächeln. »Der Orden nimmt, was er braucht, ohne lange zu fragen. Besser wir verhandeln, solange wir noch etwas zum Verhandeln haben.«
»Und bedenkt, sobald der Hohe Lord erfährt, dass ich die Bücher entwendet habe, wird er sie mit aller Macht zurückfordern«, ergänzte Kyla. »Sicher wäre es besser, wenn wir dann bereits unter dem Schutz der Arsuri stünden.«
Einige Zeit saßen sie schweigend zusammen.
»Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn der Orden die Scheibe vor uns findet« wisperte die Königin und senkte den Kopf.
»Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist.« Rhodin stand auf und legte die Hand fürsorglich auf die Schulter seiner Gefährtin. Namira griff danach und drückte sie.
»Zuerst geht es für uns ums Überleben«, bekräftigte Uisdèan. »Und dabei ist der Orden leider am besten geeignet.«
2. Eine Schnapsidee
»Flieht!« – »Rettet Euch!« – »Sie sind dicht hinter uns!«
Pferdehufe trommelten auf den matschigen Boden, dass der Dreck nur so spritzte. Räder bohrten sich tief in den Grund. Eine Kutsche preschte heran, geriet in gefährliche Schieflage, fing sich im allerletzten Moment. Unermüdlich sausten Gerten auf die Rücken der dampfenden Pferde. Schaum tropfte von ihren Mäulern. Mehrere Elfen in einfacher Kleidung, nicht wenige verletzt, rannten hinterher. Eine Frau trug ein Kind, das schlaff in ihren Armen lag. Sie selbst war leichenblass, auf ihrer Stirn klebte getrocknetes Blut. Wolkenwind wieherte, ich dirigierte ihn beiseite.
»Was ist los?« Téfor sprang vom Pferd, warf Londo die Zügel zu und packte einen Knecht roh am Arm.
»Herr, die Orks!« Der Mann versuchte vergeblich, sich aus dem eisernen Griff meines Freundes zu winden.
Orks! Wie auf ein geheimes Kommando spannten wir uns alle an. Spätestens jetzt wusste ich, dass ich den größten aller möglichen Fehler begangen hatte.
Es war eine Schnapsidee gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten vor gerade mal zwei Tagen ein Rudel junger Trolle durch den Flüsternden Wald gejagt bis dicht an das Ufer des Perlenden Flusses. Danach feierten wir, wie es sich gehört, denn Eobar hatte ihren ersten Troll ohne Hilfe erledigt. Und ja, dann war die Idee entstanden, das Magiertreffen, zu dem Loglard gereist war, auszunutzen – für eine Stippvisite in Cérnowia. Wie in alten Zeiten. Kein Königinnengetue. Kein ewig großer Tross. Keine Leibgarde aus grimmig dreinblickenden Bogenschützen. Kein Hofgequatsche. Nur meine Freunde und ich. Gut, jede Menge Bergnebel war im Spiel gewesen. Mira hatte tatsächlich ein Fässchen in der Größe eines Kinderkopfes aus den Tiefen ihrer Satteltaschen gezaubert, das am Ende des Abends leer gewesen war. Und am nächsten Morgen hatte ich mich diesseits des Perlenden Flusses befunden, mit albtraumhaften Kopfschmerzen. Als mir endlich klar wurde, welche Dummheit ich begangen hatte, lag der Bannwald bereits hinter uns und wir ritten gen Norden. Dann trafen wir auch noch Téfor, der nach einem Besuch seiner Schwester in Plouhinec auf dem Heimweg nach Grianan Aileach war.
»Wie viele Orks?«, fragte ich.
Der Kutsche folgte eine Prozession verletzter und erschöpfter Bauern, die ihre spärliche Habe schleppten. Kinder weinten.
»Wie viele?« Téfor rüttelte den Kerl, der im Übrigen noch ziemlich unverletzt aussah.
»Was weiß ich? Lasst mich los. Mein Herr braucht mich.« Der Mann holte aus, doch Téfor blockte ihn mühelos ab, packte ihn an beiden Armen und zischte:
»Siehst du nicht, wen du vor dir hast, Bauerntölpel?«
»Nein!«, donnerte ich und Téfor zuckte zusammen.
Ich dirigierte Wolkenwind zu dem Burschen, die Rechte betont unauffällig am halb herausgezogenen Schwertgriff.
»Ich bin Schwertmeisterin, also antworte, sofort!«, befahl ich.
Es war nicht nötig, mich als die Gefährtin des Königs von Gwyneddion vorzustellen.
»Eine Kohorte, vielleicht mehr«, knurrte der Bauer. Dadurch bewies er, dass er durchaus über militärische Kenntnisse verfügte.
»Der Seneschall selbst kämpft mit seinen Männern, aber … da ist noch etwas anderes auf dem Schlachtfeld …«
Bevor er weitersprechen konnte, stob eine neue Gruppe Flüchtlinge heran, dieses Mal zu Pferde.
»Lauft, sie kommen! Bringt euch in Sicherheit!« Ein gut genährter Händler schrie in wilder Panik, hüpfte dabei im Sattel auf und ab.
Das Tier tat mir leid. Der Bursche nutzte die Ablenkung, riss sich los und verschwand im Tross der Flüchtlinge. Verfluchte Sauerei! Er hätte uns noch wertvolle Informationen geben können.
»Also, was nun?« Mit zusammengekniffenen Augen sah Mira dem Fliehenden hinterher.
Wir lenkten die Pferde zur Seite. Kel, mein Hund, folgte uns knurrend.
»Das hat mir gerade noch gefehlt.« Ich spuckte auf die Erde. »Wie war das? Nur ein kurzer Ausflug. Du bist zurück, wenn der Hohe Lord heimkehrt. Ah, bei allen Höllenfeuern! Was für ein riesiger, stinkender, vor Maden wimmelnder Kackhaufen von Trollscheiße!«
»Wenn der Meister gegen Orks kämpft, sollten wir nachsehen, ob er Hilfe braucht«, wandte Andrah vorsichtig ein.
»Ja, ist mir auch klar. Pert, was meint Ihr?«
Um wirklich das Fass zum Überlaufen zu bringen, hatte Master Pert sich uns nämlich angeschlossen, der Anführer der Bogenschützen von Gwyneddion. Reihum hatte er erklärt, es ginge ihm um ein Cérnmädchen, das er voriges Jahr auf der Burg kennengelernt hatte und er wollte die Gelegenheit nutzen, es wiederzusehen. Ich mutmaßte eher, dass er mich beschützen wollte. Jedenfalls musste ich jetzt Loglard erklären, warum ich nicht nur mich, sondern auch vier seiner besten Bogenschützen in Gefahr gebracht hatte.
Téfor dachte wohl das Gleiche, denn noch im Galopp rief er Perts Leuten zu: »Kommt mir nicht in die Quere, Ladys. Auf die Königin passe ich selbst auf!«
Die Bogenschützen tauschten grimmige Blicke. Ich wurde wütend. Das Letzte, was ich vor einem Kampf brauchte, waren Zwistigkeiten in der eigenen Truppe.
»Der Tag, an dem ich Geleitschutz brauche, wird auch mein letzter sein. Hörst du, Téfor? Also steh mir nicht im Weg, Kleiner«, konterte ich grimmig, »sonst kann ich für nichts garantieren.«
Mit einem Schenkeldruck spornte ich Wolkenwind an und setzte mich an die Spitze unserer kleinen Truppe. Alle trieben die Pferde an. Immer wieder wichen wir Flüchtlingen aus. Die hügelige Gegend rund um Vermit verbot einen Überblick, aber bald schon stiegen an verschiedenen Stellen hohe Rauchsäulen in den grauen Himmel. Ein klares Zeichen. Die Orks hatten die Weiler überfallen. Ich betete zur großen Göttin Scathach, dass der Bursche die Wahrheit gesagt und Meister Montard mit den Kriegern vor Ort war. Gegen eine Kohorte Orks hatten wir allein keine Chance.
Die Heerstraße führte uns ein Stück weiter nach Norden, umrundete einen Hügel. In diesem Moment gab das Wolkengebirge die Sonne frei und sie schaffte es, einen Strahl auf die Erde zu schicken. Helme blitzten im goldenen Schein auf, Schilde und unzählige Schwerter. Inmitten des Gewühls erkannte ich Meister Montards Standarte und dankte Scathach. Doch die Lage hätte nicht verzwickter sein können.
Ausgerechnet hier, am Durchgang zwischen zwei Hügeln, hatten die Orks angegriffen. Dichter Wald verhinderte ein Ausweichen. Die langen Lanzen verschafften unseren Feinden zudem einen nicht unerheblichen Vorteil. Jetzt galt es, schnell zu handeln. Wie hatte Meister Gowan immer gesagt: Greif den Gegner an, wenn er unvorbereitet ist!
»Pert?«
»Kein Problem, Mylady.« Auf seinem Gesicht lag ein überheblicher Ausdruck. Er ließ seinen Blick über das Gewimmel vor uns schweifen, musterte die ansteigenden bewaldeten Hügel. »Wir postieren uns dort.« Sein Finger in halblangen Handschuhen wies auf den linken Hügel. »Am Waldrand haben wir freies Schussfeld. Von da rollen wir die Nachhut auf.«
»Gut, Andrah, du gehst mit ihnen. Sobald die Scheißkerle spitzkriegen, wer sie beschießt, schützt du Master Pert und seine Männer.«
»Aye.« Andrah nickte mir zu, wandte sich dann an die Gwydd. »Kommt!«, sagte sie knapp.
Dass sie lieber mit uns geritten wäre, ließ sie sich nicht anmerken. Doch sie wusste so gut wie ich, wie wichtig es war, die Bogenschützen zu verteidigen. Orks waren nicht dumm.
»Wir warten, bis ihr in Position seid. Beeilt euch!«, rief ich ihnen hinterher.
Langsam ritten wir näher. Nach meinem Gefühl dauerte es eine halbe Ewigkeit. Jeden Moment fürchtete ich, die Standarte des Meisters würde sinken. Schon längst konnte ich nicht mehr ausmachen, wie das Gefecht stand. Endlich machten wir die ersten Pfeile aus, die beinahe gleichzeitig über der Nachhut der Orks niedergingen. Das war unser Zeichen. Wir spornten die Pferde an.
»Heute ist ein guter Tag, um Orks zu jagen!«, brüllte Téfor.
Ich musste grinsen. Mittlerweile trugen wir alle Handschuhe. Mira überprüfte den Sitz ihres Zopfes und stopfte das Ende im Nacken in das Wams. Keiner von uns war wirklich für einen großen Kampf ausgerüstet. Trotzdem hätte niemand ernsthaft erwogen, den Meister oder einen seiner Krieger im Stich zu lassen.
Ein letztes Stoßgebet an die Göttin schaffte ich noch, bevor ich in die Kämpfe eintauchte. Eobar wich nicht von meiner Seite. Teilte aus, fluchte sogar noch lästerlicher als ich. Das harte Training der letzten Zeit machte sich bezahlt. Jetzt zeigte sie, was sie gelernt hatte.
Obwohl nur zu zehnt, entschieden wir etliche Einzelkämpfe für uns. Leider währte der Vorteil der Überraschung nicht lange. Einige Orks brüllten, andere antworteten. Ihr Anführer, ein beleibter Hüne mit Ohren von beachtlicher Länge, sah sich um. Was dieser Mistkerl in Ruhe tun konnte, während mehrere Weibchen ihn mit ihren Lanzen schützten. Er bemerkte den Pfeilhagel, schrie einen Befehl. Schon setzten sich drei seiner Leute in Bewegung. Da scherte Mira aus, hielt auf den Letzten zu. Sie trieb ihr Pferd an, ihr Schwert sirrte und schlug dem Ork den Kopf ab. Solange wir im Sattel saßen, hatten wir den Vorteil noch auf unserer Seite.
Im Gegensatz zum Anführer unserer Feinde blieb mir keine Zeit, mich in Ruhe umzusehen. Zwei Orks stürmten heran – kräftige, kampferfahrene Kerle. Ich konzentrierte mich auf sie. Es gab nur zwei Stellen, an denen man sie verwunden konnte. Entweder direkt am Hals, denn Schultern und Brust waren durch metallene Panzerungen geschützt, oder oberhalb des breiten Gürtels, der mit dem Zeichen des Stammes versehen war. Die dicken Lederhosen, an den Knien verstärkt, und die klobigen Fellstiefel waren undurchdringlich.
Gerade eben sprang ein Ork über einen am Boden liegenden Cérnkrieger, baute sich vor mir auf, die Kampfaxt brüllend über dem Kopf schwenkend. Der Cérn, den der Ork wohl für halbtot hielt, richtete sich unter Stöhnen auf. Mit der letzten Kraft, die er aufbringen konnte, stach der Cérn in den Hals des Gegners. Das Brüllen verstummte, der Ork kippte nach vorn, begrub den Elfen unter seinem massigen Leib.
Zu gern hätte ich den Soldaten geborgen, doch schon jagte der nächste Ork heran, auch er schwang seine Kampfaxt. Ich stieß Wolkenwind den Stiefelabsatz in die Flanken, das Pferd machte einen Satz und ich versenkte Akrya in dem Bauch des Ork. Vor Wut und Schmerz funkelten seine Augen rotorange, aber da war ich bereits an ihm vorbei. Eobar erledigte den Rest, indem sie ihm das Schwert durch den Hals trieb.
Für mich gab es nur ein Ziel – näher an den Meister, um ihn zu unterstützen. Unsere Gegner machten es mir jedoch nicht leicht. Gerade hatte ein Weibchen einen unserer Krieger mit ihrer Lanze getötet und drehte sich zufrieden herum. Grimmig trieb ich Akrya durch ihren Hals, wartete nicht ab, bis sie zusammengebrochen war. Eobar neben mir schrie auf. Ein Ork, der wohl seine Kampfaxt verloren hatte, zerrte sie aus dem Sattel.
»Verfluchte Arschgeige!«, schrie sie und donnerte ihm die harte Ledersohle ihres Stiefels ins Gesicht.
Grünes Blut tropfte aus einer Wunde, doch das störte den Kerl nicht allzu sehr. Er grunzte, machte Anstalten, die Hauer in die weiche Flanke von Eobars Pferd zu versenken. Doch in diesem Moment bohrte sich mein Dolch in sein Auge. Das Brüllen war infernalisch, immerhin ließ er von Eobar ab. Die beugte sich kaltblütig vor, zog ihm die Waffe aus dem Auge und stieß sie ihm in die Kehle.
»Nicht mit mir!« Sie zog den Dolch wieder heraus.
Ich holte mir mit einem anerkennenden Nicken meine Waffe zurück, wurde sofort von einem Ork attackiert, der glaubte, seine Kampfaxt nach mir werfen zu müssen. Ich duckte mich, unterlief so seine Abwehr, damit Akrya ihr Ziel im weichen Fleisch seines Bauches fand.
Im selben Augenblick durchfuhr mich ein stechender Schmerz. Verdammt! Eine Lanze steckte in meinem Bein. Das Weibchen, das sie gestoßen hatte, grinste, entblößte dabei zwei veritable Hauer. Doch im gleichen Moment machte sich ungläubige Überraschung auf ihrem Gesicht breit. Eine Schwertspitze ragte aus ihrem Bauch.
Téfor spuckte auf den Boden, als er seine Klinge wieder herauszog. »Verflucht, pass besser auf!«, schimpfte er, dirigierte sein Pferd heran, zog vorsichtig die Lanze aus meinem Bein.
»Mach mir keine Vorschriften«, giftete ich.
Die Wunde blutete heftig. Mit einem Griff zog ich ein Stück Stoff, das genau zu dem Zweck obenauf lag, aus der Satteltasche und band es fest um mein Bein. Meine Fleischwunde war nichts, was es rechtfertigen würde, aufzuhören. Derweil kümmerten sich Téfor, Londo, Mira und Eobar weiter um die anrückenden Feinde.
»Ich liebe dich auch«, grinste Téfor, schlug im gleichen Augenblick einem Ork einen Arm ab.
»Du bist verrückt«, erwiderte ich und stellte mich einem Weibchen, das auf mich lauerte. Aha, sie wurden vorsichtiger.
In diesem Moment erschütterte eine Fanfare das Schlachtgetümmel. Der Boden vibrierte, die Kämpfe erlahmten. Aus dem Hügel rechts von uns brachen drei Ungeheuer hervor. Etwas Derartiges hatte ich nie zuvor gesehen.
In ihrer Gestalt ähnelten sie am ehesten Trollen; riesigen, haarlosen, bleichen Trollen; mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so groß wie ich. Sie trampelten die letzten Bäume nieder, jeder schwang einen Morgenstern in der Größe eines Elfen. Wahre Muskelgebirge bildeten den Nacken und die Arme, ließen sie nach vorn gebeugt gehen. Jetzt hielten sie einen Moment inne, so, als wollten sie sicherstellen, dass wir sie auch sahen. Dann fielen sie beinahe gleichzeitig vornüber, sodass sie nun auf allen vieren in atemberaubendem Tempo den Hügel herunterstürmten, alles zermalmend, was ihnen in den Weg kam. Sie fegten Orks und Cérn gleichermaßen beiseite. Ihr Morgenstern fuhr eine blutige Ernte ein.
Pert und seine Männer reagierten schnell. Ohne auf ein Zeichen von mir zu warten, konzentrierten sich die Bogenschützen auf die Ungeheuer. Aber die leichenweiße Haut schien undurchdringlich. Wirkungslos prallten die meisten Pfeile ab, obwohl die Monster so gut wie keine Kleidung trugen. Die Muskelgebirge rund um die Schultern schützte ein winziger Schulterharnisch, von dem allerdings mehrere Dornen abstanden. Um die Hüften war ein etwa eine Elle breiter Ledergürtel geschwungen, den eine Schließe in Form eines übergroßen Schädels zierte. Nur ein dreckiger Stofffetzen bedeckte, was Genitalien sein mochten. Arm- und Beingelenke wurden von dicken Lederstulpen umschlossen, ansonsten liefen sie barfuß. Der Hals war unter den Muskeln beinahe nicht zu erkennen. Auf ihm saß der im Verhältnis zum Rest des Körpers klein anmutende Kopf, der an einen Totenschädel der Orks erinnerte. Dünnes, weißes Haar flatterte, als sie losrannten.
Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Riesen brüllten, um ihre Überlegenheit zu untermauern. Ich sah mich jedoch getäuscht. Gespenstisch ruhig stürmten sie heran, nur einer von ihnen blies ab und zu in eine lange, gebogene Stange, eine Kriegstrompete, deren Ton den Boden erschütterte.
»Sammelt euch!« Das war eindeutig Montard, der unser Signal über ein Horn verbreiten ließ.
Die Orks, die sich nun unversehens zwischen uns und den neuen Angreifern eingezwängt vorfanden, nahmen die Kämpfe wieder auf. Der Meister versuchte, seine Einheiten zu einer geordneten Kampfformation aufzustellen, aber da das Terrain begrenzt war, gelang es nicht. Pert stoppte den Bogenangriff, sobald die Ungeheuer unsere Reihen erreicht hatten, um nicht die eigenen Leute zu treffen. Stattdessen beschossen sie die Orks, die es geschafft hatten, dem Gedränge zu entfliehen und sich nach Süden in Sicherheit bringen wollten.
Londo schloss zu mir auf, desgleichen Eobar und Téfor. Doch ich sah den Seneschall selbst nicht. Leider war keine Zeit, sich um ihn zu kümmern. Denn einer der Mistkerle scherte aus und hielt auf die Bogenschützen zu.
»Das erledige ich!«, rief Londo.
Mira kämpfte sich durch die Orkreihen und brachte Pert mit. Zusammen begannen wir von der Seite her, die Linien der Orks aufzubrechen.
Die hatten sich von ihrem Schock erholt. Ihr Anführer schrie einen Befehl. Sogleich sammelten sich fünf seiner Männer, hoben ihre Streitäxte und stellten sich dem ersten Riesen. Ihre Taktik war denkbar einfach: sich außerhalb der Reichweite des furchtbaren Morgensterns halten und abwechselnd angreifen, um auf diese Weise die Mistkerle auszubluten. Zwei Weibchen unterstützten mit Lanzen. Sie versuchten, dem grunzenden Ungeheuer die Sehnen in Unterschenkel und Knie zu durchtrennen.
Keine schlechte Strategie, dachte ich mir. Auch Téfor neben mir meinte: »Könnte klappen.«
Derweil erwehrten wir uns der Orks, die trotz ihres Rückzugs anscheinend darauf brannten, Elfenblut zu vergießen. Ihr Ansturm wurde drängender. Die fünf, die sich dem Riesen gestellt hatten, wiesen bereits zahlreiche Wunden auf. Der dritte Riese wütete unter ihnen wie ein wahrgewordener Albtraum.
Gerade zog ich Akrya aus dem Bauch eines Orks, fluchte, weil ich gleichzeitig eine Stichwunde am Arm hatte einstecken müssen, da sah ich, dass auch der Meister von dem dritten Riesen angegriffen wurde. Der zerrte als Erstes die Standarte aus dem Boden, wedelte einen Moment damit herum, als wäre sie ein Spielzeug, verzog dabei die Öffnung in seinem Gesicht, die vielleicht ein Mund war. Noch nie hatte ich so große und so spitze Zähne gesehen. Sie blitzten sogar jetzt im trüben Licht der späten Nachmittagssonne. Zwar schützten etwa zehn Cérn den Meister, doch es sah gleichwohl nicht gut aus. Der Morgenstern war eine grausame Waffe.
»Schnell!«, rief Mira, die ebenfalls alles beobachtet hatte.
Wir spornten die Pferde an. Wolkenwind trampelte einen Ork nieder, der seine Axt gerade erhob. Eobar erstach einen von ihnen, der bereits verwundet war, aber trotzdem angriff.
Greif den Feind dort an, wo er unvorbereitet ist, hörte ich Meister Gowans Stimme. Nun, momentan wäre er wohl nicht sehr zufrieden mit mir.
Wir kamen von vorn. Der Riese begrüßte uns mit einem tiefen Brummen, das unsere Ohren zum Klingeln brachte. Als er mit dem Fuß aufstampfte, vibrierte der Boden. Jetzt holte er aus, im Rückschwung mähte er mehrere Orks nieder, schon sauste der Morgenstern erneut herunter. Jeder duckte sich. Scathach sei Dank wurde kein Cérn verletzt. Zornig stampfte der Riese auf, Geifer tropfte aus seinem Maul. Die lidlosen grün-gelben Augen stierten uns an. In seinem Gesicht gab es keine Nase, nur ein Loch, aus dem gelbliches Sekret floss.
»Haltet ihn hin!«, rief ich und wartete nicht auf Antwort.
Es gab nur eine Chance. Er war groß und unwahrscheinlich stark. Beides machte bekanntlich unbeweglich. Die Orks hatten das schnell erkannt. Ich war wild entschlossen, diese Schwäche ebenfalls auszunutzen. Aber dazu musste ich zuerst hinter das Vieh gelangen.
Mittlerweile stellten sich uns immer weniger Orks entgegen. Die meisten flüchteten, einige wenige schlossen sich der Gruppe an, die den zweiten Riesen gestellt hatte. Momentan war keine Zeit, nachzusehen, wie sich Andrah und Londo schlugen.
Wolkenwind leistete heute kräftezehrende Arbeit. Sein Fall glänzte schweißnass. Als ich wieder die Zügel anzog, wieherte er empört. Doch es half nichts. Zuerst musste ich den Albtraum beseitigen, danach konnte ich mich um ihn kümmern. Wie erhofft wurde der Riese von den anderen Kriegern abgelenkt, die sich redlich mühten, ihm kleinere Verletzungen beizubringen, ohne selbst getötet zu werden.
Jetzt kam es darauf an. Wieder schwang der Morgenstern wie das Pendel einer Uhr zurück. Mittlerweile war ich so nahe, dass ich beobachten konnte, wie die schweren Muskeln gleich Wellen unter der bleichen Haut dahinrollten, als der Riese die monströse Waffe hob. Leider war ich noch nicht nahe genug. Wolkenwind scheute vor dem widerwärtigen Geruch, der von dem Riesen ausging: süßlich, schwer, nach Tod und Fäulnis.
Die massige Gestalt verwehrte mir jetzt die Sicht auf den Morgenstern, aber ich musste ihn treffen. Die Krieger brüllten auf, einer warf sich zwischen die Beine des Riesen und stach mit dem Schwert nach oben. Keine schlechte Idee, doch leider traf der Krieger nicht. Stattdessen holte der Riese aus, kickte den Cérn beiseite als wäre er ein Kieselstein. Wut überkam mich. Diese von allen Nornen und Dämonen verfluchte Missgeburt! Unbarmherzig dirigierte ich Wolkenwind näher, legte die Zügel beiseite, schwang das Bein herüber und wartete auf den richtigen Augenblick.
Es gab nur diesen einen Versuch, das wusste ich. Schon pendelte der Morgenstern nach hinten. Da – der höchste Punkt. Ich drückte mich ab, landete auf dem Boden, packte den Griff des Morgensterns, nutzte seinen Schwung aus. Tatsächlich konnte der Riese die Bewegung, wie erhofft, nicht so schnell stoppen. Er ließ ein gefährliches Grollen hören. Das kümmerte mich nicht. Vielmehr zog ich mich am Griff des Morgensterns hoch, wich seiner linken Hand aus, kletterte über Dornen, so groß wie mein Arm. Zog meinen Dolch und benutzte ihn als Kletterhilfe. Ich drang nicht tief ein, nur wenige Zoll, aber es reichte, um mir Halt zu geben. Einstechen, hochziehen, einstechen, hochziehen … Das Monster blutete nicht. Wieso nur? Ich verdrängte den Gedanken. Jetzt ragte der Metallharnisch der Schulter vor mit auf. Ich griff zu. Schaffte es, in einer Schnürung Fuß zu fassen, saß auf seiner Schulter, noch bevor er selbst es wusste. Opferte einen Moment, um mich aufzurichten und die Balance zu halten.
Der Gestank war unbeschreiblich. Mit jedem neuen Atemzug strömten Tod und Fäulnis in meine Lungen. Doch das war meine geringste Sorge, denn der Riese schüttelte sich, als wollte er ein lästiges Insekt loswerden. Seine linke Hand griff immer wieder nach mir. Sei es, weil er in der Nähe nicht so gut sah; sei es, weil die Krieger ihn mit Angriffen reizten, jedenfalls verfehlte mich die klobige Hand. Ich packte eine Haarsträhne. Sie fühlte sich an wie Stroh. Egal. Ich atmete ein und stieß ihm den Dolch in die Öffnung, die ich für das Ohr hielt. Riss den Dolch wieder heraus, stach erneut zu, noch einmal mit aller Kraft. Heißes, gelbes Blut sprudelte hervor, brannte auf meiner Hand. Ein weiteres Mal stach ich zu. Doch da packte mich eine Hand, die nur aus Daumen und zwei Fingern bestand, und schleuderte mich beiseite. Ich zog den Kopf ein, bereitete mich auf den Aufprall vor, überschlug mich mehrmals. Sofort war ich wieder auf den Beinen, denn ich wollte nicht als Orkfutter enden.
Scathach hatte ein Einsehen. Kein Ork in der Nähe. Dafür schwankte das Ungetüm. Jetzt sprangen mehrere Krieger gleichzeitig vor, klammerten sich an seine Beine, bohrten ihre Schwerter in die Kniebeugen des Monsters. Und tatsächlich! Die Bestie taumelte, fuchtelte mit seiner Waffe, machte einen Schritt – stolperte. Alle brachten sich in Sicherheit. Der Morgenstern fiel ihm aus der Hand und polterte zu Boden. Trotzdem griff der Riese nach einem der Krieger, packte ihn, wohl um ihn auseinanderzureißen. Das widerwärtige Vieh wollte einfach nicht abtreten!
Der Cérn schrie. Meister Montard trat vor. Obwohl sein Haar grauer geworden war, bewegte er sich immer noch schnell und geschmeidig. Er rief dem Riesen etwas zu, reckte das Schwert, hieb ihm den halben Fuß ab. Die Bestie legte den Kopf in den Nacken, als ob sie schreien wollte. Es war gespenstisch, dass nur ein Gurgeln aus seiner Kehle drang. Einen Wimpernschlag später hob er den gigantischen Morgenstern und schlug zu. Der Meister wurde hinweggemäht wie trockenes Gras. Für einen Moment konnte ich nicht mehr atmen, starrte dorthin, wo der Meister gerade noch gestanden hatte, war unfähig, mich zu bewegen. Erst als meine Lungen protestierten, sog ich tief die Luft ein. Schlagartig kehrte die Wut zurück.
Ich rannte los, hob Akrya, deren Scheide von gelbem Blut bedeckt war. Einige Krieger waren schneller als ich. Sie attackierten den Riesen, der schließlich zu Boden fiel wie ein gefällter Baum. Um sicher zu gehen, stieß ihm Mira die Klinge in den Hals, doch er bewegte sich schon nicht mehr.
Als ich zum Hügel links von uns hinaufsah, bemerkte ich erleichtert, dass auch der zweite Riese tot war. Mehrere Pfeile ragten aus beiden Augen. Ein abgetrennter Arm lag etwas abseits. Wie von Sinnen hieb ein Cérn auf den leblosen Körper ein.
Den dritten Riesen mussten die Orks erledigt haben. Ein wahrer Wald an Lanzen steckte in seinem Körper und im Gesicht. Auch die Orks hatten einen hohen Preis bezahlt. Rings um das tote Monster sah man nur Leichen, von ihren Kameraden zurückgelassen. Kein lebender Ork weit und breit.
Londo und Andrah ritten herunter. Zusammen sahen wir nach dem Meister.
Die Krieger hatten Umhänge auf dem Boden ausgebreitet und den Seneschall darauf gebettet. Dennoch sah ich auf einen Blick, wie die Nässe den Stoff durchdrang. Montard selbst war blutüberströmt und zitterte. Aus der zerfetzten rechten Seite ragten Knochensplitter. Das rechte Ohr war abgerissen, teilweise getrocknetes Blut färbte den Bart rostrot. Mein Herz hämmerte so laut, dass es in meinen Ohren dröhnte.
»Meister!« Ohne auf den Dreck und die Kälte zu achten, kniete ich mich neben ihn, legte die Hand auf seine eiskalte, schweißnasse Stirn.
Seine Lider flatterten. Er öffnete das unverletzte Auge, ein Lächeln breitete sich über sein Gesicht aus.
»Esmanté …« Er hustete und stöhnte, Blut sickerte aus seinem Mund.
Geflüster wogte um uns. Erst als ich streng aufsah, verstummte es.
»Lasst mich durch! Schnell!«
Einen irren Moment lang glaubte ich, Loglard würde sich durch die Krieger drängen. Wenn er jetzt nur hier wäre! Es war jedoch ein Cérnkrieger, der wohl auch als Feldscher diente. Er kniete sich neben mich, nahm die Hand des Meisters und horchte auf die Atemzüge. Dann öffnete der Feldscher vorsichtig ein Augenlid.
In diesen wenigen Augenblicken rief ich alle Götter an, die ich kannte. Doch nicht mal Scathach hatte ein Einsehen. Beinahe glaubte ich, die Rufe der Großen Banshee zu hören. Der Cérn schüttelte sachte den Kopf. Blutstropfen sprenkelten seine Hose, als Montard keuchte und hustete.
»Könnt Ihr gar nichts tun?«, fauchte ich, voller Wut auf mich selbst und darauf, dass Loglard nicht da war, um zu helfen.
»Ich kann ihm Mohnkraut geben, dann wird … es … leichter.«
»Tut es«, bestimmte ich, als niemand sonst die Führung übernahm.
Der Cérn öffnete eine Tasche, holte ein Säckchen heraus, in dem getrocknete Kräuter lagen, bat um Wasser, das ein junger Krieger ihm sofort in einem zerbeulten Becher reichte, und mischte einen Trank.
»Der Meister muss davon trinken, so viel wie möglich.« Er reichte mir den Becher.
Ich kniete mich wieder zu Montard, nahm seine kalte, feuchte Hand. Die Schwielen rieben sich an meinen.
»Bitte, Meister, Ihr müsst dies trinken«, versuchte ich mein Glück. »Es nimmt die Schmerzen.«
Montard öffnete die Augen, wollte etwas sagen, röchelte nur. Dennoch schaffte ich es, ihm ein paar Schlucke einzuflößen. Nach bangen Minuten des Wartens beruhigte sich sein Atem. Er drehte den Kopf zu mir und lächelte leicht.
»Mohnkraut, hm«, murmelte er.
»Ihr schafft das«, beharrte ich, obwohl ich genau wusste, dass es nicht stimmte.
Schwach hob er die Hand: »Lüg nicht, Esmanté.« Er schloss kurz die Augen. »Es ist Scathachs Wille«, fügte er flüsternd hinzu.
Die wenigen Worte riefen einen Hustenanfall hervor, der seinen ganzen Körper erschütterte. Blut sickerte aus seinem Mund, das ich wegwischte.
»Pass auf dich auf, Esmanté.« Der Druck seiner Hand war stärker geworden. »Du hast jetzt ein Kind und einen Gefährten. Uns stehen harte Zeiten bevor. Diese Riesen …« Er hustete, Tropfen verteilten sich über das Wams. »Gib mir …«
Vage deutete seine Hand neben sich, aber ich wusste auch so, was er wollte. Londo brachte das Schwert.
»Hier!« Weil der Meister die Waffe nicht mehr heben konnte, legte ich sie an seine Seite.
Doch er war nicht zufrieden. Obwohl sein Brustkorb sich quälend langsam hob, verlangte er, dass das schwere Schwert auf ihm lag. Das Gemurmel um uns erstarb, ich blickte auf. Jeder Cérn, der noch stehen konnte, hatte sein Schwert erhoben. Ernste, verschlossene Mienen sahen auf den Meister und mich herunter. Also nahm auch ich Akrya, ihre Spitze wies nur eine handbreit neben den Meister auf den Boden.
»Scathach wird Euch erwarten, Meister Montard«, deklamierte ich. »Sie wird ihre Raben schicken, um Euch zu empfangen. Ihr habt so viel Ruhm und Ehre im Kampf erworben, dass Euch ein Platz an ihrer Tafel zusteht. Ihr werdet mit den größten Helden feiern, vom heutigen Tag an bis zu dem Moment, an dem der Ruf an uns alle ergeht, die letzte Schlacht zu schlagen.«
Einer der Krieger stimmte leise eine Melodie an – heiser, zögernd. Immer mehr fielen mit ein, sangen das letzte Lied, das die Seele des Meisters in die Anderswelt geleiten würde. Auch ich stimmte ein, obwohl meine Kehle zugeschnürt war. Ich umklammerte den Schwertgriff, in der Hoffnung, er würde mir Stärke verleihen, blinzelte die Tränen weg und ignorierte den schweren, kalten Stein, der einmal mein Herz gewesen war. Ich suchte den Blick meines Meisters, um ihn allein dadurch noch ein kleines Stück auf dem Weg begleiten zu können.
Erleichtert umklammerte Montard die Waffe, die ihn ein Leben lang begleitet hatte. Noch einen Herzschlag lang sah er mich an, bevor das Leben aus seinen Augen wich.
3. Revanche
Bleierne Schwere lag über dem Schlachtfeld. Die ersten Raben zogen ihre Kreise. Wie betäubt sammelten sich die Krieger, unterhielten sich leise.
»Mylady?«
Ich schrak hoch. Vor mir stand ein kräftiger Elf, etwas jünger als ich.
»Mein Name ist Emelt. Eigentlich bin ich hier der ranghöchste Offizier. Aber jetzt ist neben dem Seneschall eine Schwertmeisterin auf dem Schlachtfeld, die außerdem Königin ist … eines anderen Landes …«. Hilflos zuckte er mit den Schultern. Seine Augen waren rotgerändert. »Ich bin sein Stellvertreter und würde das Kommando übernehmen, aber wenn Ihr …«
»Nein, nein!« Ich räusperte mich, ballte die Fäuste und drängte die Tränen, die mir immer wieder in die Augen schossen, entschlossen zurück. Als ich tief einatmete und mich straffte, bemerkte ich zum ersten Mal, dass ich verletzt war. Aber das war gleichgültig. »Natürlich, Emelt, sammelt Eure Männer! Achtet nicht auf mich.«
»Werdet Ihr mitkommen?«
Ich hatte mich schon weggedreht, verharrte jetzt in der Bewegung. Dem Meister stand ein prunkvolles Begräbnis zu und ich wollte dabei sein. Die Frage war nur: Wie sollte ich das Loglard erklären?
»Montard würde es verstehen, wenn du nach Gwyneddion zurückkehrst«, sagte Mira leise zu mir.
»Wir schaffen es morgen bis Béara«, mischte sich Emelt wieder ein. »Die Verletzten müssen behandelt werden und …« Jetzt versagte ihm die Stimme und es war an ihm, sich wegzudrehen.
Béara war sowieso mein Ziel. Merta d‘Elestre lebte dort, ihres Zeichens Söldnerin und meine Tante. Loglard hatte es sich in den Kopf gesetzt, sie demnächst aufzusuchen und um Mithilfe bei der Suche nach der Scheibe der Ewigkeit zu bitten. Ich wollte die Gute warnen, bevor der König von Gwyneddion samt Gefolge vor ihrer Tür auftauchte, etwas von einem absolut wichtigen, mächtigen Artefakt schwafelte und ihr von Schwarzmagiern erzählte, die sich Arsuri nannten und eine Schlangengöttin anbeteten. Und die jene Scheibe der Ewigkeit mindestens genau so dringend benötigten wie Loglard. Blöderweise stand dieses Artefakt in magischer Verbindung zu uns d’Elestre-Frauen. Weshalb die Arsuri neben der Scheibe auch immer eine Elfenfrau aus unserem Geschlecht brauchten, um das Artefakt kontrollieren zu können. Leider gab es nur noch Merta und mich. Das alles war verworren und kompliziert. Meine Tante war Söldnerin. Ich hatte vor, ihr in unseren Worten von dem ganzen Schlamassel zu erzählen, ohne Loglard. In einigen Tagen wäre ich von Gwyneddion aufgebrochen. Dazu war es aber nicht gekommen. Nach unserer ungeplanten Aktion waren wir im Rausch in Cérnowia gelandet. Da hatte ich mir überlegt, den Besuch bei meiner Tante mit der Stippvisite zu verbinden.
»Also gut, ich begleite Euch bis Béara. Kurz vorher zweigt ein alter Schmugglerpfad ab. Dann bin ich in zwei Tagen wieder daheim.«
Meine Freunde sahen mich entgeistert an. Da wurde mir klar, dass ich Gwyneddion als mein Zuhause bezeichnet hatte. Wie sich die Zeiten doch geändert hatten! Cérnowia, meine Heimat, und Gwyneddion, das Reich der Waldelfen, hatten sich lange Zeit erfolgreich gegenseitig ignoriert. Kontakt mit dem anderen Volk war jedenfalls aus Sicht von Cérnowia nicht erwünscht gewesen, bis ich Loglard kennenlernte und im Zuge der Flucht vor den Arsuri seine Gefährtin wurde. Mittlerweile fühlte ich mich in Gwyneddion wohl, mochte sogar die Lebensweise der Waldelfen. Vor allem aber lebten dort Loglard und unsere Tochter Noreia. Sie waren meine Familie, mein Zuhause. Aber im Moment war ich zu müde und zu traurig, um ihnen das erklären.
Während des Rittes nach Béara schweiften meine Gedanken ab. Wie lange war es her, dass ich Montards Schülerin geworden war? Ein kalter Morgen vor zwei Jahrhunderten kam mir in den Sinn. Mutter war gerade aus der Gefangenschaft der Orks entlassen worden. Zwar hatte ich während ihrer Abwesenheit die Freiheit genossen und war, nur unter der sporadischen Aufsicht von Londo und Mira, viel in Grianan Aileach unterwegs gewesen. Dennoch konnte ich mein Glück kaum fassen, als sie unversehrt aus der Gefangenschaft zurückkehrte. Etwa zwei Wochen nach Mutters Heimkehr geschah es. Mir war, als würde ich alles noch einmal erleben.
Mein Selbstbewusstsein bröckelte, als der Seneschall selbst, Schwertmeister Montard de Guillaume, im Trainingsgeviert stehend mich zu sich winkte. Fest umklammerte ich das Holzschwert, das Londo mir geschnitzt hatte, atmete tief ein und ging die paar Schritte auf ihn zu. Hellblaue Augen unter buschigen Augenbrauen musterten mich, die Narbe auf der linken Seite glänzte rosa in der Morgensonne.
»Du bist also Eillis‘ Tochter.« Seine Stimme klang nicht so dunkel, wie Londo sie immer nachmachte.
»Ja, Meister … ich meine, Lord Montard, Seneschall.« Bei Scathachs Titten, warum stotterte ich so?
Ringsum ertönten verhaltenes Lachen und vereinzelte Spottrufe, die sofort verstummten, als Montard einen Blick in die Runde warf. Seine Augen wanderten wieder zu mir.
»Meister Montard reicht hier auf dem Turnierplatz völlig.«
»Aye, gut, dann Meister Montard.« Mit einem schnellen Augenaufschlag sah ich zu ihm hoch.
»Ich habe gehört, es gab eine unschöne Auseinandersetzung mit Cian, Lord Veltrins Sohn.«
Ein Wink des Meisters und der Idiot von gestern trat ebenfalls in den Ring. Ich musste grinsen, als ich sah, dass er leicht humpelte. Tja, ich hatte ihn gut erwischt.
»Er fordert Revanche.«
»Kann er haben, wenn er sich hier vor allen Leuten blamieren will.«
»Spuck nicht so große Töne, du verlauste kleine Kröte«, gab der Junge zurück. »Und nur, dass du’s weißt, eigentlich stelle ich mich nur Meinesgleichen, nicht einem Bastardkind aus zweifelhaftem …«
Keine Ahnung, was der arrogante Mistkerl noch alles labern wollte, aber mir reichte es. Wie Londo es mir beigebracht hatte, griff ich unvermutet an, die Überraschung auf meiner Seite. Du bist jung, hast keine Erfahrung. Deine einzige Chance besteht darin, ihn schnell fertig zu machen, hatte er mir eingeschärft.
Cian schaffte es gerade noch, sein Übungsschwert – richtige Klingen waren hier nicht erlaubt – hochzureißen. Schade, sonst hätte er seinen Arm ein paar Tage nicht mehr gebrauchen können. Ich duckte mich unter seiner Replik weg, wirbelte herum. Es war ein Vorteil, klein zu sein. Ich erwischte das schmerzende Bein. Er schrie auf, sprang zurück; nur um Haaresbreite verfehlte mich sein Schwert.
»Du mieses kleines Stück Scheiße«, zischte er.
Krachend trafen die Klingen aufeinander. Jetzt brüllte ich auf. Natürlich verfügte er über viel mehr Kraft. Einen anderen Trick hatte mir Mira beigebracht. Den Schwung nutzend rollte ich ab, sprang auf und hieb mit all meiner Kraft auf seinen Schwertarm. Leider trug er Handschuhe, die mir noch fehlten. Wahrscheinlich gab es gar keine so kleinen. Trotzdem ächzte er und konnte seinen Schlag nicht ausführen. Dafür umklammerte seine Linke meinen Hals. Unversehens landete ich auf dem Boden, rang nach Luft, die mir eine unbarmherzige Hand abschnürte.
»Genug«, befahl Montard.
Hasserfüllte Augen stierten mich unverwandt an. »Ich werde dich lehren, Respekt zu zeigen«, fletschte mein Feind.
»Cian, es reicht!«, donnerte Montard.
Mein Peiniger blinzelte, dann ließ er los, richtete sich in einer fließenden Bewegung auf. Schon wollte er mit dem Fuß ausziehen, um mich zu treten, doch in diesem Moment attackierte ihn Mutter von hinten. Gierig sog ich die Luft ein, kam irgendwie in den Vierfüßlerstand und rang nach Atem.
»Eillis – Schluss damit! Du bist immer noch verletzt. Außerdem musst du dich an so etwas gewöhnen.« Der Meister zog mich hoch. Seine Hand tastete meinen Hals ab. Dann nickte er. »Wenn du zustimmst, wird deine Tochter nämlich ab heute meine Schülerin. Es sei denn, du hättest etwas dagegen, Esmanté d‘Elestre.« Beinahe belustigt blickte er mich an.
»Das ist …. also … ich weiß nicht …«, stammelte Mutter, während um uns herum heftiges Getuschel einsetzte. So weit ich wusste, hatte der Meister schon lange keine Schüler mehr angenommen.
»Es ist mir eine Ehre«, krächzte ich. Mein Hals fühlte sich an wie ein Reibeisen.
»Das ist nicht Euer Ernst.« Empört starrte das Adelssöhnchen auf mich herab. »Sie gehört nicht zu den besten Häusern.«
»Sag das noch mal, du aufgeblasener Speichellecker.« Mutter hatte ihre Überraschung wohl überwunden. »Die Familie d‘Elestre gehört zu den ältesten Elfengeschlechtern von ganz Tiranorg.«
»Dann hättet Ihr Eurer Tochter mehr Benehmen beibringen sollen, Lady Eillis«, entgegnete Cian ungerührt, »aber offensichtlich bevorzugt sie das wilde Leben unter einfachen Kriegern – wie ihre Mutter.«
Ein herablassender Blick, er wedelte mit den Fingern. Schon erschien ein Diener, der ihm das Übungsschwert abnahm und einen Wasserschlauch reichte. Bereits im Weggehen orderte er ein warmes Bad in seinen Gemächern. Londo gab mir ebenfalls einen Schlauch, aus dem ich ausgiebig trank. Dann stand ich unschlüssig zwischen Montard und Mutter.
»Also, Eillis, stimmst du zu?«, fragte der Meister, jetzt mit wärmerer Stimme.
Mutter räusperte sich. Lange sah sie mir in die Augen. »Ich wünschte, sie würde diesen Weg nicht gehen«, erwiderte sie leise und umarmte mich. Dann straffte sie sich, schob mich weg auf den Meister zu. »Es ist eine große Ehre, Meister Montard, dass Ihr meine Tochter Esmanté d‘Elestre als Schülerin annehmt. Damit ist es abgemacht.« Sie reichte ihm die Hand, in die er einschlug.
Verwirrt sah ich sie an. In ihren Augen lagen so viel Schmerz, Einsamkeit und Mitgefühl. Doch mir blieb nicht viel Zeit, denn schon senkte sich Montards schwere Hand herab und umfasste meine Schulter.
Dann sprach er die rituelle Formel: »Esmanté d’Elestre, ich nehme dich als meine Schülerin an. Du stehst von diesem Moment an unter meinem Schutz, du schuldest mir Gehorsam, bis ich die Lehrzeit für beendet erkläre.«
»Du musst schwören«, flüsterte Mutter.
»Ich schwöre Euch, Meister Montard, Gehorsam«, haspelte ich.
»Gut, dann ist das geklärt. Hol deine Sachen. In einer halben Stunde will ich dich in meinen Gemächern sehen«, entschied er. »Ihr anderen trainiert und haltet keine Maulaffen feil«, befahl er den übrigen Kriegern, die sich daraufhin sofort aufstellten. »Freyda, du beaufsichtigst das Training«, ordnete er noch an, bevor er davonmarschierte.
»Was hat das zu bedeuten, Mutter?«
»Wenn die Götter einen bestrafen wollen, erfüllen sie dir deine Wünsche«, murmelte sie. Tränen füllte ihre Augen, die sie zornig wegwischte. »Du bist nun die Schülerin von Montard selbst. Das ist eine große Ehre, aber auch die härteste Aufgabe, die es gibt. Sein Wort zählt nun. Komm, wir packen.«
Harsch nahm sie mich an der Hand und bahnte uns einen Weg durch die Krieger. Aufmunternde Blicke trafen mich, die ein oder andere behandschuhte Hand klopfte mir auf den Rücken. Aber auch manch mitfühlenden Blick fing ich auf.
»Ich soll nicht mehr hier schlafen?« In der Abgeschiedenheit unserer Kammer kamen mir doch ernste Zweifel.
»So ist es. Der Meister bewohnt einen eigenen Trakt im Wohnturm. Er ist Seneschall und muss die Königin beschützen. Dort gibt es sicher eine Kammer für dich.«
Ohne mich anzusehen, packte Mutter hastig meine wenigen Kleidungsstücke zusammen.
»Darf ich dich besuchen?« Verschämt wischte ich die Tränen weg. Nicht auszudenken, wenn mich jemand so sehen würde.