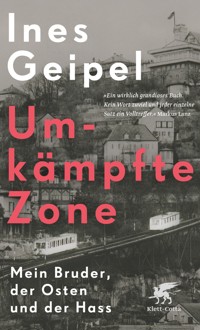12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ivano Matteoli, Sohn eines KP-Funktionärs, verlässt Anfang der sechziger Jahre sein toskanisches Heimatdorf gen Leningrad. Dort lernt er Bea kennen – Beate Ulbricht, das "erste Staatskind der DDR" und Tochter von Walter Ulbricht. Dies ist der Beginn einer Amour fou zwischen Ost und West, einer Liebe im politischen Geflecht zwischen Paris, Leningrad, Rom, Ost-Berlin und dem erzkatholischen Cigoli. Die Erzählerin Anni kennt Ivano von Kindesbeinen an. Auf den Dächern der alten Häuser ihres toskanischen Heimatdorfes haben sie beide zusammen gesessen und den Männern beim Bocciaspielen zugesehen. Auch, als es sie wegen des Studiums in unterschiedliche Himmelsrichtungen verschlägt – sie nach Paris, ihn nach Leningrad –, verfolgt Anni aus der Distanz Ivanos Liebe zu der Deutschen Beate. Deren Eltern, Walter und Lotte Ulbricht, versuchen die Ehe der beiden zu verhindern. Das gelingt nicht, aber der Preis dafür ist hoch. Ines Geipel ist in ihrem ganz eigenen Ton ein raffinierter und kontrastreicher Roman darüber gelungen, wie das Autoritäre ins intimste Innere des Lebens eindringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Ähnliche
InesGeipel
TochterdesDiktators
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
Datenkonvertierung: Tropen Studios, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98311-1
E-Book: ISBN 978-3-608-10986-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Inhalt
Anni, was ist denn? Komm doch!
Wir nähern uns kritischen Tagen
Im von der Sonne abgewandten Teil des Mondes
Budjonnys Reserve
Verlust macht schön
Nicht mehr lange und hier laufen Eisbären rum
Jede Epoche hat ihre Hafenarbeiter
Das ist der Ort der Infragestellung
Wohin das dann flieht
Es wird nie mehr aufhören
Alles sehr kontinental
Materialien und Dank
Abbildung1
Anni, was ist denn? Komm doch!
MEIN NAME IST ANNI, genauer gesagt Anni Paoli. Aber Anni reicht. Ich will die Geschichte meines Lebens erzählen. Nein, nicht die ganze Geschichte. Ich weiß ja, dass das nicht geht. Es kann nie die ganze Geschichte sein. Aber ich nenne es mal so – die Geschichte meines Lebens. Auch weil die, die unbedingt in diese Geschichte gehören, nicht mehr da sind. Bea nicht, Nello und Giorgia nicht, Francesco, Giulia, Leticia, Nino nicht, so viele aus dem Ort nicht, vor allem aber Ivano nicht. Ich bin die Letzte, die Einzige von uns, die noch weiß. Es gibt niemanden mehr, mit dem ich meine Erinnerungen teilen kann. Was für das, was ich zu erzählen habe, nicht ganz unerheblich ist. Es bedeutet nämlich, dass ziemlich viel möglich ist. Dass ich erfinden kann und es auch gern tun würde. Aber nein, das geht nicht. Das ist nicht drin, höchstens ab und an, in ein paar Ausnahmen. Ich bin hier verpflichtet.
Heute zum Beispiel, da wollten wieder zwei kommen. Um unseren Ort sollte es gehen, um Ivano und um Bea. Um wen denn sonst. Aus Berlin wollten die beiden anfliegen. In Pisa hätte ich sie abgeholt. Na, das mache ich dann schon. Aber Achtung, Anni, habe ich mir gesagt. Das wird nichts, das kann nur schiefgehen, das macht ja gar keinen Sinn. Denn sagen wir mal so: Die Leute, die hier vorbeikommen, die haben ein Bild, und das ist fertig. Sie wissen, wie die Geschichte geht. Und ich bin im Grunde nur dazu da, ihnen ihr Bild zu bestätigen oder, was noch besser für sie wäre, es mit meinen Gefühlen aufzufüllen. Ich bin ein Platzhalter, nichts weiter. Weil ich eben schon da war. Aber das ist nicht lustig und auch nichts, was ich mir zumuten werde. Denn das bringt nichts. Das bringt niemandem etwas. Und deshalb kommen die beiden auch nicht. Ich habe abgesagt. Ich kann nicht.
Das erste Licht des Tages und noch immer kein Schlaf. Anni schläft wieder nicht, wird Carlo mir auf der Piazza später zurufen und dabei so eigenartig mit den Armen rudern. Er sieht das. Er sieht das Licht, das die ganze Nacht durch meine Läden blinzelt. Und er hat ja auch recht. Das mit dem Schlaf ist keine ganz einfache Sache, trotz Perricone und Magenschmiere. Also erst der Popenwein und darauf zwei Maalox Rapid. Das hilft, das ist die perfekte Mischung. Der Magen liegt dann schön in Watte und kann in Ruhe vor sich hin wolken. Jahrelang ist das gut gegangen, aber seit zwei, drei Wochen klappt das nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Mitunter verschiebt sich ja was, sagt Grazia, meine Nachbarin. Muss nichts Großes sein, ein winziger Tick und schon gehört nichts mehr zusammen. Aber lassen wir das. Magen ist kein Thema, Magen ist immer. Als würde man vom Wetter sprechen oder von der Zeit oder von Gott oder vom Licht.
Apropos Licht. Die Geschichte, die ich erzählen will, spielt in Cigoli, wenigstens die meiste Zeit über. Cigoli, das ist Süden, das ist Italien, das ist Toskana. Wir reden also von Klischees, nein, von Klischees über Klischees. Aber ich kann ja nicht so tun, als existiere all das nicht – die Bilder, das Wetter, die Farben, und die Klischees eben. Was ich damit sagen will? Ganz einfach: Cigoli, das ist Licht. Den ganzen Frühling über trägt es Flaum, und die Landschaft schlägt sich den Bauch voll damit. Das ist hier unerträglich, unerträglich schön. Doch Schönheit hinzunehmen ist schwerer, als gemeinhin angenommen wird. Die Statistik besagt jedenfalls, dass sich im Frühling bei uns deutlich mehr Unfälle ereignen als das restliche Jahr über. Ein erhöhtes Unaufmerksamkeitsrisiko. Oder auch Aufmerksamkeitsrisiko. Je nachdem, wie man das betrachten will.
Wenn jetzt jemand da wäre, dem ich zurufen könnte: Kommen Sie, ich muss Ihnen den schönsten Augenblick des Tages hier zeigen. Ansonsten kapieren Sie ja nichts. Nichts von Cigoli, nichts von Bea und Ivano, nichts von mir. Noch dazu habe ich eine Entscheidung getroffen: Ich werde mich von nun an strikt an die Ereignisse halten und zusammentragen, was ich weiß. Denn es bringt ja nichts, die Wächterin einer Geschichte zu sein, die nur mir gehört. Das entspricht mir nicht. Man wird höchstens seltsam mit der Zeit. Wobei ich klarstellen muss, dass hier niemand ist. Keiner, dem ich sagen könnte: Meine Geschichte, das ist nichts Sentimentales, auch kein Skandal, wo ja eh heute keiner mehr weiß, was noch ein Skandal sein kann. Nein, es geht allein um uns, um Bea, Ivano, um mich und um die Verteidigung eines Glaubens. Denn ich bin halt der Ansicht, dass die Welt eine andere sein wird, wenn ich meine Geschichte erzählt habe. Ja, daran glaube ich. Es kann auch gar nicht anders sein. Bea zum Beispiel, die in der Realität niemand anderes als Beate Matteoli ist, die Tochter des Berliner Mauerbauers Walter Ulbricht, das erste ostdeutsche Staatskind also, wird nie wirklich Bea sein können ohne uns hier, ohne Cigoli. Ohne uns ist ihre Geschichte nicht richtig, ohne uns fehlt ihr was. Fast würde ich sagen, das Wichtigste. Dasselbe behaupte ich von Ivano und mir. Unsere Geschichten sind ohne einander nicht denkbar, das heißt auch ohne Bea nicht. Sie gehört dazu. Und auch Cigoli ist bei Lichte besehen nicht Cigoli ohne die Tatsache, dass mit Bea, die kein einziges Mal bei uns war, etwas völlig anderes, immerhin ein Stück Weltgeschichte vom Norden in den Süden herangeweht kam. Ich persönlich kann mit dem, was man Weltgeschichte nennt, nicht viel anfangen. Was soll das schon sein? Aber für Bea stimmt das. Sie muss ins große Bild, auf ihre ganz eigene Weise.
Der schönste Augenblick des Tages. Der Sonnenaufgang in Cigoli. Und zwar ganz oben, direkt vor der Kirche. Ihr Name: Santuario della Madre dei Bimbi. Wie das schon klingt. Das Heiligtum der Mutter mit Kind. Aber niemand hat eine Ahnung davon, was die Madonna für ein erzkatholisches 400-Seelen-Nest wie unseres hier bedeutet. Man braucht gar nicht so rumtun. Keiner weiß es, es kann keiner wissen, und vor allem soll es keiner wissen. Niemand von außerhalb hat eine Vorstellung davon, wie es hier zugeht. Wenn jemand von sich sagt: Ich bin Agnostiker, ich glaube nicht an Gott, kann er das in der Welt überall behaupten, und jedem wäre ziemlich rasch klar, was das bedeutet. Nur bei uns spielt das keine Rolle. Hier ist es egal, was einer ist, was er macht oder nicht macht, was er glaubt oder nicht glaubt. Man gehört dazu, man gehört dem Ort und damit basta. Was allerdings eine Rolle spielt, ist die Tatsache, ob du Jungfrau bist oder nicht. Jungfrau zu sein ist für uns Frauen hier noch immer von großer Bedeutung, ich denke fast, von immer größerer Bedeutung. Ja, ja, ich weiß schon, das führt zu nichts, das ist völlig unzeitgemäß. Na, sicher doch. Nur, Italien ist das – völlig unzeitgemäß. Es gibt Frauen, die resigniert haben, die es nicht geschafft haben, die sich die Familie, die Tradition, das Gesetz des Schweigens aufgeladen haben. Man muss da höllisch aufpassen.
Ich glaube nicht an Gott, ich bin Agnostikerin oder, um es mal auf meine Art zu sagen: Ich gehe jeden Morgen die paar Schritte hoch zur Kirche. Seit der Kindheit ist das so. Mich am Morgen mit dem Rücken an die kühle Kirchwand lehnen, die erste Zigarette des Tages rauchen und eine Zeitlang in die dunkle Ebene unter mir schauen. Einfach so. Daran liegt mir noch. Da unten zum Beispiel, das ist das Arno-Tal. Und wenn ich lange genug in die Ferne blicke, kann ich hinten am Horizont schon das Meer blinzeln sehen. Der Ort schläft noch, die Tiere zögern, das Licht auch. Es ist unsagbar still, und plötzlich kommt der Moment, wo es kippt. Nicht nach und nach, nein, mit einem Schlag bricht es aus hier. Das Leben, das Licht. Als gäbe es ihn doch, den großen Schalter.
Augenblicke, die frei sind und die wir nötig haben. In denen wir den Eindruck haben, dass nur wir entscheiden, wann was beginnt, was wir als Erstes tun oder was wir halt bleiben lassen. Wir starren ins Tal wie in die große Leere und hören ihr dabei zu, wie sie sich langsam füllt: mit klappenden Autotüren, mit Geschrei und Lachen, mit Ciao, Ciao und Mamma mia. Augenblicke, in denen wir das Gefühl haben, dass alles vorhanden ist. Man kann sich ruhig Zeit lassen dafür, so wie man Zeit braucht für einen Ort wie diesen hier. Die Kirche lohnt sich. Ab zehn kann man rein und ein bisschen mit der hölzernen Madonna plaudern oder später zusammen mit den Frauen in der Nachmittagssonne auf der Bank an der Kirchwand sitzen. Wie sie die Rosenkränze zischeln lassen, mit den Beinen baumeln und am Ende die Abendsonne verdösen. Diese Frauen gehören hierher. Es ist ihr Ort und die Madonna mit Kind ihr alleiniger Schutz. Santuario della Madre dei Bimbi. Man muss sich nichts vormachen. Klischees wie diese kriegt man nicht umsonst.
Da ist so vieles. Die Geschichten wachsen sich aus wie die knorzigen Trüffel unter unseren Füßen. Ich mag keine Trüffel, ich mag auch keine Katholizismen, ich will nichts anderes als meine Geschichte erzählen. Anni? Anni, wo bleibst du denn so lange? Komm endlich! Ich war sechs. Es war der Sommer vor der Schule, als Ivano dreimal kurz an unsere Tür klopfte. Ich hatte keine Wahl oder eher: Es gab nichts zu wählen. Es gab diesen Jungen zwei Häuser weiter, genauer einmal um die Ecke, der so alt war wie ich. Er war da und gehörte in meine Kindheit wie der Geruch meiner Mutter, wie das Boccia-Spielen der Alten auf der Piazza, wie die Schatten der Platanen. Er hatte wie immer seine Steinschleuder in der Hand. Ich nahm meine. Es würde unser Tag werden. Viele Tiere würden dran glauben müssen. Zuerst die blauen Schmetterlinge, dann die Geckos, später die Graumäuse und wer weiß, was uns heute noch alles begegnen würde. Wir waren gute Jäger. Ivano war schnell, ich war schneller.
Wenn du Kind bist, nimmst du irgendeine Hand und stiefelst los. Aber warum ist es dieser eine Morgen, an den ich mich erinnere, wenn es um Ivano geht? Es gab so viele davon. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht musste der Junge von nebenan Hunderte Male da stehen und klopfen, bis dieser Morgen zu einem Bild wurde. Jene Tür, hinter der etwas spielt, wofür Ivano mir das Erbe übertragen hat. Denn so ist es. Anni? Was ist denn? Kommst du? Wenn er jetzt klopft und mit der Steinschleuder in der Hand vor mir steht, weiß ich, dass das der Anfang hier ist. Dann sind wir im Jahr 1948, denn Ivano und ich sind gleichaltrig. Jahrgang 1942, Kriegskinder. Dann sitzen wir schon oben auf der Bank an der Kirchwand und machen nichts Besonderes. Es ist mal wieder nichts los, aber irgendwer wird schon noch kommen, der die Madonna sehen will. Eine Nonne vielleicht oder jemand von außerhalb. Wir reden nicht, wir hocken nur da und schauen ins Tal. Später laufen wir in die Weinberge auf der Rückseite von Cigoli. Ivano weiß, wo die Schmetterlinge sitzen.
Vermutlich ist es das. Dass dieser Sommermorgen nichts an sich hatte, nichts, was sich eingebrannt hätte, kein Hoch, kein Tief, sondern nur vor sich hin flimmerte und mit jeder Minute heißer wurde. Irrsinnig heiß. Und Ivanos Art, in den Sommer zu laufen, als sei alles möglich, ich glaube, das ist es gewesen. Und dass dieses Bild von Dauer ist und längst herausgetreten war aus allem, als beanspruche es einen Sonderplatz. Ich mag Bilder, die etwas Unverrückbares an sich haben. Sie sind wie die Trüffelballen. Man stößt immer wieder auf sie, egal, von wo man kommt, und egal auch, wie sehr sich die Dinge schon verknotet haben. Wie er ausgesehen hat? Ein Foto? Ich hab keins. Und was wäre schon groß zu sehen? Er sah aus, wie die Jungs hier so aussehen. Dunkle Augen, ein bisschen zu viel Süden vielleicht. Mehr kann es nicht gewesen sein. Nein, mir war nichts wirklich aufgefallen an ihm.
Der Sommer vor der Schule war aber auch der mit den Lüftern. Und für die werde ich mir ein bisschen Zeit nehmen müssen. Denn es ist so: Hier direkt unterhalb, das ist Cigoli. Wie ein Nest am Stamm klebt es seit tausend Jahren über dem Tal. Etwas, das sich in einem fort wegduckt, um sich auf diese Weise zusammenzuhalten. Ich bin ja kein Reiseführer, den man einfach mal so durchblättern kann. Ich lebe hier. Aber ich nehme mal an, dass Cigoli niemandem etwas sagen würde und man glatt durchführe, um nach Pisa, Parma oder Florenz zu gelangen. Einmal direkt bis zum Ortsausgang und die paar Häuser, die sich Cigoli nennen, wären schon wieder vergessen. Aber Vorsicht, der Schein trügt. Hier waren sie alle, hier sind sie alle durch. Das da drüben? Das ist Vinci. Na, sicher doch, der Geburtsort von Leonardo da Vinci. Keine zwanzig Kilometer Luftlinie von hier entfernt, nur auf der anderen Seite des Tals. Das Problem ist, dass wir das überall hier haben: Universalgenies, unfassbare Entdeckungen, die absolute Hochkultur. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und irgendwann genug hat von dem ganzen Renaissance-Rummel, kann man auch gleich durchmarschieren, bis in die Antike. Wir sind mit allen in Kontakt.
Nur, wenn es ums reale Leben der Leute hier geht, sieht die Sache ein klein wenig anders aus. Dann wird es rasch mal kompliziert. Und da kam im Sommer 1949 das Ding mit den Klimalüftern auf. Diese Geräte, die es vor dem Krieg überall schon gegeben hatte, nur eben bei uns nicht. Von daher lag es nahe, dass irgendwann eine größere Ventilatoren-Firma in Cigoli auftauchen würde, um den Leuten das Blaue vom Himmel runterzuschwatzen: endlich Räume mit Luft, endlich Sommer, die halbwegs aushaltbar wären, endlich Winter, die nicht sklerotisch absoffen. Es herrschte heillose Aufregung. Im Stadthaus auf der Piazza ein einziges großes Palaver. Der Bürgermeister hielt lange Reden, erklärte die Windanlagen zu den wahren Helden der neuen Zeit und feierte sie als Erlösung. Endlich war mal was los. Endlich gab es Tausende Gründe, an den schönen Sommerabenden bis tief in die Nacht hinein auf der Piazza rumzustehen. Endlich wusste man wieder, dass die Renaissance von der Vorstellung beseelt gewesen war, dass das Universum wandelbar und vor allem erreichbar sein sollte. Endlich war man dran und sich sicher, unsere Großkopferten richtig verstanden zu haben. Kurz und gut: Cigoli entschied sich gemeinschaftlich für das neue Belüftungssystem.
Pausenlos wurde gebohrt und gehämmert und manche Wand aufgerissen. Jede Familie brauchte plötzlich eine Klimaanlage in der Küche und eine zweite im Bad. Die Häuser wurden offener, die Räume spürbar lichter, es gab entschieden mehr Luft. Alle sollten profitieren, frohlockte der Bürgermeister. Binnen kurzem machte der Ort einen veritablen Technikschub durch, und mitten in diesem brüllend heißen Sommer des Jahres 1949 war Cigoli im Fortschritt angekommen, über den sich ein gleichmäßig sonorer Ton legte, eine Art sanftes Geschlabber, denn die Lüfter fächerten klaglos und ohne Pause vor sich hin.
Das war das eine und ja auch ganz schön. Das andere war die um sich greifende Panik, die den Ort wegen der vielen neuen Technik nach und nach in den Ausnahmezustand versetzte. Denn die neuen Klimageräte funktionierten nicht nur wie riesige Lautsprecher, sondern leisteten im wortwörtlichen Sinne ganze Offenbarungseide. Technisch lief das so, dass die Lüfter in der Küche die Gespräche von draußen direkt ins Innere schleusten. Wohingegen die Lüfter im Bad noch die intimsten Angelegenheiten wie ein Megaphon ungefiltert auf die Straße rausposaunten.
Cigoli ist ein alter Ort. Von daher versteht es sich von selbst, dass er unter dem Rubrum Geheimnis mancherlei zu bieten hat. All die Sandbräute und Windeier, all die rabiaten Landnahmen und ermogelten Versicherungspolicen, all die ungesetzlichen Hausverkäufe und zweifelhaften Adoptionen. Schon enorm, was die Realität in der Hinsicht so zu bieten hat. Hätte Cigoli einen Beichtkatalog im Hinblick auf Niedertracht, Obsession und Verrat, er wäre bunt und schillernd wie ein Pfau. Dabei bin ich mir nicht sicher, ob er bunter und schillernder wäre als anderswo. Auch nicht, ob das Leben bei uns tatsächlich eine entschiedenere Neigung zu gewissen Peinlichkeiten hat als etwa in Rom oder Neapel. Aber dass der Mantel des Schweigens möglichst da liegen bleiben sollte, wo er lag, das konnte niemand ernsthaft bestreiten. Aber es half nichts. Die Lüfter knatterten und zerrten, was so sorgsam vergraben lag, erbarmungslos in die Öffentlichkeit. Die Verwirrung war komplett.
Und was genau trat da eigentlich zutage?
Nun, unsere Nachbarin Chiara bekam auf diesem Weg mitgeteilt, dass sie noch einen Halbbruder in Rom hat. Piedro, der schrullige Typ von gegenüber, musste damit klarkommen, dass seine Frau grad Urlaub in Palermo machte, immerhin mit seinem besten Freund. Maria, die Tante meiner Mutter, erfuhr auf diesem Weg, dass man sie schon vor fünf Jahren enterbt hatte, und zwar vollständig. Bäcker Marco wurde klargemacht, dass der Tod seiner Tochter keineswegs ein Unglücksfall gewesen war, vielmehr hatte das Kissen seiner Mutter nachgeholfen. Dem alten Lorenzo, der seine Zeit auf der Terrasse des Stadthauses zubrachte, gab das plappernde System zu verstehen, dass seine Enkel ihn um einen mächtigen Batzen Geld betrogen hatten. Und meine Patentante Rosetta? Ihr Vater hatte, wie sie nun erfuhr, einen etwas wunderlichen sizilianischen Schriftgelehrten im Suff erschlagen. Ort der Handlung: Catania. Deshalb hatte man nie davon gehört.
Mag sein, eine neue Technik hat ihre Vorzüge, und bestimmt hat sie auch ihre Berechtigung, aber bei uns bewährte sie sich nicht. Cigoli war durch den Wind. Nichts war mehr sicher. Dabei war es ja so, dass die Geheimnisse des Ortes derart tief in der Zeit versenkt worden waren, dass man vergessen hatte, was überhaupt versenkt worden war. Aber irgendwann ließen sich die ausgespuckten Wahrheiten nicht mehr ignorieren. Die Blicke in den Gassen änderten sich, die Gesten, die Schritte, die Körper. Niemand kam mehr ins Stadthaus, keiner saß mehr oben auf der Bank an der Kirchwand, die Piazza wurde Tag für Tag leerer, nicht mal mehr Lotto wurde gespielt. Das öffentliche Leben erlosch. Jeder spürte, dass das alte Leben hinfällig geworden war. Ein neues jedoch war nicht in Sicht.
Und wir Kinder? Irgendwas war mit den Alten, das sahen selbst wir, aber was sollten wir damit anfangen? Alle schienen von demselben Virus befallen, mit Symptomen wie Schweißausbrüchen, Essensverweigerung, Schlafwandel oder schwer erklärbaren Ängsten. Das war merkwürdig, aber es interessierte uns nicht sonderlich. Ivano drängelte. Er wollte zum Fluss und mir die Fische zeigen. Vor allem aber wollte er welche fangen. Wenn wir unsere Steinschleudern zeitgleich zum Einsatz bringen würden, gab er vor, hätten die Fische keine Chance.
Also zogen wir los, mussten aber noch rasch in der Werkstatt seines Vaters vorbei. Nello Matteoli war ein schmaler, ernst wirkender Mann mit fitzligem Oberlippenbart und der wirkliche Schuster von Cigoli. Ivano hatte ihm am Morgen versprochen, zum Fischmann Guido zu laufen und ihm die fertigen Schuhe vorbeizubringen.
Der Geruch von Leder, Leim und Holz. Die Leisten, die paarweise von der Decke hingen, die gefärbten Lederlappen, die Zangen, Sohlen, Schäfte, die Schnüre, Bänder und Schnallen. Nellos Werkstatt war ein einziges Lob des Handwerks, der Spleens und der Anatomie von Füßen. Er selbst saß im hinteren Teil an der Werkbank, hämmerte auf einem Schaft herum und blickte nur kurz auf. Ivano erzählte später, dass die Eltern in der Nacht wieder lange und laut diskutiert hatten. Er hatte es an den Stimmen durch die Wand hören können. Überhaupt sei die Stimmung zu Hause seit längerem ziemlich angespannt. Die Mutter würde dauernd von einer Rosa reden. Immer diese Rosa. Mehr sagte Ivano nicht über sie.
Ob wir wollten oder nicht, das Virus von Cigoli hatte auch vor uns Kindern nicht haltgemacht. Im Nachhinein würde ich sagen, dass auch wir ganz schön tief in dem steckten, was Ivano salopp den Wahnsinn nannte. Ein Wort, das er von seiner Tante aufgeschnappt hatte, wie er behauptete. Aber wie sollte das weitergehen? Wenn der Boden unter uns derart mit Wahrheiten kontaminiert war, dass dem Ort nichts anderes übrig blieb, als in den Irrsinn abzudriften, war die Lage unstrittig ernst. Cigoli musste seinen Frieden wiederfinden, das öffentliche Leben wiederhergestellt werden. Bloß wie? Die einzige Instanz, die hier Abhilfe schaffen konnte, war Pfarrer Francesco. Der aber zögerte. Warum sich aufhalsen, was ihm ohnehin bekannt war? Denn gebeichtet wurde seit dem neuen Luftsystem hemmungsloser denn je.
Erst, als der Bürgermeister den Kirchberg hochgehetzt kam und ihn flehend um Hilfe bat, lenkte Francesco gnädig ein. Die knapp 400 Ortsseelen wurden so eines schwülen Sommerabends direkt unter die hölzerne Maria geladen. Das Geraune im Gestühl, die schweißigen Gesichter. Unser Pfarrer hielt eine auf den ersten Blick unauffällige Predigt. Er erzählte etwas von einem Haus, das saniert werden musste, weil es schwere Schäden hatte. Dann von einem, bei dem die tragenden Wände rausgerissen wurden, sodass es in einem Rutsch zusammenfiel. Zu guter Letzt von einem, das Wände hatte, an denen man ruhig eine Weile herumbosseln könne, die Bausubstanz ändere sich dadurch nicht.
Die Leute hüstelten und schabten mit den Füßen. Was wollte der denn? Sie hatten grad andere Probleme. Don Francesco blickte streng auf seine Gemeinde herab. Mit den Geheimnissen, bedeutete er, sei es wie mit der Statik eines Hauses. Es gebe welche, die rausmüssten, sonst stimme am Leben nichts mehr. Andere wiederum könnten gut und gern da bleiben, wohin man sie verpackt habe. Dass sie dort lägen, hätte schon seinen Sinn. Die bleiben, wo sie sind, skandierte er scharf und ließ den Blick über seine Schafe schweifen.
Totale Stille. Gleich darauf das große Ausatmen. Das war, was die Leute hören wollten, was sie jetzt brauchten. Der Mann auf der Kanzel machte eine kleine Pause und fuhr schließlich fort, dass er die Tage bei Antonio in der Autowerkstatt gewesen sei. Der hatte ihm erklären sollen, wie die blöden Lüfter funktionierten. Eine Weile hätten die beiden herumgebosselt und, siehe da, des Rätsels Lösung gefunden.
Die Leute im Kirchenrund starrten ihren Hirten mit aufgerissenen Augen an. Pfarrer Francesco wedelte mit einem der Lüfter über seinem Kopf, der aussah wie ein ausgerenkter Fisch. Er demonstrierte, unter welchem Winkel die Ventilatorenblätter einzustellen seien, damit der Kommunikationsstrudel zum Erliegen käme. Nichts brauche nach außen oder nach innen zu dringen, meinte er spitz. Stattdessen solle sich die Gemeinde lieber um Auftrieb und Atmosphären kümmern. Die allein würden entscheiden, wie es um den Frieden des Ortes bestellt sei. Don Francesco legte seine kurzen, feisten Hände über den Bauch und betete.
Und nun geht nach Hause und bringt eure Angelegenheiten in Ordnung, murmelte er. Amen. – Amen. Die Leute nickten. Das müsste hinhauen, da könnte was dran sein, das würde man gleich mal ausprobieren, versenkten sie in ihr Vaterunser und verließen die Kirche. Nur keine Zeit verlieren, nur raus hier, nach Hause, an die Geräte. Noch am selben Abend war das Virus erledigt, die Tortur vorbei.
Wir nähern uns kritischen Tagen
NATÜRLICH HATTE DON FRANCESCO während unserer sommerlichen Krisensitzung einen Trick angewandt. Er zählte bis drei, tischte seiner Gemeinde die gleiche Geschichte zweimal auf, schickte die Leute kurzerhand nach Hause und erklärte den Spuk auf diese Weise für beendet. Sicher, jemand wie er muss das können, die Dinge einfach machen. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass etwas faul war an dem Ganzen. Der Mann auf der Kanzel hatte uns zwar ein paar Antworten gegeben, aber hatte er das Entscheidende geklärt? Geheimnisse, Schweigen, Wahrheit, Lügen. In meinen Augen waren das schwerwiegende Angelegenheiten. Denn wer bestimmte es denn, ab wann eine Lüge klein, wann sie groß und wann sie so lala war? Wer sagte uns, welches Geheimnis wir brauchen und welches wir zu lüften haben, damit wir einigermaßen miteinander klarkommen konnten? Mein Eindruck war, dass Francesco es sich mit alldem ein bisschen zu leicht gemacht hatte. Also besser vielleicht, diese Dinge ein bisschen im Blick zu behalten.
Cigoli war nach dem Nottreffen in der Kirche erstaunlich schnell wieder zur Ruhe gekommen. Um ganz sicherzugehen, hatte der Bürgermeister am nächsten Tag noch einen Techniker von Haus zu Haus geschickt, der das System neu austarieren sollte, genauer gesagt, der es kappte. Das funktionierte reibungslos. Die Leute trauten sich wieder auf die Straße, die Terrasse des Stadthauses füllte sich, im Ort kam der Alltag zurück.
Was aber sollte mit dem werden, was die Lüfter pausenlos ausgespuckt hatten? Wo würden all die vielen verrückten Geschichten bleiben? Sonderlich schwierig war das nicht. Die einen tauchten ab, als hätte man ihnen Bleimäntel umgelegt. Sie sanken in die Tiefe, und jedem war klar, dass sie nie mehr auftauchen würden. Andere kamen allenthalben zurück und verschwanden auch wieder. Wie streunende Hunde, denen nichts Besseres einfiel, als ziellos durch ihre Reviere zu ziehen. Auf die eine oder andere Art würden diese Geschichten bleiben, weil sie schlicht zu gute Geschichten waren. Und dann gab es noch die, die in aller Ruhe warten konnten. Sie waren schon da gewesen, in vagen Umrissen, als hingeworfene Andeutung, als Gerücht, aber eben nur ansatzweise. Sie kannten keine Eile, konnten anderen den Vortritt lassen. Es waren Untote, Wiedergänger, bei denen man sich darauf verlassen konnte, dass sie nie mehr wirklich weggingen. Sie würden bleiben. Sie standen uns noch bevor.
An sie muss ich jetzt denken und an unsere langen Touren zum Fluss hinunter. Wenn Ivano im Wald immer einige Meter vor mir lief, als sei er ganz für sich. Wenn er plötzlich innehielt und sich umdrehte. Anni, was machst du? Komm doch! Wenn er wartete, um meine Hand zu nehmen, und mich wie selbstverständlich hinter sich herzog. Nein, es ist nicht, wie man so denkt. Da war nichts, wir waren uns einig, wir gehörten zusammen, wir brauchten keine Harmonie. Heute frage ich mich manchmal, was ihn auf diesem schattigen Weg ins Tal eigentlich wirklich beschäftigte, was los war in seinem Kopf. Ich werde es nie erfahren. Und doch hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass ich nicht wichtig war für ihn. Wichtig war, dass es eine wie mich gab, dass er angewetzt kommen konnte und wir draußen waren. Wenn du Kind bist, bist du frei hier. Als Kind kommst du hier einigermaßen durch.
An den endlos verschlungenen Weg zum Wasser denke ich, den ich heute noch manchmal gehe, und daran, dass Ivano doch irgendwann zu reden anfing. Über die Tiere, die ihn am meisten interessierten, über seine Familie und über Rosa. An diesen Namen denke ich und daran, dass Ivano ohne Rosa nicht vorstellbar ist. Sie ist der Schlüssel, auch für vieles, was aus uns später wurde. Aus Toni, Elena, Cosetta, Maria, Paola, Alberto, Nino. Und wie schwer es für Ivano gewesen sein musste, daran denke ich, wie er das überhaupt alles aushalten konnte. Ich weiß schon, das klingt so nach Gewicht. Aber darum geht es ja, dass es Gewicht hat. Denn es ist Rosa selbst, es ist ihre Geschichte, die sich ihren eigenen Platz sucht, die ihn beansprucht, die sich nimmt, was ihr zusteht, und in alldem nur unausweichlicher wird.
Aber was ist mit Rosa? Wie sehr sie in jenen Wochen anwesend gewesen sein muss. Wie sehr sie da war, ohne da zu sein. Maria Rosa Valori