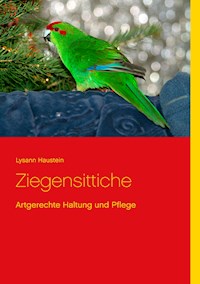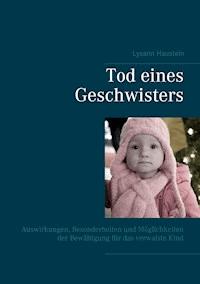
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die meisten dieser Menschen kommen mit Depressionen in die Therapie, denken aber zunächst gar nicht daran, dass der Verlust ihres Geschwisters etwas mit ihren Symptomen zu tun hat", sagt die Therapeutin. "Die Vergangenheit bringt sich meist erst schmerzhaft in Erinnerung, wenn die Leute in der Blüte ihres Lebens stehen. Da erreicht zum Beispiel eins ihrer Kinder das Alter des verstorbenen Geschwisters und auf einmal passiert etwas. Eine dunkle Flut schwappt nach oben und durchbricht das jahrelange Schweigen." Es gibt eine Gruppe, die nie einen Namen hatte. Wenn ein Kind stirbt, stehen zuerst die trauernden Eltern im Fokus, die wenigsten denken an die verwaisten Geschwister. Vielleicht fragt wirklich nie jemand nach ihnen. Für sie und etliche andere, die mit diesem Thema in Berührung kommen und sich sensibilisieren wollen für das Leid der übriggebliebenen Kinder, sei es durch den Beruf oder die eigene Betroffenheit in der Familie, ist dieses Buch geschrieben worden. Es ist wissenschaftlich fundiert und trotzdem für den Laien gut verständlich. Und alles dreht sich nur um eines: den Geschwisterverlust.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Geschwisterbeziehungen in der Familie
1.1. Familienkonstellationen
1.2. Die Bedeutung und Rolle von Geschwisterbeziehungen
1.2.1. Horizontale Geschwisterbeziehungen
1.2.2. Der Einfluss verschiedener Faktoren
1.2.3. Identifikation - Identität
1.2.4. Geschwisterrivalität
1.2.5. Zwillinge und ihre Besonderheiten
1.3. Geschwisterverlust
1.3.1. Personenverluste und ihre Auswirkungen auf Kinder
1.3.2. Besonderheiten bei Verlust eines Geschwisters
1.3.3. Die Auswirkungen des Geschwisterverlustes auf das überlebende Kind
1.4. Zusammenfassung des ersten Kapitels
Geschwistertrauer
2.1. Trauer – allgemein
2.1.1. Trauer und Trauerphasen
2.1.2. Allgemeine Symptome und Folgen von Trauer
2.1.3. Trauerarbeit vor dem Tod
2.2. Bedeutung von Todeskonzepten bei Kindern
2.3. Besonderheiten der Geschwistertrauer
2.3.1. Unterschiedliche Todesursachen als Einflu
ss
faktor
2.3.1.1. Geschwisterverlust durch Suizid
2.3.2. Die Reaktionen des überlebenden Kindes
2.3.3. Der besondere Trauerprozess der Geschwister sowie die Bedeutung von Traueraufgaben
2.3.4. Der Einfluss der Familie auf das Gelingen der Trauerverarbeitung
2.4. Zusammenfassung des zweiten Kapitels
Angebote zur Trauerbewältigung
3.1. Der Bedarf nach Unterstützung bei Geschwisterverlust
3.2. Hilfen für trauernde Geschwister – Möglichkeiten der Bewältigung
3.2.1. Abschieds- oder Trauerrituale
3.2.2. Abschied und Begräbnis – darf das Kind dabei sein?
3.2.3. Wann ist spezielle Hilfe notwendig?
3.3. Fachliche Hilfe für Geschwister und ihre Familien
3.3.1. Wochenenden/Trauerseminare für verwaiste Familien
3.3.2. Trauergruppen für Kinder
3.3.3. Geschwisterfreizeiten
3.4. Trauertherapie
3.4.1. Gestalttherapie und Rituale
3.4.2. Maltherapie mit Kindern
3.4.3. Bibliotherapie
3.5. Wie sollten sich Eltern verhalten?
3.6. Zusammenfassung des dritten Kapitels
Konsequenzen für die soziale Arbeit mit trauernden Geschwistern
4.1. Die Anforderungen an Fachkräfte
4.2. Netzwerke
4.2.1 Kindergarten
4.2.2. Schule
4.2.3. Kliniken und Krankenhäuser
4.2.4. Selbsthilfegruppen
4.2.5. Unterstützung für Fachkräfte
4.3. Mögliche Lösungsansätze
Adressen
Familienwochenenden für die gesamte Familie
Geschwisterfreizeiten
Geschwistertrauergruppen
Therapien
Begegnungstage
Hilfreiche Links im Internet
Literaturverzeichnis
Einleitung
Das Ave Maria
schwebt über der tonlosen Menge
prallt an der Urne
ab kippt um
in das Schweigen
der Schlipse und Blazer
Hinterm Schwarz im dunkelsten
Winkel des Raumes
sitzt mein Bruder und
weint er weint
ein zweites totes Meer
Ganz ehrlich
Ich habe Angst, dass er
nicht wieder aufhört
und wir müssen alle ertrinken
(Lysann Haustein, „Augen in Seenot“, 2008)
Was passiert mit uns, wenn wir eines Tages vergeblich auf jemanden warten? Wenn der Platz am Tisch neben uns leer bleibt, wenn uns plötzlich bewusst wird, wie endlich das Leben ist und wie verletzlich. Vielleicht würden wir weinen, wie im Gedicht beschrieben, ein zweites totes Meer weinen, weil wir einfach nicht wieder damit aufhören können.
Was geht dann in uns vor, wenn an uns ein Kind vorbeitollt, vielleicht unser Kind; ein Kind von dem wir wissen, dass es vor kurzem erst sein Geschwisterchen verloren hat. Trauert es denn gar nicht? Was geht in Kindern vor, die mit dem Tod konfrontiert werden? Wie erleben sie ihn? Ab wann verstehen sie, was passiert ist, können sie überhaupt trauern und wenn ja, wie kann man ihnen helfen, dieses schlimme Erlebnis zu bewältigen?
Elisabeth Kübler-Ross sagte, dass Geschwister von verstorbenen Kindern die einsamsten und vernachlässigten aller Angehörigen seien. Eltern und Ärzte versuchen, die Geschwister vor Wahrheiten zu schützen. Häufig werden die Kinder gar nicht in Entscheidungen, die gefällt werden müssen, mit einbezogen. Wissenschaftlich anspruchsvolle Literatur im Bereich der Geschwistertrauer ist rar, wie auch Untersuchungen oder Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Die Angebote für trauernde Geschwister sind immer noch dürftig, nur langsam baut sich ein verzweigtes Netz von Hilfsangeboten auf.
Dabei brauchen trauernde Kinder in unserer heutigen Zeit dringend Unterstützung. Durch den Trend zur Kleinfamilie mit nur ein oder zwei Kindern bleibt das Geschwister nach dem Tod eines Kindes meist allein zurück. Es erlebt einen Doppelverlust: den Geschwisterverlust auf der einen Seite und den Verlust der Eltern auf der anderen, denn diese haben mit ihren eigenen Gefühlen zu tun und bemerken meist gar nicht, dass auch das überlebende Kind trauert. Oder ihre Kraft reicht nicht dazu aus, dem Kind bei der Bewältigung des Schmerzes zur Seite zu stehen.
Hinzu kommt, dass Tod und Trauer Themen sind, die Menschen lieber verdrängen, solange sie nicht persönlich betroffen sind. Und selbst dann ist es einfacher, Krankheit und Tod in spezielle Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Hospize zu verbannen, als sich damit auseinanderzusetzen. Dr. phil./theol. Monika Renz (2008) ist der Ansicht, dass Tod und Sterben heute kein Tabuthema mehr darstelle. Stattdessen würden andere Dinge tabuisiert: Ohnmacht, Leiden, Kreatürlichkeit; es darf nicht gelitten werden. Dabei sehe das Leiden für andere von außen unter Umständen schlimmer aus, als es sich bei den Betroffenen innerlich anfühle.
Die Beschäftigung mit diesen Themen ist nicht nur für Menschen bedeutend, die betroffen sind oder in sozialen Bereichen arbeiten, sondern jeder sollte sich mit Sterben und Tod in seinem Leben auseinandersetzen. Leider wird der „richtige“ Umgang mit Sterben, Tod und Trauer weder in normalen Schulen und Hochschulen, noch in Fachhochschulen oder an Universitäten gelehrt. Eigentlich verwunderlich, da das Leben doch durchzogen ist von Trennungen und Abschieden, die angemessen betrauert werden müssen. Wie der einzelne Mensch seine Trauer angeht, entscheidet darüber, wie er in seinem Leben weiterhin zurechtkommt.
Doch was ist nun das Besondere daran, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher ein Geschwister verliert? Erleben sie den Tod anders als Erwachsene? Welche Chancen haben sie, den Verlust zu bewältigen: inner- und außerfamiliär?
Was muss getan werden, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden? Das vorliegende Buch erörtert diese und viele andere Fragen. Es ist das Hauptanliegen des Buches, Erwachsene, die trauernde Geschwister begleiten, zu ermutigen, Kindern zu vertrauen, sie mit einzubeziehen, ihre Fragen zu beantworten und ohne Scheu Gespräche mit ihnen zu suchen. Es ist eine Hilfe für Betroffene, das damals Geschehene neu einordnen und verstehen zu können. Und nicht zuletzt ist es auch eine Unterstützung für Eltern, die innerliche Welt ihrer Kinder zu begreifen und entsprechend zu reagieren. Doch auch professionelle Helfer können ihr Wissen erweitern und vertiefen, den Anforderungen in der sozialen Arbeit wurde insbesondere das vierte Kapitel gewidmet.
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung der Geschwisterbindung in der Kindheit und Adoleszenz. Dies ist relevant, um die Prozesse zu durchschauen, die infolge des Fehlens seines Geschwisters beim Kind ausgelöst werden. Dabei wird auch auf die durch den Tod ausgelösten Veränderungen im Familiensystem und auf die Besonderheiten beim Verlust eines Geschwisters eingegangen.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Thema Trauer im Allgemeinen und im Speziellen bei Kindern. Dies schließt die Entstehung des Todeskonzeptes, Trauerreaktionen und unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Trauer mit ein. Untersucht wird auch der Suizid von Kindern und Jugendlichen.
Hilfen für trauernde Geschwister in Form von sozialpädagogischen Angeboten und Methoden werden im dritten Kapitel vorgestellt, wo ferner geklärt wird, ob Abschiedsrituale wichtig sind, ob Kinder mit auf Beerdigungen dürfen und wann es besser ist, mit dem Kind psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vor allem wird auch darauf eingegangen, welche Verhaltensweisen der Eltern sich günstig auf das Kind auswirken.
Im vierten Kapitel wird das Thema speziell von der professionellen Seite her betrachtet, welche Konsequenzen die wissenschaftlichen Erkenntnisse für professionelle Helfer und Helferinnen nach sich ziehen und was für die Zukunft getan werden könnte, damit trauernde Geschwister besser Halt und Trost erfahren können.
Die Kapitel sind so geschrieben, dass sie auch allein für sich gelesen werden können.
1. Geschwisterbeziehungen in der Familie
Bei dem Wort „Einfluss“ und „Familie“ denken die meisten sicher sofort an die verantwortlichen Eltern. Die Eltern seien an allem Schuld. Manche Theoretiker gehen sogar davon aus, dass das Kind, wenn es auf die Welt kommt, ein unbeschriebenes weißes Blatt ist. Heute ist die Wissenschaft der Ansicht, dass viele Faktoren darauf einwirken, wie sich ein Kind entwickelt. Geschwister haben dabei einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die individuelle Entwicklung der Persönlichkeit. Deshalb ist es frappierend, dass Geschwisterbeziehungen in der Sozialisationsforschung sehr lange wenig Berücksichtigung fanden. Dagegen wurde die Dreiecksbeziehung zwischen Vater, Mutter und Kind sowie Partnerbeziehungen und berufliche Beziehungen umso genauer untersucht.
Um die Trauer von Kindern zu verstehen, ist es jedoch unerlässlich, dass auf die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen, dem Einfluss der Familie auf diese Beziehungen und letztendlich auch auf den Faktor „Geschwisterverlust“ eingegangen wird.
1.1. Familienkonstellationen
Im Raum ist es schwülwarm, aber dennoch sehr still. Alle Augen sind neugierig nach vorne gerichtet, auf die Frau, die ein Mobile an einem Faden in der Luft hält. An der Unruhe befinden sich etliche winzige Fäden mit Figuren, zwei größere und auch einige sehr kleine. Die Frau nimmt eine Schere und schneidet den Faden, an welchem ein Figürchen hängt, durch. Schlagartig fällt das gesamte Gebilde in sich zusammen, jegliches Gleichgewicht ist mit dem Faden zerstört, obwohl doch nur ein einziges Glied fehlt.
Gleichsam kann der Tod in ein Familiensystem einschlagen und alles durcheinander bringen. Und das „nur“, weil auf einmal ein kleiner Mensch fehlt.
Die Familie übt den größten Einfluss auf einen Menschen in seiner frühkindlichen Entwicklung aus und auch im späteren Leben bleibt er erhalten. Familien können als System betrachtet werden, da die einzelnen Mitglieder der Familie untereinander durch Rollen in ihren Beziehungen miteinander verbunden sind und sich wechselseitig beeinflussen. Letzteres geschieht durch Interaktion, Kommunikation, Erwartungen, Regeln und Werte. Durch die Komplexität der Familie und durch die Dynamik, die in ihr wirkt, kommt es natürlich immer wieder zu Konflikten.
In der wissenschaftlichen Arbeit ist die Beschäftigung mit den Vorgängen innerhalb der Familie wichtig, um festzustellen, welche Regeln, Muster und Erfahrungen das System Familie bestimmen. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass es in einer Familie verschiedene Subsysteme gibt. Das eine ist die Dyade, die Zweierbeziehung, etwa zwischen Vater und Sohn. Zum anderen existiert die Triade, übersetzt die Dreierbeziehung, wie zum Beispiel die Verbindung zwischen Eltern und Tochter. In beiden Ordnungsprinzipien sind Wechselwirkungen nachweisbar. Familien liegt eine komplexe und in vielen Dingen unbekannte Struktur zugrunde, die aus gewissen regelmäßigen, sich beinahe gesetzmäßig wiederholenden Ereignissen innerhalb der Familie abgeleitet werden können. Dazu kann die Art und Weise gehören, wie man mit Konflikten umgeht, ob es Rituale gibt und wie diese zelebriert werden. Die Grundstruktur eines Familiensystems kann in konkreten Handlungsweisen oder Riten aufgedeckt werden; in manchen Familien wird zum Beispiel stets dieselbe Person als Sündenbock behandelt. Man mag es nicht meinen, aber Eltern neigen generell dazu, das eine oder andere Kind zu bevorzugen - Geschwister sind dafür sehr sensibel. Unter Riten versteht Boszormenyi-Nagy „Muster erlernter Reaktionen“ (1995, S. 21).
Brodmann-Baumann & Greter (2004) nannten bestimmte Systemeigenschaften, welche das Wohlbefinden und den Zusammenhalt einer Familie fördern. Dazu gehören Strukturflexibilität, Transparenz und Umweltoffenheit. Mit Strukturflexibilität ist die Bereitschaft gemeint, interne Beziehungen und Erwartungen an die Interaktionspartner anzupassen. Transparenz führt dazu, dass Struktureigenschaften wie Selbstbild, eigene Erwartungen, bestehende Regeln den anderen bewusst und durchschaubar gemacht werden. Unter Umweltoffenheit verstehen die Autoren, dass das Familiensystem nach innen und außen offen ist, Beziehungen pflegt, Bedürfnisse formulieren kann und in der Lage ist, auch Enttäuschungen auszusprechen.
Das Familiensystem wird unbewusst auch von genetischen und historischen Abfolgen bestimmt. Um sich diesen Einfluss der Familie auf das Kind bewusst zu machen, sollten sich gerade professionelle Helfer mit der eigenen Familie, deren Struktur, Funktionsweise und Machtverteilung beschäftigen.
Toman (2002) ist der Ansicht, dass Eltern und Geschwister sich gegenseitig beeinflussen. Die Gesellschaft betrachtet Familie als eine soziale Lebensform, „welche die Eltern (oder einen Elternteil) und mindestens ein Kind umfasst“. Sie beruht auf Solidarität, Dauer und Bindung (Wiswede, 2003, S. 165).
Unterschieden werden die Kern- und die Großfamilie. Erstere umfasst Eltern und Kinder. Typ 2 kann mehr als zwei Generationen ausmachen. Die Personenzusammensetzungen in der Familie kann man nach Altersfolge und Geschlechterverteilung differenzieren. Eine Familie kann zum Beispiel aus Vater, Mutter, Bruder und Schwester bestehen. Durch diese Zusammensetzungen lassen sich auch gefühlsmäßige Beziehungen voraussagen.
Die Stellung der Familienmitglieder zueinander nennt sich Familienkonstellation. Vor allem die Anzahl der Familienmitglieder bestimmt die Art und Komplexität des Beziehungsgeflechts innerhalb einer Familie. Zum Beispiel ist es wahrscheinlich, dass in einer sehr großen Familie jedes einzelne Kind weniger Zuwendung von den Eltern erfährt und sich womöglich infolgedessen die Geschwister gegenseitig umeinander kümmern.
Wenn ein Elternteil oder ein Geschwisterkind stirbt, verändert sich die Familiensituation im Vergleich zu anderen Familien bleibend.
Langenmayer (1978) sieht in der Geschwisterkonstellation einen der Hauptbereiche der Familienkonstellation. Wie Bank & Kahn (2004) herausfanden, haben die Eltern bereits vor der Geburt eines neuen Kindes bestimmte Erwartungen in Bezug auf Identität und Rolle des ungeborenen Kindes. So stellt sich etwa eine Mutter vor, dass ihre Tochter ihr schwarzes Haar erbt und vielleicht genauso gerne kocht wie sie. Diese Erwartungen variieren und verändern sich bei nachfolgenden Kindern. Sie bestimmen das Verhalten der Eltern, so dass in der Literatur eine Unterteilung in Erstgeborene, Zweitgeborene und Letztgeborene vorgenommen wurde. Da jedes Kind eine andere Rolle ausfüllt, welche ein bestimmtes Verhalten gegenüber den anderen Familienmitgliedern erfordert, kann die jeweilige Rolle des Kindes teilweise systematisiert und ihr bestimmte Attribute zugeschrieben werden. Darauf wird in einem späteren Kapitel noch genauer eingegangen.
Die Familie kann in Subsysteme (Untersysteme) unterteilt werden, die als je eigenes System betrachtet werden können. Zum Beispiel bildet die Beziehung zwischen Vater und Mutter ein Subsystem, ebenso wie die Geschwisterbeziehung für sich genommen. Es wird vermutet, dass ein Kind sich für seine Entwicklung das günstigste Beziehungssubsystem aussucht, welches die Familie unbewusst auch zur Verfügung stellt. Dies kann auch eine Beziehungsform im Geschwistersubsystem sein, welches ergänzend zur Familie wirken kann oder sich von ihr unterscheidet. Je unsicherer die Bindung zu den Eltern ist, umso mehr suchen Kinder die Bindung zu ihren Geschwistern. Innerhalb dieser Subsysteme bilden sich meist Koalitionen (Brodmann-Baumann & Greter, 2004). In jeder Familie entstehen solche Bündnisse, die aufgrund von verschiedenen Machtbedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder geschlossen werden und der Stärkung des Selbstwertgefühls dienen.
Doch wie kommt es überhaupt zu Familienkonstellationen und Bindungen zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen den Geschwistern? Die Bindungstheorie geht davon aus, dass die Eltern-Kind-Bindung die Grundlage für alle weiteren Bindungen darstellt. John Bowlby, der "Erfinder" der Bindungstheorie, definiert Bindung als ein emotionales Band, welches die Folge von vorherbestimmten Verhaltensmustern (Bindungsverhalten) ist, die auf einen anderen Menschen konzentriert werden und dazu führen sollen, den anderen an sich heranzubringen und in der Nähe zu halten.
Bindung selbst kann nicht nachgewiesen werden, man kann sie nur durch bestimmtes Verhalten erfassen, wozu Weinen, Rufen, Folgen und Festhalten sowie starker Protest gehören. Das Bindungsverhalten entwickelt sich gegenüber einer bevorzugten Person (welche nicht die Mutter sein muss) während der ersten neun Monate des Lebens und bleibt im Verhaltensrepertoire eines Menschen erhalten. Diese erlernten Arten, sich zu verhalten (Verhaltenssysteme) werden durch bestimmte Bedingungen aktiviert, wie zum Beispiel durch Fremdheitsgefühle, Hunger und Angst. Durch andere Bedingungen wird ihre Aktivität beendet, wie etwa das Wahrnehmen der Bezugsperson und Interaktionen mit ihr. Wenn sich ein Kind sicher fühlt und das Vertrauen in die Beziehung zu seiner wichtigsten Bezugsperson hat, so hat es auch die innere Ruhe, seine Umwelt zu erkunden. Dieses Verhalten wird Exploration genannt. Hat das Kind keine gute Bindung zu seiner Betreuungsperson, wird es eher klammern oder – im anderen Extrem – auf Trennungen gefühlsmäßig kaum reagieren und vielleicht zu jedem Fremden „Mama“ sagen.
Zwei Wissenschaftler der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA haben in ihren jüngsten Studien mit Rhesusaffen festgestellt, dass Affen mit einer bestimmten Version eines mit OPRM1 abgekürzten Gens (das auch beim Menschen vorkommt) sehr engen Kontakt zur Mutter suchen. Affenkinder mit der „normalen“ Variante des speziellen Gens waren weniger anhänglich und beruhigten sich bei Trennung schnell wieder. Zurzeit fehlen noch entsprechende Studien beim Menschen, dennoch vertreten beide Wissenschaftler die Meinung, dass die genetische Prägung auch beim Menschen zutreffen könnte und die Gene des Kindes bei der Qualität der Bindung zur Bezugsperson maßgeblich beteiligt sind und nicht nur das Verhalten der Bezugsperson (C. S. Barr, 2008). Davon abgesehen kann davon ausgegangen werden, dass das Verhalten von Eltern und anderen Personen, zu deren Aufgabe die Fürsorge gehört, das Verhalten des Kindes direkt beeinflusst.
Das Bindungsstreben eines Kindes kann sich auf mehrere Personen richten, dauerhafte Bindungen knüpfen Kinder indes nur zu wenigen ausgesuchten Menschen. Eine solche Beziehung bleibt meist über einen langen Zeitraum bestehen und wird von intensiver emotionaler Anteilnahme bei der Ausbildung, dem Erhalt, der Unterbrechung und der Erneuerung von Bindungsbeziehungen begleitet. Wer fortwährend für ein Kind sorgt, wird nach Bowlby zur Hauptbindungsperson. Grossmann (2001) geht davon aus, dass Bindungspersonen nicht einfach austauschbar sind, weil das Kind Erwartungen in Bezug auf den Charakter der Interaktionen mit diesen verlässlichen Personen entwickelt. Steht eine solche zur Verfügung, entwickelt jedes Kind eine Bindung, wobei es deutliche Unterschiede in der Qualität gibt. Zum Beispiel unterteilt Holmes (2002) in sichere und unsichere Bindung. Die erste Form entsteht, wenn die Bezugsperson des Kindes beruhigend mit ihm agiert, aktiv auf es eingeht und seine Signale richtig interpretiert. Verfügt die Bezugsperson über diese Merkmale, kann sich eine sichere Bindung entwickeln. Fehlen sie, ist die Bindung nur schwach ausgeprägt und dies wird im Verhalten des Kindes, wie schon am Beispiel erklärt, sichtbar. Die Qualität der Bindung kann durch bestimmte Verfahren wie die "Fremde Situation" von Mary D.S. Ainsworth wissenschaftlich erfasst werden (Jacobvitz, Hazen & Thalhuber, 2001, S. 158). Bei der „Fremden Situation“ werden einjährige Kinder für drei Minuten von ihrer Mutter getrennt. Normalerweise äußern Kinder unter solchen Bedingungen ein dringendes Bedürfnis nach Trost und Beruhigung durch die Mutter. Kehrte diese im Versuch zu ihrem Kind zurück, traten vier verschiedene Reaktionsweisen des Kindes zutage, die darauf schließen lassen, wie gut (sicher) oder schlecht (unsicher) die Bindung zwischen Mutter und Kind ist. Etwa die Hälfte der Kinder suchte den Kontakt zur Mutter und wendete sich erst danach wieder dem Erkundungsspiel zu. Diese Kinder wurden als sicher gebunden eingeordnet. Etwa ein Viertel der Kinder kombinierte Annäherungsversuche an die Mutter mit gleichzeitiger Vermeidung ihrer Nähe. Eine dritte Gruppe näherte sich der Mutter, zeigte aber Anzeichen von Wut und verhielt sich passiv. Bei einer kleinen Gruppe von Kindern offenbarte sich Verwirrung und Desorganisation. Die Kinder blieben verstört, mieden aber trotzdem den Kontakt zur Mutter; manche versuchten gar, den Raum zu verlassen, andere versteckten sich oder kollabierten. Das ist damit zu erklären, dass die Mutter - als Objekt ihrer Sicherheit - gleichzeitig große Angst in ihnen auslöste, gegen die sie sich nicht wehren konnten. Eine Anzahl von Langzeituntersuchungen kam zu dem Schluss, dass eine sichere Bindung in der frühen Kindheit dazu beiträgt, dass das Kind sich gut an eine neue Lebenssituation anpassen kann, sie mit günstigen Strategien („coping“) bewältigt. Eine sichere Bindung fördert zum Beispiel Sozialverhalten, Regulierung der Emotionen und kognitive Begabung; also Funktionen, die mit Lernen, Wahrnehmen, Erinnern und Denken zu tun haben. Doch die Forschung blieb nicht dabei stehen, nur die „Fremde Situation“ zur Erklärung von Bindungen heranzuziehen. Es wurden auch Erwachsenen-Interviews durchgeführt. Die globalen Ergebnisse von Peter Fonagy und Mary Target (2003) ergänzen damit den wachsenden Datenbestand. Befragungen der Eltern zu ihren Bindungserfahrungen, Lebensereignissen und Schwierigkeiten, Psychopathologie-Screening usw. enthüllten Folgendes: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Bindungsverhalten und den eigenen Erfahrungen der Eltern und dem bei der „Fremden Situation“ ermittelten Bindungsverhalten der Kinder. Die un- bzw. sichere Bindung wird also in irgendeiner Form zwischen den Generationen weitergegeben. Daher ist es den Wissenschaftlern bereits vorgeburtlich möglich, das Risiko einer unsicheren Bindung für das Kind einzuschätzen. Und das in bis zu 80 Prozent der Fälle. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde deutlich, dass Bezugspersonen mit unverarbeiteten Trauer- und Traumaerfahrungen anscheinend gerade die vierte Reaktion (Desorganisation des Bindungsverhaltens) bei ihren Kleinkindern verursachten. Das Erwachsenen-Bindungsinterview offenbarte eine solche „mangelnde Verarbeitung“ durch zunächst unbedeutende Auffälligkeiten bei der Erwähnung von Verlust oder Erschütterung, so traten etwa gehäuft Versprecher, Verwechslungen von Vergangenheit und Gegenwart, Identitätsverwirrung, längere Pausen oder sogar unvermittelte Durchbrüche einer seelischen Verletzung auf. Doch warum sollte das ungelöste Trauma einer Generation mit gestörtem Bindungsverhalten die nachfolgende beeinflussen? Einer überzeugenden Theorie zufolge bewirke die fehlende Verarbeitung des seelischen Schocks, dass Eltern auf kindliche Verzweiflung (z.B. durch die Trennung) mit Angst reagierten, anstatt sicher auf das Kind zuzugehen.
Auch nachfolgende Bezugspersonen, zu welchen zum Beispiel auch die Geschwister gehören, werden zu weiteren Modellen, die dem Kind neue Denk- und Verhaltensmöglichkeiten vermitteln können. Ein intensiver Austausch mit Gleichaltrigen bietet dem Kind zahlreiche Gelegenheiten, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie seine Spielgefährten die Welt sehen, wie sie sich fühlen, wie sie denken. Bindungssicherheit kann beim Kind auch die Fähigkeit und Kompetenz im Umgang mit Gleichaltrigen fördern und dazu führen, dass das Kind eine soziale Einstellung entwickelt (Fonagy & Target, 2003).
Bank & Kahn (1994) konstatierten, dass Säuglinge jede Art des Kontakts annehmen, der ihnen entgegengebracht wird, solange es keine bessere Alternative gibt. Überleben um jeden Preis. Sie untermauerten diese Annahme damit, dass Geschwisterbeziehungen unsichere Elternbindungen teilweise ersetzen können. Diese Ersatzbindung sei nach Urteil der Wissenschaftler jedoch in der Regel „unvollständig, unbefriedigend und von Ängsten begleitet“ und birgt Gefahren für den Säugling. Die Mutter bleibe nach Ansicht von Bank & Kahn (1994) immer die potentielle Bezugsperson. Die Geschwisterbeziehung spiele in der frühen Persönlichkeitsentwicklung aber dennoch eine wichtige Rolle. Die Aussagen der Bindungstheorie können laut Cierpka (2001) wahrscheinlich in abgeschwächter Form auch für die geschwisterliche Bindung herangezogen werden. Gerade ältere Geschwister werden oft zu wichtigen Bezugspersonen.
1.2. Die Bedeutung und Rolle von Geschwisterbeziehungen
1.2.1. Horizontale Geschwisterbeziehungen
Ich wollte das Klassenzimmer gerade verlassen, als jemand von der Seite meinen Arm ergriff und mich aus dem Strom der den Klassenraum fluchtartig verlassenden Schüler zog.
„Tommy“, sagte ich und schaute erstaunt in die aufgerissenen Augen meines kleinen Bruders. Er ging auf dieselbe Schule wie ich und deshalb trafen wir uns manchmal zufällig im Schulhaus. Heute hatte er mich gesucht.
„Ich kann die Schule nicht verlassen“, klagte Tommy.
„Wieso, was ist los?“ Ich stellte den Schulranzen ab und gab ihm ein Taschentuch, denn er schniefte widerlich mit der Nase.
„Sie stehen wieder da draußen und warten auf mich. Sie wollen mich nach der Schule verprügeln!“
Ich wusste sofort, wovon er sprach. Es gab drei Jungs an der Schule, die meinen Bruder immer mal nach dem Unterricht draußen abpassten und übel zurichteten. Der Grund für ihr Verhalten war primitiv. Durch eine Augenkrankheit fielen meinem Bruder, als er klein war, alle schwarzen Wimpern aus. Über kurz oder lang wuchsen sie wieder nach, doch waren sie nun nicht mehr schwarz, sondern weiß. Mein Bruder konnte damit leben, andere offenkundig nicht, denn er wurde damit zur Zielscheibe pubertierender Halbwüchsiger.
Ich fühlte eine Hitze in mir aufsteigen. Diese aufgeblasenen Feiglinge, die meinen Bruder dazu benutzten, ihr Selbstbewusstsein und Ansehen aufzumöbeln!
„Du wartest hier“, sagte ich zu Tommy. Zwei meiner Freundinnen erklärten sich bereit, sich gemeinsam mit mir die Schläger vorzuknöpfen. Wir stießen gleich hinter der Schule auf sie, wo sie gemütlich auf einer Bank saßen und mit den Beinen baumelten. Es reicht, zu sagen: wir schonten sie nicht. Am nächsten Tag lachte die gesamte Schule über die gedemütigten Jungs. Von drei Mädchen verprügelt zu werden, war so ziemlich das Peinlichste damals. Meinen Bruder fassten sie nie wieder an, er konnte zukünftig in Ruhe mit seinen weißen Wimpern klimpern.
Für ein älteres Geschwister kann es selbstverständlich sein, auf kleinere Geschwister aufzupassen und sie auch gegen andere zu verteidigen. Sein Stand als Erstgeborenes ermöglicht es ihm, für seine nachfolgenden Geschwister eine Schutzfunktion zu übernehmen. Wie Sohni (1998) erkannte, vollzieht sich die soziale Entwicklung von Kindern im Wesentlichen in horizontalen Beziehungen und nicht in vertikalen Beziehungsfeldern. Zu den horizontalen Verbindungen zählen Geschwister, Gleichaltrige und Peergroups. Mit dem vertikalen Beziehungsfeld ist das Verhältnis zu den Eltern gemeint. Manche Wissenschaftler bezeichnen diese Konstellationen auch als symmetrisch oder asymmetrisch.
In symmetrischen Beziehungen (horizontale Bindung) herrscht ein Machtgleichgewicht und die Partner (z.B. die Geschwister) sind weitgehend gleich entwickelt und haben ähnliche Kompetenzen. Durch Asymmetrie ist besonders die Eltern-Kind-Beziehung gekennzeichnet, am wenigsten asymmetrisch sind Gleichaltrigen-, Freundschafts- und Partnerschaftsbeziehungen. Geschwisterbindungen liegen zwischen beiden Polen, sie sind zwar symmetrischer als Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen, aber auch asymmetrischer als solche zwischen Gleichaltrigen. Besonders in kleinen Familien sind die Verbindungen zu den Geschwistern sehr bedeutsam. Am bedeutsamsten sind Geschwister füreinander in der Kindheit und Jugend, danach ruhen diese Bindungen meist und leben erst im Alter wieder etwas auf. Eine Geschwisterbeziehung vermittelt durch ihre Berechenbarkeit das Gefühl einer vertrauten Präsenz, egal wie sie sich gestaltet. Ein geringer Altersunterschied und Gleichgeschlechtlichkeit fördern den Zugang zu gemeinsamen Lebensereignissen sowie den Wert der horizontalen Beziehung für die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Geschwister. Doch auch das Verhältnis zwischen Eltern und Kind in den ersten Lebensjahren bestimmt entscheidend mit, welche Art der Verknüpfung sich zwischen den Geschwistern entwickelt.
Geschwisterbeziehungen sind wie Eltern-Kind-Beziehungen Primärbeziehungen, weil sie so lange dauern, bis ein Partner stirbt. Geschwisterbindungen sind ein gewisser Ausgleich zur Abhängigkeit zwischen Eltern und Kind, da sie auf Gleichwertigkeit beruhen und die Geschwister sich zur Unterstützung auch zusammenschließen können. Gegenüber ihren Eltern bilden Kinder eine Einheit (Rollensymmetrie), die sich beispielsweise in Geschwistersolidarität ausdrückt. Die asymmetrischen Aspekte kommen besonders durch die Geschwisterposition, die Altersabstände und den damit einhergehenden Entwicklungsunterschieden zwischen den älteren und jüngeren Geschwistern zum Ausdruck. Ambivalenz ist ein wesentliches Merkmal von Geschwisterbeziehungen. Begründet ist dies im Nebeneinander von positiven und negativen Gefühlsbewegungen; Unterstützung und Rivalität existieren parallel nebeneinander. Geschwister werden als eigenes soziales Subsystem innerhalb der Familie betrachtet. Es ist in der Lage, Defizite seitens der Eltern hinsichtlich Zuwendung und Sozialisierung auszugleichen.
Dabei gibt es verschiedene Faktoren, die von den elterlichen Sozialisierungsfunktionen abweichen. Die älteren Geschwister erschließen sich Freiräume und Vorrechte, aus welchen auch die jüngeren Geschwister einen Nutzen ziehen. Markefka nannte dies die "Pionier-Funktion" (1993, S. 345). Darüber hinaus erfüllt die Geschwisterbeziehung klassischerweise auch eine Betreuungs- und Lernfunktion. Die Faktoren Identifikation und Differenzierung wirken in dieser Beziehung entgegengesetzt und Rangeleien bieten ein gutes Übungsfeld, um verschiedene soziale Fähigkeiten zu erlernen. Das kann zum Beispiel im motorischen, zwischenmenschlichen oder sprachlichen Bereich geschehen. Diese Fähigkeiten kann ein Einzelkind nur in der Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen erwerben. Entwicklungstheoretiker wie Piaget, Sullivan und Youniss (z.B. Youniss, 1994) argumentieren, dass in symmetrischen Beziehungen eine höhere Wahrscheinlichkeit bestehe, dass zwei Interaktionspartner die Lösung für ein Problem gemeinsam erarbeiten. In asymmetrischen Beziehungen, wie zwischen Erwachsenen und Kindern, wird die gemeinsame Wechselwirkung stark durch den kompetenteren Interaktionspartner (Vater oder Mutter) reguliert, der durch seine Autorität von dem weniger kompetenten Partner (Kind) meist ernst genommen wird. Die Vorstellungen der Eltern werden oft übernommen, ohne dass die Kinder sie vorher selbst durchdenken und prüfen.
In der horizontalen Beziehung kann das Kind den Umgang mit eigenen Bedürfnissen, Trieben und Wünschen in Bezug auf andere Menschen lernen und üben. Es kann im Austausch mit anderen Kindern die verschiedensten Emotionen erkunden. Das Geschwister wirkt dabei wie ein Spiegel und ermöglicht die Ablösung von der Mutter. Deshalb werden Geschwister in der wissenschaftlichen Literatur auch als „Übergangsobjekte“ bezeichnet.
Dass ohne Geschwister aufzuwachsen zu einer Verkürzung der Kindheit führt und negative soziale Folgen zeitigt, ist nicht bewiesen, aber Geschwister profitieren in sozial-zwischenmenschlichen Bereichen merklich voneinander. Umfassende Studien zur Entwicklung von Geschwistern über die gesamte Lebensspanne hinweg existieren leider nicht, ebenso wenig wie eine umfassende Theorie zur Erklärung konkreter Muster sowie Voraussagemöglichkeiten über Entwicklungsbesonderheiten. Die Bedeutung, die Geschwister füreinander besitzen, wird nach Kasten (1998) im Vergleich zu anderen Rollen (zum Beispiel Lehrer, Freunde) oftmals immer noch als niedrig eingeschätzt.
1.2.2. Der Einfluss verschiedener Faktoren
Geschwisterbeziehungen stehen unter vielen verschiedenen Einflüssen. Dazu gehört, wie die Eltern die Beziehungen ihrer Kinder regeln, wie die Geschwister einander formen und wie sich biologische, ethische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen und Zusammenhänge auf die Geschwisterbindung auswirken. Die Eltern bestimmen die Beziehung indirekt auch durch ihre Lebenserfahrungen, die sie mit ihren eigenen Geschwistern gemacht haben. Zusätzlich wirkt sich die Paardynamik der Eltern auf das Geschwister-Subsystem aus, weil die Eltern erste Modelle für ihren Nachwuchs darstellen. Das Kind schaut sich von den Eltern ab, wie diese miteinander und mit anderen Menschen umgehen und imitiert das gesehene Verhalten. Doch auch das Kind prägt aktiv die Funktionen und Prozesse der Familie und identifiziert sich nicht nur einfach damit. Es sorgt für deren Entwicklung und wählt aus den vielen Gelegenheiten, sich mit Rollen, Aufgaben und Verbindungen der anderen Familienmitglieder auseinanderzusetzen. Genauso gestaltet es auch seine Geschwisterbeziehungen aktiv, in welche die Erfahrungen mit der ersten Bindung einfließen und zur Entstehung von Beziehungsmustern führen.
Gegenwärtig vorliegende wissenschaftliche Erkenntnisse müssen enorm vorsichtig betrachtet werden. Stephen Bank bemängelte, dass viele Untersuchungen anderer Wissenschaftler, wie zum Beispiel Toman, nicht berücksichtigen, dass Geschwister im Kontext der gesamten Familie zu sehen sind. Stattdessen seien die Wissenschaftler bestrebt, die Geschwister in ihren Studien von der Umgebung isoliert zu ergründen (Bank & Kahn 1994).
Die in der Literatur aufgeführten signifikanten Merkmale, welche Aussagen über Geschwister zulassen, sind Geschwisterposition, Geschlechtszugehörigkeit, (Geschlechterverteilung), Geschwisterzahl und Altersabstand. Kasten (1998) ergänzte noch die Persönlichkeit und Leman (2002) wandte ein, dass auch die körperlichen Unterschiede und Behinderungen, die Position der Eltern im Kreis der Geschwister, die Vermischung von zwei oder mehr Familien (bei Tod und Scheidung) und die Beziehung der Eltern untereinander einbezogen werden müssten, um Aussagen zu treffen. Im Einzelnen wird nun auf diese Merkmale eingegangen.
Geschwisterposition
Die Geschwisterposition ist die Reihenfolge, in der Personen einer Familie geboren werden (Langenmayer (1978). Es wird angenommen, dass die Position in der Geschwisterreihe an typische Erziehungs- und Sozialisationseinflüsse gebunden ist, welche Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung des Kindes haben. Jeder Geschwisterposition wird deshalb in der Literatur durch ihre unterschiedlichen Ausgangs- und Hintergrundbedingungen die Entwicklung unterschiedlicher Verhaltensmuster zugeschrieben. Zum Beispiel sollen Erstgeborene eine Tendenz zum Führen von Gruppen haben und Zweitgeborene zur Unsicherheit neigen. Letztere finden als so genannte „Sandwichkinder” die ungünstigsten Ausgangsbedingungen vor. Letztgeborene sind in einer Familie dagegen meist die Nesthäkchen (Gözütok, Jerneizig & Langenmayr, 2000).
Die Theorie der Geschwisterfolge zeigt Tendenzen und Charakteristika auf, die oftmals zutreffen. Dabei sollte allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass zwischen den Familienmitgliedern dynamische und in ständiger Bewegung befindliche Beziehungen bestehen, die sich immer wieder verändern können.
Es gibt eine Reihe von Studien, die untersuchten, wie jüngere Kinder ein Verständnis von Gefühlen und Handlungen anderer entwickeln. Dort wurde herausgefunden, dass sich sowohl Kinder mit einem älteren Geschwister, mehr noch aber solche mit mehreren älteren Geschwistern als weiter entwickelt erwiesen als Kinder ohne solche. Von jüngeren Geschwistern ging kein entwicklungsfördernder Effekt aus (Ruffman et. al, 1998).
Auf die Frage, ob die Geschwisterposition mit dem sozialen und kognitiven Entwicklungsniveau von Kindern und Jugendlichen zusammenhängt, scheint es noch keine klare Antwort zu geben.
Geschlechtszugehörigkeit
Die Geschlechtszugehörigkeit hat einen Effekt auf das Verhalten der Geschwister untereinander, das Verhalten der Eltern und die Herausbildung gewisser Verhaltensmuster. Außerdem trägt sie nach Ansicht von Toman zum Beispiel bei gemischten Geschwisterpaaren dazu bei, dass Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht werden können, was sich später positiv auf die Partnerbeziehungen auswirkt.
Gözütok, Jerneizig & Langenmayr (2000) belegten, dass die Geschlechtsrollenstereotypisierung bei Kindern mit Geschwistern des gleichen Geschlechts ausgeprägter ist als bei Kindern mit gemischtgeschlechtlichem Hintergrund. Die Gesellschaft verbindet mit den Begriffen "Weiblichkeit" und "Männlichkeit" verschiedene Vorstellungen und Erwartungen, diese gehen nicht spurlos an Kindern vorbei, im Gegenteil, sie beeinflussen ihre emotionale und kognitive Entwicklung. Kinder entwickeln ein Gefühl dafür, wie sie sein sollten und verankern die kulturellen Idealvorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit in ihren Köpfen. So richten sie sich schließlich nach dem entsprechenden Idealbild aus. Ein klassisches Beispiel dafür: Mädchen spielen mit Puppen und Jungen mit Autos. Im Übrigen beurteilen gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare die elterliche Erziehung ähnlicher, als gemischt geschlechtliche Geschwister, diese haben eher das Gefühl, sie werden unterschiedlich erzogen.
Leman (2002) stellte eine Faustregel auf: wenn ein Kind durch sein Geschlecht in eine besondere Position gerät, so ist es wahrscheinlich, dass die Geschwister im Rang vor oder hinter ihm starkem Druck ausgesetzt sind. Der Umgang der Geschwister untereinander wirkt sich auch auf das Lösen von Denkaufgaben aus. Studien zufolge hatten allein arbeitende Kinder mit älteren Brüdern bessere Lösungsstrategien zur Verfügung als ebensolche Kinder mit älteren Schwestern. Allgemein erwies sich jedoch bei Kindern, denen ältere Geschwister halfen, nur die Hilfe vonseiten älterer Schwestern als förderlich. Ältere Brüder wirken wohl offenbar allein durch ihr wetteiferndes Verhalten stimulierend auf die kognitive Entwicklung der jüngeren Geschwister. Die älteren Schwestern in den Studien erklärten den Geschwistern mehr und wurden durch die jüngeren Kinder eher als Unterstützung anerkannt als die älteren Brüder.