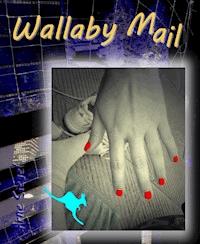Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gibt es eine Verbindung zwischen einer vermissten jungen Frau und einer Serie von Unfällen im öffentlichen Personennahverkehr? Ein stadtbekannter Angestellter der Lahrburger U-Bahn wird Kommissar Brozio den Ansatz zur Lösung des Rätsels geben, doch Kriminalassistent Nüchterlein schaut in das schimärische Auge eines massakrierenden Soziopathen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Arne Siegel
Tod in der Röhre
Roman
Wissenswertes
Über das Buch:
Gibt es eine Verbindung zwischen einer vermissten jungen Frau und einer Serie von Unfällen im öffentlichen Personennahverkehr? Ein stadtbekannter Angestellter der Lahrburger U-Bahn wird Kommissar Brozio den Ansatz zur Lösung des Rätsels geben, doch Kriminalassistent Nüchterlein schaut in das schimärische Auge eines massakrierenden Soziopathen.
Tags: Soziopath, Ratten, U-Bahn, vermisst, Leichenteile, Kleingartenanlage, Fitnessstudio
Der Autor:
Arne Siegel, geboren 1962 in Dresden, ist Bautechniker, ursprünglich gelernter Zimmerer. Nachdem er sich für zwei Jahrzehnte als Unternehmer betätigt hat, entdeckt er seine Begeisterung für das Schreiben. Der Autor lebt in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Anmerkung:
Obwohl alle meine Geschichten der Fantasie entsprungen sind, so basieren sie zum Teil doch auf eigenen Erlebnissen. Insofern sind Ähnlichkeiten mit vorhandenen Personen, Institutionen oder Firmen, die es in der Realität gibt nicht immer zu vermeiden. Dennoch bedeutet es, dass keine derselben, die darin vorkommen, in der Wirklichkeit existieren.
A. S.
Besuchen Sie auch meine Webseite unter http://arnesiegel.yooco.de/!
Böse Ahnung
1.
An einem windstillen Samstagmittag geschieht es in der Lahrburger Vorstadt.
Der gleißende Fixstern am Firmament heizt herunter, dass der Asphalt die Luft spiegelt wie ein Kaleidoskop. Schwalben auf Nahrungssuche durchziehen strahlendes Himmelsblau, Lahrburg Rosenhag hält eine Siesta, so will es dem Betrachter scheinen, einzig ein in der Hitze schillerndes Fahrzeug bewegt sich gemessenen Taktes von der Bahnhofstraße über den Pacelliplatz hinweg in Richtung Fichtenweg.
Bereits eine Viertelstunde darauf beginnt die Mittagsglut den morgendlich klaren Himmel mit faden Wolkenschleiern zu überspannen. Gewitterschauer werden in den Nachmittagsstunden heranziehen und die gegenwärtigen 30 auf 23 Grad Celsius abkühlen, das hat Gernot Katzenbeyer im Autoradio gehört und daher würde ihm nicht unbegrenzt viel Zeit für eine Tätigkeit im Freien bleiben.
Vor einer ehemaligen Fabrikantenvilla, in der Nähe des Pacelliplatzes, fährt er seinen dunkelroten Companion Uniplex-Kastenwagen in den Schatten einer alten Kastanie. Der Handwerker, von dem kein Mensch außer ihm weiß, welchen Beruf er wirklich erlernt hat, führt ein Mini-Unternehmen, das lediglich aus einer Person, nämlich ihm selbst, besteht. Von der, in dem vornehmen Anwesen wohnhaften ehrwürdigen alten Dame namens Helga Obenauf, hat der als Katzenbeyer Gebäudemanagement Service firmierte Betrieb den Auftrag erhalten, das rund 31 Meter messende schmiedeeiserne Zaungitter, das den Gehweg vom Grundstück trennt, mit einem frischen Farbauftrag zu versehen.
Bereits einen Tag zuvor hat der Allrounder die nötige Grundierung per Pinselstrich erledigt und heute, da das Penetriermittel sich ihm ausreichend trocken darbietet, will er die Endbehandlung mittels Buntlack vornehmen. Insoweit scheint alles ohne Komplikationen anzugehen und Katzenbeyers Stimmung zeigt sich nicht nur ob des bombastischen Wetters rundum exzellent. Er drückt die Hupe, zweimal kurz; erwartend, das vertraute Antlitz Helga Obenaufs zwischen Fensterstores zu erblicken. Als dieses mithin geschieht, winkt er begrüßend in ihre Richtung, was sie ihrerseits in Form einer Geste quittiert. Gernot Katzenbeyer öffnet die Flügeltüren am Fahrzeugheck. Er hebt den Lackierapparat aus dem Fond und späht dabei auf die in der Ferne leuchtende digitale Zeitanzeige des Monitors am nahen Pacellikreisel. Er wendet seinen vergleichenden Blick auf das Zifferblatt der Uhr im Cockpit des Companion Uniplex-Kastenwagens und scheint zufrieden. Erleichtert stellt er fest, dass die Gangabweichung des Chronometers weniger als eine Minute beträgt. 12 Uhr und 45 Minuten liest er von der Großanzeige ab, die er für die richtige hält, weil er weiß, dass sie exakt via Funksignal gesteuert wird. In der Annahme, die dort signifizierte Zeit könnte die absolut genaue sein, vergleicht er sie mit der Stellung der Zeiger auf dem Zifferblatt seiner Armbanduhr. Das Ergebnis der damit einhergehenden Kenntniserlangung klärt sich schnell: Der Allrounder muss sich sputen, um beim verbleibenden Teil seines Auftrags nicht in den angekündigten Regenguss zu geraten.
Gernot zieht die Schutzbrille ins Gesicht, sorgt für Energie, setzt einen arg vibrierenden Elektrokompressor in Funktion und beginnt in zügigen Schritten mit dem Lackauftrag. Zwei Buben aus der Nachbarschaft werden von dem Geblubber zur Entstehungstätte hin angelockt, wo sie mit neugierigen Blicken verfolgen, wie der Mann im Overall die vormals grauen Zaunstäbe mit karmesinroter Farbe umhüllt.
Im Gleichmut eines Fließbandmalochers arbeitet sich Gernot Katzenbeyer fort, von Pfeiler zu Pfeiler. Inspiriert vom Schwingen seiner Körperbewegungen gerät ihm ein Evergreen in den Sinn, dessen Singsang er noch kennt, nur will ihm der Name des Interpreten dazu nicht mehr einfallen. Und wie er so versucht, über andere verblühte Ohrwürmer seiner jugendlichen Epoche dem vergessenen Sänger gedanklich nachzuspüren, gewahrt er eine visuelle Regsamkeit in seinem rechten Augenfeld. Kurzum auf Unterbrechung besonnen, hechtet Gernot Katzenbeyer nach dem Schalter des bebenden Apparates, woraufhin dieser röchelnd aufgibt. Eine Sekunde später sieht er die Ursache der unfreiwilligen Pause, die ihm nun aufoktroyiert wird. Seine Auftraggeberin steht in Tüllkleid und Basthut auf dem Trottoir, zwischen ihren Fingern zwei gefüllte Halsgläser balancierend.
»Gernot! Wollen Sie frisch gepressten Orangensaft oder lieber St. Magriete ruhiges Heilwasser? Oder wünschen Sie vielleicht beides?«
»Ja, gern! Wasser und Saft zu gleichen Teilen miteinander gemischt.«
Helga Obenauf denkt kurz über seine Erläuterung nach, bis sie die nötige Klarheit hat.
»Gernot! Sie machen Ihre Arbeit bei mir immer so minuziös.«
Ihr letztes Wort dringt aus einem gespitzten Nest liniendurchfurchten Lippenstifts.
»Wissen Sie, ich kaufe Orangensaft stets frisch gepresst bei Früchte Kolberg und das Heilwasser St. Magriete bei Getränke-Hoheisel. Ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen, denn es kuriert jegliche Art von Beschwerden. Wenn Sie fertig sind, Gernot, setzen Sie sich einfach zu mir auf die Veranda, ich mache Ihnen gern einen guten Espresso!«
Während die Witwe zeitzehrend um seinen nicht vorhandenen Bart geht, nimmt er mit Sorge zur Kenntnis, dass sich der anfänglich tiefblaue Azur in milchiges Weiß verwandelt hat.
»Danke, Helga! Ich lackiere schnell noch bis zur Pforte fertig, dann nehme ich gern einen Espresso.«
»Ja, Gernot, wenn ich Sie nicht hätte!«, unterstreicht Helga Obenauf verbal die Wichtigkeit ihres Anliegens. Augenzwinkernd hebt sich der Handwerker die Schutzgläser auf die Nase und vertieft sich abermals in seine Lacknebelei. Seit zirka drei Jahren reimt sich in Katzenbeyers Ohren Obenaufs zyklisch wiederkehrender Diskurs, aber er weiß ihn inzwischen richtig zu deuten. Jedweden Allüren der Seniorin zum Trotz, bilden die Aufträge, die sie ihm stets aufs Neue im Vertrauen erteilt, gleichwohl die andere Seite der Medaille. Arbeit, die sich finanziell lohnt und bestenfalls noch flott von der Hand geht, ist das ideale Futter für Gernots berufliches Vorankommen, denn eines ist ihm bislang klar geworden: Helga zahlt für gute Arbeit gutes Geld. Das ist seine Erfahrung und darum wird er ihr stets ein vorteilhaftes Angebot unterbreiten, sofern sie es von ihm wünscht.
Nach zwei Stunden Arbeitsprozess verblasst das Sonnenlicht hinter dicken Quellwolken, was den Aufenthalt im Freien für ihn erträglicher gestaltet. Erschöpft wischt sich der Handwerker den Schweiß aus den Augenwinkeln und begutachtet kritisch sein Werk. Dabei weht ihm der Duft sowohl handgemahlenen Kaffees als auch eines köstlichen Backwerks in die Nase, jener Wohlgeruch, der mit großer Wahrscheinlichkeit der Villa-Obenauf entstammt und den er mit berechtigter Vorfreude registriert. Er malt sich schon jetzt das Kaffeekränzchen aus, was mit Bestimmtheit in Kürze folgen würde. Bisher hat es, wenn er für die Witwe tätig gewesen ist, zumeist erstklassiges Selbstgebackenes und spanischen Espresso gegeben. Und heute wird es dem Vernehmen nach so etwas wie Kokoskremtorte sein. Vergleichbare hat er in der Konditorei Stig Olov Heinkell am Pucciniplatz genießen dürfen, doch von Helga Obenauf würde sie um einiges besser sein, dessen ist sich Gernot Katzenbeyer gewiss. Sein Bulbus Olfaktorius, der dieses meterweit gegen scharfen Lackdunst erspürt, würde ihn auch diesmal nicht getäuscht haben.
Ehe das Gerüttel der Maschine infolge des Energiestopps verebbt, schlängelt sich der Druckschlauch zu seinen Füßen wie eine Natter. Um die Teile der Garnitur funktionsfähig zu halten, demontiert und reinigt Katzenbeyer sie pedantisch. Er päppelt sie Stück um Stück in eine dafür ausgeformte Gerätebox, ehe er den Blick ins grauende Gewölk erhebt. Das gleißende Sonnenlicht verblasst zusehends. Eine frische, den Umschwung der Wetter ankündigende Brise durchfährt munter die Zweige der alten Kastanie.
Indessen schlendern auf dem Gehsteig zwei Personen - ein besonnen wirkender junger Mann und eine fesche junge Lady, beide in Jeans und T-Shirt -, seinem Arrangement hinzu - sie verschwenden keine nennenswerte Aufmerksamkeit auf das dort Getane -, um sich sogleich vor dem Eingang des Anwesens, in dem der Mann zu wohnen scheint, pro tempore zur Rast einzufinden. Ohne sich auf Anhieb für ein Hinein zu entscheiden, vergehen rund drei Minuten, in denen augenscheinlich keinerlei Konversation zwischen ihnen zustande kommt.
Einen Grund für die Bedenklichkeiten derer muss es geben, schätzt der Allrounder, den das Paar ins Grübeln darüber versetzt, was ihm an der ganzen Sache eigenartig vorkommt, bis die Situation schließlich die in seinen Augen gewünschte Wendung erfährt. Die Frau, des Harrens offenbar überdrüssig, funkelt dem Mann, der sich zu zieren scheint, sehnend in die Augen, bis jener, den Schlüssel im Zylinder der Schließgarnitur wendend, das Tor ins Innere schwenkt, so als sei es jederzeit das Einfachste der Welt gewesen. Ende gut, alles gut, philosophiert Katzenbeyer, der die Leute ab diesem Punkt gedanklich in ihr Schicksal entlässt. Beruhigt ob des folgerichtigen Ausgangs der Affäre in Form eines Happy Ends, vernimmt er den gemahnenden Ruf:
»Gernot! Ihr Espresso ist fertig!«
2.
Seit etwa fünf Jahren arbeitet Holger Bahl bei der Lahrburger U-Bahngesellschaft als Monteur in der Gleiswartung. Wie stets, wenn der 27-jährige seinen Dienst antritt, so befindet er sich auch heute, zünftig gekleidet, in Overall und Signalweste, auf dem Weg zu seinem nächsten Einsatzort. An diesem Morgen wird er allerdings zu seinem letzten Arbeitsauftrag in die Röhre ausschreiten. Seit zwei Wochen ist es für ihn unumstößliche Gewissheit, dass er sein Dienstverhältnis bei der Lahrburger U-Bahngesellschaft nicht lange mehr innehaben würde. Mit einer Frist von zwei Wochen hat ihm das Unternehmen wegen Unzuverlässigkeit gekündigt und diese Zeitspanne wird um 0.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bis zur Gänze verstrichen sein. Die Auflösung des Dienstvertrages zieht der Bahnbetrieb nicht zurück, obwohl Bahl von sich meint, dass er sich um Besserung bemüht habe. Nun ist er wütend auf die Betriebsleitung, die in ihm einen Saboteur sieht, nur weil er den Gleisschlüssel in trunkenem Zustand in der Weiche hat stecken lassen. Und von der Bahngewerkschaft fühlt er sich ebenfalls im Stich gelassen, obschon er pünktlich die Beiträge gezahlt hat. Zu seiner Notlage kommt hinzu, dass Holger Bahl mit 20.000 Euro bei seiner Bank in der Kreide steht und daher zwingend auf das Gehalt der LUG angewiesen ist. Doch es gibt noch eins, warum der feiste Gleismechaniker nicht nur trauert an seinem letzten Arbeitstag. Auf dem Weg in die Röhre führt er, außer einem riesigen Gabelschlüssel, noch einen metallenen Apparat bei sich. Dieser steht in Verbindung mit einem geheimen Plan. Aus diesem Grund würde sein heutiger Dienst nicht nur aus gewohnten Routinen bestehen, sondern auch ein Befreiungsschlag aus seiner misslichen Lage sein. Im Wechseltakt setzt Bahl seinen Schritt von Schwelle zu Schwelle, eine Stirnlampe spendet ihm dafür die notwendige Helligkeit.
Nach etwa fünf Minuten betritt ein Signaltechniker namens Bruno Kalläwe in einer Entfernung von zirka 200 Metern über einen separaten Zugang denselben Streckenabschnitt. Kalläwe hat eine kräftige Leuchte, eine Dose Lackspray, Zigaretten und einen Abschiedsbrief dabei. Achtsam steigt er über im Notlicht funkelnde Gleisstränge in steter Aufmerksamkeit ob des laufenden Zugverkehrs. Heute, am letzten Tag seines Lebens, das immerhin 39 Jahre gewährt hat, wird er sich unter sichelnden Stahlreifen einer U-Bahnlokomotive ein jähes Finale setzen. So hat Bruno Kalläwe sich seinen Abschied vorgestellt und ihn entsprechend bis ins kleinste Detail geplant. Damit seine Abwesenheit vom Arbeitsplatz keinen Verdacht erregte, hat er sich mittels einer Notiz im Ausgangsbuch, einen betriebsrelevanten Betreff bezeichnend, abgemeldet. Kalläwe bewegt sich umsichtig. Meter um Meter wird der Strang - das System der Lahrburger Metro gilt als eins der best überwachten der Welt - von Meldern, teils sogar Kameras und Mikrofonen abgetastet. Um sie außer Funktion zu setzen - aufgrund seiner Körperhöhe von mehr als 1,90 m bereitet ihm das wenig Probleme -, besprüht er die Objektive und Sensoren mit schwarzer Lackfarbe. Jenes unfallträchtige Teilstück, wo es bisweilen zu Zusammenstößen kommt und wo es auch mit Herrn Kalläwes Leben zu Ende gehen soll, liegt nahe einer schwer einsehbaren Krümme. Der Triebwagenführer muss vorher abbremsen, doch würde der verbleibende Weg nicht ausreichen, um den Zug rechtzeitig vor einem menschlichen Hindernis zum Stillstand zu bringen. Diese speziellen Zusammenhänge hat Bruno Kalläwe in einer Simulation am Rechner nachvollzogen und wissentlich in sein Vorhaben integriert. Zwar ist im Laufe der Jahre das System mit modernerer Technik bestückt worden, dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist es wiederholt zu rätselhaften Kollisionen mit Personen unter Tage gekommen, die nicht ausschließlich den Suizidwilligen zuzurechnen sind. Auch ein Dipl.-Ing. Kalläwe hat den Pferdefuß an der Sache nicht herausgefunden, was seinem Vorhaben jedoch in keiner Weise im Weg steht.
Mit eigenen Plänen im Sinn kniet indes der Mechaniker Bahl auf blankem Geleise, den metallenen Apparat vor Augen, im Wissen darum, dass es sich hierbei um eine geniale Waffe handelt, mit der er all seine Probleme zu lösen gedenkt. Eine professionelle, mit sechs Kilogramm Dynamit und Funkfernzünder ausgerüstete, eigenhändig gefertigte Sprengbombe. So weit treiben Holger Bahls Wunschträume rege Blüten. Gern hätte er eine derartige Vorrichtung mit satter Explosionskraft, um der vermaledeiten Firma den entscheidenden Stich zu versetzen. Doch Bahl verfügt weder über Nitroglyzerin, noch über einen Funkfernzünder. Einzig seine von Rachegelüsten und Drang nach Bereicherung geprägte Fiktion ist Triebfeder zur Handlung, bei der er sich sowohl als filmreifer Bombenleger und Erpresser wie auch als neureicher Lahrburger in die Annalen eingehen sieht. Holger Bahls Plan besteht darin, der U-Bahngesellschaft einen Geldbetrag von einer Million Euro - die Summe scheint immens, doch verlangte er weniger, nähme es kein Mensch ernst und das will er auf keinen Fall riskieren -, mittels einer Bombendrohung abzupressen.
Unter dem Aspekt Erpresserische Anschläge in der Öffentlichkeit, hat er sich via Internet Informationen beschafft, um sich mit den Modalitäten vertraut zu machen. Die Forderungen in sämtlich darin aufgeführten Beispielen belaufen sich auf mindestens eine Million Euro, meistens noch mehr. Aufgrund der angemessen Höhe der geforderten Summe hat er insofern keine Bedenken mehr und es wäre ja auch nicht alles für ihn allein bestimmt, darüber ist er sich schon jetzt im Klaren. Holger würde als ›Robin Hood der Lahrburger U-Bahn‹ den Aussätzigen dieser Stadt wie auch seinen Kumpels Geschenke machen. All das, was ihm die LUG nimmer erfüllen kann.
Beim Blick auf die Zeiger seiner Armbanduhr wird ihm schlagartig bewusst, dass, bei aller Träumerei, sein eigentliches Vorhaben keinesfalls ins Wanken geraten darf. Zum Absichern seiner Forderung würde Bahl in einer sich automatisch absendenden E-Mail der LUG erklären, was passierte, wenn sechs Kilogramm Sprengstoff einen mit Menschen besetzten Zug der Zerstörung preisgäbe. Punkt 17.00 Uhr, das heißt, mitten im quirligen Feierabendverkehr, soll sodann die imaginäre Explosion erfolgen. Dies alles geschähe nicht, wenn die Gesellschaft in einem von ihm benannten Schließfach auf dem Hauptbahnhof eine Million Euro in gemischten Scheinen hinterlegte. Bis zu diesem Zeitpunkt müsste er allerdings den Sprengsatz positioniert und den Streckenabschnitt verlassen haben. Vom Gedanken an seine Cleverness und an das viele Geld, was er, wenn der Coup gelänge, vermeintlich bald in den Händen hielte, ist Holger Bahl so ergriffen, dass er den Luftzug, der das Nahen eines Zugverbandes ankündigt, erst im letzten Moment erfasst. Der Gleismechaniker springt in einen Verbindungsgang zur Gegenröhre. Einen Pulsschlag darauf erhellen flutende Scheinwerfer die Kulisse. Waggons donnern vorbei. Die Luftbewegung wechselt von Druck zu Sog. Rote Wagenleuchten gewinnen zügig an Abstand, bis sie in der Finsternis verschwinden.
Bahl atmet durch. Er übersteigt die 800 Volt-Versorgungsschiene, kraxelt an eingelassenen Mauereisen bis zu den Informationssträngen der Kabelkonsole empor. Behutsam setzt er die Bombenattrappe auf die vielfarbig aneinander geklammerten Kabelzüge ab, als er plötzlich einen Lichtschein gewahrt. Der Strahl schwenkt im Gehtakt des Leuchtenden hin und her und nähert sich stetig.
Alles Erdenkliche schießt Holger Bahl durch den Kopf. Er befürchtet, dass ihm jemand die Vollendung seines Ziels im letzten Moment zunichte machen könnte, belässt darum den Apparat, wo er ihn hingelegt hat, will schleunig die Steigeisen verlassen, doch stellt er rasch fest, dass es für einen Rückzug bereits zu spät ist. Aus der Düsternis des Tunnels stapft ihm eine Gestalt durch rasselnden Schotter entgegen.
Irgendwas ist hier faul, knirscht der Gleisschrauber, der sich sicher ist, dass sich außer ihm keine Person zu dieser Zeit und an diesem Ort aufhalten dürfte. Beide Männer überlegen in dieser Sekunde, ob sie bei ihrer Planung eine Kleinigkeit übersehen haben könnten. Sowohl Bahl als auch Kalläwe haben nichts Dringenderes im Sinn, als die Identität des anderen festzustellen, ohne die eigene hingegen preiszugeben. Sich keinen Millimeter von der Stelle rührend, harrt der Bombenleger auf den Tritten. Dann leuchtet ihm der Techniker mit der Lampe ins Gesicht und fragt, obwohl er es ja sehen muss:
»Hallo! Ist da jemand?«
Holger erkennt sofort die Stimme Bruno Kalläwes.
»Herr Kalläwe! Kommen Sie nicht näher! Keinen Schritt! Lebensgefahr!«, schreit er dem Ingenieur entgegen. Im Lichtkegel gewahrt Kalläwe den in der Firma bekannten Gleisarbeiter. Ebenso wenig wie sein Gegenüber kann er die Verwunderung darüber verbergen, eine einsame Menschenseele an diesem unwirtlichen Ort anzutreffen. Die Gleiswartung, da ist er sich sicher, hat hier und heute keinen Auftrag zu haben und schon gar nicht an der Kabelkonsole.
»Herr Bahl! Machen Sie keinen Blödsinn! Kommen Sie da runter! Ganz vorsichtig!«
Der von ihm Angeredete möchte obschon nichts lieber als runter von den Stiegen, doch der Techniker könnte im Unwissen um ihren Zweck die Attrappe entdecken und beseitigen wollen.
»Hier oben ist eine Bombe!«, schrillt Holger Bahl in falsettiger Stimme.
»Da oben ist auf keinen Fall eine Bombe«, entgegnet Bruno Kalläwe kühl, der sich denken kann, dass Bahls Behauptung nicht stimmte.
»Woher wollen Sie das wissen, Sie Schlaumeier?!«
»Ich sehe es Ihnen an, Herr Bahl, dass Sie lügen! Kommen Sie einfach weg da und nehmen Sie mit, was Sie da oben hingelegt haben!«
»Einen Scheißdreck werde ich tun!« schreit jener wie von Sinnen.
›Ich könnte ja mit dem Gleisschlüssel solange auf Kalläwe einschlagen, bis der sich nicht mehr muckst. Später gäben ihm die Ratten den Rest.‹
Mit diesen Gedanken im Sinn schnellt der Gleisarbeiter um die eigene Achse. Er berührt die Attrappe dabei unvorteilhaft, die ihm von oben her ins Genick fährt. Er bekommt sie im Flug zu fassen, gerät ins Wanken, was sich angesichts profilierter Arbeitsstiefel - optimal für Bodenhaftung, auf blankem Metall aber ohne Widerstand - als schwer korrigierbar erweist. Ob der geringen Friktion verlieren sie an Halt und geben den Monteur schlagartig der Gravitation preis. Hastige Versuche, die Richtung des freien Falls in der Kürze des Weges noch zu beeinflussen, schlagen fehl. Der abwärts fahrende Mann sieht sich außerstande etwas aufzuhalten was objektiv nicht mehr zu bremsen ist. Bruchteile einer Sekunde vergehen, bis die aus Kunststoff bestehende Verkleidung der Fahrstromversorgung unter ihm entzwei bricht. Ein jäh erstrahlender Lichtbogen taucht die Kulisse in gespenstische Helligkeit. 800 Volt Gleichstrom entladen sich via Bahls vertikaler Körperachse, begleitet von infernalischem Knattern, ins umliegende Erdreich. Die daraufhin einsetzende Atemlähmung gestattet es ihm nicht, vor seinem Ende noch einen Schrei auszustoßen.
Bruno Kalläwe reibt sich Lid und Ohr, als ob er daran zweifelte, die unglaubliche Szene soeben eigener Sinne vernommen zu haben. Einen Wimpernschlag darauf gewahrt er ein leises, von brenzligen Gerüchen begleitetes Zischeln, was sich rasch verstärkt. Der Ingenieur ist sich dessen gewiss, dass es lebensgefährlich wäre, Bahl mit bloßen Händen zu berühren. Fieberhaft sucht er in den Taschen nach Zigaretten. Zittrig zündet er sich eine an, inhaliert deren Rauch in einem tiefen Lungenzug. Sein eigentliches Vorhaben, weswegen er sich hier vor Ort eingefunden hat, ist ihm völlig aus dem Sinn geraten. Ihm bleibt sowieso keine Zeit zum Überlegen, denn der nächste Wagenkorso kündigt sich mit einem vehementen Luftzug an. Der Techniker nimmt all seine Kräfte zusammen und hechtet in den Schatten des Verbindungsgangs. Gnadenlos donnert der Verband an den Männern vorüber. Kalläwe weht es die brennende Kippe aus dem Mund. Bahls Körperflanke wird von der Bahn erfasst und dabei zerrissen. Erst eine Minute später kommt die Metro, in der niemand etwas von dem Vorfall bemerkt hat, an der Station Platz der Dichter und Philosophen zum Stillstand.
Bruno Kalläwe richtet seine Leuchte auf die betreffende Stelle. Die Betriebsspannung lässt Holger Bals austretendes Blut trocknen und in beißenden Rauch aufgehen. Der Signaltechniker zündet sich eine nächste Zigarette an und genehmigt sich einen innigen Zug. Dann entschließt er sich den Gleiskilometer zu verlassen, um den Unfall zu melden. Schwerer Schritte stapft er durch rasselnden Schotter in die entgegengesetzte Richtung, aus der er ursprünglich gekommen ist.
3.
In sequentiellem Wechsel von Farbigkeit und Lichtkraft der Bildpunkte offeriert der Monitor am Pacelliplatz sowohl die regionale Berichterstattung als auch die aktuelle Temperatur von 24,7 Grad Celsius im Gleichlauf mit der Anzeige der Sommerzeit von 20 Uhr und 15 Minuten. Zahlreiche Rosenhager Anwohner verachten das Lichtsmog verursachende Monstrum, wie Helga Obenauf es gern betitelt. Es verschandele die Landschaft und verstöre tausende nachtaktive Tiere. Eine Bürgerinitiative versucht gegen die kommunale Maßnahme einzuschreiten, allerdings mit der Befürchtung, dass jene bei Erfolg womöglich anderenorts in Rosenhag erneut zum Einsatz kommt. Zahlreiche Unterschriften sind bereits geleistet worden und man sieht sich auf dem Weg zum Kompromiss, versichert die Witwe dem Handwerker, als sie feststellt, dass er mit Interesse seinen Blick auf die von ihr geschmähte Infotafel lenkt.
Gernot Katzenbeyer nickt gelassen, als wenn Helga Obenaufs Worte ohnehin für alle Welt Gesetz wären. Er dreht ein geschliffenes, mit Sherry befülltes Stielglas zwischen den Fingern und guckt dabei verträumt durch dessen Facetten in den matt durchlichteten Garten. Der tagblaue Azur hat sich hinter graue Wolken verzogen. Spontane, von gewittrigem Grummeln begleitete Tropfenschauer folgen in der Ferne zuckenden Blitzen.
Gut, dass der Lack schon getrocknet ist, bevor der Guss ihn genetzt hat, konstatiert er frohgemut, den Plausch mit seiner anderen Hirnhälfte beiläufig fortführend.
Nach wortreichem Abschied schreitet der wohllaunige, gut gesättigte Handwerker, den Scheck mit der Zwischenzahlung großzügig von sich weisend, dann aber noch annehmend, in Richtung seines Companion Uniplex-Kastenwagens und atmet dabei die vom Regen erfrischte Luft tief in seine Lungen ein. Wie ein Déjà-vu-Erlebnis kommt ihm die Melodie des Evergreens in den Sinn, dessen Interpret ihm trotz Denkanstrengung nicht einfallen will. Als er den Titel ›Sweetheart forever in my mind‹ Helga Obenauf am Kaffeetisch vorsummt, versichert sie ihm, dass die Weise von Rock'n'Roller Ted Tellmann stamme. Gernot ist zwar anderer Meinung, aber zu einer Gegenrede nicht aufgelegt gewesen.
Mit forschem Dreh wendet er eine Sekunde später den Zündschlüssel in die Startposition und lässt ihn sofort wieder fahren.
›Was ist das?!‹
Ein am Boden liegendes Etwas, erhellt vom Scheinwerferlicht, indiziert sich in seinem Fokus. Er zieht die Handbremse, schwingt seine Beine heraus, langt die Marginalie vom Boden weg und betrachtet sie im Leuchtkegel der Fahrzeuglampen. Von einem Augenaufschlag zum andern wird ihm klar, dass er ein liebevoll gefertigtes, aus Lederschnüren und Glasperlen bestehendes Schmuckstück in den Händen hält, was höchstwahrscheinlich einer Frau gehört. Dabei kommt ihm sofort die Maid von heute Nachmittag in den Sinn, die den Mann zu einem Stelldichein überredet hat. Katzenbeyer benötigt nicht viel Phantasie, sich vorzustellen, dass die Besitzerin, die den Schmuck jetzt schmerzlich vermisst, in Auflösung darüber, sich und dem Mann die Schuld daran gibt. Vielleicht ist ja jemand anwesend im Haus hinter dem Torrahmen, vor dem die jungen Leute kurz vor dem Regenguss gestanden haben. Dort zu klingeln wäre zumindest eine Chance, der Eigentümerin das Verlorene zugänglich zu machen, um damit wenigstens die Stimmung des wunderbaren Abends zu retten.
Gernot Katzenbeyer sucht die Glocke und auch das Namensschild. Außer einem dunkel glänzenden Kugelknopf im Türpfosten, der ihn an eine große schwarze Johannisbeere erinnert, ist darüber hinaus nichts auszumachen. Okay - es benötigt dafür ja auch keinen Namen, findet der Handwerker. Den Johannisbeerknopf betätigend, harrt er einer Erwiderung, die jedoch nicht kommt. Das windschiefe Häuschen mit dem rostigen Wetterhahn auf dem First gibt keinerlei Rückmeldung von sich preis. Es wirkt einsam und verlassen, dabei kommt es ihm vor, als ob er zumindest ein leises Gebimmel in der Ferne gehört hätte. Gernot drückt noch einmal auf den dunklen Glasknubbel - aufmerksam spitzt er die Ohren. Doch seine Wahrnehmung bleibt untrüglich. Dieses Haus muss verwaist sein. Obwohl er nicht ganz von dem Fakt überzeugt ist, trottet er zurück zum Wagen. Das schmucke Kleinod schiebt er zwischen anderen Klüngel in eine verschließbare Ablage unter das Armaturenbrett. Dann startet er den Motor und tritt das Gaspedal voll durch. Fauchend erwacht der Diesel unter der Haube zu neuem Leben und bläst eine schwarze Rußwolke von sich weg. Katzenbeyer knipst das Fernlicht an, legt den Gang ein und lenkt den Companion in Richtung Fahrbahnmitte. Nach Sekunden fließen seine Rückleuchten in der Ferne zu einem roten Punkt zusammen.
Im Licht des vergehenden Tages duckt sich das Haus mit dem Johannisbeerknopf am Torrahmen unter das abendgraue Firmament. Der rostige Wetterhahn reitet auf dessen Dachscheitel; er scheint über Wohl und Wehe des Anwesens zu wachen. Von der anderen Straßenseite aus funkelt ihn ein frisch lackierter Schmiedezaun an. Es ist ein ungetrübtes Ambiente, was der Aura einen friedlichen Anschein geben soll. Hinter dem Haus, im Verborgenen jedoch, ergreift in diesem Augenblick eine männliche Person von der Szenerie Besitz. Nachtigallensang, Froschquaken und das Zirpen der Zikaden verstummen unisono und lassen ein beängstigendes Schweigen in die Flur herab sinken. Als dem Mann die Stille so stark in den Ohren drückt, dass er sein Blut darin rauschen hört, tritt er mit einem länglichen Gegenstand in der Hand hinaus ins Freie. Eine an der Hauswand befestigte Glühlampe illuminiert durch wallende Insektenschwärme hindurch die Gartenkulisse, bestehend aus Fingerhut und Bärenklau. Er schreitet einem Bodendeckel hinzu und bewegt ihn mittels eines Hebels aus der Einfassung in die Höhe. Unter dem Geländeniveau flammt elektrisches Licht auf. Es zeigt eine kellerartige Gruft mit gekalkten Mauern in deren Mitte eine reglose weibliche Person liegt. Schwadronen aberwitzig fiepender Ratten schwallen um ihren Leib herum und zehren von den unbekleideten Stellen das Fleisch bis auf die Knochen ab. Ein nasenloses, von unzähligen Bisswunden übersätes Gesicht, glotzt stier in eine beliebige Richtung. Ungerührt ob der haarsträubenden Szenerie, kraxelt der Mann an Mauereisen hinab, bis er auf dem Grubenbeton zum Stehen kommt. Dort angelangt, zieht er eine pfeifenartige Flöte aus der Hosentasche und bläst darauf eine einfache Weise. Unvermittelt recken die Nager ihre besudelten Schnauzen in die Richtung des Klangkörpers. Der Mann setzt die Jingle fort, bis die Tiere, von den Tönen dazu gelockt, durch eine Öffnung ins Verborgene entschwinden. Als der letzte Vierbeiner sich aus dem Verlies getrollt hat, blickt der Mann mit zufriedener Miene. Er sieht fortan keinen Grund mehr, an diesem unwirtlichen Ort zu verbleiben. Mittels eines Tuchs reibt er das Instrument sauber und schiebt es sich in die Gesäßtasche. Dann entsteigt er dem Gewölbe und schwenkt den schweren Deckel in die Umrandung zurück.
Allmählich gewinnt die Klangkulisse an nachtaktiven Wesen den Grad ehemaliger Intensität zurück. Das Leuchtmosaik der Reklametafel am Pacelliplatz bricht sich auf dem nassen Asphalt in tausende Spiegelfacetten. Musik, ferne menschliche Stimmen und fader Duft nach Gegrilltem durchziehen allmählich die Lüfte.
4.
Ein 21-jähriger Student der Uni Lahrburg namens Till Poster balanciert ein Heißgetränk von der Wohnküche der FOPS Studenten-WG in die Diele. Das Initialwort FOPS steht für die Familiennamen der zeitweiligen Bewohner: F für Falcke, O für Offergeld, P für Poster und S für Stegemann. Bei Mieterwechsel wird es in ein anderes Akronym umgeschrieben, wobei die Reihenfolge der Buchstaben keinerlei Wertung darstellt. Die Vertauschung der Zeichen mag insoweit irritieren, trotzdem hat sich die Ansicht, einen stets aktuell gesetzten Namen zu führen, über die Jahre hinweg erhalten. Ohne jedoch mindestens einen Vokal in der Buchstabengruppe zu verwenden, macht das Aussprechen nicht so viel Spaß, weiß Bo Offergeld, dem der Begriff des Solo-Vokal(isten) in diesem Zusammenhang verliehen worden ist. (Dass es Vorsänger, im Englischen auch Lead Vocalist bedeutet, ist hier allen klar.) Gleichwohl hat Bo Offergeld, als wäre es ein Wink von höherer Stelle, in der Wohngemeinschaft den Status einer administrierenden Vertrauensperson inne. Vielleicht weil er homosexuell ist und Medizin studiert? Der Student der Informatik Till Poster gibt nicht viel darauf. Er hebt das Glas auf die abgewetzte Tischplatte und zieht vor Hitze die Finger zurück. Das Kraut im Beutelchen muss drei Minuten ziehen, das hat er im Kopf, ohne es auf der Verpackung extra nachlesen zu müssen. Erstaunt darüber, dass es noch immer so stark wärmt, greift er vorsichtig zum Henkel, um sich einen ersten Schluck des aromatischen Aufgusses zu gönnen. Gespitzter Lippen erspürt er die hohe Temperatur des Dampfes, bevor er den Rand berührt. Sofort setzt er das Gefäß ab. So leidenschaftlich habe ich es doch gar nicht gekocht, überlegt Till. Ob das Wasser hier in Lahrburg Schäfichen hochgradiger siedet als bei meiner Tante Helga in Rosenhag, wo der Tee immer so schnell fertig ist? Man müsste glatt die Physikusse zu diesem Phänomen befragen. Schade nur, dass keiner von uns in der WG so etwas Praktisches studiert. Dank des preisgünstigen f+b Rooibos-Minze-Teebeutelpacks, dem letzten, den Bo Offergeld im Supermarkt erstanden hat, entfaltet sich der Duft der Geschmacksnuance nun in der gesamten Räumlichkeit. Ein Gebräu, das hier Tote aufzuwecken scheint. Till Poster gewahrt die Regsamkeiten einer, auf ihrem Futon dösenden Mitbewohnerin namens Edda Falcke.
›Dummerweise kann sie nur bei offener Tür schlafen, weil sie sonst Platzangst bekommt.‹
Die Asien-, Afrikawissenschaften und Ethnologie Studierende kann in völliger Abgeschiedenheit kein Auge zutun. Währenddessen sie träumt, muss die Tür geöffnet bleiben, egal, wievielerlei Betrieb um sie herum herrscht. Vor wenigen Stunden ist sie völlig ermattet von einem Praktikum aus Tansania zurückgekehrt. Nun ruht sie unerschütterlich, aufgrund ihres immensen Schlafbedarfs. Wohlig die Strapazen der Reise mittels Schlummer kurierend, streckt sie sich, bedeckt von einer Antilopenhaut, auf ihre japanische Matratze der Länge nach hin. Von ihrem Schlafbedürfnis angesteckt, sinkt der Informatikstudent auf einen Stuhl. Er streckt seine Extremitäten mit Behagen in alle vier Richtungen aus und gähnt lange. Dann trinkt er einen Schluck Tee, um auf klare Gedanken zu kommen.
Er will sich soeben in die Vorbereitungen des morgigen Seminars stürzen, als seine Befürchtung zur Wahrheit erwächst. Das sanfte Schnarchen aus Eddas Zimmer bricht ab und weicht einem schlaftrunkenen Seufzen. Als hätte sie Tills Blick im Traum erspürt, reibt sie sich die Lider. Zwei strahlend blaue Augen öffnen sich. Ihr Körper entrollt sich dem Fell, um in Slip und Sporthemd gehüllt das bescheidene Lager aufzukündigen.
»He, Edda! Kommenden Mittwoch um 20.00 Uhr wird in der Anstalt wieder kräftig eingeheizt«, hört Poster sich reden, der bei ihrem Anblick weder denken noch abschalten kann.
»Ist ja toll. Die Bands, die da spielen, sind nicht immer mein Geschmack, aber welches Laienorchester wird es denn diesmal sein?«
»Die Maniacs aus Boogshave in ihrer neuen Besetzung.«
»Und wie ticken die so ein? Haben sie eine okkulte Message, die wir erraten müssen? Politisch, religiös oder so?«
Till Poster schlürft vom Rand seines Teepotts einige Tropfen weg.
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Ich meine, kann man sich das ernsthaft antun?«
»Kommt darauf an. Aber ich denke, du kannst sie dir getrost zu Gemüte führen. Die halten sich für eine Art Comicrevoluzzer. Treten in Camouflagehose, Che Guevara-T-Shirt und Budjonnyjmütze auf. Sie verbrauchen pro Gig zirka zwölf Packungen Gitarrensaiten und massig Drumsticks, weil sie es gut finden so aggressiv zu spielen. Die Bühne ist zum Schluss mit Holzsplittern übersät. Ich frage mich, ob sie die Verluste mit der Gage, die die Anstalt ihnen zahlt, überhaupt ausgleichen können. Ihr Stil nennt sich Groovy Metal oder so.«
Edda Falcke lässt sich auf die Bank in der Küche nieder. Sie zieht sich das Antilopenfell über die nackten Beine und rollt dabei die Augäpfel.
»Denen gibt bestimmt ein anderer noch was dazu, sonst könnten die so was gar nicht machen.«
Sie pustet sich eine rot gefärbte Strähne aus der Stirn. Als er daraufhin nichts mehr sagt, blättert sie in einer Mädchenzeitschrift mit Boypics. Till stellt ihr einen Becher Lemon-Soda zur Seite. Er hingegen trinkt den restlichen Tee aus seinem Glas und betrachtet dabei ihre wohlgeformten Füße.
Ein Geräusch, das vom Öffnen der Eingangstür herrührt, unterbricht den Fortgang des Geschehens. Es fokussiert die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf eine dritte Person, die sich ihnen vernehmlich nähert. Der Medizinstudent Bo Offergeld drängt mit Einkaufsbeuteln in den Fäusten durch den Flur in Richtung Küche. Sekunden später lässt er sie auf die Arbeitsplatte fallen.
»Gott sei Dank, dass du kommst, Bo! Wir sterben fast vor Hunger«, ruft Till ihm entgegen. Offergeld kickt seine Römersandalen über abgezogene Dielen in die Ecke des Korridors.
»He, hallo! Ruhe bewahren, Leute! Ich musste ja noch schnell in die Bibliothek, die abgelaufenen Bücher zurückbringen. Vor der Metro treffe ich dann Achmed. Der drückt mir ein nicht abgefahrenes Ticket in die Hand. Erstmal gut, denke ich und checke ein in den nächsten Treck. Später steht der Zug eine geschlagene halbe Stunde im Tunnel ohne sich auch nur um einen Zentimeter zu bewegen. Die Unruhe und der Mief im Abteil waren grauenvoll, das kann ich euch sagen.«
»Alterchen, komm zur Sache, wir haben Hunger!«
»Na ja, es ist zum Schluss alles gut gegangen. Die Kinder krakeelten herum und eine Schwangere hat sich eingepisst, doch die Fahrt ging schließlich nach einigem An und Aus der Wagenbeleuchtung wieder voran. In der Bibliothek berichtete mir der Administrator vom Scientific-Search-Engine, dass es im U-Bahnschacht gebrannt haben soll. Die Rauchmelder haben angeschlagen, obwohl kein offenes Feuer da gewesen war. Ich bin jedenfalls froh, unseren Einkauf dann noch geschafft zu haben.«
Till Poster blickt auf die Lebensmittelpackungen und runzelt die Stirn.
»Bo, du solltest eine Dreierbox Pizza von frisch+billig mitbringen. Ich sehe aber keine. Was sind denn das für Luxusfladen?«
Offergeld hantiert angebrochene Esswaren im Kühlschrank von einer Seite auf die andere.
»He, hallo! Ruhe bewahren! Die dreier f+b Pizzaboxen waren ausverkauft, es gab nur noch welche zu 3,60.«