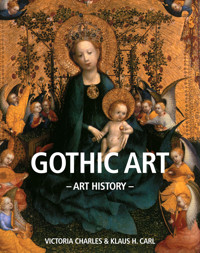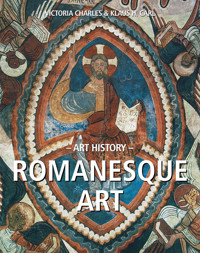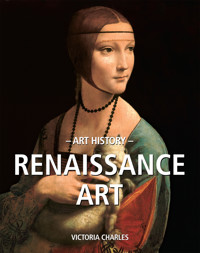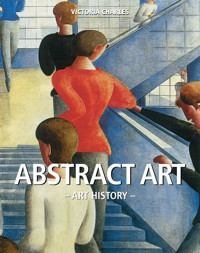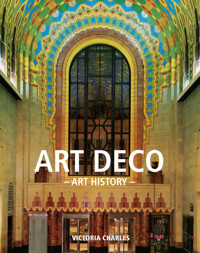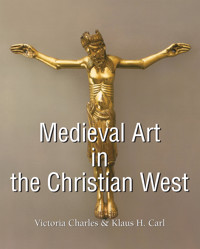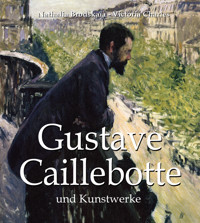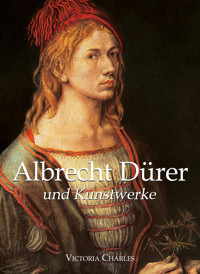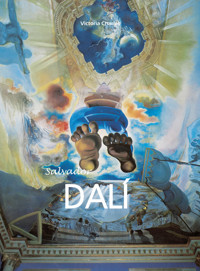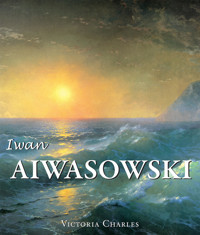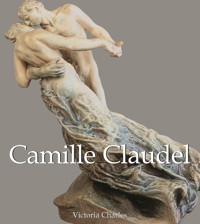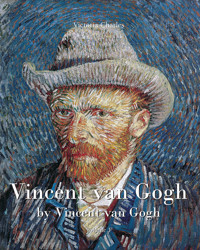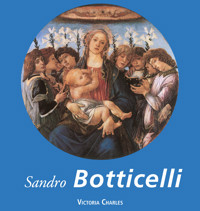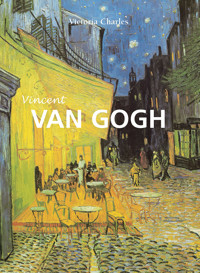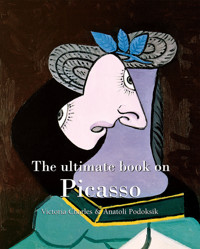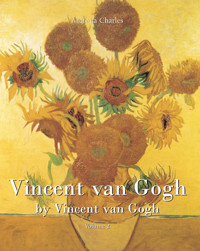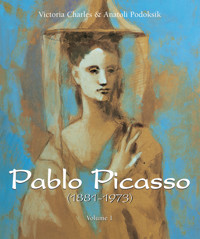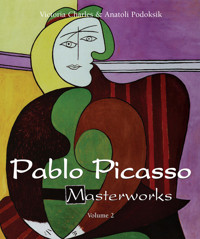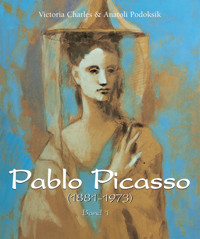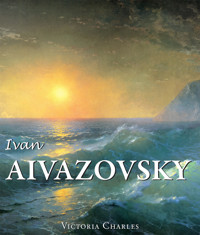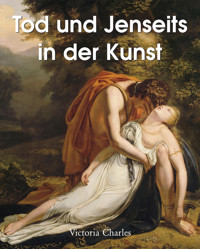
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Parkstone International
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Grabdenkmäler auf den Gräbern errichtet wurden, hat die Vorstellung vom Tod und vom Leben nach dem Tod einen wichtigen Stellenwert in der Kunstwelt erlangt. Der Tod, eine unbegrenzte Inspirationsquelle, in der Künstler nach dem Ausdruck des Unendlichen suchen können, ist das Motiv zahlreicher mysteriöser und unterschiedlicher Darstellungen. Das antike ägyptische Totenbuch, die für immer schlafenden Grabfiguren auf mittelalterlichen Gräbern sowie die Strömungen der Romantik und des Symbolismus des 19. Jahrhunderts sind der Beweis für das unaufhörliche, die Produktion von Kunstwerken zum Thema Tod und Jenseits antreibende Interesse. In diesem Buch untersucht Victoria Charles, wie die Kunst im Laufe der Jahrhunderte der Spiegel dieser Fragestellungen zum Jenseits geworden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Autor:
Victoria Charles
Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4. Etage
Distrikt 3, Ho Chi Minh City
Vietnam
© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
Image-Barwww.image-bar.com
© Marc Chagall Estate, Artists Rights Society (ARS), New York, ADAGP, Paris
© Salvador Dalí, Gala-Salvator Dalí Foundation/ Artists Rights Society (ARS), New York/ VEGAP, Madrid
© Succession H. Matisse, Artists Rights Society (ARS), New York
© Graham Sutherland Estate, alle Rechte vorbehalten
Weltweit alle Rechte vorbehalten.
Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.
ISBN: 978-1-78310-681-3
Victoria Charles
Tod und Jenseits
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Antike Konzepte von Tod und Jenseits
Christliche Lehren von Tod und Jenseits
Visionen des Jenseits
Das antike Ägypten
Die Etrusker
Reliquien der Toten
Etruskische Glaubenslehren von Tod und Jenseits
Das alte Griechenland und das alte Rom
Das Christentum
Frühchristliche Lehren vom Jenseits
Mittelalterliche Lehre vom Jenseits
Die spätere Lehre vom Jenseits
Christlicher Symbolismus
Gott und die Trinität
Das Kreuz
Die Schlange
Todessymbole
Die Hölle und das Fegefeuer
Der Himmel
Wiedergeburt und Erleuchtung
Die hinduistische Lehre vom Jenseits
Die buddhistische Lehre vom Jenseits
Die Skhandas - fünf konstituierende Elemente
Das Nirwana
Ausgewählte Bibliografie
Abbildungsverzeichnis
Der Buddhapada, 1. Jh. v.Chr.
Kalkstein, 67,5x46,25x15cm.
Großer Stupa in Amaravati, Andhra Pradesh.
Um eine Welt in einem Sandkorn zu schauen
Und einen Himmel in eines Blütenkelches Mund,
Halte die Unendlichkeit in deiner kleinen Hand,
Und die Ewigkeit in einer Stund’.
William Blake, Auszug aus:Auguries of Innocence
(Weißsagungen der Unschuld)
Vorwort
Wie Wellen hin zum kies’gen Ufer rauschen,
So eilen unsre Tage rasch zum Ziel;
Im Wechsel müssen sie die Stellen tauschen,
Sie dringen vorwärts stets in bunt Gewühl.
Wenn die Geburt begrüßt des Lebens Licht,
Zur Reife kriecht sie dann, die, kaum gewährt,
Als hämisch Dunkel ihren Ruhm anficht.
Der Zeit Geschenk wird von der Zeit zerstört;
Vernichtet wird durch Zeit der Jugend Prangen,
Es muß die Schönheit ihren Furchen weichen,
Ihr ist, was liebend hielt Natur umfangen,
Mit scharfer Sens’wird Alles sie erreichen;
Doch nicht mein Vers, der deinen Preis gesungen,
Soll – mag sie droh’n – der Zukunft sein verklungen.
William Shakespeare,Sonett LX, inWilliam Shakspeares sämtliche Werke.
Übersetzer: Emil Wagner
Seit Urzeiten haben im Lauf der Jahrhunderte zahllose Berufene und Unberufene immer wieder geforscht und versucht, die sich um den Tod und das Jenseits rankenden Geheimnisse zu lüften. Die ausweglose Realität des Todes und der menschliche Alterungsprozess bilden die Grundlage für einen Glauben an das ewige Leben. In der Hoffnung, dem Tod entfliehen zu können, suchten die Menschen nach einem Halt in einem Unsterblichkeit verleihenden Mittel. Über viele Jahrhunderte hinweg haben Symbolisierungen wie der Jungbrunnen, der Heilige Gral oder der Stein der Weisen ihre verlockenden Eigenschaften und die Beliebtheit dieses Themas veranschaulicht.
Als Folge der Natur, des Mythos’ und der Religion werden die Menschen immer wieder an den bevorstehenden Tod erinnert. Die Figuren aus der griechischen Mythologie wie Achilles, Ikarus und Sisyphos sowie eine Fülle anderer legendärer Charaktere dienen als didaktische Werkzeuge, um den Menschen deutlich zu machen, welches Schicksal ihnen bevorsteht, wenn sie versuchen, sich über die Grenzen und Gesetze des Universums hinwegzusetzen. Ohne den Tod würden die Menschen, bildlich gesprochen, das Schicksal des Sisyphos erleiden, dessen fortwährende Strafe darin besteht, unaufhörlich einen ihm immer wieder wegrutschenden Felsblock einen steilen Hang hinaufzurollen.
Irdische Unsterblichkeit ist eine unnatürliche Falle, die den Kreislauf des Lebens behindern würde. Die wechselnden Jahreszeiten erinnern uns ständig an die vergängliche Natur; die Rückkehr und das Wiedererwachen des Frühlings hängt immer vom Verschwinden des dunklen und tristen Winters ab. Die Menschheit kann dem Tod nicht entfliehen, denn er ist tief in ihr verwurzelt und daher ein wesentlicher Teil des menschlichen Lebens.
Die Drei Pyramiden von Gizeh,
um 2600 v.Chr. und später.Altes Reich
von Ägypten. Stein. In situ, Gizeh.
Pieter Bruegel der Ältere, Der Triumph des Todes, um 1562.
Öl auf Holz, 117x162cm.Museo Nacional del Prado, Madrid.
So leicht man die Unvermeidlichkeit des Todes auch akzeptieren mag, klärt sie uns aber nicht über das Geschehen selbst auf. Die Menschen können sich auf die Umstände und Ursachen des Todes vorbereiten, es gibt aber keine Erklärung für die verborgenste Realität des Todes. Die Bedrängnisse der Todesstunde sind unendlich mannigfaltig, aber der Kern der Sache ist immer gleich: es gibt zwar tausende Arten zu sterben, aber es gibt nur den einen Tod. Dadurch, dass man die Möglichkeit eines undefinierbaren Todes anerkennt, akzeptiert man auch die Existenz des Unbekannten, eine extrem überwältigende Bewusstwerdung. Um mit dieser Tatsache fertig zu werden, glauben die Menschen an die Möglichkeit eines Lebens im Jenseits und trösten sich mit der Vorstellung, dass dort alles prächtig ist. Einer der wichtigsten englischen Dichter, John Keats (1795-1821), begrüßte diese Idee in seiner Ode auf eine griechische Urne, in der es heißt:
Gehört sind Klänge süß,
doch ungehört noch süßer;
Drum spielt, Pfeifen, fort im Chor.
(Keats,Ode auf eine griechische Urne, Zeile 11-12)
Offensichtlich verringert der Glaube an ein Leben im Jenseits die Angst vor dem Tod. Der sterbende Sokrates (um 469-399 v.Chr.) sagte „er soll seine Seele der Hoffnung auf ein Leben im Jenseits anvertrauen, wie ein Floß, und sich ins Unbekannte treiben lassen.“ Kein Symbol unseres menschlichen Daseins mit seinen Drohungen, Gefahren, Mysterien und Versprechungen könnte beeindruckender sein als das eines in eine unbekannte Tiefe gleitenden Gefährts. Der Geist grübelt daher über die prophetischen Warnungen und die verlockenden Einladungen, die durch die geheimnisvollen Häfen der Ewigkeit charakterisiert werden.
Die Besessenheit von der Ewigkeit ist in der Geschichte tief verankert; viele Kulturen und Zivilisationen haben Glaubenssysteme entwickelt, die sich mit der Aussicht auf ein Leben nach dem Tod beschäftigen. Raffinierte Kunstwerke wie Särge, Grabreliquien, religiöse Malereien und sogar abstraktere Stücke sind exzellente soziokulturelle Beispiele, mit denen man das Jenseits betreffende spezifische Glaubensrichtungen, Rituale und philosophische Konzepte verstehen kann. Das Nebeneinander von Kunst und Lyrik schafft eine dynamische Kraft, die die Ausdruckskraft des Themas noch hervorhebt.
Antike Konzepte von Tod und Jenseits
Tizian (Tiziano Vecellio),Adam und Eva,
um 1550.Öl auf Leinwand, 240x186cm.
Museo Nacional del Prado, Madrid.
Théodore Géricault, Das Floß der Medusa, 1819.
Öl auf Leinwand, 491x716cm.Musée du Louvre, Paris.
Auguste Rodin, Das Höllentor, 1880-1917.
Bronze, 635x400x85cm.Musée Rodin, Paris.
Christliche Lehren von Tod und Jenseits
Der erste Teil des ersten Kapitels des nachfolgenden Textes umreißt zunächst die vorherrschenden christlichen Ansichten zu Tod und Jenseits. Mit dem Schwerpunkt auf patristischen, mittelalterlichen und modernen Glaubenssätzen beschäftigt sich diese Untersuchung des zukünftigen Lebens sowohl mit den Komponenten, die das Christentum über die Jahre hinweg geprägt haben als auch mit den Diskussionen hinsichtlich der verschiedenen Reiche des Jenseits.
Der zweite Teil dieses Kapitels konzentriert sich mehr auf den christlichen Symbolismus im Kunstwerk selbst und seinen Bezug zum Tod und zum Jenseits. Das Kreuz, die Schlange sowie verschiedene andere Todessymbole werden detailliert besprochen und liefern so eine verständlichere Studie zu Christus als Märtyrer, zum Garten Eden sowie zu Himmel und Hölle. Die Kunstwerke reichen von Wandmalereien aus Katakomben, von Kreuzigungsdarstellungen über Vanitas-Skulpturen und -Gemälde bis hin zu anderen Werken.
Visionen des Jenseits
Zusätzlich zur Untersuchung der antiken Zivilisationen und der Interpretation der Art und Weise, mit denen die Menschen mit dem bevorstehenden Tod fertig wurden, wird auch eine symbolischere Betrachtungsweise herangezogen, mit der die subjektiven Darstellungen bezüglich der verschiedenen Aspekte des Jenseits wie Himmel, Hölle, Erleuchtung, Paradies, Fegefeuer und Wiedergeburt näher untersucht werden. Dieser Abschnitt beabsichtigt dabei, aufzuzeigen, wie sich Künstler das Unbekannte vorstellten und visualisierten.
Von den Himmel darstellenden islamischen Mosaiken bis hin zu den Illustrationen der Göttlichen Komödie
Die Totenmaske von Tutanchamun, Neues Reich von Ägypten,
18. Dynastie, 1549-1298 v.Chr., Reich von Tutanchamun,
um 1333-1323 v.Chr., um 1323 v.Chr.Gold, Lapislazuli,
Karneol,Quarz, Obsidian, Türkis und Glaspaste,54x39,3cm,
Gewicht: 11kg. Ägyptisches Museum, Kairo.
Das antike Ägypten
Bei dem Versuch, die Menschen des antiken Ägypten und ihre Auffassungen vom Jenseits zu verstehen, muss man zunächst fragen, warum sie ihre Toten mit solchem Aufwand konserviert haben. Es ist dann zu fragen, welches Motiv sich hinter dieser verschwenderischen Maßlosigkeit von Geld, Zeit und Arbeit, hinter dieser mit hohen Kosten verbundenen Einbalsamierung verbirgt. Leider hatten sich nur wenige hochkarätige Theologen mit dem Thema beschäftigt, denn eigentlich ist doch bekannt, dass die Ägypter ihre Toten deswegen so gut einbalsamierten und in steinernen Lagern aufbewahrten, um die Körper vor dem Verfall zu schützen. Schließlich glaubten sie daran, dass die verstorbenen Seelen eines Tages zurückkehrten und die Körper wiederbelebten.
Auch wenn diese Annahme viele Jahrhunderte lang geglaubt wurde, ist sie sicherlich falsch. Es gibt bisher keinen Beweis oder irgendwelche Indizien für eine Reinkarnation. Der griechische Historiker Herodot (490/480 v.Chr.-um 424 v.Chr.) berichtete, dass
[…] die Ägypter glauben, dass die Seele nach dem Ableben des Körpers in ein neugeborenes Tier eindringt und dass sie, nachdem sie in verschiedenen irdischen Wasser- und Himmelswesen gelebt hat, in einen neugeborenen Menschen zurückkehrt.
Es gibt auch keinen Beweis dafür, dass nach einem angenommenen Kreislauf von etwa dreitausend Jahren die Seele wieder in den alten Körper zurückkehrt. Man kann höchstens annehmen, dass sie bei jedem Schritt der Seelenwanderung in einem neuen Körper geboren wird.
Aber auch die Veränderung des Körpers durch die Einbalsamierung verbietet den Glauben an eine Rückkehr zum Leben. Das Gehirn wurde entnommen und der Schädel mit Baumwolle ausgestopft. Die Eingeweide wurden entfernt und, nach Ansicht des Schriftstellers Plutarch (um 45-um 125) und des Philosophen Porphyrios (um 233-305), in den Nil geworfen. Wie spätere Untersuchungen festgestellt haben, wurden die entnommenen Eingeweide in vier Bündel gepackt und entweder in die Bauchhöhle gelegt oder in vier Kanopenvasen neben der Mumie untergebracht.
Die Theorie der Seelenwanderung, von der man annimmt, dass sie ein wichtiger Bestandteil des ägyptischen Glaubenssystems war, besagt, dass die Seelen nach dem Tod entweder sofort oder nach einem vorübergehenden Aufenthalt im Himmel oder der Hölle, je nach Verdienst, in neuen Körpern wiedergeboren werden und niemals in den alten Körper zurückkehrten. Darüber lässt sich jedoch streiten, da man neben Bildern Inschriften gefunden hat, auf denen Szenen der Glückseligkeit der gesegneten Seelen im Himmel dargestellt werden und die aussagen, dass „[…] ihre Körper für immer in ihren Gräbern ruhen sollen, sie werden ewig in den himmlischen Gefilden leben und die Anwesenheit des obersten Gottes genießen.“ Es heißt auch, dass „ein Volk, das an Seelenwanderung glaubt, sich daher ständig bemüht, den Körper vor Fäulnis zu bewahren, in der Hoffnung, dass die Seele in den verlassenen Körper wieder zurückkehrt.“
Dieser Hinweis ist an sich nicht korrekt, denn der Lehrsatz von der Seelenwanderung existiert in Übereinstimmung mit dem Gesetz von der Geburt, der Kindheit und dem Aufwachsen und nicht mit dem Wunder des Wiederbelebens von Körpern. Dieser Gedanke wurde historisch auch durch die Tatsache widerlegt, dass im Osten die an diesen Lehrsatz Glaubenden ihre Leichname niemals aufbewahrten, sondern sie begruben oder verbrannten. Die ägyptische Theologie steht daher der hinduistischen nahe, die eine Wiederauferstehung des Körpers ausschloss, ganz im Gegensatz zur davon überzeugten persischen Theologie. Eine andere, die ägyptische Einbalsamierung erklärende Annahme besagte, dass
Das Ägyptische Totenbuch, Papyrus Ani: Das Urteil von Ani:Die Szene vor dem Gericht (Blatt 3), Neues Reich von Theben,
19. Dynastie, 1320-1200 v.Chr., um 1250 v.Chr.
Bemalter Papyrus, 42x67cm. The British Museum, London.
Diese willkürliche Vermutung ist fragwürdig. In keiner Weise führt die Erhaltung des Körpers dazu, dass die Seele festgehalten oder sogar mit ihm vereinigt wird. Es ist undenkbar, dass die Abwesenheit der Seele den Tod ausmacht. Und auch dies ist keine ausreichende Erklärung für die Einbalsamierung, denn in den hieroglyphischen Darstellungen schwebt die Seele beim Übergang zur Urteilsverkündung über dem Körper, kniet vor den Richtern oder geht ihren Abenteuern in den verschiedenen Reichen der Schöpfung nach. Der klassische französische Gelehrte, Philologe und Orientalist Jean-François Champollion (1790-1832) äußerte:
Die Darstellung des Körpers ist eine Hilfe für den Betrachter und lehrt keineswegs die körperliche Auferstehung. Des Predigers Samuel Sharpe Ansicht, dass das Bild eines Vogels, der mit den Symbolen des Atems und Lebens in seinen Krallen über dem Mund einer Mumie schwebt, die Lehre der allgemeinen körperlichen Wiederauferstehung impliziere, ist eine verblüffende Schlussfolgerung.
Welcher Beweis führt zu einer solchen Annahme? Hunderte Bilder in den Gräbern zeigen Seelen, die ihre Zuweisungen in der anderen Welt erhalten, während ihre körperlichen Mumien ruhig in den Grabstätten liegen. In seiner Abhandlung Isis und Osiris schrieb Plutarch, dass „die Ägypter glauben, dass, während die Körper bedeutender Männer unter der Erde begraben wurden, ihre Seelen als Sterne am Himmel strahlen.“ Es ist schwierig und unbegründet, sich vorzustellen, dass im ägyptischen Glauben die Einbalsamierung entweder die Seele im Körper festhielt oder den Körper für eine zukünftige Rückkehr der Seele bewahrte.
Wer kann sich vorstellen, dass die Ägypter aus einem dieser Gründe auch eine Vielzahl von Tieren einbalsamierten, deren Mumien die Forscher noch gelegentlich finden. Die Ägypter konservierten Affen, Bullen, Falken, Käfer, Katzen und auch Krokodile mit der gleichen Mühe, mit der sie auch Menschen einbalsamierten. Als man die Kanarischen Inseln entdeckte, fand man heraus, dass ihre Bewohner ihre Toten traditionell einbalsamierten. Dasselbe galt für die Peruaner, deren Friedhöfe bis heute voller Mumien sind. Allerdings erwarteten diese Völker nicht, dass die Seelen in die mumifizierten Körper zurückkehrten. Herodot berichtete, dass
Grabkammer, Grab von Ramses I., 19. Dynastie,
1320-1200 v.Chr., um 1290 v.Chr. Tal der Könige, Luxor.
Das Ägyptische Totenbuch, Papyrus Horus: Urteilszene:links sitzt Osiris mit den GöttinnenIsis und Nephthys,die hinter ihm stehen (Blatt 6), Ptolemäische Dynastie,
332-331 v.Chr., um 300 v.Chr., Achmim.Bemalter Papyrus,
42,8x58cm
Statue von Osiris, Ende 26. Dynastie, um 685-525 v.Chr.,
Ende 6. Jahrhundert v.Chr. Glimmerschiefer,
89,5x28x46,5cm.Ägyptisches Museum, Kairo.
Da die Ägypter für ihre dauerhaften Grabstätten einen so großen Aufwand betrieben und die Wände mit unterschiedlichen Verzierungen schmückten, wurde oft angenommen, dass sie vom Verbleib der Seele im Körper ausgingen und diese somit ein bewusster Bewohner des ihr bereitgestellten Ortes war. Man ging ebenfalls davon aus, dass die an den Küsten Südamerikas vom Fischfang lebenden alten Stämme Köder und Angelhaken mit in die Gräber legten, weil sie glaubten, dass die Toten sich im Grab mit dem Fischfang beschäftigten.
Die Ausschmückungen der ägyptischen Gräber sind aufwändig und mannigfaltig und waren die Belohnung für liebevolle, spontane Arbeiten und bedürfen keiner ausführlicheren Erklärungen. Jedes Land hat seine eigenen Bestattungsriten und -traditionen, von denen viele so schwer zu erklären sind wie die aus Ägypten. Skandinavische Seefahrer wurden manchmal zunächst auf ihren Schiffen aufbewahrt und später auf einer ins Meer ragenden Landzunge beerdigt. Die Skythen beerdigten ihre vornehmen Toten in manchmal bis zu 50 Pfund schweren Goldrollen. Der griechische Geschichtsschreiber Diodor (1. Jh. v.Chr.), der Sizilianer, erklärte:
Die Ägypter, die die einbalsamierten Körper ihrer Vorfahren in prächtige Monumente legten, sahen die wahren Gesichter und das Äußere derer, die lange Zeit vor ihnen starben. Sie finden viel Gefallen daran, ihre Gesichtszüge und körperlichen Proportionen zu sehen, gerade so, als weilten sie noch unter ihnen.
Statue von Isis, Ende 26. Dynastie, um 685-525 v.Chr.,
Ende 6. Jahrhundert v.Chr. Glimmerschiefer,
90x20x45cm.Ägyptisches Museum, Kairo.
Unter den Ägyptologen gab es hierbei unterschiedliche Ansichten. Die einen meinten, dass das Einbalsamieren die Seele im Körper bis nach dem Beerdigungsurteil und der Bestattung festhielt und dass nach der endgültigen Konservierung der Ka (der Geist des Verstorbenen) voranschritt, um entweder die Sonne in ihrem Tag- und Nachtkreislauf zu begleiten oder eine Seelenwanderung durch verschiedene Tiere und Gottheiten anzutreten. Andere hingegen waren der Meinung, dass der Einbalsamierungsprozess angewendet wurde, um die Seele in der anderen Welt zu schützen, ausgenommen davon waren die Seelenwanderungen bis zum Verfall des Körpers. Vielleicht existierten aber alle diese Auffassungen zeitgenössischer Autoren über die Ägypter auch zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Der Drang, die Erinnerung an den Verstorbenen zu bewahren, war die Grundlage für die Entwicklung eines theologischen Grundsatzes – ein ausgearbeitetes, tief in der Struktur des Landes verwurzeltes System priesterlicher Lehren.
Eine weitere Frage ist: Welche Bedeutung hatten die Bestattungszeremonien der Ägypter für ihre Toten? Wenn der Körper einbalsamiert war, wurde er einem Tribunal von vierzig Richtern präsentiert, die am östlichen Rand des Sees Acherusia (bei Memphis) saßen. Es gab eine strenge Befragung zum Charakter und Verhalten des Verstorbenen. Jeder konnte sich über ihn beschweren oder in seinem Namen aussagen. Stellte sich heraus, dass er bösartig war, mit Schulden starb oder sich anderweitig unbeliebt gemacht hatte, wurde ihm eine ehrenvolle Bestattung versagt. Er wurde er in eine Grube geworfen die man als „Tartar“ bezeichnete. War die Person jedoch gutmütig gewesen und hatte ein anständiges Leben geführt, wurde ihr die Ehre eines würdevollen Begräbnisses zuteil.
Stele von Djeddjehutyiuankh, 22. Dynastie des
Alten Ägypten, um 945-720 v.Chr.
Bemalter Stuck auf Holz, 27,6x23x2,7cm.
Grabstele von Amenemhet, 11. Dynastie, 2134-1991 v.
Chr., Nekropole von Al-Asasif, Altes Theben
(heute Luxor/Al-Karnak). Tanis, Grab von Psusennes I.,
Gruft von Psusennes I., Ausgrabung von P. Montet.
Bemalter Kalkstein, 30x50cm.Ägyptisches Museum, Kairo.
Scheintür-Stele von Iteti, 6. Dynastie, 2345-2181 v.Chr.,
um 2181 v.Chr.Altes Reich des Alten Ägypten,
Sakkara (Grab von Iteti).Bemalter Kalkstein,
360x210cm. Ägyptisches Museum, Kairo.
Triade von Mykerinos, 4. Dynastie, 2620-2480 v.Chr.
Altes Reich, Reich von Mykerinos, 2490-2472 v.Chr.,
Gizeh.Grauwacke, Höhe: 96cm. Ägyptisches Museum, Kairo.
Die antiken Griechen wurden vor allem durch die ägyptische Ideologie vom Jenseits beeinflusst und entwickelten viele ihrer Ideen anhand des Schicksals und Zustands der Toten aus Ägypten. Hades entspricht Amenthes, Der Gott Hades dem unterirdischen Osiris, Hermes entspricht Anubis, dem „Platzanweiser der Seelen“ , Aiakos, Minos und Rhadamanthys entsprechen den drei Göttern die dem Wiegen der Seele beiwohnen und Osiris das Ergebnis verkünden, Tartaros dem ägyptischen Tartar, Charons Geisterboot auf dem Styx ist der Kahn, der den mumifizierten Körper zu den Gräbern bringt, Kerberos entspricht dem Oms, Acheron dem Acherusia, das Elysion dem Elisout. Herodot bestätigte, dass diese Orte und Personen aus dem ägyptischen Glauben stammen, das antike griechische System ist auch einfach zu ähnlich, als dass es sich hätte unabhängig entwickeln können.
Der Triumph der Forschung auf dem Gebiet des antiken Ägypten, das Entschlüsseln der Hieroglyphen und Aufdecken alter Geheimnisse haben eine verständliche Übersicht der ägyptischen Glaubenssätze über das zukünftige Leben vermittelt, wobei drei Informationsquellen offengelegt wurden.
Die erste Quelle waren die Papyrusrollen, von denen eine bei jeder Mumie platziert wurde. Mit Hieroglyphen übersät, wurden diese Rollen auch das ‚Bestattungsritual’ oder das ‚Buch der Toten’ genannt. Es war Teil des Bestattungsritus und enthielt die Namen der Verstorbenen und ihrer Eltern, eine Reihe Gebete, die von der Person auf ihrer Reise vor den Gottheiten zu rezitieren waren sowie Darstellungen des im Ungewissen zu erwartenden Schicksals. Die geschmückten Särge, in denen die Mumien aufbewahrt wurden, zeigen Szenen des ewigen Lebens und behandeln die Ereignisse und Gegebenheiten, die die Seele des Verstorbenen in der anderen Welt erleben könnte. Die verschiedenen Schicksale der Seelen findet man als Gemälde und Skulpturen auch auf den Grabwänden, zusammen mit den bereits im 19. Jahrhundert entzifferten Schriftzeichen.
Aus dieser Information können wir schließen, dass gemäß der ägyptischen Darstellung die Seele vom Gott Thoth, dem Protokollführer des Totengerichts, in den Amenthes, in die höllische Unterwelt, geleitet wird, deren Eingang ganz im Westen liegt, auf der anderen Seite des Meeres, da, wo die Sonne untergeht. Die Seele daneben kniete vor den fünfundvierzig Richtern des Osiris, das abschließende Urteil wurde in der Halle der zwei Wahrheiten gefällt. Hier wiegen die drei Gottheiten Horus, Anubis und Thoth das Gewicht der Seele mit den Maßstäben von Maat (der Personifikation von Wahrheit und Gerechtigkeit). Wenn das Herz mit der Feder von Maat im Gleichgewicht ist, wird die Seele mit ewigem Leben belohnt. Besteht das Herz diesen Test nicht und die Waage schlägt aus, wird die Seele vom schrecklichen Monster Ammit gefressen.
Thoth, der Schreiber der Götter, zeichnet die Ergebnisse auf und die Seele des Verstorbenen rückt zum Thron des Osiris vor (Gott des Todes und König der Unterwelt), der das letzte Urteil fällt. Wie zahlreiche Zeichnungen verdeutlichen, wird die verdammte Seele entweder sofort zur Erde zurückgeschickt, um dort in der Gestalt eines abstoßenden Tieres zu leben, oder der Folter der erbarmungslosen Feuerhölle und den Teufeln darin ausgesetzt oder sogar in die Atmosphäre verbannt, um dort so lange von Unwettern durchgeschüttelt und gewaltsam in die Böen und Wolken geschleudert zu werden, bis ihre Sünden gebüßt sind und sie als neue Existenz in menschlicher Form auf die Probe gestellt wird.
Es gibt zwei Darstellungen der Aufteilung des ägyptischen Universums. Nach der ersten Ansicht setzt sich die Erschaffung aus drei verschiedenen Stufen zusammen: Zuerst gibt es die Erde oder Prüfungszone, in der der Mensch auf die Probe gestellt wird. Danach kommt die Atmosphäre oder der Bereich der weltlichen Bestrafung, in der die Seelen für ihre Sünden malträtiert werden. Der Herrscher dieses ätherischen Existenzbereichs war der Gott Chons der Aufseher der Seelen während der Buße. Diese Auffassung finden wir bei den späteren griechischen Philosophen sowie in den Schriften der Juden von Alexandria, die zweifelsohne von der Erschaffungstheorie der Ägypter beeinflusst wurden. Zusätzlich spricht der Apostel Paulus vom „… Prinz der Macht der Luft.“ Auch William Shakespeare (1564-1616) nimmt in seinem Stück Maß für Maß (1604) Bezug darauf, als Claudio vor dem Tod zurückschreckt, damit seine Seele nicht „gefangen wird in den unsichtbaren Winden und mit rastloser Gewalt um die Welt geblasen wird.“ (III. Akt, Zeilen 122-124).
Nach ihrer Reinigung in diesem Bereich leben alle Seelen durch Seelenwanderung wieder auf der Erde. Der dritte Bereich befand sich im blauen Himmel zwischen den Sternen, dem Bereich der Glückseligkeit, wo man Verweilzeit in unendlichem Frieden und Glück finden konnte. Eusebius von Caesarea (260/264-339/340) sagte: „Die Ägypter stellten das Universum mit zwei ineinanderliegenden Kreisen sowie einer Schlange mit dem Kopf eines Falken dar, der seine Flügel darum legt.“ Somit wurden drei Sphären gebildet: die Erde, die Atmosphäre und das Himmelreich.
In den meisten Darstellungen wird die Erde jedoch im Mittelpunkt angesiedelt und die Sonne kreist mit ihren Begleitern um sie herum, wobei die obere Sphäre hell erstrahlt und die höllische dunkel erscheint. Die Seelen der Toten steigen im Westen in die Unterwelt hinab und werden dort verurteilt, um, wenn sie verdammt werden, zur Erde zurückgeschickt oder in der Unterwelt zur Bestrafung eingesperrt zu werden. Werden sie freigesprochen, erhalten sie die glückselige Gesellschaft des Sonnengottes und steigen mit ihm im Osten auf, um die Reise über die himmlische Laufbahn anzutreten.
Sarkophag von Pakhar in der Cachette von Deir el-Bahari,
21. Dynastie, 1077-943 v.Chr., Reich von
Psusennes I./ Amenemope, um 1047-992 v.Chr. Bab el-Gasus,
Altes Theben (heute Luxor/Al-Karnak).Bemaltes Holz,
189x59cm
Kanopen von Psusennes I., Byzantinisches Reich,
21. Dynastie, 1077-943 v.Chr., Reich von Psusennes I.,
1045-944 v.Chr. Alabaster, Blattgold und Bronze,
Höhe: 38 und 43cm.Ägyptisches Museum, Kairo.
Die obere Hemisphäre ist in zwölf gleich große, den zwölf Stunden des Tages entsprechende Bereiche aufgeteilt. Am Tor zu jedem dieser goldenen Abschnitte steht ein Wächtergott, den die gerade angekommenen Seelen passieren müssen, um ihre Reise fortzusetzen. Die untere Hemisphäre ist zwar in dieselbe Anzahl, jedoch düstere, den zwölf Stunden der Nacht entsprechende Bereiche aufgeteilt. An jedem Tag passiert die Hauptgottheit in hellen Gewändern die strahlenden Bereiche der Gesegneten, wo sie jagen und fischen oder in den Feldern der Sonne an den Ufern des himmlischen Nils pflügen und säen, ernten und sammeln. Bei Nacht durchquert die von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidete Seele die trostlosen Bereiche der Verdammten, wo ihr Vergeltung widerfährt.
Das künftige Schicksal des Menschen wurde mit dem Pfad der Sonne durch die oberen und unteren Hemisphären assoziiert. Astronomie war in der altägyptischen Theologie eine zwingend erforderliche Komponente. Die Sterne wurden symbolisch als Geister und reine Genies betrachtet, die großen Planeten wurden als Gottheiten dargestellt. Der Kalender war eine religiöse Karte und jeder Monat, jede Woche, jeder Tag, jede Stunde war für einen bestimmten Gott angesetzt.
Es gab in diesen Lehrsätzen und Symbolen viel poetische Schönheit und ethische Kraft. Die Notwendigkeit der Tugend, die schrecklichen Proben des Grabes, die Gewissheit der Vergeltung, die mystischen Kreisläufe der Seelenwanderung, die ruhmreiche Unsterblichkeit, die Pfade der Planeten, der Götter und der Seelen durch die Schöpfung wurden allesamt auf beeindruckende Art angekündigt und dramatisch dargestellt.
Die ägyptische Seele segelte über das himmlische Meer in einer kristallenen Arche voll riesiger Götter,
um die Tiefen des Raumes zu schleppen und
die Sterne mit einem Netz zu bedecken,
wo sie in den nebeligen Untiefen in die Leere gespült werden
und in der blinden typhonischen Nacht erstrahlen.
Dann, voller Sonnenenergie, drang sie zur Sonne vor,
und im himmlischen Hades, der Halle der Götter,
wurde sie schließlich am Firmament begrüßt.
James Philip Bailey,
Zweiter vergoldeter Sarkophag von Tutanchamun, 18. Dynastie,
1549-1298 v.Chr., Reich von Tutanchamun, 1333-1323 v.Chr.
Vergoldetes Holz, Halbedelsteine und Glas,
204x78,5x68cm.Ägyptisches Museum, Kairo.
Die Verknüpfung zwischen dem Schicksal des Menschen und dem astronomischen Universum, eine wunderbare Verschmelzung zwischen den grundlegendsten moralischen Lehrsätzen und der imponierendsten der physischen Wissenschaften, erklärt verschiedene in der ägyptischen Mythologie und Religion verankerten Aberglauben. Der Ort der Unterwelt verkörpert diese Vorstellung. Einige Ägypter glaubten, dass sie auf der Reise in westlicher Richtung im Zwielicht in den großen Sümpfen von Schwärmen der grauweißen Ibisse heimgesucht würden, den ernsten, geisterhaften, lethargischen Vögeln, die als Verkörperung umhertreibender Seelen interpretiert wurden, die auf die Bestattungsriten warteten, damit sie ihre Reise zu dem ihnen bestimmten Aufenthaltsort fortsetzen konnten.
Die ägyptischen Lehrsätze des zukünftigen Lebens mit all seiner Komplexität und seiner Pracht waren Teil eines unbeschreiblich mächtigen Glaubenssystems, das an Festtagen teilweise von hunderttausenden Menschen öffentlich vollzogen wurde. Die meisten über ihr Glaubenssystem vorliegenden Informationen wurden in ihren Tempeln und Pyramiden dargestellt - beeindruckende Strukturen, die nur durch einzigartiges Lernen, durch Macht, Talent und Reichtum entstehen konnten. Die überragende Natur der Zivilisation befahl den Gehorsam und die Vorstellungkraft ihres Volkes. Dies war die Kraft, die die Pyramiden errichtete, in denen ganze Generationen der mumifizierten ägyptischen Bevölkerung in reich verzierten Grabstätten und in ewigem Stein aufbewahrt wurden. Ihr Gespür für den hier dargestellten Glauben und das esoterische Wissen verhalfen der altägyptischen Zivilisation zu langanhaltendem Erfolg.
Halskette derPrinzessin Sathathor mit einemdenNamen von Sesostris II. enthaltenden Brustschmuck,
Mittleres Reich,12. Dynastie, 1991-1802 v.Chr.
Reich von Sesostris III., 1878-1839 v.Chr.,Dahschur,
Grabanlage von Sesostris III., Grab der Prinzessin Sathathor.
Gold, Karneol, Türkis und Lapislazuli, Länge: 4,9cm.
Ägyptisches Museum, Kairo.
Kanope, 18. Dynastie, 1549-1298 v.Chr.,
Reich von Echnaton, um 1350-1334 v.Chr.,
um 1340-1336 v.Chr., Tal der Könige, Luxor.
Alabaster mit Glas und Steininkrustation, Höhe: 52,1cm.
The Metropolitan Museum of Art, New York.
Platte von der Rückseite des Goldthrons von Tutanchamun (Detail),
Neues Reich, 18. Dynastie, 1549-1298 v.Chr.,
Reich von Tutanchamun, 1333-1323 v.Chr.,
1323 v.Chr.Holz, Karneol, Glas, Fayence, Silber,
Gold und Stuck.Ägyptisches Museum, Kairo.
Grab von Paschedu (TT3): Die Rückwand der innerstenGrabkammer mit dem Gott Osiris auf seinem Thronund dem hinter ihm liegenden Westberg,
Altes Ägypten, 19. Dynastie, um 1298-1187 v.Chr.
Fresko. Deir el-Medina, Nekropole von Theben, nahe Luxor.
Blockstatue und Nischenstele von Sahathor,
Altes Ägypten, Mittleres Reich, 12. Dynastie, 1991-1802 v.Chr.,
Reich von Amenemhet II., um 1922-1878 v.Chr., Abydos.
Kalkstein mit Farbspuren, Stele: 112x63,8x18cm,
Statue: 41,5cm.The British Museum, London.
Ich bin hier, ich bin dem Grab entstiegen.
Ich sehe dich, der du stark bist!
Ich habe die Unterwelt durchquert und
Osiris gesehen,
die Nacht verdrängt.
Ich bin gekommen, und habe meinen Vater, Osiris, gesehen.
Ich bin sein Sohn.
Ich bin der Sohn, der seinen Vater liebt,
Ich bin geliebt.
Ich habe mir einen Pfad geebnet, am westlichen Horizont,
als Gottheit.
Büste von Ramses II. (Detail), 19. Dynastie 1298-1187 v.Chr.,
Reich von Ramses II., 1279-1212 v.Chr.
Granit, 80x70cm. Ägyptisches Museum, Kairo.
Ein Wandrer kam aus einem alten Land,
Und sprach: „Ein riesig Trümmerbild von Stein
Steht in der Wüste, rumpflos Bein an Bein,
Das Haupt daneben, halb verdeckt vom Sand.
Der Züge Trotz belehrt uns: wohl verstand
Der Bildner, jenes eitlen Hohnes Schein
Zu lesen, der in todten Stoff hinein
Geprägt den Stempel seiner ehrnen Hand.
Und auf dem Sockel steht die Schrift: „Mein Name
Ist Osymandias, aller Kön’ge König: –
Seht meine Werke, Mächt’ge, und erbebt!”
Nichts weiter blieb. Ein Bild von düstrem Grame,
Dehnt um die Trümmer endlos, kahl, eintönig
Die Wüste sich, die den Koloß begräbt.
Percy Bysshe Shelley,Osymandias,inPercy Bysshe Shelleys ausgewählte Dichtungen, Zweiter Theil.
Bestattungsurne in der Form einer Mater Matuta,
um 430 v.Chr., Nekropole von Pedata, Chianciano.
Terrakotta. Archäologisches Nationalmuseum, Florenz.
Die Etrusker
Auch wenn der Großteil der Archive aus Etrurien schon vor sehr langer Zeit verschwunden ist, haben Ausgrabungen etruskischer Überreste Einblicke in ihre Religion und ihr Verständnis vom Tod und Jenseits verschafft. Mit Hilfe der Gräber, Grabstätten und anderen archäologischen Fundstücken konnten Historiker die Geschichte der Etrusker von der Wiege bis in das Grab rekonstruieren. Sie vermittelten ihnen die Kenntnisse über Häuser, Möbel, Namen, Ränge, Spiele, Grabfeiern, Sterbeszenen, Verwandtschaften, Beschäftigungen, ihr genaues Aussehen, verschiedene Nationalkostüme, Bestattungsprozessionen und das Leben im Jenseits.
Die Etrusker trieben ihre Gräber in den Fels der Berge und Hügel oder schufen massives Mauerwerk. Sie bemalten oder bearbeiteten die Wände mit anschaulichen und symbolischen Szenen und überhäuften die Innenräume mit Kelchen, Spiegeln, Urnen, Vasen, Sarkophagen und vielen anderen Gegenständen, die wiederum mit Gemälden und Skulpturen und damit reich an Informationen über ihre Autoren versehen waren. Die Untersuchung dieser in großen Mengen im 19. Jahrhundert freigelegten Artefakte ist die Grundlage für das gesamte Verständnis dieser Zivilisation. Wenn das Leben erlischt, eröffnet sich eine düstere, die Vergangenheit offenlegende und die Zukunft bestimmende Welt.
Die Etrusker beerdigten ihre Verstorbenen außerhalb ihrer Stadtmauern, und demzufolge war manchmal die Stadt der Lebenden von einer riesigen Stadt der Toten umgeben. Unter den Äckern und Hügeln wurden ganze Felder dieser gemeißelten Steingräber gefunden. Die Häuser der Toten sollten den Häusern der Lebenden in kleinerem Format entsprechen, und die Inneneinrichtung wurde so genau imitiert, dass man vermutete, dass das Leben und die Geräusche nachgeahmt werden sollten. Bei den auf die die Grabstätten ausfüllenden Urnen und Sarkophage gemalten oder radierten Bildern handelt es sich um Porträts der Verstorbenen von unterschiedlichem Alter, Ausdruck, Geschlecht und sonstigen Merkmalen. Diese persönlichen Porträts sollten an die Toten erinnern. Wenn man heute die Gräber betrachtet, schauen uns dort tausende verewigte Gesichter mit stummer Bitte an. Jegliche Spur ihrer Namen und Persönlichkeiten ist für immer verloren, und ihr Staub in alle Winde verweht.
Entlang einer Grabkammer gab es massive Steinregale, gelegentlich auch Bänke und Tische, auf denen die Toten abgelegt wurden, um sie für das Jenseits vorzubereiten. Bei den Körpern wurden mit den Särgen vergrabene Helme, Waffen, Beinschienen, Bruststücke, Siegelringe, eine Auswahl an Schmuck und andere Dekorationen entdeckt; die Armreifen, Halsketten, Ohrringe und anderer Schmuck der Frauen befanden sich alle an ihrem jeweiligen Platz, auch wenn von dem Körper, den sie einst geschmückt hatten, nichts mehr erhalten war.
Ein Altertumsforscher, der einmal auf der Spurensuche war, brach durch die Decke eines Grabes, schaute hinein und berichtete:
Ich sah einen auf einem Steinbett platzierten Krieger, der innerhalb weniger Minuten vor meinen Augen verschwand, da Luft in das Grab eindrang und die Rüstung durch die Oxidation in kleinste Partikel zerfiel. Innerhalb kürzester Zeit war kaum noch eine Spur dessen übrig, was ich auf dem Steinbett gesehen hatte. Es ist unmöglich, auszudrücken, welche Wirkung dieser Anblick auf mich hatte.
Reliquien der Toten
Eine spezielle, besondere Aufmerksamkeit verdient die etruskische Vase die den Kanopenkrügen ähnelt, in denen die Ägypter die Eingeweide ihrer Mumien aufbewahrten. Die etruskischen Kanopen sind oft Darstellungen menschlicher Figuren, bei denen die häufig auf ägyptische Weise verzierten Köpfe als Deckel der Gefäße verwendet wurden. Die Augen sind manchmal Einlegearbeiten, und die Frauenköpfe besitzen lange, bewegliche Ohrringe und andere Verzierungen.
Es war üblich, in den Gräbern auf runden Holz-, Bronze- oder Terrakottastühlen Vasen zu platzieren. Ein gutes Beispiel ist hierfür die in Gräbern in Chiusi (Provinz Siena, Toskana) gefundene Urne mit Menschenkopf. Historiker sehen den Ursprung dieser Kanopen in den über die Köpfe der Toten platzierten, in frühen etruskischen Gräbern gefundenen Bestattungsmasken. Diese Tradition stammt wahrscheinlich aus Mykene (in der Ebene von Argos, Griechenland). Dort hatte der Kaufmann und Archäologe Heinrich Schliemann (1822-1890) in den Schachtgräbern von Agora Goldmasken gefunden. In Etrurien waren diese Werke jedoch aus Bronze oder Terrakotta gefertigt worden. Man erkennt den graduellen Übergang der Masken, die zuerst über und dann an den Körpern angebracht wurden und schließlich die mit Asche gefüllte Urne bedeckte. Anfänglich schmückte der Kopf lediglich die Gefäße, schließlich entwickelte er sich aber auf den Deckeln der Sarkophage zu liegenden Abbildern (1, 2, 3). Auch wenn die Etrusker die Einbalsamierung nicht im gleichen Maß ausübten wie die Ägypter, ähnelte die Methode, die sterblichen Überreste einer Person in ihre eigene Darstellung zu legen, den Sarkophagen Altägyptens.
Beschreibungen zweier der in den Gräbern gefundenen etruskischen Sarkophage.
Der Sarkophag des Ehepaares (Ende 6. Jh. v.Chr.) ist ein außergewöhnliches Monument. Es handelt sich um eine Urne oder einen Sarkophag aus Caere, dem heutigen Cerveteri (Provinz Rom, Latium) einer in der archaischen Periode für ihre Tonskulpturen bekannten Stadt. Zu jener Zeit war Terrakotta eines der beliebtesten Materialien in den Werkstätten der Region und wurde für Grabmonumente und architektonische Verzierungen eingesetzt. Die Formbarkeit des Tons erlaubte den Künstlern zahlreiche Möglichkeiten und kompensierte den Mangel an Stein im Süden Etruriens.
Dieses besondere, 1861 während der Regierungszeit Napoleons III. (1808-1873) entdeckte Monument wird wegen seiner Dimensionen oft als Sarkophag bezeichnet. Es zeigt die beiden Verstorbenen, die, in Übereinstimmung mit dem Stil Kleinasiens, verschlungen in einer halb sitzenden Stellung auf einem Bett angeordnet sind. Man erkennt die rituelle Geste des Parfümdarbietens, die, neben dem Ausschank von Wein, Teil der traditionellen Beisetzung war. Der Sarg und sein Deckel wurden mit nun zwar teilweise verblassten, ehemals aber leuchtenden und die Eleganz der Verzierungen sowie die Details der Haare und Kleidung noch betonenden Malereien versehen.
Der Stil dieser besonderen Skulptur zeigt einen starken, an den lächelnden Gesichtern und vollen Formen der beiden Figuren erkennenbaren Einfluss aus dem Osten Griechenlands, besonders aus Ionien. Es gibt aber auch auffällige etruskische Merkmale, wie etwa den Mangel an formaler Kohärenz, oder die Art, wie die Beine bildhauerisches Volumen aufweisen und die Gesten der Verstorbenen betont wurden.
Der Sarkophag der Larthia Seianti befindet sich im Archäologischen Museum in Florenz und stammt, dem Prägedatum folgend, wahrscheinlich aus den Jahren 217 bis 146 v. Chr., und da eher gegen Ende dieser Zeit, da die Münzen der Grabbeigaben meistens recht abgegriffen sind. Die Figur der Frau wurde in zwei Teilstücken gegossen, wobei sich die Verbindungsstelle unterhalb der Hüfte befindet. Sie wird als Matrone mittleren Alters dargestellt, ihr Kopf ist mit einem Tuch verhüllt, das sie mit der rechten Hand zur Seite schiebt. In der linken Hand hält sie einen Spiegel in einem offenen Gehäuse. Am rechten Arm trägt sie Armreifen und an der linken Hand sechs Ringe mit karneolroten Fassungen sowie Ohrringe, die wie in Gold gefasster Bernstein aussehen. Die Akte sind fleischfarben, die Farben wurden frei aufgetragen, die Kissen in Streifen gemalt. Diese Skulptur besitzt keine Vorderreliefs, sondern wurde mit Pfeilern, Triglyphen und Vierpässen ausgestattet.
Etruskische Glaubenslehren von Tod und Jenseits
Man kann annehmen, dass die Etrusker nach dem Tod ein einem System von Belohnung und Bestrafung gleichendes Urteil erwarteten. Die etruskischen Darstellungen in den Gräbern geben jedoch keinen Aufschluss über irgendwelche Strafprozesse und weisen auch keine Entsprechungen zum Verfahren des Osiris zum Wiegen der Seele auf, der auf den ägyptischen Monumenten so verbreiteten Belohnung und Bestrafung.
Ein wichtiges Element in der Religion Etruriens war der Glaube an die Genii, ein System von Hausgöttern oder Wächtergeistern, die auf das Schicksal der Familien und Individuen aufpassten und in den Gravuren der Gräber oft als lenkende Gestalten gezeigt werden, die daran interessiert sind, was mit ihren Schützlingen geschieht. Jede Person besaß zwei ihr zugewiesene Genii, die eine, die sie zu guten, die andere, die sie zu schlechten Taten animierte. Beide begleiteten sie auch nach dem Tod, um das Schicksal des Verstorbenen mitzuentscheiden. Die guten und die bösen Geister kämpfen in der Unterwelt um den Besitz der Seele; die bösen Genii drohen, quälen oder verfolgen sie; die guten Genii beschützen sie vor den dunklen Dämonen, die versuchen, sie an den Ort der Bestrafung zu führen.