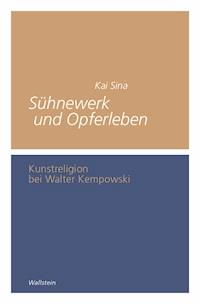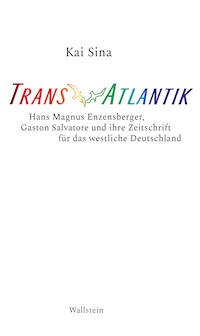
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Zeitschriftenprojekt "TransAtlantik" und die Ideengeschichte der Bundesrepublik. Ein gleichermaßen anspruchsvolles wie liberales, ironisches wie kosmopolitisches Magazin – dies stand Hans Magnus Enzensberger und seinem Freund Gaston Salvatore im Sinn, als sie Ende der siebziger Jahre ihr Konzept einer neuen Zeitschrift entwarfen. Ihr Vorbild war der "New Yorker", das Leitorgan des intellektuellen Amerika. Der Titel des im Oktober 1980 erstmals erschienenen Magazins bringt seine programmatische Westbindung auf den Punkt: "TransAtlantik". Autorinnen und Autoren waren u. a. Rainald Goetz, Irene Dische, Martin Mosebach und Christoph Ransmayr. Kai Sina porträtiert eine der ideengeschichtlich aufschlussreichsten publizistischen Unternehmungen der alten Bundesrepublik. Nach den revolutionären Kämpfen und ideologisch verbissenen Debatten der sechziger und siebziger Jahre sollte "TransAtlantik" ein Medium der offenen Gesellschaft sein. Geprägt war dieses Vorhaben durch den spielerischen Selbstentwurf einer mündigen Leserschaft, die – nach einem Zeitalter der Kritik und der Negation – versuchsweise "Ja" zur westlichen Moderne sagt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kai Sina
TransAtlantik
Hans Magnus Enzensberger, Gaston Salvatore und ihre Zeitschrift für das westliche Deutschland
Die Arbeit an diesem Buch und
die Drucklegung wurden unterstützt
durch Mittel der VolkswagenStiftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2022
www.wallstein-verlag.de
Umschlag: Susanne Gerhards, Düsseldorf
ISBN (Print) 978-3-8353-5125-7
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4957-5
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4958-2
Inhalt
BRD Blanche: Vorbemerkung
1. Ein New Yorker für Deutschland: Planungen
2. Feuerländisches, Hannover: Das erste Heft
3. Verfrühte Eleganz? Resonanzen
4. Zweierlei Luxusliner: Relationen
5. Abschied vom Prinzipiellen: Voraussetzungen
6. Kaffeetrinken mit Gaston Salvatore: Innenansichten
7. Loslabern mit Rainald Goetz: Literarisches
8. Münchener Freiheit? Liberalität
9. Abstürzende Möwen: Anschlüsse, Abgrenzungen
10. Alle lächeln: Abschied von TransAtlantik
Amerikanisches Licht: Schlussbemerkung
Anmerkungen
Dokumente
Literatur und Quellen
Bildnachweise
Personenregister
Dank
»Es ist wirklich etwas besser geworden.«
Jürgen Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit, 1985
BRD Blanche: Vorbemerkung
Im Jahr 2011 veröffentlichte Hans Magnus Enzensberger eine Sammlung seiner persönlichen Lieblings-Flops. Es handelt sich um einen Katalog an Vorhaben, die er einst mit Enthusiasmus erdacht oder sogar betrieben hatte, bevor sie aus irgendeinem Grund im Sande verlaufen, misslungen, gescheitert waren. Es ist ein Blick ins Panoptikum des Unerfüllten, aber ohne alle Koketterie oder Larmoyanz. Eher scheint Enzensberger, der bereits über achtzig Jahre alt war, als er seine Sammlung veröffentlichte, mit gelassenem Witz und aufrichtigem Interesse auf die Fehlschläge und Misserfolge seines Lebens als Dichter und Schriftsteller, Intellektueller und Publizist zurückzuschauen.
Mehr noch, seine Flops seien ihm, liest man im kurzen Vorwort, »im Lauf der Jahre immer mehr ans Herz gewachsen«. Wenigen Erfahrungen verdanke er so viel wie ihnen, und daraus könnten vielleicht auch die Leserinnen und Leser seines Buches einigen Nutzen ziehen: »Triumphe halten keine Lehren bereit, Mißerfolge dagegen befördern die Erkenntnis auf mannigfaltige Art. Sie gewähren Einblick in die Produktionsbedingungen, Manieren und Usancen der relevanten Industrien und helfen dem Ahnungslosen, die Fallstricke, Minenfelder und Selbstschußanlagen einzuschätzen, mit denen er auf diesem Terrain zu rechnen hat.«[1] Im Anschluss an diese »Prämisse« präsentiert der Band nacheinander geordnet »Meine Kino-Flops«, »Meine Opern-Flops«, »Meine Theater-Flops«, »Meine verlegerischen Flops« – und so weiter.
Unter den »verlegerischen Flops« findet sich auch ein Projekt, das man aus heutiger Sicht zumindest nicht rundheraus als Misserfolg bewerten mag: Von der Zeitschrift TransAtlantik, die Hans Magnus Enzensberger gemeinsam mit seinem Freund Gaston Salvatore Ende der Siebzigerjahre entwickelte und gründete, liegen immerhin mehr als zwei Jahrgänge vor. Monatsweise erschienen sind die Hefte zwischen Oktober 1980 und Dezember 1982. In ungezwungener Orientierung am großen Vorbild des New Yorker wollte TransAtlantik seinem Publikum politische Essays und literarische Reportagen auf höchstem Niveau bieten. Nicht ohne Stolz zählt Enzensberger die Namen der Autorinnen und Autoren auf, die in seiner Zeitschrift gedruckt worden seien und von denen die bundesrepublikanische Öffentlichkeit hier teils zum ersten Mal habe lesen können: Rainald Goetz und Irene Dische, Martin Mosebach und Christoph Ransmayr werden von ihm unter anderen genannt, als internationale Beiträger etwa Tom Wolfe, Isaiah Berlin, Jane Kramer, Joseph Brodsky.
Der intellektuellen Weltläufigkeit im Inneren entsprach die wohlüberlegte Gestaltung der Zeitschrift im Äußeren. Mit ihrem Understatement und ihrer Eleganz beruhte sie auf einer ästhetischen Haltung, die auf dem westdeutschen Zeitschriftenmarkt der frühen Achtzigerjahre vollkommen unbekannt gewesen sei, behauptet Enzensberger. Gezielt habe man auf »fette Schlagzeilen« auf der Titelseite verzichtet, man hätte sie als »vulgär« empfunden. Stattdessen und ganz bewusst war der gesamte redaktionelle Teil in Schwarz-Weiß gehalten. Alles Farbige war den Werbeanzeigen vorbehalten. Auf dem grellbunten Zeitschriftenmarkt sollte TransAtlantik ein »Augentrost« sein.[2]
*
Das Unbehagen, aus dem heraus Enzensberger und Salvatore ihr Vorhaben entwickelten, ging über den Bereich der zeitgenössischen Publizistik allerdings deutlich hinaus. »Weil uns damals […] der Zeitgeist besonders zum Hals heraushing, faßten wir einen Plan«, mit dieser erzählerischen Geste hebt der Rückblick in den Lieblings-Flops an. Oder nein, eigentlich beginnt er mit Versen, die ihm als Motto vorangestellt sind: »Also was die siebziger Jahre betrifft, / kann ich mich kurz fassen. […] / Widerstandslos, im großen und ganzen, haben sie sich selbst verschluckt, / die siebziger Jahre«. Es handelt sich um einen Auszug aus Enzensbergers Gedicht »Andenken«, das vollständig in dem ebenfalls 1980 erschienenen Band Die Furie des Verschwindens abgedruckt worden ist. Die neue Zeitschrift stand, so betrachtet, an einer Zeitenschwelle, am Umbruch eines zu vernachlässigenden alten in ein vielversprechendes neues Jahrzehnt. Getragen war TransAtlantik von einem epochalen Aus- und Aufbruchswillen, der sich reizvoll abhebt von dem, was der Schriftsteller Frank Witzel und der Zeithistoriker Philipp Felsch als BRD Noir beschrieben haben, als ein für die bundesrepublikanische Gesellschaft charakteristisches Verharren in »provinziellem Leerlauf«.[3] In präziser Abgrenzung dazu versteht sich TransAtlantik als neues, erfrischtes und erfrischendes Ausdrucksmedium einer BRD Blanche.[4]
Auf breite Gegenliebe beim Publikum stieß der publizistische Neuanfang, den Enzensberger und Salvatore im Sinn hatten, allerdings nicht, eher im Gegenteil: Bereits der Absatz des ersten Heftes habe deutlich gezeigt, dass die Leserschaft im Allgemeinen »ungeneigt« gewesen sei. Nicht als erquickender, von Westen her kommender Wind auf dem Zeitschriftenmarkt sei TransAtlantik wahrgenommen worden, sondern vielmehr als Provokation. Dies habe unter anderem daran gelegen, dass das Magazin einem »verabscheuungswürdigen Laster« zugeneigt gewesen sei, und zwar der Welt des exklusiven Konsums. Eine gleich am Anfang jedes Heftes gedruckte Rubrik trug die Überschrift »Journal des Luxus und der Moden«, und obwohl dieser Bezug auf einen »ehrwürdigen Titel der Goethezeit« spielerisch gewählt worden sei, trug er der Zeitschrift den – bis heute nachhallenden – Vorwurf des Snobismus ein. Der Haupttitel sei allerdings »noch ungünstiger«, nämlich als politisches Statement aufgenommen worden: »Wie konnten wir unser Blatt TransAtlantik nennen, während tapfere Friedenskämpfer auf der Mutlanger Heide gegen die Stationierung amerikanischer Pershing-II-Raketen demonstrierten?«[5]
Die Folge dieser doppelt nachteiligen Rezeptionsbedingungen war ein »lang sich hinziehendes Siechtum«, das allerdings von einer merkwürdigen Dialektik bestimmt gewesen sei: »Je besser die Zeitschrift aussah, desto betrüblicher ging es mit der verkauften Auflage bergab.«[6] In Schönheit und Anmut vor sich hin sterben: Wenn TransAtlantik wirklich ein Flop war, dann war es ein durch und durch poetischer Flop. Und ein interessanter zumal: Über das »mörderische Geschäft am Zeitungskiosk« habe man im Laufe der Zeit einiges gelernt, bilanziert Enzensberger, ebenso über den »trickreichen Umgang mit Auflagenzahlen, Grossovertrieben und Werbeagenturen«. Nach zweieinhalb Jahren habe er sich deshalb »ohne Groll« aus dem Projekt verabschiedet.[7]
Spätestens an dieser Stelle muss allerdings hinzugesagt werden, dass das »Siechtum« der Zeitschrift im Dezember 1982 nur vermeintlich beendet war. Nachdem Salvatores und Enzensbergers Vertrag nach heftigen Auseinandersetzungen mit dem Verlag nicht verlängert worden war und daraufhin die gesamte Redaktion gekündigt hatte (in dieser Hinsicht gab es also schon einigen »Groll«), erschien die Zeitschrift noch bis zum Jahr 1991, zunächst weiterhin im ursprünglichen NewMag-Verlag, ab 1989 dann im Spiegel-Verlag, der die Publikation aber rasch einstellte. Vom Anfangsteam war nur die Herausgeberin Marianne Schmidt übriggeblieben. Aber auch sonst hatte die neue mit der ursprünglichen Zeitschrift nur wenig gemein: Erdacht als publizistischer »Traum« wurde sie zu einem schnöden Imitat ihrer selbst – so zumindest die abschätzige Bewertung Gundolf S. Freyermuths, der seinerseits Mitglied der ersten Redaktionsgarde gewesen war.[8]
*
Transatlantisch angelegt war die Zeitschrift nicht nur in programmatischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die beteiligten Personen. Es trafen sich in diesem Vorhaben in leitender Funktion: ein kosmopolitisch gesinnter, polyglotter Dichter und Essayist, Medientheoretiker und Publizist, der bereits seit den frühen Sechzigerjahren eine Hauptfigur des bundesrepublikanischen Kultur- und Literaturbetriebs war; und ein aus Chile stammender Dichter, Erzähler, Regisseur, Dramatiker und Journalist, der seit 1965 in Westberlin ansässig und als enger Freund Rudi Dutschkes zu einer charismatischen Gründungsfigur der Studentenbewegung geworden war.[9] Die beiden Zeitschriftengründer bildeten damit eine Art transatlantisches Tandem, und es ist nicht auszuschließen, dass auch dieser Gedanke bei der Titelgebung ihres Magazins eine Rolle gespielt hat.
Wer den ersten Impuls zu der Unternehmung gab, ist hingegen nicht eindeutig zu bestimmen. Folgt man den Erinnerungen Katharina Enzensbergers, vormals Kaever, die als Redakteurin an TransAtlantik mitgewirkt hat, so war es Salvatore, auf den die Idee ursprünglich zurückging. Ihm, als seinem engen und langjährigen Freund, habe ihr heutiger Mann die Bitte um Mitwirkung an dem Projekt nicht abschlagen können.[10] Freyermuth hingegen, der im Oktober 1981 zur Redaktion hinzustieß, verweist auf Marianne Schmidt, die ihre Vision einer deutschen Kulturzeitschrift nach dem Vorbild des New Yorker habe verwirklichen wollen.[11] Ob nun Salvatore, Schmidt oder, was ja auch denkbar wäre, beide im Einklang: In keiner dieser Ursprungsgeschichten wird der Name Enzensbergers an erster Stelle erwähnt. Die Idee war offenbar schon in der Welt, als er sie sich angeeignet hat.
Und angeeignet hat er sie sich wirklich, und zwar so weitgehend, dass der Name Salvatores im Rückblick mitunter ganz unter den Tisch gefallen ist.[12] Auch wenn man Enzensberger nicht vorschnell zum »führenden Kopf«[13] des ganzen Unternehmens ernennen möchte, kommt man nicht um die Feststellung herum, dass es in programmatischer Hinsicht unverkennbar seine Handschrift trägt. Dies zeigt sich bereits in einem langen Konzeptpapier vom Juni 1979, das im Anhang dieses Buches zum ersten Mal abgedruckt wird. Streckenweise liest sich das Exposé wie eine kultursoziologische Abhandlung aus dem Kursbuch, dessen Redaktion Enzensberger nur wenige Jahre vorher, nämlich 1975, verlassen hatte. Auch stammen von niemand anderem als ihm jene großen Essays in TransAtlantik, die metakommunikativ Aufschluss geben über die grundsätzliche Ausrichtung der Zeitschrift und das ihr zugrunde liegende Gesellschaftsverständnis; zu nennen ist beispielhaft seine Abhandlung über »Das Ende der Konsequenz«, die im Mai 1981 erschienen ist. Liest man TransAtlantik schließlich im Kontext von Enzensbergers literarischem Werk, so ist die Zeitschrift gewiss als Reflex auf jenes 1978 erschienene Versepos zu verstehen, das immer wieder und ganz zu Recht als Abschied von der sozialistischen Utopie gelesen worden ist: Der Untergang der Titanic.
Dennoch lässt sich die Frage nach dem jeweiligen Anteil Enzensbergers und Salvatores an der Programmatik von TransAtlantik nicht ganz ohne Vorbehalt beantworten. Seinen Grund hat dies in einer scharf divergierenden Forschungslage. Im Falle Enzensbergers liegen bereits eine Fülle an biografischen, ideenhistorischen und literaturwissenschaftlichen Beiträgen vor, außerdem sind Teile seines persönlichen Archivs über das Deutsche Literaturarchiv in Marbach zugänglich. Eine substanzielle Bewertung seiner Tätigkeit als Zeitschriftenmacher ist auf dieser Grundlage durchaus möglich. Ganz anders im Falle Salvatores. Solange sein literarisches, essayistisches und journalistisches Werk nicht erforscht, seine Biografie nicht geschrieben und, dies vor allem, sein Nachlass nicht für die Wissenschaft erschlossen ist, lassen sich hinsichtlich seines Einflusses auf die grundsätzliche Ausrichtung der Zeitschrift allenfalls vorläufige Aussagen formulieren.
Ebenso geringfügig wie mit dem Leben und Wirken ihres Mitgründers Salvatore hat sich die Forschung bislang mit TransAtlantik selbst auseinandergesetzt – und dies obwohl die Zeitschrift für eine ideenhistorische Betrachtung von nicht unerheblicher Relevanz zu sein scheint, wie sich nach den ersten Anmerkungen bereits abzeichnet. Worauf ist dieses Desinteresse zurückzuführen? Vielleicht darauf, dass sich der erwähnte Vorwurf des Snobismus zu einem Rezeptionsklischee erhärtet und man die Zeitschrift entsprechend rasch abgetan hat. Als ein zentrales Medium des intellektuellen und kulturellen Diskurses in Westdeutschland galt sie eigentlich zu keinem Zeitpunkt.
Weniger aufschlussreich ist das Magazin deswegen aber nicht, im Gegenteil, denn in ihm überkreuzen sich auf spannungsreiche Weise gleich mehrere intellektuelle und politische, soziale und ästhetische Tendenzen der Zeit: der Wille und die Lust, aus einem als stickig empfundenen geistigen Klima der Siebzigerjahre auszubrechen; eine emphatische kulturelle Westorientierung, die aufseiten eines politischen Milieus, das den Vereinigten Staaten mit notorischer Skepsis gegenüberstand, heftige Abwehrreaktionen hervorrufen musste; schließlich eine bejahende Neigung zu Eleganz und Luxus, die zu Beginn des neuen Jahrzehnts noch keine gesamtgesellschaftliche Entsprechung hatte: Erst im Verlauf der Achtzigerjahre, so zeigt die historische Konsumforschung, gewann eine »materiell-hedonistische Lebenseinstellung« in der BRD zunehmend an Popularität.[14]
Diese möglichst prägnant zu haltende Abhandlung setzt sich zweierlei zum Ziel: Einerseits will sie ein Porträt von TransAtlantik unter der Ägide von Enzensberger und Salvatore zeichnen, beginnend bei den ambitionierten Planungen der Zeitschriftengründer über die konkrete Umsetzung bis hin zu den kritischen Reaktionen in der Presse und den sozialen Dynamiken innerhalb der Redaktion. Andererseits, und im Zuge des Porträtierens, möchte sie den distinkten Ort der Zeitschrift innerhalb der bundesrepublikanischen Ideengeschichte nach 1945 möglichst genau bestimmen.[15]
Inspiriert ist das Buch von einigen neueren Studien, die sich um eine Historisierung derjenigen Jahrzehnte bemühen, die man vor wenigen Jahren noch einer ›breit‹ ausgelegten Gegenwart zugerechnet hätte: der späten Siebziger- und Achtzigerjahre.[16] Die Studie teilt die vom Historiker Ulrich Herbert formulierte Beobachtung, dass die Kultur im Laufe der Achtzigerjahre »liberaler, auch selbstbewusster, entspannter und weltoffener« wurde – und eben nicht »restriktiver«, wie von der Linken nach dem Beginn der Kanzlerschaft Helmut Kohls im Jahr 1982 befürchtet worden war. Die Achtziger stehen für Herbert im Zeichen der »Akzeptanz pluraler individueller Orientierungen«,[17] und eben hierauf zielt auch jener Satz von Jürgen Habermas von 1985, der dieser Studie als Motto vorangestellt wurde: »Es ist wirklich etwas besser geworden.«[18]TransAtlantik ist Ausdruck genau dieses gesellschaftlichen Wandels, ja er spitzt sich in ihr möglicherweise sogar zu.
*
Die kulturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung – insbesondere jene, die an Zeitschriften als »Spiegel intellektueller Milieus« interessiert ist – wird seit einigen Jahren mit großer Intensität betrieben.[19] In diesem Zusammenhang ist vor allem auf einige neuere Arbeiten zum Kursbuch, zur Alternative und zu Tempo zu verweisen.[20] Ihren Gegenstand sieht die Zeitschriftenforschung idealtypisch dort realisiert, so definiert die Germanistin Hedwig Pompe, »wo viele unterschiedene Texte (und Bilder) der Rahmung durch die periodisch erfolgende Veröffentlichung unterliegen«. Im Unterschied zur Tages- oder Wochenzeitung komme dabei eine gewisse »Affinität zu literarischen und wissenschaftlichen Formen der Buchkultur« zum Tragen. Äußerst weit gefasst ist dieser Bestimmungsversuch nicht ohne Grund: Im Zuge des um 1800 einsetzenden gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses hat sich das Zeitschriftenwesen hochdynamisch entwickelt und stark ausdifferenziert. Deutlich ablesen lässt sich dies an der zunehmenden Anzahl von Subtypen, angefangen beim ›Journal‹ über das ›Magazin‹ bis zur ›Illustrierten‹.[21]
Etwas konkreter und auf den Gegenstand dieser Studie bezogen zeigt sich diese Ausdifferenzierung auch im Bereich der deutschsprachigen Literatur- und Kulturzeitschriften der 1980er-Jahre, deren »unheimliche Vitalität« trotz häufig »miserablem Absatz« in einem Beitrag von 1994 so beschrieben wurde: »Es entstehen unabläßlich neue, zum größten Teil eben nur kurzfristige Blätter, die die Lebendigkeit des Phänomens jedoch immer wieder demonstrieren und zugleich zeigen, unter welchen Bedingungen die Zeitschriften entstehen.« TransAtlantik wird in diesem Zusammenhang neben beispielsweise dem Tintenfisch oder Westermanns Monatsheften zu jenen »renommierten und überregional bekannten Zeitschriften« gezählt, die seit 1980 ihr Erscheinen eingestellt hätten (was so, wie soeben erwähnt, nicht ganz zutrifft).[22] Kein Wunder daher, dass auch in den mir vorliegenden Quellen immer wieder die Rede ist von ökonomischen Aspekten, die teils scharf mit ästhetischen und inhaltlichen Fragen konfligierten.
Wie nun aber Zeitschriften wissenschaftlich lesen? Sicher jedenfalls ist, dass sie sich im Modus einer autorzentrierten Hermeneutik kaum angemessen erschließen lassen. Der Herstellungsprozess einer Zeitschrift ist schließlich in hohem Maße arbeitsteilig und zudem stark von äußeren, unter anderem technischen und ökonomischen Faktoren bestimmt. Jenseits basaler konzeptueller Entscheidungen lassen sich spezifische Intentionen wohl aber in Einzelfällen ausmachen. So ist es, um nur ein Beispiel zu nennen, ganz sicher kein Zufall, wenn Enzensberger ausgerechnet im ersten Heft von TransAtlantik kritisch über globale Tendenzen der Verwestlichung nachdenkt; man kommt nicht umhin, seinen Essay »Eurozentrismus wider Willen« als eine metareflexive Kommentierung der erstmals vorliegenden Zeitschrift und ihres für linkspolitisierte Leserinnen und Leser provozierenden Titels zu verstehen. In anderen Bereichen – man denke beispielsweise an die Auswahl von Beiträgerinnen und Beiträgern, die Illustrationen von Artikeln, die Titelgestaltung – sind dagegen immer schon kollektive Beratungs- und Entscheidungsprozesse vorauszusetzen.
Statt einer allenfalls punktuell ergiebigen Hermeneutik zu folgen, liegt es eher nahe, die Perspektive eines aufmerksamen, kritisch beobachtenden Lesers einzunehmen. Das Ziel dieses Lesers sollte darin bestehen, wie der Zeitschriftenforscher Philipp Pabst formuliert, »die Lektüresteuerung nachzuvollziehen«, die ihm eine Zeitschrift anbietet, zum Beispiel über »thematische, lexematische oder visuelle Äquivalenzbildungen« zwischen verschiedenen Artikeln oder über mehrere Ausgaben hinweg. Eine aussagekräftige Werbeanzeige kann in dieser Logik ebenso bedeutsam sein wie eine starke These, eine auffallende Typographie wie ein vielsagender Rubrikentitel. Zeitschriften, erklärt Pabst grundlegend, »operieren im Modus semiotischer Nebenordnungen« und weisen daher »kein festgefügtes Zentrum auf.« Der Ausgangspunkt »der textuellen Relationierung im Rahmen einer Analyse« sei daher »je nach Fragestellung und Heuristik« ein anderer.[23]
Ergänzen lässt sich diese auf dem fernsehwissenschaftlichen Ansatz des »Flows« beruhende Heuristik[24] durch weitere Perspektiven, um so über die reine Materialebene der jeweils zu analysierenden Zeitschrift hinauszukommen. Im Falle dieses Buches sind dies zum Beispiel die Betrachtung der konzeptuellen Planung, der organisatorischen und redaktionellen Praktiken, der Bezüge zu anderen publizistischen und literarischen Unternehmungen der Zeit und nicht zuletzt der kritischen Resonanz in anderen Medien.
Ähnlich wie das Medium der Zeitschrift folgt meine Untersuchung – und eigentlich bereits diese ensemblehafte Einleitung – einem mittleren Strukturprinzip. Sie beginnt mit den Plänen der Zeitschriftengründer von 1979, blickt von dort aus weiter auf die erste Ausgabe von TransAtlantik, schildert sodann die kritischen Reaktionen im Feuilleton und die Voraussetzungen in Enzensbergers literarischem Werk. Den Schluss bildet die Lektüre des letzten Heftes, das in der Ära Enzensberger / Salvatore erschienen ist, und die Schilderung der Geschehnisse im Zuge der Redaktionsauflösung im Dezember 1982. Dazwischen werde ich in mehreren einzelnen Schlaglichtern zu erhellen versuchen, was TransAtlantik ausmachte, von den gesellschaftstheoretischen Prämissen über die konkrete Redaktionsarbeit bis zur charakteristischen Literarizität und Liberalität der Zeitschrift.
Inhaltlich werden meine Ausführungen dabei insofern zusammengehalten, als sie immer wieder – mal eher beiläufig, dann wieder fokussierter – nach Entwürfen des Transatlantischen fragen. Auf dieser Grundlage wird ganz am Ende der ideenhistorische Rahmen über die Gegenwart der späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahre bis in die Nachkriegszeit zu erweitern sein: Als selbsterklärtes Medium der kulturellen Westbindung wirkt TransAtlantik wie ein letzter Schritt im langen, sich weit über die unmittelbare Nachkriegszeit und konkrete politische Maßnahmen hinausstreckenden Prozess der Re-Education.
1. Ein New Yorker für Deutschland: Planungen
Am ausführlichsten und detailliertesten schildern Hans Magnus Enzensberger und Gaston Salvatore ihren Plan für die neu zu gründende Zeitschrift TransAtlantik in einem 29 Seiten umfassenden, engzeilig getippten Konzeptpapier vom Juni 1979, das sich heute im Deutschen Literaturarchiv in Marbach befindet. Es handelt sich um eine höchst aufschlussreiche Quelle, die überdies von großer Lust am Projektieren zeugt. Sie enthält weitreichende Beobachtungen über die Mentalität der Westdeutschen an der Schwelle zum neuen Jahrzehnt, die gegenwärtige kulturelle, im engeren Sinne publizistische Gesamtsituation – und liest sich streckenweise eher wie ein pointierter, mitunter auch polemischer Essay denn als ein streng sachbezogenes, nüchternes Exposé. Vor dem Hintergrund ihrer allgemeinen Kulturdiagnose wiederum legen die Verfasser konkret und äußerst kleinteilig die Zielsetzung und die Anforderungen, die Blickwinkel und Schreibweisen, die Gestaltung und Vermarktung des von ihnen geplanten Magazins dar, wobei eigentlich jede Zeile von dem Anspruch durchdrungen ist, die Sache groß zu denken: »Oben ist immer noch Platz« – dies sei der »Wahlspruch« gewesen, erinnert sich Rainald Goetz aus der rückwärtigen Perspektive des Jahres 1999, unter dem TransAtlantik dereinst angetreten sei.[25]
Zumindest Enzensberger konnte bei der Erarbeitung des Konzeptpapiers bereits auf beträchtliche Erfahrungen und einiges Vorwissen zurückgreifen. Nicht nur hatte er 1965 die Zeitschrift Kursbuch gegründet (gemeinsam mit Karl Markus Michel, der ebenfalls der Redaktion von TransAtlantik angehören sollte) und über zehn Jahre herausgegeben.[26] Darüber hinaus war er als minutiöser Beobachter der bundesdeutschen Medienlandschaft und zudem als Medientheoretiker bekannt. Bereits in den Fünfziger- und Sechzigerjahren hatte er unter anderem den Spiegel und die Frankfurter AllgemeineZeitung kritischen Analysen unterzogen,[27] während er 1970 der Öffentlichkeit einen an Bertolt Brecht anknüpfenden »Baukasten zu einer Theorie der Medien« präsentierte. Ohne je einer schlichten »Manipulationstheorie«[28] das Wort zu reden, waren diese Arbeiten geprägt von Impulsen der Kritischen Theorie – was sich mit dem neuen Projekt, für viele provozierend, fundamental ändern sollte.[29]
Für das westliche Deutschland
»TRANSATLANTIK. Projekt einer Zeitschrift für das westliche Deutschland«: Schon der Titel des Papiers ist in seiner konkreten Wortwahl bedenkenswert. Das ›westliche Deutschland‹ ist schließlich nicht gleichzusetzen mit der politischen Einheit ›Westdeutschland‹. Gerade im Zusammenhang mit dem in Großbuchstaben getippten Obertitel wird ersichtlich: Das Adjektiv ›westlich‹ wird hier im Sinne einer politisch-kulturellen Grundorientierung verstanden, ja konkreter noch als Ausrichtung an einer US-amerikanischen Ausdrucksform und Denkweise. Dass die Verfasser des Papiers eine solche in Deutschland zumindest in Ansätzen bereits realisiert sehen, deutet sich im Untertitel, in der Zueignung »für das westliche Deutschland«, bereits an. Der auf diese Weise gleichzeitig erhobene Anspruch auf Repräsentativität wird gestützt durch die assoziative Nähe der Formulierung zu einem der bundesrepublikanischen Leitmedien schlechthin, nämlich der Frankfurter Allgemeinen, deren Selbstverständnis in ihrem Untertitel unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird: Zeitung für Deutschland.
Was im Titel TransAtlantik anklingt, macht die Präambel des Papiers explizit. »Eine Zeitschrift, die fehlt«, gelte es nun ins Leben zu rufen, dies stellt gleich der erste Satz fest, und zwar auf der Grundlage »einer Analyse der gesellschaftlichen und kulturellen Situation der Bundesrepublik«. Nicht, was aus Deutschland werden solle, sondern was es bereits sei, bildet demnach die Ausgangsbasis der Zeitschriftenplaner. Auf ein »exaktes, statistisches Kalkül« könne man sich dabei zwar nicht berufen, das wäre nichts anderes als »Hochstapelei«. Man verlasse sich vielmehr auf die eigenen »Beobachtungen und Vermutungen«, denn, so folgert man im eher alltagspraktischen Sinn, »Wünsche werden nicht errechnet, sondern (mit einigem Glück) erraten«.[30]
Die journalistische Lage überblickend: Gaston Salvatore und Hans Magnus Enzensberger auf einer Fotografie von Isolde Ohlbaum
Hervorgehoben durch Unterstreichungen der Kernwörter folgen auf die Eingangspassage einige Charaktermerkmale, die Enzensberger und Salvatore den ›westlichen Deutschen‹ zuschreiben. So betonen sie an erster Stelle die gehobene Anspruchshaltung der Bewohnerinnen und Bewohner der BRD, und zwar nicht nur im Blick auf ihre »Konsum- und Reisegewohnheiten« und andere Aspekte des Ökonomischen. Aufgrund eines nunmehr »über dreißigjährigen Friedens«, »enorm gewachsenen gesellschaftlichen Reichtums« und »eines zunehmenden Selbstbewußtseins« suche die »Nation von Aufsteigern« nach einer »kulturellen Identität«.[31] Dies zeige sich darin, dass der Neureiche – man spricht distinguiert vom nouveau riche – aufgehört habe neu zu sein und nunmehr höhere Bedürfnisse in sich entdecke. Der zwar wohlhabende und selbstbewusste, aber noch kultur- und identitätslose Westdeutsche wolle den Kleinbürger der Nachkriegszeit in sich überwinden, die »innere Unsicherheit«, die »Lächerlichkeit«, die »Banalität«, den »kleinkarierten Zuschnitt« seines Daseins.[32] Es folgen einige milieuspezifische Beobachtungen: Vor allem in der »upper middle class« (eine genuine »upper class« habe es in Deutschland nie gegeben) sei man, trotz einer gewissen »inneren Unsicherheit« eifrig darum bemüht, »ein bißchen mehr Weltkenntnis und Lebensart zu erwerben«. Der deutsche Stiernacken sei nunmehr ein Relikt der Vergangenheit, ja vollkommen »out«.[33]
Der Befund ist ideenhistorisch signifikant: Die Formlosigkeit, die Provinzialität und der Stilmangel der Bundesrepublik, die Intellektuelle wie Karl Heinz Bohrer noch Mitte der Achtzigerjahre wortreich beklagen,[34] sehen Enzensberger und Salvatore im Jahr 1979 bereits nahezu überwunden. Man gebe sich in Westdeutschland »urbaner, ironischer, zivilisierter denn je zuvor«, was sich auch in einem sich zunehmend steigernden Interesse an der Kultur spiegele – einer Kultur, die erfreulicherweise gar nichts mehr habe von bildungsbürgerlicher Verstockt- und Verstaubtheit, die weit über die öde Trias »Staatsoper / Beethoven / Bundespresseball« hinausreiche. Eine Zeitschrift allerdings, die genau diesen neuen Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werde, die sie »aufgreifen« und – darauf kommt es besonders an – »entwickeln« könne, gebe es in Deutschland bisher nicht.[35]
Die Lücke, die TransAtlantik publizistisch füllen will, wird von den Verfassern des Papiers sodann genau umrissen, ohne dabei allerdings zu versäumen, die publizistische Gesamtsituation scharf abzuwerten. Magazine wie Madame oder Der Herr seien lediglich »dilettantische Kopien eines nicht vorhandenen Originals«, sie imitierten nur das, was sie für einen internationalen Stil, für weltläufige Eleganz hielten. Tatsächlich atmeten die genannten Zeitschriften aber »die Bonner Kleinstadtluft«, es seien Geburten aus dem Geist eines »verschwitzten Strebertums« und »kulturellen Kretinismus«. Unterhalten könnten sie nur »heruntergekommene Herrenreiter« – in die Jahre gekommene Nazis, so lässt sich assoziieren – und ihre »hilflosen Gattinnen«. Jeder intellektuelle Anspruch sei ihnen fremd, und ein individueller Ton gehe ihnen völlig ab.[36]
Eher schon entsprächen dem konstatierten Gesellschaftszustand Druckerzeugnisse wie Geo, Essen und Trinken, Schöner Wohnen oder sogenannte Männermagazine wie Lui oder Playboy. Aber es gelinge ihnen nur durch »Spezialisierung« die jeweilige Leerstelle im Zeitschriftensegment zu füllen: »Die Suche nach der Marktlücke führt zur Sektorialisierung der Kultur; vorhandene Zielgruppen sollen möglichst risikolos dingfest gemacht und bedient werden.« Was dabei aus dem Blick gerate, seien »neue, noch nicht definierte Bedürfnisse« – also gerade das, so darf man schließen, was TransAtlantik bei seinem Publikum zwar ebenfalls ›aufgreifen‹, aber zugleich auch ›weiterentwickeln‹ möchte. Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus vermieden es die Spezialjournale für Kunstliebhaber, Theaterbesucher, Bücherfreunde und so weiter, mutig ins Offene zu gehen.[37]
Was aber ist mit den großen Publikumszeitschriften, den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen? Sie werden im Konzeptpapier ebenfalls berücksichtigt. Zwar sei auch in ihnen momentan ein Ausbau der Kulturberichterstattung zu bemerken (genannt werden die expandierenden Kulturteile des Stern, des Spiegel, der F. A. Z. und der Zeit), dieser sei aber vornehmlich aufs Quantitative beschränkt. Verantwortlich dafür sei ein beschränkter, zu enger und vor allem zu traditioneller Kulturbegriff, der sich in einem »Übergewicht der Rezensionen« und einer gewissen »Betriebsblindheit von Berufskritikern« niederschlage. Der »neuen Lage« der bundesdeutschen Mentalität könne man so ebenfalls nicht gerecht werden, man laufe den »Zielgruppen« lediglich hinterher, anstatt risikofreudig eigene Impulse zu setzen.[38]
Durch die klare Abgrenzung von einer bloß marktorientierten, eine internationale Ausrichtung nur vortäuschenden, gefahrlos und langweilig den Leserinnen und Lesern hinterher schreibenden Publizistik ist rhetorisch die Bühne für den Auftritt des eigenen Zeitschriftenprojekts vorbereitet. Die Zeit sei nunmehr gegeben für »eine großstädtische, intelligente Publikumszeitschrift«, die den »historisch neuen Ansprüchen der Bundesrepublik« Rechnung tragen solle. Hierzu aber sei ein neues, eigenständiges Konzept nötig, das vor allem klären müsse, welche »Haltung« einzunehmen, welche »Schreibweisen« zu verfolgen, welcher »Ton« anzuschlagen sei.[39]
Was sich hinter diesen Schlagwörtern verbirgt, wird daraufhin im Einzelnen ausgeführt, und zwar zunächst in einer Auflistung, die neben den erhofften die zu vermeidenden Eigenschaften der Zeitschrift nennt:
Überlegen (aber nicht arrogant)
Intelligent (aber nicht akademisch)
Böse (aber nicht hämisch)
Elegant (aber nicht selbstgefällig)
Sophisticated (aber nicht esoterisch)
Kritisch (ohne Besserwisserei)
Ironisch (aber nicht patzig)[40]
So schwierig es ist, sich diese abstrakten Merkmale in konkreter journalistischer Gestalt vorzustellen, so eindeutig sind Enzensberger und Salvatore in der Benennung ihres Vorbilds, das nirgendwo anders als in der »Metropole der westlichen Welt« zu Hause ist. Auch wenn es nicht darum gehen könne, den New Yorker mit seiner ganz eigenen Tradition und spezifischen kulturellen Verortung lediglich zu imitieren, seien doch »die souveräne, überlegene Haltung, der Sinn für Qualität, der großstädtische Humor« des Magazins unbedingt nachahmenswert.[41] Vorbildlich sei ferner, so legen die Verfasser des Papiers in einer weiteren Auflistung dar,
die Orientierung auf das geschriebene Wort, die zentrale Rolle der Autoren, der große Raum, der den einzelnen Beiträgen eingeräumt wird, und die hohe Sachkenntnis, von der sie zeugen; die äußere Gestalt, die kühle, zurückgenommene Aufmachung, das künstlerische Titelblatt, die Bevorzugung der Grafik; der Verzicht auf üppiges Layout, großformatige Fotografie, Farbe, Überwältigung durch artwork;
Die universelle Thematik, der ein weitgespannter Kulturbegriff zugrundeliegt;
Haltung und Ton dem Publikum gegenüber: die Weigerung, sich in irgendeiner Form anzubiedern: keine Lebenshilfe, keine Tips, keine Geschenk-Boutique, keine Hausmitteilungen, keine Tests, keine Rätsel, keine »Einlauftexte«, keine Zwischenüberschriften, keine »Lesehilfen«, keine Leserbriefe, keine plumpen Anreden an den »Lieben Leser«; dafür die elementare Höflichkeit, einen mündigen Leser vorauszusetzen (das heißt aber auch, zu finden, zu gewinnen, ja sogar zu ermöglichen).[42]
Der »urbane Aristokrat« als Zeitschrift: Titel des New Yorker vom 11. Juni 1979
Der Zentralbegriff in dieser Passage ist unterstrichen, der Begriff des »mündigen Lesers«, der die Prämisse des Magazins bildet. Was mit dem Charakteristikum der ›Mündigkeit‹ konkret bezeichnet ist, wird zwar nicht ausdrücklich geklärt, aber es lässt sich aus dem Gesamtzusammenhang erschließen: eine gewisse Anstrengungsbereitschaft und Offenheit gegenüber dem Ungewohnten und Schwierigen; die Fähigkeit, sich in einer auf moderierende Elemente verzichtenden Publikation selbst zu orientieren; die intellektuelle Kompetenz, das Relevante vom weniger Relevanten zu unterscheiden; sich überhaupt mitdenkend und eigenständig zum Gedruckten verhalten zu können. Auf reine Unterhaltungselemente und Gesten der ästhetischen Überwältigung insbesondere durch groß aufgezogene Fotografien wolle eine so begriffene Leserschaft ebenso verzichten wie auf pseudopersönliche Anreden und lebenspraktische Ratschläge. Der »mündige Leser« will nicht ›abgeholt‹, an die Hand genommen und auf den richtigen Weg geführt werden. Was ihm überkuratiert erscheint, und zwar gestalterisch wie intellektuell, lehnt er reflexhaft ab.
Ebenfalls in Entsprechung zum New Yorker könne sich eine solche Zeitschrift nur in einer Metropole entwickeln, also »im ökonomischen und politischen Zentrum einer Zivilisation«. Erwartbar ist damit allerdings nicht München gemeint, wo die TransAtlantik-Redaktion ihre Arbeit aufnehmen sollte und von deren urbanem Esprit die Zeitschrift in vielerlei Hinsicht geprägt war (ich komme darauf zurück). Vielmehr wird die Bundesrepublik im Ganzen als »sekundäre Metropole« aufgefasst, »abhängig« zwar von den Vereinigten Staaten, aber doch, »ob sie will oder nicht«, die »Nummer eins in Europa«.
Eben dies wolle der Titel zum Ausdruck bringen: die Zeitschrift als ein transatlantischer Flügelschlag in die USA, der nach der politischen und wirtschaftlichen nun auch eine kulturelle Westbindung befördern soll. Entsprechend sind die »mitspielenden Momente und Assoziationen« des »international verständlichen« Titels unter anderem diese: »Luxus, Großzügigkeit, Zugang zur Welt« und die »Tradition der mythischen Transatlantikschiffe«.[43]
Schreibweisen, Blickwinkel
Die konzeptuellen Überlegungen der Zeitschriftenmacher gehen über diese allgemeinen Erwägungen allerdings deutlich hinaus, nämlich bis in die gewünschten »Schreibperspektiven und Blickwinkel« hinein. Prinzipiell solle es darum gehen, halten Enzensberger und Salvatore fest, »systematisch abweichende Sehweisen« auszuprobieren und einzuüben, also im Vokabular des Formalismus gesprochen: die Wahrnehmung der Wirklichkeit und Gegenwart zu ›verfremden‹ und dadurch zu ›entautomatisieren‹. Wie aber soll dies erreicht werden? Vor allem dadurch, dass man die konventionellen Redaktionssparten zu durchbrechen versucht, also etwa ein Sportthema gerade nicht durch einen »Sportsachverständigen« behandeln lässt, sondern die Sache von einem »schrägen, seitigen, nicht orthodoxen Gesichtswinkel« aus betrachtet; nur so ließen sich »wirkliche Einblicke gewinnen«. Konkret solle ein Thema wie zum Beispiel das Risiko der Radioaktivität nicht durch eine Reportage aus Harrisburg oder Gorleben abgehandelt werden; das wäre das Konventionellste und mithin »das Verkehrteste«. Viel reizvoller sei es stattdessen, eine Reportage über die Folgen der Strahlentests auf der Insel Bikini schreiben zu lassen und zu fragen, »welche Lebewesen starke Dosen von Strahlen überleben würden« – nämlich, wie man weiß, »Käfer und Schachtelhalme«.[44]
Weiterhin ließe sich die Entautomatisierung der Gegenwartswahrnehmung durch folgende insgesamt elf Prinzipien erreichen: indem man (a) »die ›falschen‹ Leute an das richtige Thema« setze (etwa: der Bankier Poullain schildert seine Eindrücke bei der Lektüre eines Handke-Romans); indem man (b) von Autoren gerade das verlange, »was sie nicht