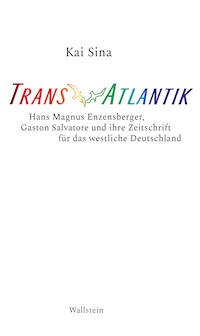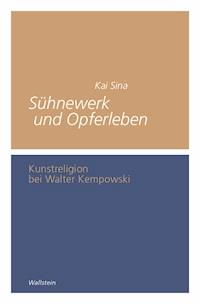19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Thomas Manns Kampf um die Demokratie Thomas Mann sitzt in seinem Arbeitszimmer, denkt und schreibt, bewusst und gewollt entfernt vom störenden Tagesgeschehen um ihn herum. So wird uns der große Autor in vielen Büchern gezeigt. Aber da fehlt eine wichtige Facette, sagt Kai Sina: Thomas Mann war auch ein politischer Aktivist, der mit Leidenschaft dafür eintrat, dass es in der Verantwortung eines jeden liegt, Politik nicht nur zu erleiden, sondern sie zur eigenen Sache zu machen. "In unsere Hände ist er gelegt," rief er 1922 den Gegnern des demokratischen Staates zu, "in die jedes Einzelnen". Wie in einem Brennglas spiegelt sich Thomas Manns äußerst facettenreiches politisches Engagement in der Debatte um den Zionismus. Schon in den Zwanzigerjahren war er Mitglied in einem prozionistischen Unterstützerverein. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er sich mit Nachdruck für die Gründung eines jüdischen Staates ein, der den Überlebenden der Shoah – deren Schrecken und Ausmaß Thomas Mann als einer der ersten Intellektuellen vor aller Welt benannt hatte –, eine sichere Heimstätte bieten sollte. In Kai Sinas meisterhaft geschriebenen Porträt tritt uns dieser zu wenig bekannte Thomas Mann eindrücklich, lebhaft und in seiner ganzen Menschlichkeit vor Augen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Was gut ist und was böse
Kai Sina, geboren 1981 in Flensburg, ist Inhaber der Lichtenberg-Professur für Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik (mit dem Schwerpunkt Transatlantische Literaturgeschichte) an der Universität Münster und leitet die an den Lehrstuhl angeschlossene Thomas-Mann-Arbeitsstelle. Gemeinsam mit Hans Rudolf Vaget gibt er die im amerikanischen Exil entstandene Essayistik Thomas Manns (1939–1945) heraus. Der Band wird im Rahmen der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe der Werke Thomas Manns(GKFA) erscheinen.
Thomas Mann war sehr viel mehr als ein Theoretiker der Politik, nämlich ein Kämpfer und Aktivist. »In unsere Hände ist er gelegt«, mahnte er 1922 mit Blick auf den demokratischen Staat, »in die jedes Einzelnen.«Wie in einem Brennglas spiegelt sich sein facettenreiches politisches Engagement in der Debatte um den Zionismus. Bereits in den 1920er-Jahren schloss er sich einem prozionistischen Unterstützerverein an. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er sich mit Nachdruck für die Gründung eines jüdischen Staates ein, der den Überlebenden der Shoah – deren Schrecken und Ausmaß Thomas Mann als einer der ersten Intellektuellen vor aller Welt angeprangert hatte –, eine sichere Heimstätte bieten sollte.In Kai Sinas meisterhaft geschriebenem Porträt tritt uns dieser bislang viel zu wenig bekannte Thomas Mann eindrücklich, lebhaft und in seiner ganzen Menschlichkeit vor Augen.
Kai Sina
Was gut ist und was böse
Thomas Mann als politischer Aktivist
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbHwww.ullstein.de© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Alle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Lektorat: Ulrich WankAutorenfoto: © Hans ScherhauferE-Book-Konvertierung powered by PepyrusISBN 978-3-8437-3279-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Vorspiel am Pazifik
In public affairs
Was unserem Europa zustoßen könnte
»Tommy’s unerträgliche Politik«
»Hakenkreuz-Unfug« und Ehestreit
Scharren im Parkett
Von ernstlichsten Vorhaltungen
Verlorene Illusionen
Die Welt am Abend
Einer gegen 18,3 Prozent
Antifaschistische Prosa
Das Wort in aller Freiheit
Dem Unwesen kein Zugeständnis
Mit gutem Amplifier
Anstiftungen zum Widerstand
Wer ist der Faschist?
Wider Treu und Glauben
Gute Dinge, Mängel
Nachgedanken in Princeton
Dank
Siglen und Abkürzungen
Literatur und Quellen
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Motto
»Gut und böse – gut und schlecht: Nietzsche hat viel psychologischen Federlesens gemacht von diesem Gegensatzpaar, aber es fragt sich, ob schlecht und böse wirklich so verschiedene Dinge sind, wie er wahrhaben wollte. In der ästhetischen Welt, das ist wahr, braucht das Böse, das höhnisch Menschenfeindliche und Grausame nicht das Schlechte zu sein. Es habe nur Qualität, so ist es ›gut‹. In der Welt des Lebens und der menschlichen Gesellschaft aber ist das Schlechte, Dumme und Falsche auch das Böse, nämlich das Menschenunwürdige und Verderbliche, und sobald der Kritizismus der Kunst sich nach außen wendet, sobald er gesellschaftlich wird, wird er moralisch, wird der Künstler zum sozialen Moralisten.«
Thomas Mann: Der Künstler und die Gesellschaft, 1952
Prolog
Mehr als ein Denkort am Pazifik: das kalifornische Zuhause der Familie Mann
ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv/Fotograf: Unbekannt/TMA_4485
Vorspiel am Pazifik
Im Radio des Taxifahrers, der mich vom Flughafen in Los Angeles nach Pacific Palisades bringt, läuft Marvin Gaye. Schwebender, heller, zurückgelehnter Soul der Siebzigerjahre. Ob ich schon einmal in der Stadt gewesen bin? Als ich verneine, empfiehlt er, die Strecke entlang der Küste zu nehmen. Es klingt wie die Einführung in ein Buch.
Es ist Dezember 2019. Ich bin hierhergekommen, um einige Zeit im ehemaligen Wohnhaus der Familie Mann zu verbringen, für Treffen, Gespräche, einen Vortrag. Beim Abflug in Deutschland hatte das Wetter sämtliche Graustufen durchgespielt: feucht, trüb und so mild, dass es sich wie ein Vorwurf anfühlte. Tags zuvor hatte das »Lichterfest« unseres Sohnes im Innenhof einer Göttinger Grundschule stattgefunden, im Nieselregen. Hier, in Kalifornien, wirken Licht und Luft fast schon wie eine Parodie europäischer Klischees. Es ist, als hätte jemand für diesen Tag eine Sondervorstellung von »Amerika« auf den Spielplan gesetzt.
Mein Fahrer, ein gebürtiger Angeleno, erzählt mir stolz von seiner Stadt, von den sichtbaren und unsichtbaren Schichten ihrer Geschichte. Das spätnachmittägliche Sonnenlicht bricht sich scharf in den Wellen. Übermüdet vom Flug und im Zusammenspiel mit der lauwarmen Luft, die mir durchs Autofenster ins Gesicht bläst, hat das eine betäubende Wirkung. Noch immer Marvin Gaye. Falsett-Gesang über gedämpften Beats und wehenden Streichern.
Bald wird die Gegend, durch die wir fahren, hügeliger, grüner, weniger dicht bebaut – und mehr als nur wohlhabend. Als das Taxi die Adresse San Remo Drive 1550 erreicht und die berühmte weiße Mid-Century-Villa vor mir auftaucht, stellt sich ein Gefühl der Benommenheit ein. Die wenigen Tage, die für meinen Aufenthalt vorgesehen sind, erscheinen mir geradezu lächerlich – als könnte ich in dieser kurzen Zeit mehr schaffen, als nur meinen Koffer aus- und wieder einzupacken.
Der Vortrag, den ich während meines Aufenthalts halten werde, soll sich mit Thomas Manns transatlantischem Demokratieverständnis befassen, seinen Quellen und Ambivalenzen. Fertig geschrieben habe ich ihn noch nicht, das will ich hier erledigen, in der noblen Abgeschiedenheit dieses Hauses, in dem außer mir nur ein paar Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Deutschland wohnen, die man gelegentlich in der Küche trifft.
Um den Ort, an dem ich mich befinde, zumindest in seiner Geschichte etwas besser zu verstehen, greife ich in den kommenden Tagen immer wieder zu den Tagebüchern des ehemaligen Hauseigentümers. Was ich längst weiß, stellt sich nun, in diesen Räumen, noch einmal ganz anders, plastischer und lebendiger vor Augen. Ich lese von seinen langen Vortragstourneen, die ihn von hier aus durchs ganze Land geführt haben; von den Radioansprachen, die er im Zimmer nebenan geschrieben und in einem NBC-Studio in Hollywood aufgezeichnet hat, bevor sie über New York und London ins dunkle, vom Krieg immer weiter zerstörte Nazideutschland gesendet worden sind; von den zahllosen Statements, Interventionen und Kommentaren zur globalpolitischen Lage, die er in diesem Haus verfasst und in die ganze Welt geschickt hat; von den Komitees, Verbänden und Organisationen, die sich mit ihren politischen Anliegen an diese Adresse gewandt haben.
»Quellen und Ambivalenzen des Demokratiebegriffs«? Es scheint mir zwar weiterhin nicht falsch, diese Frage zu stellen, und genügend Zeit (und Energie), meinen Vortrag umzuwerfen, habe ich ohnehin nicht. Aber mir wird im Zuge meines Aufenthalts und meiner Lektüre immer klarer, dass ich mit meiner Frage den wesentlichen Punkt verfehle, ja dass sie möglicherweise genauso neben der Spur liegt, wie ich mich in diesen Tagen fühle. Thomas Mann ist nicht, oder zumindest nicht in erster Linie, ein Theoretiker der Demokratie, ein politischer Denker. Er ist ein Handelnder, ein Aktivist, und sein Haus eine Schaltzentrale, ein Ausgangspunkt und Umschlagplatz. Das wird mir in diesen Tagen klar.
Zwei Jahre später erhalte ich eine Mail von Nikolai Blaumer, damals Direktor des Thomas Mann House. Ob ich mir vorstellen könnte, für seinen Blog einen Artikel zu schreiben. Er schlägt ein Thema vor, über das man bisher, wie er meint, nicht sehr viel wisse, nämlich Thomas Manns Verhältnis zum Zionismus. Ich nehme das Angebot an und beginne bald mit der Arbeit.
Die Recherchen in Archiven, Datenbanken, Bibliotheken sind elektrisierend, und das nicht nur, weil sich hier in der Tat ein weitgehend unerschlossenes Gebiet auftut, sondern mehr noch, weil in dieser Frage der Zusammenhang von gelebter Demokratie und politischem Aktivismus beispielhaft nachvollziehbar ist. Thomas Mann war ein beharrlicher Unterstützer des Zionismus: als Mitglied eines Komitees »Pro Palästina« in den Zwanzigerjahren; als verlässlicher Anwalt in Zeiten von Krieg, Verfolgung und Genozid; schließlich, in der Nachkriegszeit, als energischer Fürsprecher des jungen Staates Israel. Dieses Engagement ist weit mehr als nur eine Fußnote, es zieht sich als durchgehender Strang durch seine politische Biografie.
Als der Artikel erscheint, gibt es für meine Verhältnisse ungewöhnlich viele und entschiedene Rückmeldungen, Zustimmung und Ablehnung gleichermaßen, besonders aus den USA. Thomas Mann als Zionist? Obwohl mein Text nur eine Rekonstruktion der Quellen sein soll, nüchtern, ohne interpretative Ausschweifungen, ruft er überraschend starke Reaktionen hervor. Manns politisches Handeln wirkt in diesem Moment bis in die Gegenwart hinein.
Die Resonanz auf meinen Artikel lässt mich erneut an die seltsam entrückten Tage in Pacific Palisades denken. Schon damals hatte ich den Eindruck gewonnen, dass Manns Politik weit über bloße Begriffe und Theorien hinausging. Jetzt wird mir noch deutlicher, wie lebendig und kontrovers seine Haltung bis heute wahrgenommen wird. Eine rein ideen- oder begriffsgeschichtliche Analyse seiner demokratischen Überzeugungen, wie sie in Forschung und Kritik immer noch vorherrschend ist, greift an diesem Punkt tendenziell vorbei. Was mir entscheidender und faszinierender erscheint, ist sein gelebtes Engagement – in seiner ganzen Komplexität und Konsequenz, ja selbst noch in seinen charakteristischen Widersprüchen.
Der Plan, den politischen Thomas Mann in seinem konkreten Handeln und Agieren zu beschreiben – im Gesamtzusammenhang zwar, aber mit besonderem Augenmerk auf seinen Bezug zum Zionismus –, resultiert aus dieser Spannung. Mit dem vorliegenden Essay, den ich bereits vor dem 7. Oktober 2023 in seinen Grundzügen entworfen, aber unter dem Eindruck dieses Tages geschrieben habe, will ich versuchen, ihn in die Tat umzusetzen.
Der politische Intellektuelle als Handelnder: Order of the Day (1942)
Chesil Books/Fotograf: Murdoch Mactaggart
In public affairs
Wo beginnt in Thomas Manns politischer Biografie das Agierende und Aktivistische, von dem ich in diesem Buch erzählen will? In den Reden und Ansprachen, den Essays und Artikeln seit 1938, dem Jahr, in dem Thomas Mann in die Vereinigten Staaten emigrierte, tritt es besonders kraftvoll zutage. Notwendig war dafür aber zunächst in den Zwanzigerjahren die Einsicht in die historische Unausweichlichkeit der Republik und der Demokratie.
Dieser Zusammenhang ist entscheidend: Unterhalb des in hohem Ton vorgetragenen Plädoyers für die Weimarer Republik im Jahr 1922, deren schwärmerischer Demokratiebegriff auf einer eigenwilligen, bei näherer Betrachtung wenig stimmigen Mixtur aus Novalis, Walt Whitman und der Ideenwelt des Wandervogel beruht – unterhalb des Bekenntnisses in der Rede Von deutscher Republik bildete Thomas Mann eine politische Praxis heraus, die für John Dewey, den Verfasser der für das US-amerikanische Bildungswesen unermesslich einflussreichen Abhandlung Democracy and Education, den Kern des Demokratischen schlechthin ausmacht. Mehr als ein politisches System, mehr als Gewaltenteilung und Stimmrecht, Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit sei die Demokratie, schreibt Dewey, »a mode of associated living, of conjoint communicated experience«, und setze als solche ein ausdauerndes Mitwirken jedes und jeder Einzelnen in public affairs voraus.1 Spätestens seit den mittleren Jahren der Weimarer Republik war Thomas Mann die mustergültige Verkörperung eines genau solchen pragmatischen Demokratieverständnisses.
Und darin wiederum lag die Voraussetzung für seinen politischen Aktivismus. In diesen Modus geht sein demokratisches Handeln in dem historischen Moment über, in dem die junge Weimarer Demokratie existenziellen Bedrohungen ausgesetzt war, namentlich durch eine zunehmend stärker werdende und aggressiver auftretende politische Rechte. Die ausdrückliche Hinwendung zum Aktivismus formulierte er in seiner Deutschen Ansprache vom Herbst 1930, die er im Untertitel einen Appell an die Vernunft nannte – und ausgerechnet in dem Berliner Beethovensaal vortrug, in dem er acht Jahre zuvor seine Republikrede gehalten hatte, gerade so, als habe es eines öffentlichen Updates seiner Position als politischer Intellektueller bedurft.
Die Ansprache hebt mit einem scheinbar eindeutigen Dementi an: »Ich bin kein Anhänger des unerbittlich sozialen Aktivismus«, so erklärte er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern da, zurückgreifend auf einen Begriff, der nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Modevokabel insbesondere lin-ker politischer Intellektueller geworden war.2 Auch wenn es keinen Zweifel daran geben könne, dass das Zeitalter des ästhetischen Idealismus, der vollkommenen Zweckfreiheit der Kunst, wie sie Friedrich Schiller noch habe vertreten können, unwiederbringlich vorüber sei – einer »aktivistischen Gleichung von Idealismus und Frivolität« müsse man deshalb noch lange nicht zustimmen.3
Die erklärte Abwehr ist eine rhetorische Geste, die keine andere Funktion hat, als die ungewöhnliche Dringlichkeit der gegebenen Situation hervorzuheben. Sie lässt die Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz als ausweglos erscheinen:
Dennoch gibt es Stunden, Augenblicke des Gemeinschaftslebens, wo solche Rechtfertigung der Kunst praktisch versagt; wo der Künstler von innen her nicht weiterkann, weil unmittelbare Notgedanken des Lebens den Kunstgedanken zurückdrängen, krisenhafte Bedrängnis der Allgemeinheit auch ihn auf eine Weise erschüttert, daß die spielend leidenschaftliche Vertiefung ins Ewig-Menschliche, die man Kunst nennt, wirklich das zeitliche Gepräge des Luxuriösen und Müßigen gewinnt und zur seelischen Unmöglichkeit wird.
4
»Unmittelbare Notgedanken«, »krisenhafte Bedrängnis«: Im eloquenten Flow der Wörter und Sätze gehen die Drastik und Dramatik, mit der Thomas Mann die gesellschaftliche Lage beschreibt, fast ein wenig unter. Dabei wird erst vor ihrem Hintergrund die geradezu lutherische Haltung, die sich mit seinem Bekenntnis verbindet, in ihrem ganzen Pathos erkennbar: Ich kann nicht anders. Zwar hatte er tatsächlich schon mehrere Jahre zuvor nicht anders gekonnt, der Beginn seiner öffentlichen Agitationen gegen die Rechte reichte mindestens ein halbes Jahrzehnt zurück,5 was er in seiner Rede wohl nicht zuletzt aus dramaturgischen Gründen, zugunsten einer Zuspitzung der biografisch-gesellschaftlichen Wendepunktsituation, unter den Tisch fallen ließ. Ausdrücklich unter dem Begriff des »Aktivismus« stand sein politisches Handeln aber erst seit dem Appell an die Vernunft.
Was zeichnet diesen Aktivismus im Einzelnen aus? Auch darauf gibt die Ansprache eine Antwort, und zwar weniger, indem sie Wort für Wort ausbuchstabierte, was sie darunter versteht, sondern vielmehr, indem sie ihn selbst in die Tat umsetzt. Für meinen Essay leitet sich daraus – das sei betont – keine feststehende Definition und kein unflexibler Kriterienkatalog ab. Vielmehr eröffnet die Rede ein Spektrum an Merkmalen und Eigenschaften, das Manns Aktivismus seit den mittleren Zwanzigerjahren in unterschiedliche Akzentuierungen und Facetten prägt. Eingedenk dieser Einschränkungen meint »aktivistisch« erstens, dass es einen konkreten Anlass für das politische Einschreiten gibt (im beispielhaften Fall die Reichstagswahl vom September 1930 mit dem alarmierenden Stimmenzuwachs der NSDAP); dass Thomas Mann zweitens auf einen für ihn ansonsten ungewöhnlich handfesten Ton, teils auf Polemik zurückgreift (etwa wenn er den Nationalsozialisten einen politischen »Groteskstil mit Heilsarmee-Allüren, Massenkrampf, Budengeläut« bescheinigt); dass er drittens auf der Grundlage einer klaren moralischen Unterscheidung argumentiert (eine Verletzung des »Menschenanstands« erkennt er im politischen Rechtsruck); und dass er viertens zielgerichtet vorgeht, also wirksamen Einfluss auf den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung nehmen will (was ja bereits durch die Gattungszuordnung seiner Rede als »Appell« deutlich gemacht wird).6
Insbesondere der drittgenannte Punkt, die moralische Unzweideutigkeit, unterscheidet Manns politischen Aktivismus von seinem literarischen Schreiben im engeren Wortsinne. Auch wenn gewisse Überschneidungspunkte und Übergangszonen zwischen Aktivismus und Literatur durchaus zu finden sind (auf einige werde ich zu sprechen kommen, insbesondere auf den ersten Band des Josephsromans, Die Geschichten Jaakobs, und seine Publikationsumstände im Oktober 1933), so darf man in diesem Punkt doch Thomas Mann selbst folgen, der stets eine klare Trennlinie zwischen den beiden Sphären seines Schaffens gezogen hat, mit einer deutlichen Bevorzugung des Literarischen vor dem Politischen: Im Tagebuch beklagt er laufend, wie ihn das politische Tagesgeschäft von der literarischen Arbeit abhält, wie er das eine tun muss und das andere dadurch nicht im erwünschten Maße tun darf. Ganz im Einklang damit hat er die an ihn herangetragene Bezeichnung als Politiker im übertragenen Sinne ebenso konsequent zurückgewiesen wie politische Ämter im eigentlichen Wortsinn. Wohl nicht ganz ungeschmeichelt, aber doch unmissverständlich wies er den im Sommer 1943 per Umfrage ermittelten Wunsch einiger Emigranten, alliierter Diplomaten und Deutschland-Experten, ihn zum Präsidenten des künftigen Nachkriegsdeutschland zu machen, als »Unsinn« in die Schranken.7
Man kann es aber auch stärker inhaltlich fassen, denn während der Aktivist Thomas Mann sehr bewusst mit groben Mitteln auf noch gröbere Umstände reagiert, dominieren in seiner Literatur Komplexität und Ambivalenz, und das selbst noch dort, wo der Faschismus eigens zum Thema wird, beispielsweise in der 1930 veröffentlichten Novelle Mario und der Zauberer, die auf psychologische Weise das Ineinander von charismatischer Verführungskraft und lustvoller Vernunftpreisgabe plausibel zu machen versucht, also mehr das Geschäft der literarischen Analyse als der politischen Anklage betreibt – wie nach dem Krieg nicht anders der große Deutschlandroman Doktor Faustus.
Hierin zeigt sich ein untrügliches Gespür für das, was die Rhetorik als aptum bezeichnet; gemeint ist die situative Angemessenheit und Stimmigkeit einer Rede im jeweils gegebenen Kontext. Der elaborierteste Versuch, das Literarische und das Politische in dieser Hinsicht voneinander zu unterscheiden, stammt von dem Germanisten Matthias Löwe. Demnach gebe es für Thomas Mann »keinen rein künstlerischen Menschen«, vielmehr sei das Künstlertum für ihn »eine soziale Rolle neben anderen, von denen keine das Ich vollständig bestimmen kann«. Und daher wiederum lassen sich »die Maßstäbe, die im System Kunst gelten, nicht ohne Weiteres auf das System Politik übertragen«. Mann sei stets bewusst gewesen, dass »nicht bei jeder Gelegenheit […] ein Sprechen in der Rolle des ironischen Künstlers geboten« ist.8 Mitunter braucht es einen politischen Redner, der klarere Unterscheidungen vorzunehmen und zu benennen vermag, als es dem Künstler jemals möglich wäre. »Ja, wir wissen wieder, was gut und böse ist«, erklärte Thomas Mann ausdrücklich und programmatisch in seiner Rede Das Problem der Freiheit von 1939, und erläutert, man lebe in einem »Zeitalter der Vereinfachung«.9 Unverkennbar handelt es sich um einen Satz des politischen Aktivisten, der dem Erzähler und Romancier so gewiss nicht über die Lippen gekommen wäre.
Staubiger als Ideen
Thomas Mann so zu betrachten, als demokratischen Aktivisten und Aktivisten der Demokratie, ist in dieser Zuspitzung eher unüblich. Folgt man dem in jeder germanistischen Fachbibliothek greifbaren, wenn auch wahrscheinlich mit zahlreichen Randanmerkungen versehenen Überblickswerk von Hermann Kurzke, so gibt es in der Auseinandersetzung und Bewertung des politischen Thomas Mann grundsätzlich zwei etablierte Positionen. Je nach Perspektive lässt sich entweder der »Radikaldemokrat bürgerlicher Provenienz« als »progressiv« adeln oder der Bürgerkünstler mit seinem »ironischen Skeptizismus« als »Feind der progressiven Sache« verurteilen.10 Diese gespaltene Wahrnehmung ist bis in die Gegenwart nicht überwunden, eher im Gegenteil. Betrachtet man die Diskussion, wie sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit besonderer Intensität geführt worden ist, und das weit über die akademische Öffentlichkeit hinaus bis in die Sphäre des Journalismus und der Politik hinein, so offenbart sich eine Lagerbildung, die auf beiden Seiten mit starken und teils fragwürdigen Tendenzen zur Vereinseitigung einhergeht.
Am schärfsten fällt die Kritik wahrscheinlich beim Historiker Manfred Görtemaker aus, der als Schlussfolgerung seiner Abhandlung über Thomas Mann und die Politik von 2005 festhält, dieser sei im Grunde nichts anderes als ein »Schreibtischtäter« gewesen und habe »in der Sphäre der Politik oft mehr Schaden als Nutzen« angerichtet. Persönlichen Mut könne man ihm nicht attestieren, denn mutig sei er »stets nur mit der Feder« gewesen.11 Der Begriff des »Schreibtischtäters«, das wird Görtemaker als Geschichtswissenschaftler klar gewesen sein, geht auf Hannah Arendt zurück, die ihn prägte – und zwar in Bezug auf Adolf Eichmann.12 Mit Fug und Recht darf man das eine Entgleisung nennen.
Mit vergleichbarer Attitüde betont der Ideenhistoriker Philipp Gut in seiner drei Jahre nach Görtemakers Buch veröffentlichten, in vielerlei Hinsicht umsichtigen und lesenswerten Studie Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur an gleich zwei Stellen, der von den Nazis ins Exil Geflüchtete sei »im Wortsinne fein raus« gewesen.13 Gut nimmt damit fast bruchlos – wenn auch wahrscheinlich unbewusst – den Vorwurf des nationalkonservativen Schriftstellers und Publizisten Frank Thiess aus der frühen Nachkriegszeit auf, wonach Mann und all die anderen Emigrantinnen und Emigranten der deutschen Katastrophe von den »Loge- und Parterreplätzen des Auslands« zugesehen hätten.14 Man fragt sich, woher Taktlosigkeiten wie diese rühren, dazu noch so lange nach den historischen Ereignissen, welche bewussten oder unbewussten Ressentiments ihnen zugrunde liegen. Vielleicht hat man Thomas Mann die kühle Anatomie der deutschen Kultur und ihrer Irrwege im Doktor Faustus, die geschliffen scharfen Anklagen in seinen Radioreden an Deutsche Hörer! immer noch nicht so ganz verziehen?
Die Gegenseite der verurteilenden Kritik stellt die unumwundene Krönung Manns zum Vorbild im »Ringen um eine freie und offene Gesellschaft« dar, wie sie beispielsweise Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Rede anlässlich der Eröffnung des Thomas Mann House im Juni 2018 vollzogen hat.15 Zwei Jahre zuvor, noch unter seiner Ägide als Außenminister im Kabinett Angela Merkels, hatte die Bundesregierung die Mann-Villa für einen zweistelligen Millionenbetrag erworben. Manns im kalifornischen Exil entstandene Reden und Schriften zur Demokratie – in Steinmeiers Worten erscheinen sie als Erbauungsliteratur für die krisengeschüttelten Bewohnerinnen und Bewohner des transatlantischen Westens.
In eine ähnliche Richtung wie der Bundespräsident zog fast gleichzeitig ein Meinungsartikel in der New York Times. In Reaktion auf das erste Chaosjahr der Präsidentschaft von Donald Trump empfahl der Kolumnist David Brooks den Leserinnen und Lesern der Times Manns Rede The Coming Victory of Democracy aus dem Jahr 1938 als ein Mittel zur demokratischen Selbstvergewisserung: »Mann’s great contribution is to remind us that democracy is not just about politics; it’s about the individual’s daily struggle to be better and nobler and to resist the cheap and the superficial.«16 Ohne dem US-Journalisten einen Vorwurf daraus machen zu wollen – zumal er auf die oft übersehene ethische Dimension des Demokratischen hinweist, auf seine Bedeutung als moderne Lebensform –, bleibt seine Ernennung Manns zum demokratischen Vorbild doch nicht ohne Folgen. Kritikwürdige Aspekte geraten dabei in den Hintergrund, etwa der immer wieder diskutierte »geistesaristokratische Einschlag« in seinem Demokratieverständnis und die Überzeugung, dass eine gelingende Demokratie nur »als Güte, Gerechtigkeit und Sympathie von oben« umsetzbar sei.17 Ob sich auf diese Weise eine wirkungsvolle Aktualisierung des politischen Thomas Mann für das 21. Jahrhundert erreichen lässt, mag dahingestellt bleiben.
Eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit der exemplarisch angeführten Positionen lässt sich bei genauerem Hinsehen aber doch erkennen. So gegensätzlich, ja unvereinbar die Bewertungen von Görtemaker und Gut auf der einen, Steinmeier und Brooks auf der anderen Seite in sachlicher Hinsicht erscheinen – sie treffen sich darin, dass sie ihre Bewertungen primär auf Manns explizite und reflexive Aussagen gründen, auf das, was er ausdrücklich über das Wesen der Demokratie und Politik äußerte. Der übliche Blick auf den politischen Thomas Mann ist an Ideen, Konzepten und Begriffen interessiert, gerade so, als wäre sein Fach die politische Theorie oder Philosophie gewesen, als stünde er in dieser Hinsicht in einer Reihe mit Zeitgenossen wie Hannah Arendt, Theodor W. Adorno oder Max Horkheimer. Schlagend ist in dieser Hinsicht die Zielsetzung eines vor wenigen Jahren erschienenen Kompendiums, das sich mit Thomas Mann und der politischen Neuordnung nach 1945 befasst. Man wolle, so liest man in der Einleitung, »Konstellationen« nachzeichnen, »in denen sich Thomas Manns politisches Denken im US-amerikanischen Exil weiterentwickelte und erprobte, um Möglichkeiten zu eröffnen, über die Neuordnung der Welt nach dem Weltkrieg nachzudenken«.18 Ohne dass die Einleitung noch der Band im Ganzen darin aufgingen, ist mit dieser Formulierung letztlich nichts anderes gesagt, als dass es Thomas Mann im Politischen vordringlich um Gedanken, ja um ein Denken des Denkens wegen gegangen sei (ein Denken erproben … um Möglichkeiten zu eröffnen … nachzudenken). Wenn dem wirklich so wäre, hätte man es tatsächlich mit einem politischen Glasperlenspieler zu tun, womit man allerdings fast schon wieder da angekommen wäre, wo die Debatte um den politischen Thomas Mann vor Jahrzehnten begann, bei der Frage also, ob er überhaupt und jemals ein politischer Autor gewesen sei oder nicht doch bloß ein »unwissender Magier« (Joachim Fest).
Dieser Essay setzt einen anderen Akzent, und natürlich gibt es auch dafür Impulsgeber, namentlich einige neuere Arbeiten der Literaturwissenschaftler Hans Rudolf Vaget und Heinrich Detering über den amerikanischen Exilanten Thomas Mann. Beide beziehen nämlich mehr als nur seine allgemeinen Verlautbarungen zur Politik und Demokratie in ihre Betrachtungen ein und richten den Blick besonders intensiv auf sein Tun: auf seine langen Vortragstourneen, auf denen er sein Lob der Demokratie und Freiheit bis in die entlegendsten Gebiete der Vereinigten Staaten getragen hat, seine engagierte Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen, unter anderem im Emergency Rescue Committee, das von den Nazis verfolgte europäische Künstler beim Weg ins amerikanische Exil begleitete, oder sein aktives Mitwirken als Neubürger der USA in zwei amerikanischen Wahlkämpfen, 1944 und 1948.19 Ohne es ausdrücklich zu formulieren, stützen diese Arbeiten die These, dass Thomas Mann – und zumal der politische Aktivist Thomas Mann – für eine als Lebensform begriffene Demokratie steht, wie sie wiederum John Dewey beschrieben hat: »Democracy as a way of life is controlled by personal faith in personal day-by-day working together with others.«20
Von dieser Arbeit »day-by-day«, die nicht immer glänzt und strahlt, die im Gegenteil oft etwas unrein und staubig ist, handeln die folgenden Kapitel. Dabei richten sie den Blick nicht allein auf einige der immer wieder diskutierten großen Reden, Essays und Vorträge, sondern auch auf die oft tagesaktuellen, in der Regel kurzen bis mittellangen Gebrauchstexte, auf all die Statements, Interventionen, Kommentare, Botschaften und so weiter, für die sich die Forschung bislang nur selten oder nur unter spezifischen Blickwinkeln interessiert hat, was auch darauf zurückzuführen ist, dass sie in der Summe erst nach und nach in den sukzessive erscheinenden Bänden der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA) dem Gesamtwerk hinzugefügt werden. Für ein umfassendes Bild des politischen Thomas Mann ist die Berücksichtigung dieser Ephemera aber unerlässlich, mehr noch, sie gehören zu seinen wichtigsten Ausdrucksformen.
Entwicklungen und Zionismus
Der politische Aktivist, zu dem Mann in der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre in Reaktion auf den Aufstieg der politischen Rechten wurde, gipfelnd im bekenntnishaften Appell an die Vernunft von 1930, kann nur im Kontext seiner politischen Biografie im Ganzen verstanden werden. Entsprechend setzt meine Rekonstruktion nicht erst mit der Rede Von deutscher Republik Anfang der Zwanzigerjahre ein, sondern deutlich früher, im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg. An politischer Aktivität zeichnet sich in dieser frühen Phase bereits ab, was in der Weimarer Republik und später im amerikanischen Exil zur vollen Ausprägung kommen sollte.
In dieser Entwicklung stellt die Essayistik der Kriegszeit, stellen an erster Stelle die Betrachtungen eines Unpolitischen eine klare Zäsur dar, auch und gerade in ihrer dezidierten Ablehnung des Aktivismus. Die Betrachtungen erscheinen in diesem Zusammenhang als ein Essay-Experiment, das in seiner verwirrenden Selbstbezüglichkeit und formalen Eigenwilligkeit alle Werkklassifizierungen sprengt, nicht nur im Kontext von Manns Œuvre. Die Rede Von deutscher Republik wiederumist auf dieser Folie nicht bloß als eine politische Wende zu diskutieren, wie es in der Forschung üblich ist, sondern auch als eine Wiederanknüpfung. Über den ideologischen Bruch der Jahre 1914 bis 1918 stellte sie den Anschluss an den proto-aktivistischen Gestus und Sound der frühen Jahre wieder her.
Die Jahre nach 1945 erscheinen demgegenüber als eine Zeit des politischen Abklingens. Geschwächt vom jahrelangen antifaschistischen Kampf, in gewisser Weise heimatlos und mit depressiven Tendenzen, was aus den späten Tagebüchern unverkennbar hervorgeht, trat der öffentliche Intellektuelle Thomas Mann zwar durchaus noch in Erscheinung. Von der Agilität und dem Aktivismus der vorangegangenen Jahre war aber nur noch selten etwas zu spüren – was die wenigen Momente, in denen es doch der Fall ist, umso erklärungsbedürftiger macht. An die Stelle des progressiven Gestaltenwollens trat für Mann nun zunehmend das Gefühl der Enttäuschung angesichts der sich herausbildenden globalen Nachkriegsordnung, bisweilen auch ein gewisser Fatalismus.
Auch wenn dieser Essay eine Entwicklung über nahezu 50 Jahre darstellen will, kann, soll und will er keine Gesamtdarstellung des politischen Thomas Mann sein. Dankbar sei in diesem Zusammenhang auf die nicht wenigen werkbiografischen Großunternehmungen verwiesen,21 die es mir nicht nur erlauben, mich auf den Aktivismus als einen Modus des demokratisch-politischen Handelns zu konzentrieren, sondern in diesem Rahmen den Themenkreis sogar noch etwas enger zu ziehen. So möchte ich einen Problemkomplex ins Zentrum rücken, der bisher weder in der wissenschaftlichen Literatur zu Thomas Mann noch in der öffentlichen Diskussion eingehender zur Kenntnis genommen worden ist, und das, obwohl er für die Weltpolitik des 20. Jahrhunderts fundamentale Bedeutung hatte und seine Folgen bis in die unmittelbare Gegenwart hineinreichen. Ich spreche vom Zionismus.22