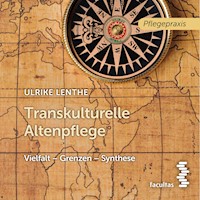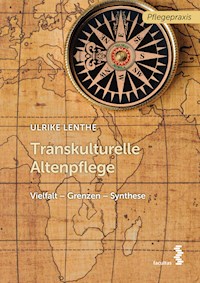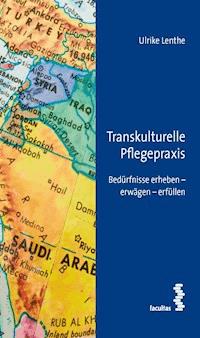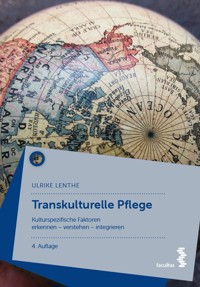
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Oft kommen Pflegepersonen und Pflegebedürftige aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen, der Pflegealltag ist multikulturell geprägt. Sprachbarrieren und die Unkenntnis fremder Kulturen können zu Missverständnissen führen, die den Pflegeerfolg ernsthaft gefährden. Dieses Buch vermittelt Kenntnisse über kulturspezifische Orientierungssysteme. Es zeigt, warum Fremde anders empfinden, urteilen oder handeln und wie Pflegepersonen sie in ihrer kulturell geprägten Lebenswelt als Persönlichkeit wahrnehmen und ihnen mit Wertschätzung begegnen können. Mit gebündeltem Hintergrundwissen aus Kulturwissenschaft, Religionsgeschichte, Sozialanthropologie, Migrationsforschung und Politikwissenschaft beantwortet dieses Buch Fragen, an denen heute niemand mehr vorbeigehen kann, der an interkultureller Zusammenarbeit interessiert ist. Für Pflege- und Gesundheitsberufe, Pflege- und Betreuungsinstitutionen und alle, die im Pflegealltag mit fremdsprachigen Klient:innen in Kontakt kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ulrike LentheTranskulturelle Pflege
Ulrike Lenthe, MAS, DGKP; akad. gepr. Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege, akad. gepr. Krankenhausmanagerin, Absolventin des European Health Leadership Programme am King’s Fund Management College, London. Auslandspraktika in Dänemark, England, Italien, im Nahen Osten, Südafrika und Ostasien. Ehem. Pflegedirektorin des Alten- und Pflegeheimes MarienheimbetriebsgesmbH, Bruck/Leitha. Seminare und Vortragstätigkeit in der Fort- und Weiterbildung für Pflegepersonen in den Bereichen transkulturelle Pflege und Pflege dementierender Klientinnen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet und stattdessen die weibliche Form verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wird die männliche Form verwendet, so ist dies ausdrücklich gewollt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung der Autorin oder des Verlages ist ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
4. Auflage 2024
Copyright © 2011 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Verlag, Wien, Österreich
Umschlagbild: shutterstock.com
Lektorat: Sabine Schlüter, Laura Hödl, Wien
Satz: Florian Spielauer, Wien
Druck: Facultas Verlags- und Buchhandels AG
Printed in the EU
ISBN 978-3-7089-2368-0
eISBN 978-3-99030-773-5
Dieses Buch widme ich den Pflegepersonen im Marienheim Bruck an der Leitha.
Die gedeihliche Zusammenarbeit mit meinen multikulturellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat mein Verständnis von kultureller Vielfalt ungemein bereichert.
Vorwort zur 4. Auflage
Seit der Erstauflage dieses Buches im Jahre 2011 ist die Zahl der Menschen signifikant gestiegen, die aufgrund von Kriegen, Naturkatastrophen, Hunger und Verfolgung oder in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen nach Österreich gekommen sind. Das Thema Transkulturelle Pflege ist damit heute aktueller denn je zuvor.
Lebten im Jahre 2010 noch 1,54 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich (18,6 % der Gesamtbevölkerung), waren es Ende des Jahres 2021 bereits 2,24 Millionen, somit 25,4 % der Gesamtbevölkerung. In Anbetracht der kontinuierlich steigenden Zahl von Asylanträgen sowie der Fluchtbewegungen aus der Ukraine wird Zuwanderung weiterhin eine dominierende Komponente der Bevölkerungsentwicklung in Österreich sein.
Im Hinblick auf die demographische Entwicklung werden immer mehr Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen. Gleichermaßen nimmt auch die Diversität unter den Pflegepersonen deutlich zu. Auch wenn multikulturelle Pflegeteams in Österreich bereits seit Jahrzehnten Realität sind, werden die steigende Zuwanderung und der gravierende Mangel an Pflegepersonal den Anteil an Pflegepersonen mit Migrationshintergrund noch weiter erhöhen.
Demnach wird Transkulturelle Pflege, die heute bereits unverzichtbar ist, auch im Laufe der nächsten Jahre eine immer größere Bedeutung erhalten.
Der konstruktive Umgang mit kultureller, religiöser und sprachlicher Vielfalt sowie mit unterschiedlichen Wertehaltungen der Menschen zählt damit zu den Schlüsselkompetenzen in der Gesundheits- und Krankenpflege. Die Vermittlung dieser Kompetenz muss daher ein fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung in den Pflegeberufen sein. Nur so ist es möglich, dass Klientinnen mit Migrationshintergrund bestmöglich in das bestehende Pflegesystem integriert und ihre Bedürfnisse dabei angemessen berücksichtig werden.
Demnach möge dieses Buch alle Pflegepersonen in ihrer beruflichen Qualifizierung unterstützen, in der pflegerischen Praxis begleiten und alle Verantwortlichen anregen, die Transkulturelle Pflege als fundierte Grundlage für professionelles Arbeiten im multikulturellen Pflegealltag zum Wohle von Klientinnen und Pflegepersonen zu fördern.
Ausdrücklich will ich mich an dieser Stelle auch bei Frau Magistra Cornelia Russ vom facultas-Verlag für die jahrelange, konstruktive und überaus angenehme Zusammenarbeit bedanken.
In der hier vorliegenden Neuauflage wurde an der bisher bewährten Form der Darstellung festgehalten. Ich habe allerdings wesentliche Ergänzungen hinzugefügt, Zahlen und Daten aktualisiert sowie einige Korrekturen vorgenommen.
Ulrike LentheWien, im Herbst 2023
Über dieses Buch
Dieses Buch handelt vom Menschen. Es handelt von den vielfältigen Erscheinungsformen seiner Kultur und von der Interaktion des Menschen als kulturspezifische Persönlichkeit mit der Gesundheits- und Krankenpflege im Allgemeinen und deren Ausübenden, den Pflegepersonen, im Besonderen.
Darüber hinaus werden die Angehörigen all jener Berufsgruppen, denen multikulturelle Klientenverhältnisse besonderes Wissen abverlangen, in diesem Buch reichlich Sachinformationen und konkrete Anwendungsmodelle finden, die ihnen ihre Arbeit mit Angehörigen fremder Kulturen wesentlich erleichtern können.
Fremde Kulturen lernt man nicht im Urlaub kennen. Denn da passt sich das Land der Kultur seiner Gäste an, und die All-Inclusive-Hotels, Busfahrten, Guided Tours und Folkloreabende sind von der realen Alltagskultur des Urlaubslandes sehr weit entfernt.
Meine ersten praktischen Erfahrungen mit Angehörigen fremder Kulturen machte ich im Jahre 1982 in einer Privatklinik, die vor allem von Klientinnen aus dem arabischen Kulturkreis frequentiert wurde. Deren fremde Welt mit ihren unbekannten Verhaltensweisen war mir unverständlich. Das hat mich dazu motiviert, mir erstes Wissen über fremde Kulturen anzueignen und mich dabei nicht mit Stereotypen zufriedenzugeben, sondern sie zu hinterfragen. Später, während meiner Aufenthalte und beruflichen Praktika im Nahen und im Fernen Osten, in Afrika und in einigen europäischen Staaten, waren mir meine kulturgeschichtlichen Studien immer wieder ein wertvoller Schlüssel für das Verständnis der Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Diese Studienaufenthalte haben mir gezeigt, wie sehr transkulturelle Kompetenz sowohl auf theoretischem Wissen als auch auf praktischer Erfahrung beruht. Das gilt vor allem auch für die kulturkongruente Gesundheits- und Krankenpflege. Auf dieser Basis arbeite ich seit nunmehr dreizehn Jahren mit einem multikulturellen Team von hoch qualifizierten Pflegepersonen zusammen. Sie sind mir nicht nur wertvolle Mitarbeiterinnen, sondern liefern mir auch täglich den Beweis dafür, dass transkulturelle Pflege praktizierbar ist, und zeigen, unter welchen Voraussetzungen sie mit Erfolg realisiert werden kann. Aus dieser Kompetenz von Wissen und Erfahrung ist mein Buch „Transkulturelle Pflege“ entstanden.
Zunächst vermittelt das Buch Informationen und Anleitungen dazu, spezifische Faktoren fremder Kulturen als solche zu erkennen.
Fremdes und fremdartige Verhaltensweisen können oft unverständlich, verwirrend oder gar abschreckend wirken. Hier wird allerdings die Frage nach dem „Warum?“ oft vorschnell gestellt – zumeist bevor die Frage „Was ist?“ ihre erklärende Antwort erhalten hat. Diese Antwort aber kann jenen Prozess einleiten, der zum Verstehen fremder Verhaltensweisen führt.
Wie auf der Grundlage von Wissen und Verständnis Angehörige fremder Kulturen in den Prozess der transkulturellen Pflege zu integrieren sind, wird an erprobten theoretischen Modellen und praxisnahen Beispielen dargestellt.
Was dieses Buch zum Verständnis von Pflege in multikulturellen Gesellschaften beitragen kann, sind insbesondere sachbezogene Hintergrundinformationen über Kultur, über die für unsere Gesellschaft wichtigsten Religionen und ihren Einfluss auf die Pflege sowie über Migration, deren Motive und Wirkungsprozesse; somit Hintergrundinformationen zu Wissensbereichen, ohne deren Kenntnis weder eine seriöse Diskussion über transkulturelle Pflege noch ihre praktische Ausübung stattfinden kann.
Dazu bietet das Werk eine eingehende, auf den amerikanischen Primärquellen basierende Darstellung der transkulturellen Pflegemodelle von Giger/Davidhizar und Purnell. Diese beiden Modelle gelten zwar heute neben dem ebenfalls vorgestellten Initialmodell von Leininger als richtungsweisend für die transkulturelle Pflege, wurden aber bisher in der deutschsprachigen Literatur eher rudimentär und meist aus Sekundärquellen zitiert.
Der Gesamttext des Buches ist so gestaltet, dass die einzelnen Kapitel in sich abgeschlossene thematische Einheiten bilden. Damit ist ein leichter Zugang zu den verschiedenen Wissensgebieten sichergestellt. Denn vielleicht will man sich in einer bestimmten Situation nur über Kultur oder Religion oder Migration, über transkulturelle Aspekte im Pflegealltag oder über die strukturelle Verankerung transkultureller Kompetenz in Gesundheitseinrichtungen eingehend informieren. Dann ist es jederzeit problemlos möglich, das betreffende Kapitel nachzuschlagen, ohne dazu erst die vorangegangenen Kapitel nachlesen zu müssen. Die einzelnen Kapitel fügen sich als Wissensmodule in das Gesamtkonzept dieses Buches ein, das damit alle grundlegenden Teilbereiche umfasst, die für den Einstieg in die transkulturelle Pflege erforderlich sind.
Inhalt
1 Transkulturelle Pflege: Eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts
1.1Zum Begriff der transkulturellen Pflege
1.2 Die Anfänge der transkulturellen Pflege
2 Was ist Kultur?
2.1 Zum Kulturbegriff im Wandel der Zeiten
2.2 Elemente der Kultur
2.2.1 Das Konzept der kollektiven Programmierung
2.2.2 Das Zwiebelmodell
2.3 Unterschiede zwischen Kulturen
2.3.1 Kulturdimensionen nach Hall
2.3.2 Kulturdimensionen nach Hofstede
2.3.3 Kulturdimensionen nach Trompenaars
2.4 Kultur als Orientierungssystem
2.4.1 Kultur als dynamisches Phänomen
2.4.2 Die Multikollektivität des Menschen
2.4.3 Stereotype im interkulturellen Kontext
3 Religionen, die Grundlagen der Kulturen
3.1 Das Christentum
3.1.1 Zur christlichen Lehre und ihrer Entstehung
3.1.2 Pflegerelevante religiöse Bedürfnisse
3.2 Der Islam
3.2.1 Zur Lehre des Islam und ihrer Entstehung
3.2.2 Pflegerelevante religiöse Bedürfnisse
3.3 Der Hinduismus
3.3.1 Zur hinduistischen Lehre und ihrer Entstehung
3.3.2 Pflegerelevante religiöse Bedürfnisse
3.4 Der Buddhismus
3.4.1 Zur buddhistischen Lehre und ihrer Entstehung
3.4.2 Pflegerelevante religiöse Bedürfnisse
3.5 Der Konfuzianismus
3.5.1 Zur konfuzianischen Lehre und ihrer Entstehung
3.5.2 Pflegerelevante konfuzianische Wertvorstellungen
3.6 Das Judentum
3.6.1 Zur mosaischen Lehre und ihrer Entstehung
3.6.2 Pflegerelevante religiöse Bedürfnisse
4 Migration
4.1 Zum Begriff Migration
4.2 Motive zur Migration
4.3 Formen der Migration
4.4 Der Migrationsprozess
4.5 Eingliederung im Aufnahmeland
5 Aspekte der transkulturellen Interaktion im Pflegealltag
5.1 Unterschiede im interkulturellen Kommunikationsverhalten
5.1.1 Zur verbalen Kommunikation
5.1.2 Zur nonverbalen Kommunikation
5.2 Unterschiede im Umgang mit Schmerz
5.3 Tabus und Schamempfinden
5.3.1 Tabus im sozialen Verhaltenskodex
5.3.2 Familienehre, Gesichtsverlust und Schamgefühl
5.4 Die Klientin im sozialen Netzwerk der Familie
5.4.1 Das Familienoberhaupt als Entscheidungsträger im Krankheitsfall
5.4.2 Familienaktivitäten am Krankenbett der Klientin
5.5 Volksmedizin und Krankheitsursachen im Volksglauben
5.6 Kulturgeprägte Vorstellungen der Klientin über Pflege
5.7 Über die Zusammenarbeit im multikulturellen Pflegeteam
5.7.1 Missverständnisse aufgrund von Sprachproblemen
5.7.2 Divergierende Wertvorstellungen und Verhaltensweisen
5.7.3 Abwertende Vorurteile aufgrund von ethnischen Merkmalen
5.7.4 Unterschiede im Berufs- und Pflegeverständnis
5.7.5 Voraussetzungen für eine effektive transkulturelle Teamarbeit
6 Modelle der transkulturellen Pflege
6.1 Das Sunrise-Modell nach Leininger
6.2 Das transkulturelle Assessment-Modell von Giger und Davidhizar
6.3 Das Purnell-Modell für kulturelle Kompetenz
7 Konzepte zur transkulturellen Kompetenz
7.1 Das Konzept der transkulturellen Kompetenz nach Domenig
7.2 Das Vulkan-Modell von Campinha-Bacote
8 Grundvoraussetzungen der transkulturellen Pflege
8.1 Die Entwicklung von transkultureller Kompetenz
8.2 Der Aufbau einer transkulturellen Pflegebeziehung
8.3 Die strukturelle Verankerung der transkulturellen Kompetenz
8.4 Transkulturelles Lernen in der Aus- und Weiterbildung
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
1 Transkulturelle Pflege: Eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts
Die Ausbreitung der Globalisierung, verbunden mit einer zunehmend komplexen internationalen Medienverflechtung, hat den laufenden Prozess einer vielschichtigen, andauernden Grenzüberschreitung beschleunigt. Diese permanenten Grenzüberschreitungen auf zahlreichen Ebenen haben längst den Lebensalltag jeder Einzelnen erfasst und verlangen die integrative Fähigkeit, ihr Leben in mehreren Welten gleichzeitig zu führen. Vor diesem Hintergrund sind auch die Pflegepersonen gefordert, die relevanten neuen Perspektiven dieser Entwicklung zu erkennen, zu definieren und zu verwirklichen.
Insbesondere die starken Migrationsbewegungen in und nach Europa sowie die zunehmende Realität der medizinischen Versorgung von Klientinnen über die Grenzen hinweg erfordern von den Pflegepersonen sowohl eine entsprechende Wahrnehmung als auch die Fähigkeit, die damit verbundenen kulturellen Veränderungen in ihr Berufskonzept miteinzubeziehen.
Der Arbeitsalltag vieler Pflegepersonen ist bereits multikulturell geprägt, da sowohl Klientinnen als auch Pflegepersonen vielfach aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen stammen. Pflegepersonen stehen dabei unterschiedlichen Gruppen von ausländischen Klientinnen gegenüber: Geschäftsreisenden oder Touristinnen, die während eines Österreich-Aufenthaltes erkranken oder verunglücken; Personen, die aus medizinischen Gründen eingereist sind, weil sie hier bessere medizinische Versorgungsstandards erwarten als in ihrem Heimatland oder weil dort für bestimmte Behandlungsmethoden lange Wartezeiten bestehen; freilich auch den im Lande lebenden Migrantinnen, die zweifellos die größte Gruppe darstellen; und nicht zuletzt den seit 2015 ins Land gekommenen Flüchtlingen, die unsere Sprache kaum bis gar nicht verstehen, denen unsere Werte und Normen großteils fremd sind und die sich in ähnlichen Kontexten völlig unterschiedlich verhalten. Die Gesamtheit der ausländischen Klientinnen ist somit in keiner Weise als homogen zu betrachten. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die Pflege?
Das größte Problem bilden wohl nicht so sehr die sprachlichen Grenzen des Verstehens, da sie bei Bedarf von einer Dolmetscherin überbrückt werden können. Weitaus schwieriger ist es, einander zu verstehen, wenn unterschiedliche kulturell geprägte Konzepte, Einstellungen und Lebensanschauungen vorliegen, die sich als entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Pflege erweisen können. Diese Herausforderungen und ihre Lösungsansätze werden in den folgenden Kapiteln ausführlich dargestellt. Einige von ihnen sollen hier kurz aufgezeigt werden.
So etwa, wenn Familienstrukturen, Rollenverständnisse innerhalb der Familie bzw. in der Gesellschaft oder der Stellenwert der Frau nicht unserer Mentalität bzw. unserem kulturellen Muster entsprechen; oder wenn eine Frau keine selbstständigen Entscheidungen trifft bzw. in Anwesenheit von Fremden nicht spricht oder gegenüber fremden Männern bestimmte Dinge nicht anspricht. Diese Frauen deshalb generell als unterdrückte Geschöpfe zu bezeichnen, ist absolut entwürdigend. Wie ich selbst in Ländern mit angeblich extremer Frauenunterdrückung erlebt habe, sind gerade jene Frauen oft selbstbewusster, stolzer und stärker als so manche westliche, vorgeblich emanzipierte Frau.
Weitere Herausforderungen liegen z. B. in der Berücksichtigung von religiös bedingten Speisegeboten oder Berührungstabus und vor allem auch in der Tatsache, dass Migrantinnen, die aufgrund von Kriegen, aus politisch-sozialen Gründen oder wirtschaftlicher Not ihre Heimat verlassen mussten, mitunter posttraumatische Belastungsstörungen aufweisen. Wenngleich der Traumatisierung mit der Migration ein Ende gesetzt wurde, müssen die posttraumatischen Folgen aufgearbeitet werden. Dabei stellt es eine besondere Herausforderung dar, wenn die Klientinnen psychosomatische Krankheitsursachen negieren, weil psychische Krankheiten im Herkunftsland Stigmatisierung oder Schande für die Familie bedeuten.
Viele Pflegepersonen wissen auch davon zu berichten, dass ihnen ausländische Klientinnen misstrauisch gegenüberstehen, da sie mit professioneller Pflege nichts anzufangen wissen. Sie können deren Sinn und die vielen damit verbundenen Fragen nicht nachvollziehen und empfinden all das als Eindringen in ihre Privatsphäre.
Etliche Klientinnen sind wiederum nicht bereit, aktiv an ihrer gesundheitlichen Wiederherstellung mitzuarbeiten, da ihrem Verständnis von Pflege die passive Krankenrolle entspricht.
Aber auch andersartige Konzepte über Schmerz- oder Schamerleben zählen zu den für uns völlig fremden Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen von Klientinnen aus anderen Kulturen, mit denen Pflegepersonen konfrontiert sind.
Insgesamt besteht die große Herausforderung der transkulturellen Pflege in der Fähigkeit, die Bedürfnisse unterschiedlicher kultureller Gruppen und Personen zu erkennen, zu verstehen und angemessen auf sie zu reagieren, um sie in geeigneter Weise in die Pflege zu integrieren und dadurch Menschen mit anderen kulturellen, religiösen und ethnischen Hintergründen eine effiziente und effektive Pflege bereitstellen zu können.
Das bedeutet auch für die Gesundheits- und Krankenpflege eine Neuorientierung und den Dialog mit anderen Kulturen. Der Ansatz dazu liegt im Verständnis und in der Akzeptanz dieser Kulturen. Und dafür ist kulturspezifisches Wissen erforderlich.
Im Bewusstsein der Unterschiedlichkeit von Menschen und Kulturen sind es die Konzepte der gegenseitigen Achtung, Anerkennung und Interaktion, die lösungsorientierte Perspektiven für die Herausforderungen unserer Zeit bieten.
Jeder Mensch ist einzigartig und unverwechselbar und geprägt von seinem soziokulturellen Kontext. Dieser Vielfalt von Identitäten begegnen wir tagtäglich in unserem unmittelbaren Umfeld und noch offensichtlicher in Begegnungen mit Menschen aus fremden Kulturen. Der US-amerikanische Anthropologe und Soziologe Clyde Kluckhohn hat diese Vielfalt in einem schönen Satz zum Ausdruck gebracht: „Every man is in certain respects like all other men, like some other men, like no other man.“ (Kluckhohn/Murray 1953, S. 53) „Jeder Mensch ist in gewisser Hinsicht wie alle anderen Menschen, wie einige andere Menschen, wie kein anderer Mensch.“ (Übersetzung d. Verf.)
1.1 Zum Begriff der transkulturellen Pflege
Das für die Begriffsbedeutung von „transkulturell“ maßgebliche lateinische Verhältniswort trans meint „über (etwas) hinweg, bzw. jenseits (von etwas)“ (vgl. Heinichen 1881, S. 888). Somit kommt die Bezeichnung „transkulturell“ in gewisser Weise den aktuellen Verhältnissen entgegen, die sich sowohl durch starke Globalisierungsströmungen als auch durch Individualisierungstendenzen charakterisieren ließen.
Mit den Definitionen der neusprachlichen Begrifflichkeiten „multikulturell“, „interkulturell“ und „transkulturell“ will ich eine Hilfestellung anbieten, um „transkulturelle Pflege“ in den entsprechenden semantischen Bedeutungsrahmen und sprachlichen Beziehungsrahmen setzen zu können. Alle drei Begriffe schließen die Begegnungen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit ein.
• Das Adjektiv „multikulturell“ bezeichnet einen Zustand: Multikulturalität liegt dann vor, wenn in einer Gesellschaft verschiedene, unterschiedlich definierbare Kulturen eigenständig nebeneinander (oder auch miteinander) bestehen. In der Pflege dient die Bezeichnung „multikulturelles Team“ üblicherweise dazu, ein Team von Pflegepersonen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln zu bezeichnen.
• Das Adjektiv „interkulturell“ kennzeichnet die dialoggesteuerte, anwendungsorientierte Methode einer sachkundigen Berücksichtigung kulturspezifischer Verschiedenartigkeiten. Diese Bedeutung ist durch das lateinische Verhältniswort „inter“ im Sinne von „zwischen, innerhalb; auch: untereinander“ begründet. Interkulturalität ist somit das Ergebnis eines durch Kommunikation und Interaktion herbeigeführten Austauschs einzelner Elemente zwischen zwei oder mehreren Kulturen, wobei aber jede der beteiligten Kulturen ihre kennzeichnende Identität behält. Interkulturell zu handeln bezeichnet auch die beabsichtigte, auf kulturellen Austausch angelegte Interaktion zwischen Personen aus unterschiedlichen Kulturen.
• Das Adjektiv „transkulturell“ beinhaltet eine kulturspezifische Qualifikation: Transkulturalität bezeichnet die erworbene und auf Wissen begründete universale Fähigkeit, die Besonderheiten anderer Kulturen als solche wahrzunehmen, sie im Kulturvergleich als gleichwertig zu erkennen und, ohne die eigene Kultur dabei hintanzustellen, in jeder Kultur adäquat, empathischdialogisch und integrativ handlungsfähig zu sein.
Pflege ist vor allem dann und von sich aus transkulturell, wenn sie sich an den existenziellen Bedürfnissen des Menschen orientiert. Denn diese Bedürfnisse sind für alle Menschen aller Zeiten und aller Kulturen dieselben. Bloß ihre Reihung, Gewichtung und Bedeutung wird aufgrund kulturbedingter Auffassungen oft unterschiedlich sein. So mag zwar eine Buddhistin den Tod nicht fürchten, da sie in ihm den Durchgang in eine neue, womöglich bessere Wiedergeburt sieht; dennoch wird sie pflegerisch-therapeutische Maßnahmen zur Erhaltung ihres Lebens in der Regel nicht zurückweisen.
Sinngemäß formulieren auch Uzarewicz/Piechota (1997, S. 7): „Transkulturelle Pflege bezieht sich auf das Kulturgrenzen Überschreitende, das grundlegend Gemeinsame, das Wesentliche von Pflege, nicht zuletzt um festzustellen, was Pflege (erkenntnistheoretisch) eigentlich ist.“
Transkulturelle Pflege ist demnach kulturübergreifend und bedeutet Pflege über die Grenzen von kultureller Verschiedenartigkeit hinweg: somit Pflege an sich, als die reine Idee in ihrer kulturunabhängigen Form. Transkulturelle Pflege kann daher als ein allgemeingültiges ideelles Prinzip verstanden werden.
1.2 Die Anfänge der transkulturellen Pflege
Es ist wohl kein Zufall, dass die Idee der transkulturellen Pflege gerade in den USA entstand und die meisten Theorien bzw. Modelle der transkulturellen Pflege von amerikanischen Pflegewissenschaftlerinnen entwickelt worden sind. Denn seit Bestehen der Vereinigten Staaten von Amerika ist deren Gesellschaft wie in keinem anderen Staat dieser Erde durchgehend multiethnisch und multikulturell geprägt. Somit waren multikulturelle Anforderungen an die Pflege in den USA bereits evident, bevor sie in Europa erkennbar wurden.
Vor diesem Hintergrund besitzen gerade amerikanische Pflegewissenschaftlerinnen eine sehr hohe Kompetenz für die Entwicklung von transkulturellen Konzepten, Theorien und Modellen. Die amerikanische Pflegewissenschaftlerin Dr. Madeleine M. Leininger war die Erste, die Pflege in einen kulturellen Rahmen gestellt hat und damit zur Begründerin der transkulturellen Pflege geworden ist.
Madeleine M. Leininger wurde im Jahre 1925 in Sutton (US-Bundesstaat Nebraska) geboren. Ihre Ausbildung zur Krankenschwester, die sie 1948 mit dem Diplom abschloss, absolvierte sie an der St. Anthony’s School of Nursing in Denver. Im Jahre 1950 erhielt sie am Benediktiner-College in Atchison (Kansas) den Bachelor of Biological Science. Danach eröffnete sie als Pflegedirektorin am St. Joseph’s Krankenhaus in Omaha (Nebraska) eine psychiatrische Abteilung. Während dieser Zeit setzte sie ihre pflegewissenschaftlichen Studien fort, die sie 1954 an der Katholischen Universität von Amerika in Washington DC mit dem Magister der Pflegewissenschaft (Schwerpunkt psychiatrische Pflege) abschloss. Anschließend wurde Leininger Professorin für Pflegewissenschaft und Leiterin des ersten Studienganges für psychiatrische Pflege an der Universität von Cincinnati.
In dieser Zeit schrieb sie als Co-Autorin mit Charles K. Hofling und Elizabeth Bregg eines der ersten Lehrbücher für psychiatrische Pflege, „Basic Psychiatric Concepts in Nursing“, das in elf Sprachen übersetzt worden ist. Gleichzeitig arbeitete sie mit geistig behinderten Kindern, die aus verschiedenen kulturellen Milieus der USA stammten.
Dabei stellte Leininger fest, dass Kinder mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund auch unterschiedliche Erwartungen an die Pflegepersonen richteten. Sie schreibt dazu (1998, S. 35):
„In gewisser Weise erlitt ich damals einen Kulturschock und fühlte mich ziemlich hilflos im Umgang mit Kindern, die eindeutig verschiedene kulturbezogene Verhaltensmuster und Erwartungen in Bezug auf Fürsorge zeigten.“ Obwohl die Kinder ihre Wünsche und Bedürfnisse nachdrücklich äußerten, war Leininger (1998, S. 35) unfähig, darauf angemessen zu reagieren:
„Ich verstand einfach ihr Verhalten nicht. Später lernte ich, daß dieses Verhalten von ihrer Kultur bestimmt war und daß dieses ihre psychische Gesundheit beeinflußte.“
Der Wunsch nach mehr Wissen über diese die Pflege beeinflussenden kulturellen Faktoren veranlasste Leininger, Anthropologie zu studieren. Dabei erkannte sie, wie wichtig die Anthropologie für die professionelle Pflege ist, wie sehr beide Disziplinen zusammenhängen und welche Bedeutung sie für eine transkulturelle Pflege haben. 1965 promovierte sie als erste Krankenschwester an der Universität von Washington in Anthropologie und wurde 1966 als Professorin für Pflegewissenschaft und Anthropologie an die Universität von Colorado berufen, wo sie die ersten Seminare in transkultureller Pflege abhielt.
Ihre Erkenntnis, dass Anthropologie und Pflege unauflösbar miteinander verbunden sind, veranlasste Leininger, ihre Theorie der transkulturellen Pflege zu entwickeln und das erste Buch zum Thema transkulturelle Pflege zu schreiben, das im Jahre 1970 unter dem Titel „Nursing and Anthropology: Two Worlds to Blend“ erschien. Im Jahre 1974 gründete Leininger die „Transcultural Nursing Society“ und 1978 folgte dann ihr Grundlagenwerk „Transcultural Nursing: Concepts, Theories and Practices“. Mit diesem Buch legte Leininger den Grundstein für die Entwicklung der transkulturellen Pflege.
Ab 1981 wirkte Leininger als Professorin für Pflegewissenschaft und Direktorin des Center for Health Research an der Wayne State University in Detroit. In den nahezu 40 Jahren ihrer Forschungsaktivität untersuchte sie gemeinsam mit Studentinnen und Kolleginnen – auf der Grundlage ihrer Theorie der kulturspezifischen Fürsorge und unter Anwendung ethnografischer und ethnopflegerischer Methoden – an die 60 verschiedene Kulturen auf deren Wertvorstellungen, Überzeugungen, Ausdrucksweisen, Muster und Erfahrungen. Dabei arbeitete sie fast 200 Fürsorgekonstrukte mit speziellen Bedeutungen, Verwendungen und Interpretationen heraus. Nach Leininger (1991, S. 71) erfordert ihre Forschungsmethode, dass man längere Zeit mit der betreffenden Bevölkerungsgruppe zusammenlebt, um dadurch vom Fremden zum Freund zu werden, dem Informationen anvertraut werden.
Über ihre Forschungen hat Leininger an die 25 Bücher publiziert. Ihr abschließendes großes Grundlagenwerk über transkulturelle Pflege, „Culture Care Diversity and Universality: A Theory of Nursing“, ist 1991 erschienen.
Bis zu ihrem Tod im Jahr 2012 in Omaha (US-Bundesstaat Nebraska) war Leininger eine der profiliertesten Autorinnen zum Thema Pflege und die weltweit führende Expertin auf dem Gebiet der transkulturellen Pflege. Es war ihr Lebenswerk, die Qualität von kulturell kongruenter, kompetenter und angemessener Pflege zu steigern und somit weltweit zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen beizutragen. Zugleich war es ihr ein Anliegen, Pflegepersonen und andere Fachkräfte des Gesundheitswesens mit dem nötigen Grundwissen auszustatten, um kulturelle Kompetenz in Praxis, Ausbildung, Forschung und Verwaltung sicherzustellen.
Neben Leiningers Forschungen wurden in den USA noch andere Studien durchgeführt und auch andere Modelle für den Bereich der transkulturellen Pflege vorgeschlagen, wie etwa von Larry D. Purnell, Betty J. Paulanka, Joyce N. Giger, Ruth E. Davidhizar, Josepha Campinha-Bacote, Margaret M. Andrews, Joyceen S. Boyle, Rachel E. Spector, Modesta Soberano Orque und einigen anderen. Es ist wohl kein Zufall, dass etliche dieser amerikanischen Pflegewissenschaftlerinnen ethnischen Minderheiten angehören. Sie alle haben auf Leiningers Erkenntnissen aufgebaut und ihrer Theorie neue Dimensionen eröffnet. Andere wieder benützen Leiningers Theorie oder bestimmte Konzepte daraus, um diese theoretischen Vorgaben in einer speziellen Anwendungspraxis umzusetzen.
2 Was ist Kultur?
Das Wort Kultur zählt zu den Begriffen, die in der Gesellschaft sowie in den Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften am häufigsten gebraucht werden. Dennoch bleibt der Kulturbegriff im alltäglichen Sprachgebrauch meist ohne fest umrissene Bestimmung.
Im Alltag wird das Wort Kultur in derart unterschiedlichen Bedeutungen und Zusammenhängen verwendet, dass es zu einer ausgeprägten Bedeutungserweiterung bis hin zur Sinnentleerung gekommen ist. Kultur ist zu einem idiomatischen Bestandteil zahlreicher Komposita geworden, wie Alltagskultur, Diskussionskultur, Esskultur, Fußballkultur, Hochkultur, Rockkultur, Sprachkultur, daneben gibt es etliche weitere Zusammensetzungen wie Kulturinstitution, Kulturlandschaften, Kulturerbe, Kulturtechniken, Kulturministerium etc.
Das Wort Kultur ist in unserem Leben nahezu allgegenwärtig: wir verreisen, weil wir uns für Kulturen anderer Länder interessieren; in der Tageszeitung lesen wir die Kulturbeilage; im Werbefernsehen wird uns ein neues Joghurt mit probiotischen Kulturen schmackhaft gemacht; wir besuchen eine Veranstaltung im Rahmen der Kulturwochen; wir sind entsetzt über die Gesprächskultur bei politischen Debatten; wir achten auf die Esskultur unserer Kinder; wir schätzen die Sprachkultur unserer Gesprächspartnerinnen; wir pflegen einen kultivierten Umgang miteinander.
Die Verwendung des Begriffes erfolgt dabei keineswegs einheitlich, sondern ist vieldeutig und variiert je nach Benutzerin und Kontext.
Wer von Kultur spricht, kann einmal Kultur als Hochkultur meinen. Man schließt dabei eine kennzeichnende und durch die Elemente der Hochkultur bewirkte Veredelung der Sitten mit ein, im Besonderen durch Religion, Philosophie, Bildung, Wissenschaften und Künste wie Literatur, Musik, Schauspiel, Architektur, Malerei, Bildhauerei usw.
Ein anderes Mal kann mit Kultur eine auf Bildung oder Erziehung beruhende besondere Lebensart gemeint sein, somit Kultur als Lebensstil. Menschen, denen Lebenskultur wichtig ist, zeichnen sich durch Bildung, Humanität, Geschmack, Manieren und geistige Interessen aus.
Als fremde Kulturen werden Sitten, Religion und Bräuche fremder Völker bezeichnet. Fremde Kulturen zeigen sich als Verhaltensweisen, sozusagen als way of life bestimmter Gruppen von Menschen, die sich nach territorialen, ethnischen, ideologischen, mentalen und sprachlichen Kriterien als Einheit bestimmen lassen.
Aber auch Natur und Kultur stehen in begrifflichem Zusammenhang. So kommt der Kulturbegriff etwa in der Landwirtschaft (z. B. Gartenkultur, Monokultur), in der Geografie (z. B. Kulturlandschaft) oder in der Medizin (z. B. Bakterienkultur) sprachlich zum Ausdruck.
Nach ursprünglichem Verständnis werden unter Kultur die bekannten Äußerungen des Menschen wie Sprache, Glaubensvorstellungen, Kunst und Wissenschaft, Lebensgewohnheiten und Umweltgestaltung zusammengefasst. Jede einzelne Kulturgestaltung ist das Produkt einer langen historischen Entwicklung und ist mehr gewachsen als ausgedacht (vgl. Keyserling 1913, S. 29). Kultur bedeutet somit nach Brockhaus (1975, 3. Bd., S. 278) „die Gesamtheit der typischen Lebensformen größerer Gruppen, einschließlich ihrer geistigen Aktivitäten, besonders der Werteinstellungen“.
2.1 Zum Kulturbegriff im Wandel der Zeiten
Betrachtet man den Begriff Kultur im Verlauf der Geschichte, so lässt sich feststellen, dass die Menschen verschiedener Zeitepochen jeweils ihre eigenen Sichtweisen und Wahrheiten darüber entwickelt haben, was unter Kultur zu verstehen sei.
Die etymologischen Wurzeln des Begriffs Kultur gehen auf das lateinische Wort cultura zurück, hergeleitet vom lateinischen Verb colere (anbauen, pflegen, verehren) und dem Substantiv cultus (Bearbeitung, Pflege, Verehrung). So wird der Begriff bei den Römern sowohl im Sinne von landwirtschaftlicher Anbaukultur als auch im Sinne von Verehrung und Fürsorge verstanden. Der römische Philosoph und Staatsmann Marcus Tullius Cicero (106–43 v.Chr.) übertrug den lateinischen Begriff des Ackerbaus auf die Philosophie und sprach als Erster von einer cultura animi (Pflege der Seele) im Sinne einer „Bebauung und Pflege des Geistes“ – kurz, von der Geisteskultur (vgl. Kluge 1975, S. 411). In seinem Werk „Tusculanae disputationes“ führt Cicero (II, 5) dazu aus: „Wie ein noch so ertragfähiger Acker ohne Pflege (sine cultura) nicht ertragreich sein kann, so auch die Seele nicht ohne Unterrichtung (sine doctrina). [...] Pflege der Seele aber ist die Philosophie; diese reißt die Laster mit der Wurzel aus und bereitet die Seelen zur Aufnahme der Saaten vor und übergibt ihnen und, um mich so auszudrücken, sät das, was dann, wenn es herangewachsen ist, die reichsten Früchte trägt.“ Unter diesem Aspekt erhält das Wort Kultur auch den Sinngehalt von „gute Sitten“. Eine lasterhafte Kultur war Cicero nicht vorstellbar. Und eine pflegliche Weisheitsbildung ist ihm nicht Selbstzweck, sondern ein Weg zur Verfeinerung des Menschenlebens und zur Gewinnung der Menschenwürde. Demnach bedeutet Kultur bei Cicero Pflege des menschlichen Geistes durch die Philosophie. Philosophie aber umfasste in der Antike die Gesamtheit aller Wissenschaften.
Im frühchristlichen Mittelalter wird Kultur entweder im rein agrarischen Verständnis oder metaphorisch verwendet: die Begrifflichkeit steht für den transzendenten Gott und Schöpfer aller Dinge, der das Innere des Menschen wie ein Ackerland zu bestellen hat. Mit cultura ist cultura Christi gemeint (vgl. Niedermann 1941, S. 20 ff). In diesem Sinne ist der Mensch nicht selbst für seine Kultur verantwortlich, sondern verdankt sie Gott, seinem „Ackermann“, der den Menschen pflegt und bessert.
Die Renaissance-Philosophie greift dann wieder direkt auf die ciceronische Bedeutung zurück. Die Humanisten Erasmus von Rotterdam (um 1466–1536) und Thomas Morus (1478–1535) plädierten für die cultura ingenii, die Kultur des erfinderischen Geistes (vgl. Niedermann 1941, S. 63 f). Nicht Gott, sondern der Mensch allein sei für seine Tugend, Würde und Weisheit selbst verantwortlich.
Bis in die Frühaufklärung wurde Kultur immer mit den Genitivattributen animi (des Geistes) bzw. ingenii (des Schöpferischen) verbunden. Erst der deutsche Naturrechtsphilosoph Samuel Freiherr von Pufendorf (1632–1694) verwendete den Begriff alleinstehend im Sinne einer menschlichen Pflicht, die dem Menschen, im Gegensatz zum Tier, über die bloße Selbsterhaltung hinaus obliegt. Pufendorf (zit. nach Welsch 1999, S. 46) beschreibt Kultur als „insgesamt diejenigen Tätigkeiten, durch welche die Menschen ihr Leben als spezifisch menschliches – im Unterschied zu einem bloss tierischen – gestalten“. Weiters bezeichnet Pufendorf (zit. nach Hetzel 2001, S. 30) Kultur als „den sittlichen Zustand einer Gemeinschaft, der es ermöglicht, diese von anderen Gemeinschaften abzugrenzen“. Mit „Kultur“ wird das gemeinsam erarbeitete und gehütete spezifische Würdegefühl einer Gemeinschaft bezeichnet, die aufgrund ihrer Zusammengehörigkeit weiß, was sich gehört, was nachahmenswert und anständig ist. An die Stelle einer einheitlichen Menschenkultur tritt nunmehr ein pluralistisches Kulturverständnis.
Ein Jahrhundert später legt Johann Gottfried Herder (1744–1803) jenen Kulturbegriff fest, der das abendländische Denken maßgeblich prägte. Herder unterscheidet nicht mehr zwischen einem Natur- und einem Kulturzustand des Menschen, sondern er spricht allen Menschen der Erde ein gewisses Maß an Kultur zu. Der Mensch ist durch Vernunft, Sprache, Erziehung und Überlieferung zum Kulturwesen bestimmt. Er wächst in einer bestimmten Kultur auf und wird durch sie gestaltet und geprägt. Dabei unterscheidet sich eine Kultur historisch und geografisch von den anderen. Daraus entsteht Herders relativistische Einstellung: „Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich wie jede Kugel ihren Schwerpunkt.“ (zit. nach Löchte 2005, S. 85) Kultur wird damit als unverwechselbare Substanz eines Volkes bzw. einer Nation verstanden, die das Typische dieser gesellschaftlichen Einheit zum Ausdruck bringt und sie von anderen deutlich unterscheidet.
Ähnlich wie Johann Gottfried Herder definiert Edward Burnett Tylor (1832–1917), einer der Begründer der modernen Kulturanthropologie, Kultur als „ jenes komplexe Ganze, das Wissen, Glaube, Kunst, Moral, Recht, Sitte, Brauch und alle anderen Fähigkeiten und Gewohnheiten umfasst, die der Mensch als Mitglied einer Gesellschaft erworben hat“ (zit. nach Harris 1989, S. 20). Von zentraler Bedeutung bei dieser Definition ist, dass Kultur nicht etwas von Natur aus Gegebenes ist, sondern vielmehr etwas durch das Leben in der Gesellschaft Erworbenes, das sich jede Einzelne im Verlauf ihrer Enkulturation lernend aneignen muss.
Im späten 19. Jahrhundert plädierten Anthropologen für eine breitere Definition des Begriffs Kultur. Sie wollten das Wort auf eine Vielzahl verschiedener Gesellschaften anwenden können: Kultur beinhaltet nicht mehr allein menschliche Kulturfähigkeit, sondern vornehmlich ein Verhalten. Zugleich explodierte aber auch die Zahl der Begriffsbestimmungen. So veröffentlichten die Anthropologen Alfred Louis Kroeber und Clyde Kluckhohn bereits im Jahre 1952 in ihrem Buch „Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions“ nicht weniger als 164 verschiedene Definitionen von Kultur. Eine fachbezogene Ausdifferenzierung war die notwendige Voraussetzung für eine nützliche und weiterführende Reflexion des Kulturbegriffs. Dazu haben Kroeber und Kluckhohn die 164 Begriffsverwendungen von Kultur sechs Klassen von Kulturdefinitionen zugeordnet (vgl. Kroeber/Kluckhohn 1952, S. 81 ff):
1. Die aufzählend-beschreibenden Definitionen abstrahieren das wesentliche Prinzip des jeweiligen Kulturbegriffs nicht, sondern zählen sämtliche Aktivitäten oder Verhalten des menschlichen Lebens auf, die mit Kultur assoziiert werden.
2. Die historischen Definitionen betonen die Tatsache, dass Kultur überliefert und sozial erlernt werden muss.
3. Die normativen Definitionen fokussieren darauf, dass sich Menschen einer kulturellen Gruppe nach gemeinsamen impliziten Regeln richten, die ihre Lebensweise prägen.
4. Die psychologischen Kulturdefinitionen sehen den Aspekt des Lernens der Anpassung an Umweltbedingungen als konstitutiv für Kultur an.
5. Die strukturellen Definitionen sehen Kultur in erster Linie als ein System, das einzelne Merkmale in einen Zusammenhang setzt und organisiert. Kultur organisiert sich, indem sie ein Muster von zusammenhängenden Merkmalen aufbaut.
6. Die genetischen Definitionen fassen jene Kulturbeschreibungen zusammen, die den Aspekt der Entstehung von Kulturen in den Vordergrund stellen, wobei hier drei Unterkategorien gebildet wurden: 1. Kultur entsteht durch die Adaption von Gewohnheiten; 2. Kultur entsteht durch soziale Integration; 3. Kultur entsteht durch einen für den Menschen charakteristischen kreativen Prozess.
Die Klassifikation nach Kroeber und Kluckhohn zeigt: Die vielen verschiedenen Kulturbegriffsdefinitionen divergieren hauptsächlich darin, dass sie unterschiedliche Aspekte von Kultur in den Vordergrund rücken und somit teilweise schwer vergleichbar werden.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es im Zuge des „cultural turn“, der sogenannten kulturellen Wende, zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel, wobei die bis dahin dominierenden Kulturbegriffe kritisch hinterfragt und durch neue Kulturtheorien erweitert wurden. Kultur wird dabei nicht mehr normativ (z. B. als Vorstellung einer für alle Menschen erstrebenswerte Lebensform) oder totalitätsorientiert (z. B. als spezifische Lebensform einzelner Kollektive in einer historischen Epoche) betrachtet und ebenso wenig differenzierungstheoretisch (z. B. als soziales Teilsystem einer Gesellschaft mit Bezug auf die Bereiche Kunst, Bildung und Wissenschaft).
Vielmehr rückten symbolische Ordnungen, Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge als Bedingungen von Kultur in den Mittelpunkt, die vor allem in einem bedeutungs- und wissensorientierten Kulturbegriff zum Ausdruck kommen. Kultur wird dabei als „ein Komplex von Sinnsystemen oder […] symbolischen Ordnungen mit denen sich die Handelnden ihre Wirklichkeit als bedeutungsvoll erschaffen und die in Form von Wissensordnungen ihr Handeln ermöglichen und einschränken“ (Reckwitz 2006, S. 84) bezeichnet.
Demzufolge werden unter Kultur die Bedeutungen, die Menschen Objekten zuschreiben und auf deren Grundlage sie handeln, verstanden. Nach Reckwitz lebt der Mensch in einem symbolischen Universum und kann daher die Welt nicht anders erfahren, als dass er ihr fortwährend Bedeutungen verleiht und somit nur in einer Bedeutungswelt handeln kann (vgl. Reckwitz 2006, S. 86). Dementsprechend wird Kultur nicht mehr vordergründig als Schöpfung menschlichen Handelns sondern als maßgebliche Voraussetzung für menschliches Handeln verstanden.
Von einem ganz anderen Ansatz her hat der deutsche Kulturphilosoph Oswald Spengler (1923, 2. Bd., S. 41) Kultur mit einem lebenden Organismus verglichen und den Satz formuliert: „Hohe Kultur ist das Wachsein eines einzigen ungeheuren Organismus, der nicht nur Sitte, Mythus, Technik und Kunst, sondern auch die ihm einverleibten Völker und Stände zu Trägern einer einheitlichen Formensprache mit einheitlicher Geschichte macht.“
Insgesamt unterstreicht die Vielfalt der Kulturbegriffe die Einsicht, dass Kultur auf vielfältige Weise erfahren, definiert und erforscht werden kann. So schließt die Definition von Kultur als „Gesamtheit der typischen Lebensformen größerer Gruppen“ (Brockhaus 1975, 3. Bd., S. 278) auch die Gesundheits- und Krankenpflege als einen untrennbaren Bestandteil der typischen Lebensformen mit ein. Denn die professionelle Pflege als beabsichtigte Interaktion zwischen mehreren Personen einer Kulturgruppe verfolgt ein definiertes, von allen akzeptiertes Ziel: Gesundheit zu fördern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit wiederherzustellen und Leiden zu lindern. Pflege ist somit an sich ein elementarer Grundbestandteil jeder Kultur, wie immer sich diese Kultur auch sonst als typische Lebensform ausgebildet hat und darstellt (vgl. Lenthe 2008, S. 94).
2.2 Elemente der Kultur
Kultur ist weder homogen noch eindimensional. Vielmehr bewirken und bedingen einander verschiedene Ebenen und Schichten, welche die hohe Komplexität von Kultur auszeichnen und die nach objektiv und subjektiv bzw. nach bewusst und unbewusst unterschieden werden können. Erklärungsmodelle verschiedener Wissenschaftlerinnen, insbesondere das Konzept der kollektiven Programmierung oder das Zwiebelmodell, veranschaulichen diese komplexen Zusammenhänge.
2.2.1 Das Konzept der kollektiven Programmierung
Hofstede definiert Kultur unter anderem als „die kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet“ (Hofstede/Hofstede 2009, S. 4). Kultur ist für ihn in Analogie zur Programmierung eines Computers die mentale Software eines Menschen, die Muster des Denkens, Fühlens und potenziellen Handelns umfasst, wie sie jeder Mensch in sich trägt und ein Leben lang erlernt hat. Sie macht zusammen mit der menschlichen Natur, die universell und ererbt ist, sowie mit den einzigartigen Erfahrungen eines Menschen dessen Persönlichkeit aus (siehe Abb. 1).